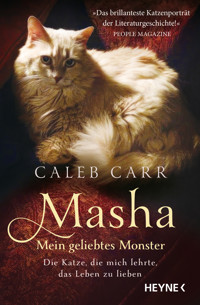4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Psychogramm eines Mörders
New York 1896: Unter Polizeichef Theodore Roosevelt kommt es zu einem grauenvollen Mord, der sich als Teil einer ganzen Mordserie erweist. Mit den Ermittlungen wird Dr. Kreisler beauftragt, ein Vorläufer Sigmund Freuds. Gegen erbitterte Widerstände gelingt es ihm, mittels eines detaillierten Psychogramms den Mörder einzukreisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 880
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
DAS BUCH
In New York wird im Jahre 1896 die übel zugerichtete Leiche eines Strichjungen entdeckt. Polizeipräsident Theodore Roosevelt, später Präsident der Vereinigten Staaten, möchte den Fall aufgeklärt wissen, den seine Polizisten aus Gründen falscher Moralvorstellungen am liebsten unter den Teppich kehren wollen.
Roosevelt setzt sich mit seinem Studienfreund Kreisler in Verbindung, der in seiner wissenschaftlichen Arbeit bereits einige Theorien Sigmund Freuds vorwegnimmt. Wichtige Helfer sind auch der Polizeireporter John Moore und Roosevelts Sekretärin Sara Howard, die es sich in den Kopf gesetzt hat, die erste weibliche Kriminalpolizistin New Yorks zu werden.
Es stellt sich heraus, dass der Mord an dem Strichjungen Teil einer ganzen Mordserie ist. Anhand der Indizien und Hinweise stellt Kreisler ein Profil des Täters zusammen. Aus den Daten aller Morde, die immer im Zusammenhang mit hohen kirchlichen Feiertagen stehen, lässt sich auch der Zeitpunkt des nächsten Verbrechens vorhersagen. Es kommt zu einem Showdown über den Dächern New Yorks.
DER AUTOR
Caleb Carr ist in der Lower East Side von Manhattan aufgewachsen und lebt heute in der Nähe von New York. Er studierte Geschichte an der New York University. Sein erster Roman »Die Einkreisung« wurde ein internationaler Erfolg und in über zwanzig Sprachen übersetzt. Caleb Carr arbeitet als Journalist für verschiedene Zeitungen und das Fernsehen.
CALEB CARR
DIE
EINKREISUNG
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Hanna Neves
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe The Alienist erschien bei Random House New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 06/2018
Copyright © 1994 by Caleb Carr
Copyright Nachwort © 2006 by Caleb Carr
Copyright © 1994 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Neubearbeitung: Tamara Rapp
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von
THE ALIENISTTM Paramount Pictures &
© 2017 TNT Originals, Inc., and Paramount Television
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-18541-1V001
www.heyne.de
Diese Ausgabe ist Dr. David Abrahamsen gewidmet und all jenen Lesern,
die sie erst ermöglicht haben.
TEIL EINS
WAHRNEHMUNG
»Ein Teil unserer Wahrnehmungen wird durch das reale Objekt vor uns bestimmt, das wir durch unsere Sinne erfahren, doch der andere und vielleicht größere Teil entspringt immer unserem Geist.«
WILLIAM JAMES: The Principles of Psychology
»Mordgedanke, woher kommst du?«
FRANCESCO MARIA PIAVE:
Libretto zu Verdis Macbeth 1. Akt, 3. Szene
KAPITEL 1
8. Januar 1919
Theodore ist unter der Erde.
Jetzt, da ich diese Worte niederschreibe, erscheinen sie mir ebenso wenig Sinn zu ergeben wie der Anblick des Sarges, der in den sandigen Boden sank, in der Nähe von Sagamore Hill, jenem Ort, der ihm auf der ganzen Welt am liebsten war. Als ich heute Nachmittag dort im kalten Januarwind vom Long Island Sound stand, dachte ich: Das alles ist natürlich nur ein Scherz. Gleich wird er den Sargdeckel aufreißen, uns der Reihe nach mit seinem ansteckenden Grinsen mustern und wieder einmal so laut lachen, dass uns die Ohren schmerzen. Und dann wird er losbrüllen, dass Arbeit auf uns wartet, und uns dazu antreten lassen, irgendeine obskure Molchart zu beschützen, deren Lebensraum durch die Bauabsichten eines finsteren Industriegiganten bedroht ist.
Ganz sicher war ich nicht der Einzige, dem beim Begräbnis derartige Gedanken durch den Kopf schossen, das sah ich den Gesichtern der anderen an. Und nach allem, was man hört, geht es dem ganzen Land, ja der ganzen Welt nicht anders. Die Vorstellung, dass Theodore Roosevelt nicht mehr unter uns weilt, ist einfach – inakzeptabel.
Es ging ihm allerdings schon länger nicht gut, genau genommen seit jenem Augenblick, da sein Sohn Quentin in den letzten Tagen des Großen Schlachtens den Tod fand. Seit Quentins Flugzeug im Sommer 1918 vom Himmel geholt worden war, sei »das Kind in Theodore gestorben«, meinten die Leute. Als ich heute mit Laszlo Kreisler bei Delmonico zu Abend aß, zitierte ich diese Ansicht und musste mir daraufhin zwei Gänge lang eine tiefschürfende psychiatrische Analyse anhören, warum Theodore über Quentins Tod nicht hinwegzukommen vermochte. Er habe allen seinen Kindern sein Ideal eines »harten, tatenreichen Lebens« derart gründlich eingeimpft, dass diese sich oft in voller Absicht in Gefahren stürzten, nur um ihrem geliebten Vater zu imponieren. Also habe sich Theodore zutiefst schuldig gefühlt.
Nun, ich hatte schon immer gewusst, dass Theodore Trauer nicht ertragen konnte; jedes Mal, wenn ein ihm nahestehender Mensch starb, dann schien es, als würde er damit einfach nicht fertig. Allerdings begriff ich erst heute, da ich Kreislers Ausführungen lauschte, wie sehr obendrein der moralische Zwiespalt jenem Mann zugesetzt haben muss, der sich bisweilen für Justitias moderne Verkörperung zu halten schien.
Kreisler … Er hatte nicht zum Begräbnis kommen wollen, obwohl es Edith Roosevelt so gerne gesehen hätte. Sie hatte immer zu diesem Mann gehalten, den sie »das Rätsel« nannte, dem brillanten Arzt, dessen Forschungen über die menschliche Psyche in den vergangenen vierzig Jahren so viele von uns zutiefst verstört hatten. In seinem Beileidsschreiben an Edith hatte er erklärt, dass ihm die Vorstellung einer Welt ohne Theodore wahrhaftig nicht zusage; und da er inzwischen schon vierundsechzig sei und sein ganzes Leben lang der Realität in die grässliche Fratze gestarrt habe, wolle er sich jetzt den Luxus leisten und den Tod seines Freundes einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Mir sagte Edith heute, Kreislers Brief habe sie zu Tränen gerührt, denn erst jetzt habe sie erkannt, dass es Theodore dank seiner schrankenlosen Zuneigung und Begeisterung – so vielen Zynikern ein Greuel und, wie ich im Namen journalistischer Wahrheitspflicht gestehen muss, auch für seine Freunde manchmal schwer erträglich – gelungen war, einem Mann näherzukommen, der sich fast völlig von der menschlichen Gesellschaft zurückgezogen hatte.
Einige Kollegen von der Times hatten mich für heute Abend zu einem Gedächtnis-Dinner eingeladen, aber mir schien ein ruhiger Abend allein mit Kreisler sehr viel passender. Dabei ging es mir nicht um nostalgische Erinnerungen an eine gemeinsame Kindheit in New York, denn Laszlo und Theodore hatten sich ja erst in Harvard kennengelernt. Vielmehr gedachten Kreisler und ich einer alten Geschichte, die sich im Frühling 1896 abgespielt hatte – also vor beinahe einem Vierteljahrhundert – und die sogar für eine Stadt wie diese zu bizarr schien.
Beim Nachtisch angelangt, lachten wir, schüttelten die Köpfe und wunderten uns wieder einmal, dass wir die Sache damals lebend überstanden hatten. Dabei fand ich in Kreislers Gesicht ebenso wie in meinem eigenen Herzen die alte Trauer um jene, die damals nicht mit dem Leben davongekommen waren.
KAPITEL 2
Lautes Gepolter gegen die Haustür meiner Großmutter am Washington Square North Nr. 19 trieb am 3. März 1896 gegen zwei Uhr früh zuerst das Stubenmädchen, dann meine Großmutter selbst aus den Federn. Ich lag im Bett, noch ganz gefangen in einem vom Schlaf kaum abgemilderten Zustand zwischen Rausch, Kater und Nüchternheit. Natürlich wusste ich nur zu gut, dass ein derartiger Lärm um diese Zeit wahrscheinlich eher mir galt als meiner guten alten Großmutter. Doch ich vergrub mich tief in mein Kissen und hoffte, es würde von selbst wieder aufhören.
»Mrs. Moore!«, hörte ich das Mädchen rufen. »Das ist ja ein Höllenspektakel – soll ich aufmachen gehen?«
»Kommt nicht infrage«, erwiderte meine Großmutter kühl wie immer. »Weck meinen Enkel, Harriet. Wahrscheinlich hat er seine Spielschulden nicht bezahlt!«
Im nächsten Moment näherten sich Schritte meiner Türe, und ich erkannte, dass weiteres Verstecken zwecklos war. Seit der Auflösung meiner Verlobung mit Julia Pratt vor zwei Jahren wohnte ich bei meiner Großmutter, und die alte Dame war ganz offensichtlich immer weniger einverstanden mit der Art und Weise meiner Freizeitgestaltung. Zwar hatte ich ihr wiederholt erklärt, dass ich mich in meiner Eigenschaft als Polizeireporter bei der New York Times schon von Berufs wegen in einigen weniger angesehenen Vierteln und Etablissements herumtreiben und vielleicht manchmal auch mit Kerlen treffen musste, die nicht gerade der Traum einer Schwiegermutter waren; sie aber erinnerte sich nur allzu gut an meine Jugend und schien nicht bereit, diese zugegebenermaßen etwas zweifelhafte Erklärung widerspruchslos zu schlucken. Außerdem bestärkte sie der Zustand, in dem ich abends normalerweise nach Hause kam, in ihrem Verdacht, dass es eigene Neigungen waren und nicht etwa berufliche Verpflichtungen, die mich jede Nacht in die Tanzsalons und an die Spieltische des Tenderloin zogen; und nachdem gerade schon wieder eine solche Anspielung an mein Ohr gedrungen war, musste ich mich wohl bemühen, als nüchterner Mann mit einer ernsthaften Beschäftigung aufzutreten. Schnell schlüpfte ich in einen schwarzen chinesischen Schlafrock, strich mir das kurz geschnittene Haar zurecht und öffnete, als Harriet eben klopfen wollte, erhobenen Hauptes meine Tür.
»Ach, Harriet«, sagte ich gelassen, eine Hand unter das Revers des Schlafrocks geschoben. »Es besteht kein Grund zur Unruhe. Ich beschäftigte mich mit den Vorarbeiten zu einem Artikel und habe dabei bemerkt, dass mir noch einige Unterlagen aus dem Büro fehlen. Das ist wohl der Bote, der sie bringt.«
»John!«, erschallte die Stimme meiner Großmutter, während Harriet verwirrt nickte. »Bist du das?«
»Nein, Großmutter«, erwiderte ich und stieg auf dem dicken Perserteppich die Treppe hinunter. »Es ist Dr. Holmes.« Dr. H. H. Holmes war ein unvorstellbar sadistischer Serienmörder, der in einem Gefängnis in Philadelphia auf seine Hinrichtung wartete. Die Vorstellung, er könne sein Rendezvous mit dem Henker nicht einhalten, sondern vorher entfliehen und nach New York reisen, um meiner Großmutter den Garaus zu machen, war seltsamerweise deren ständiger und größter Albtraum. An ihrer Schlafzimmertür angekommen, drückte ich ihr einen Kuss auf die Wange, den sie ohne ein Lächeln entgegennahm, obgleich ich wusste, dass es ihr gefiel.
»Sei nicht so frech, John. Das steht dir nicht. Und bilde dir ja nicht ein, du könntest mich mit deinem Charme um den Finger wickeln.« Doch schon wurde wieder an die Tür getrommelt, und diesmal hörte man eine Knabenstimme meinen Namen rufen.
»Wer in drei Teufels Namen ist das, und was will er?« Inzwischen hatte meine Großmutter Zornesfalten auf der Stirn.
»Ich glaube, das ist der Botenjunge aus dem Büro«, erklärte ich, tapfer weiterlügend, inzwischen aber selbst etwas nervös bezüglich der Identität des jungen Mannes, der die Eingangstür derart vehement bearbeitete.
»Aus dem Büro?«, wiederholte meine Großmutter, und es war offensichtlich, dass sie mir kein Wort glaubte. »Nun gut, dann mach doch auf.«
Auf dem Weg nach unten wurde mir klar, dass mir die Stimme zwar bekannt vorkam, ich sie aber nicht identifizieren konnte. Dass die Stimme so jung klang, war mir dabei keineswegs eine Beruhigung – einige der gemeinsten Diebe und Mörder, die ich im New York des Jahres 1896 kennengelernt hatte, waren noch Kinder.
»Mr. Moore!«, brüllte der Junge erneut, während er dem Klopfen mit ein paar tüchtigen Fußtritten Nachdruck verlieh. »Ich muss mit Mr. John Schuyler Moore sprechen!«
Ich stand jetzt auf dem schwarz-weißen Marmorfußboden der Eingangshalle. »Wer ist da?«, rief ich, eine Hand auf der Klinke.
»Ich bin’s, Sir! Stevie, Sir!«
Mit einem Seufzer der Erleichterung sperrte ich das schwere Holzportal auf. Draußen im schwachen Schein einer Gaslaterne stand Stevie Taggert. In den ersten elf Jahren seines Lebens hatte Stevie fünfzehn Polizeireviere das Fürchten gelehrt; dann aber war er meinem guten alten Freund Dr. Laszlo Kreisler in die Hände gefallen, dem bedeutenden Arzt und Psychologen, der ihn nicht nur wieder auf den rechten Weg gebracht, sondern ihn auch zu seinem Leibkutscher und Botenjungen gemacht hatte. Stevie lehnte an einer der weißen Säulen vor dem Eingang und rang nach Atem – irgendetwas hatte den Burschen sichtlich schockiert.
»Stevie!«, rief ich, als ich sah, dass ihm die langen, braunen, glatten Haare an den schweißnassen Wangen klebten. »Was ist denn passiert?« Gleich hinter ihm erblickte ich Kreislers kleinen Einspänner. Das Verdeck der schwarzen Kutsche war heruntergeklappt, und gezogen wurde sie von einem Wallach namens Frederick. Wie Stevie war auch das Tier in Schweiß gebadet und dampfte in der kalten Nachtluft. »Ist Dr. Kreisler auch da?«
»Der Doktor lässt sagen, Sie sollen mitkommen!«, stieß Stevie hervor. »Jetzt sofort!«
»Aber wohin denn? Es ist zwei Uhr früh …«
»Jetzt sofort!« Zu einer Erklärung war Stevie offenbar nicht in der Lage, also bat ich ihn zu warten, während ich mir schnell etwas anzog. Meine Großmutter rief mir durch die Tür meines Schlafzimmers zu, sie sei überzeugt, »dieser höchst eigenartige Dr. Kreisler« und ich hätten zu dieser frühen Morgenstunde nichts Schickliches im Sinn. Ohne auf sie zu achten, eilte ich wieder hinaus, knöpfte im Laufen meinen Tweedrock zu und sprang in die Kutsche.
Ich hatte noch nicht richtig Platz genommen, als Stevie bereits mit seiner langen Peitsche Frederick in Trab setzte. Unelegant auf dem kastanienbraunen Lederpolster gelandet, wollte ich den Jungen schon schelten, aber sein Gesichtsausdruck hielt mich davon ab. Mit halsbrecherischer Geschwindigkeit hüpfte der Wagen über das Kopfsteinpflaster des Washington Square, und das Gerumpel und Gepolter ließ nur unmerklich nach, als wir auf die langen, breiten Steinplatten des Broadway einbogen. Zuerst ging es aufs Stadtzentrum zu, dann in Richtung Osten, in jenes Viertel von Manhattan, wo Laszlo Kreisler seiner Arbeit nachging und das Milieu umso elender und schmuddeliger wurde, je tiefer man in die Lower East Side vordrang.
Eine Weile lang fürchtete ich fast, Kreisler selbst sei etwas zugestoßen. Das wäre jedenfalls eine Erklärung dafür gewesen, dass Stevie wie wild auf Frederick eindrosch, den er doch sonst immer so pfleglich behandelte. Kreisler war der erste Mensch gewesen, der Stevie mehr als einen Biss oder Faustschlag hatte entlocken können. Ihm allein war es auch zuzuschreiben, dass der Bursche sich nicht mehr in jenem Haus auf Randalls Island befand, das man beschönigend als »Knabenzufluchtsheim« bezeichnete. Stevie, der nach Aussagen der Polizei schon mit zehn ein »Dieb, Taschendieb, Trinker, Raucher und Schmierensteher« war und außerdem eine »Gefahr für die sittliche Gesellschaft« darstellte, hatte auf Randalls Island auch noch einen Wärter angefallen und schwer verletzt. Allerdings hatte nach Stevies Aussage dieser ihn »angegriffen« – was in der damaligen Zeitungssprache eigentlich fast immer Vergewaltigung bedeutete. Da der Wärter aber Frau und Kinder hatte, zweifelte man nicht nur an der Wahrheit von Stevies Angaben, sondern schließlich auch an seinem Verstand – und an diesem Punkt hatte dann Kreisler, damals die unumstrittene Koryphäe auf dem Gebiet der forensischen Psychiatrie, seinen Auftritt. Bei Stevies psychiatrischem Gutachten beschwor Kreisler ein eindringliches Bild seiner Kindheit herauf. Mit drei hatte seine Mutter, dem Opium mehr zugetan als ihrem Sohn, ihn auf die Straße gejagt und war mit einem chinesischen Drogenhändler fortgezogen. Der Richter zeigte sich von Kreislers Plädoyer sehr beeindruckt und glaubte auch nicht so recht an die Aussage des verletzten Wärters; zur Freilassung Stevies erklärte er sich aber erst bereit, als Kreisler anbot, den Jungen zu sich zu nehmen, und für sein zukünftiges Wohlverhalten bürgte. Das hielt ich für ziemlich verrückt. Doch es war nicht zu bestreiten, dass Stevie innerhalb eines Jahres ein anderer Mensch geworden war. Und wie alle, die für Kreisler arbeiteten, war auch Stevie seinem Herrn und Meister trotz dessen merkwürdiger Distanziertheit, die so vielen von Kreislers Bekannten zu schaffen machte, vollkommen ergeben.
»Stevie«, schrie ich gegen den Lärm der Kutschenräder an, die über die abgefahrenen Ränder der Steinplatten ratterten, »wo ist Dr. Kreisler? Ist ihm etwas zugestoßen?«
»Er ist im Institut«, brüllte Stevie mit weit aufgerissenen blauen Augen zurück. Der Mittelpunkt von Laszlos Arbeit lag im »Kreislerschen Institut für Kinder«, einer Mischung aus Schule und Forschungszentrum, das er in den Achtzigerjahren gegründet hatte. Ich wollte mich gerade erkundigen, was Kreisler zu dieser nachtschlafenden Zeit dort verloren hatte, schluckte meine Frage aber hinunter, als wir uns kopfüber in die immer noch belebte Kreuzung von Broadway und Houston Street stürzten. Hier, so hieß es, konnte man jederzeit mit einem Gewehr in alle Richtungen feuern, ohne je einen anständigen Menschen zu treffen. Stevie begnügte sich damit, ein paar Säufer, Morphium- und Kokainsüchtige, etliche Huren samt ihrem Gefolge aus Matrosen sowie ein paar ganz normale Obdachlose auf die Gehsteige zu scheuchen, von wo aus sie uns finstere Flüche nachsandten.
»Fahren wir also auch zum Institut?«, schrie ich. Aber Stevie riss das Pferd scharf nach rechts in die Spring Street, wo wir vor zwei oder drei Musiksaloons die Geschäfte störten. Es waren in Wirklichkeit Freudenhäuser, wo sich Prostituierte, als Tänzerinnen getarnt, für später in billige Hotels einladen ließen, meist von ahnungslosen Provinzlern. Von der Spring Street kutschierte Stevie in die Delancey Street – die damals gerade verbreitert wurde, um dem nach der Fertigstellung der Williamsburg Bridge erwarteten Verkehr gewachsen zu sein –, und dann rasten wir an mehreren bereits geschlossenen Theateretablissements vorbei. In den schmutzigen Seitenstraßen echoten verzweifelte, irre Klänge aus jenen heruntergekommenen Kellerlöchern, wo man für einen Heller ein Glas Fusel bekam, das mit allem Möglichen gestreckt war, von Kampfer bis Benzin. Stevie jagte immer noch im gleichen Tempo dahin – offenbar steuerten wir auf den äußersten Rand der Insel zu.
Ich unternahm einen letzten Versuch: »Fahren wir denn ins Institut?«
Als Antwort schüttelte Stevie nur den Kopf und schnalzte dann wieder mit der Peitsche. Resigniert die Schultern zuckend, hielt ich mich an den Seitengriffen fest und überlegte, was diesen Jungen, der trotz seines kurzen Lebens doch schon so viele der Gräuel von New York kannte, derart erschüttert haben mochte.
Die Delancey Street führte uns, vorbei an Ständen, wo Obst und Kleidung verkauft wurden, in eines der übelsten Viertel der Lower East Side: in den Bezirk genau oberhalb von Corlears Hook. Vor uns erstreckte sich ein Meer aus schäbigen neuen Mietskasernen, dazwischen kauerten windschiefe Hütten aus Wellblech und Holz. Dieser Stadtteil war Schmelztiegel der verschiedensten Einwandererkulturen und -sprachen, wobei südlich der Delancey Street die Iren und weiter nördlich, in Richtung Houston Street, die Ungarn dominierten. Aus den verkommenen, verdreckten Häuserzeilen, an denen selbst an einem so kalten Morgen wie diesem überall Wäsche flatterte, ragte hier und dort eine Kirche empor. Steif gefrorenes Bettzeug und Kleidungsstücke knatterten im Wind, auf groteske, unnatürliche Weise verzerrt – sofern man in einer solchen Gegend, wo in spärliche Fetzen gekleidete, skelettartige Gestalten aus finsteren Hauseingängen in lichtlose Hinterhöfe huschten und dabei mit bloßen Füßen durch Pferdemist, Urin und Asche schlurften, überhaupt von »unnatürlich« reden wollte. Wir waren in einem Viertel, in dem das Gesetz nicht mehr viel galt, ein Viertel, das seinen Einwohnern wie seinen Besuchern nur dann Freude machte, wenn sie es nach gelungener Flucht aus der Ferne betrachten durften.
Gegen Ende der Delancey Street verkündete jene charakteristische Geruchsmischung aus frischer Seeluft und dem Gestank des Abfalls, den die Bewohner der hiesigen Waterkant täglich einfach über den Rand von Manhattan ins Meer kippten, dass wir uns dem East River näherten. Und plötzlich ragte ein riesiger Schatten vor uns auf: die Rampe der im Bau befindlichen Williamsburg Bridge. Ohne innezuhalten, donnerte Stevie auf die mit Brettern beschlagene Rampe. Auf dem Holz machten die Pferdehufe und die Räder der Kutsche noch weit mehr Lärm als zuvor auf dem Stein.
Ein verworrenes Netz von Stahlträgern unter der Rampe hob uns über zehn Meter hoch hinauf in die eiskalte Nachtluft. Ich begriff immer weniger, wohin es denn eigentlich gehen sollte, denn die Brückentürme waren noch lange nicht fertig, von einer Eröffnung der Brücke noch längst keine Rede. Da erblickte ich direkt vor mir etwas, das wie die Wände eines großen chinesischen Tempels aussah. Doch dieses merkwürdige Gebäude aus zwei riesigen Granitblöcken, gekrönt von zwei eckigen Wachttürmen, jeder von einem filigranen Stahlgespinst umgeben, war der Brückenanker auf der Seite von Manhattan, eines jener beiden Bauteile also, die schließlich einmal dem ungeheuren Zug der Stahlträger der Brückenkonstruktion würden standhalten müssen. Der Vergleich mit einem chinesischen Tempel war dennoch nicht ganz von der Hand zu weisen: Wie die Brooklyn Bridge, deren gotische Spitzbögen sich im Süden deutlich vom Nachthimmel abhoben, so war auch diese neue Verbindung über den East River ein Ort, wo die Leben vieler Arbeiter dem Glauben an die neue Baukunst, die in den vorausgegangenen fünfzehn Jahren überall in Manhattan wahre Wunderwerke hervorgebracht hatte, geopfert wurden. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das an diesem Abend über dem Westanker der Williamsburg Bridge dargebrachte Blutopfer von ganz anderer Art war.
Rund um den Eingang zum Wachtturm oben auf dem Anker drängten sich im flackernden Licht der schwachen elektrischen Birnen einige Polizisten, deren kleine Messingschilder sie als dem Dreizehnten Bezirk zugehörig auswiesen – wenige Augenblicke zuvor erst hatten wir ihr Revier in der Delancey Street passiert. Dann erkannte ich unter ihnen einen Sergeant aus dem Fünfzehnten und stutzte; in meiner zweijährigen Arbeit als Polizeireporter für die Times, von meiner Kindheit in New York ganz zu schweigen, hatte ich die Erfahrung gemacht, dass jedes Polizeirevier eifersüchtig seinen Bezirk hütete, ja, um die Jahrhundertmitte hatten die einzelnen Polizeitruppen einander sogar offen bekämpft. Wenn der Dreizehnte Bezirk heute einen Mann aus dem Fünfzehnten dazuholte, dann lag wirklich etwas ganz Besonderes vor.
Bei dieser Gruppe von Polizisten in blauen Wintermänteln brachte Stevie den Wallach endlich zum Stehen, sprang vom Kutschbock, packte das in den Flanken zitternde Pferd an der Trense und führte es zur Seite, zu einem riesigen Haufen aus Baumaterial und Werkzeug. Von dort spähte der Junge misstrauisch zu den Bullen hinüber. Der Sergeant aus dem Fünfzehnten, ein groß gewachsener Ire mit einem teigigen Gesicht, das man sich nur deshalb merkte, weil es eben nicht von jenem breiten Schnurrbart geziert wurde, der sonst bei all seinen Berufskollegen üblich war, dieser Ire also trat vor und sah Stevie gefährlich grinsend ins Gesicht.
»Na, wen haben wir denn da?«, sagte er dann mit breitem irischen Akzent. »He, Stevie, hat mich vielleicht der Kommissar den weiten Weg nur deshalb raufgeschickt, damit ich dir kleinem Scheißer eins über den sturen Schädel ziehe?«
Ich stieg aus der Kutsche und stellte mich neben Stevie, der dem Sergeant einen bösen Blick zuwarf. »Hör nicht auf ihn, Stevie«, sagte ich. »Unter dieser Lederhaube muss einem ja der Verstand vertrocknen.« Der Junge lächelte vorsichtig. »Aber ich hätte nichts dagegen, wenn du mir endlich sagen würdest, was ich hier soll.«
Stevie deutete mit dem Kopf zum nördlichen Wachtturm, dann zog er eine etwas mitgenommene Zigarette aus der Tasche. »Da rauf. Der Doktor hat gesagt, Sie sollen da rauf.«
Also ging ich los in Richtung Granitwand, bemerkte aber sogleich, dass Stevie beim Pferd stehen blieb. »Du kommst nicht mit?«
Schaudernd wandte sich der Junge ab und zündete sich die Zigarette an. »Hab’s schon gesehen. Und wenn ich so etwas nicht noch mal sehen muss, dann ist mir das ganz recht. Wenn Sie nachher wieder heimfahren wollen, Mr. Moore, ich warte hier auf Sie. Befehl vom Doktor.«
Mit einem flauen Gefühl im Magen wandte ich mich in Richtung Eingang, wo ich allerdings von dem Polizeisergeant zurückgehalten wurde. »Und mit wem haben wir hier die Ehre? Muss ein großer Herr sein, wenn der kleine Stevie ihn die ganze Nacht herumkutschiert. Das hier ist der Schauplatz eines Verbrechens, wissen Sie?«
Ich stellte mich mit Namen und Beruf vor, worauf er mich angrinste und dabei einen höchst eindrucksvollen Goldzahn aufblitzen ließ. »Ah, ein Herr von der Presse – und noch dazu von der Times, na, so was! Also, Mr. Moore, ich bin selbst gerade erst gekommen. Ein dringender Ruf, war offenbar sonst niemand da, dem man vertrauen kann. Nennen Sie mich Flynn, wenn Sie wollen, F-l-y-n-n, und vergessen Sie den Titel nicht: Full Sergeant. Na gut, gehen wir zusammen rauf. Und du benimm dich, Stevie, sonst wanderst du wieder nach Randalls Island, so schnell kannst du gar nicht spucken!«
Stevie drehte sich zu seinem Pferd. »Lass dich doch eingraben«, murmelte er, gerade laut genug, dass der Sergeant es hören konnte. Dieser fuhr herum, gefährliche Wut im Blick, doch dann erinnerte er sich wieder an mich und richtete sich auf. »Der Bursche da ist unverbesserlich, Mr. Moore. Kann mir nicht vorstellen, warum ein Mann wie Sie sich mit ihm abgibt. Wahrscheinlich als Führer durch die Unterwelt, haha. Also, hoch da mit uns, und passen Sie auf, dort drinnen ist es pechschwarz.«
Das war es tatsächlich. Immer wieder stolpernd, tastete ich mich eine unfertige Treppe hinauf, bis ich, oben angelangt, den Umriss eines weiteren Lederschädels ausmachen konnte. Der Bulle, ein Streifenpolizist aus dem Dreizehnten, wandte sich bei unserem Erscheinen um und rief dann:
»Da ist Flynn, Sir. Er ist da.«
Wir traten aus dem Stiegenhaus in einen kleinen Raum mit Sägeböcken, Holzbrettern, Eimern voller Nieten und Schrauben, Draht und Metall. Die großen Fenster boten eine überwältigende Aussicht nach allen Seiten – auf die Stadt hinter uns, den Fluss und die zum Teil fertiggestellten Brückentürme vor uns. Durch den Ausgang gelangte man auf eine Metallplattform, die rund um den Turm führte. Neben der Tür stand ein schlitzäugiger, bärtiger Detective Sergeant namens Patrick Connor, den ich von meinen Besuchen in der Polizeizentrale in der Mulberry Street kannte. Und gleich neben ihm entdeckte ich, mit auf dem Rücken verschränkten Händen auf den Fluss blickend, eine sehr viel vertrautere Gestalt: Theodore.
»Sergeant Flynn«, sagte Roosevelt und starrte weiter hinaus, »es ist ein scheußlicher Anlass, aus dem ich Sie rufen ließ. Wirklich scheußlich.«
Mein Unbehagen vertiefte sich, als Theodore plötzlich herumwirbelte. Auf den ersten Blick sah er genauso aus wie immer: ein teurer, leicht dandyhafter Glencheck-Anzug, wie er ihn damals gerne trug; eine Brille, die ebenso wie die Augen dahinter irgendwie zu klein schien für seinen kantigen Kopf; der breite Schnurrbart unter der geraden Nase. Trotzdem wirkte sein Gesicht ganz anders. Und plötzlich erkannte ich den Grund dafür: seine Zähne. Seine breiten, immer wie zum Zuschnappen bereiten Zähne waren nicht zu sehen. Seine Lippen waren zusammengepresst, entweder in rasendem Zorn oder aus Selbstvorwurf. Irgendetwas hatte Roosevelt außerordentlich erschüttert.
Als er mich sah, wurde seine Stimmung um nichts besser. »Was – Moore! Was zum Teufel hast du denn hier verloren?«
»Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Roosevelt«, würgte ich nervös hervor und streckte ihm die Hand hin.
Er schüttelte sie, wobei er sie mir ausnahmsweise einmal nicht aus dem Gelenk riss. »Was – oh, tut mir leid, Moore. Ich – ja, ja, ich freu mich auch, dich zu sehen, natürlich. Aber wer hat dir gesagt …?«
»Wer mir Bescheid gesagt hat? Na, ich wurde von Kreislers Jungen aus dem Bett geholt und hierherkutschiert. Auf seine Anordnung, ohne ein Wort der Erklärung.«
»Kreisler!«, murmelte Theodore und starrte mit ungewöhnlich besorgtem, ja fast ängstlichem Blick aus dem Fenster. »Ja, Kreisler war hier.«
»Er war hier? Das heißt, er ist wieder fortgegangen?«
»Noch vor meinem Eintreffen. Aber er hat eine Nachricht hinterlassen. Und einen Bericht.« Theodore wies auf ein zerknülltes Stück Papier in seiner Linken. »Zumindest einen vorläufigen. Er war der erste Arzt, den sie auftreiben konnten. Obwohl es natürlich gänzlich sinnlos war …«
Ich packte ihn an der Schulter. »Roosevelt – was ist hier los?«
»Offen gestanden, Commissioner, würde ich das auch ganz gern erfahren«, meldete sich jetzt Sergeant Flynn mit einer honigsüßen Unterwürfigkeit zu Wort, vor der mir regelrecht graute. »Wir im Fünfzehnten kommen ohnehin kaum zum Schlafen, und ich wüsste wirklich …«
»Also gut«, bemerkte Theodore und holte tief Atem. »Meine Herren, ich hoffe, Sie haben alle einen guten Magen.«
Ich erwiderte nichts, nur Flynn machte einen dummen Witz über die Scheußlichkeiten, die ihm in seinem Leben als Polizist schon begegnet waren. Theodores Gesichtsausdruck blieb hart und abweisend, als er auf die Tür zum äußeren Metallsteg deutete. Detective Sergeant Connor trat zur Seite und ließ Flynn vorangehen.
Draußen angelangt, wurde mein unangenehmes Vorgefühl für einen Moment von der Aussicht verdrängt, die hier vom Metallsteg aus noch überwältigender war als aus den Turmfenstern. Jenseits des Wassers lag Williamsburg, bis vor Kurzem ein friedliches, ländliches Städtchen, jetzt bereits von der lärmenden Metropole verschlungen, die sich innerhalb der folgenden Monate offiziell zum Großraum New York mausern sollte. Im Süden wieder die Brooklyn Bridge, im Südwesten weit entfernt die Türme des Printing House Square und unter uns die aufgewühlten schwarzen Wassermassen des Flusses.
Und da … sah ich es.
KAPITEL 3
Eigenartig, wie lange ich brauchte, um das Bild, das sich mir bot, zu erfassen. Doch das war alles so vollkommen falsch, so irrwitzig, so … verzerrt – wie hätte man das auch schneller begreifen sollen?
Auf dem Metallsteg befand sich der Körper einer jungen Person. Ich sage »Person«, weil zwar die sekundären Geschlechtsmerkmale die eines halbwüchsigen Jungen waren, aber die Bekleidung (zu sehen war nur ein Unterkleid, dem ein Ärmel fehlte) sowie das Make-up auf ein Mädchen oder vielmehr auf eine Frau hindeuteten, und zwar eine von zweifelhaftem Ruf. Das unglückliche Geschöpf hatte die Handgelenke auf dem Rücken zusammengebunden, die Beine waren zu einer knienden Haltung gebogen, und zwar so, dass das Gesicht gegen den eisernen Laufsteg gepresst wurde. Aber was mit dem Körper geschehen war …
Das Gesicht wies keine Spuren von Schlägen auf – die Schminke schien unberührt –, aber wo einst Augen gewesen waren, sah man jetzt nur noch blutige Höhlen. Aus dem Mund ragte ein unkenntliches Stück Fleisch. Quer über die Kehle zog sich ein breiter Schnitt, der jedoch kaum blutete. Der Unterleib war geradezu zerfetzt worden, sodass man die inneren Organe erahnen konnte. Die rechte Hand war glatt und sauber abgeschlagen. Eine klaffende Wunde im Schritt bot die Erklärung für den Mund – die Genitalien waren abgetrennt und dem Opfer zwischen die Zähne gestopft worden. Auch die Hinterbacken fehlten, mit großen, breiten Schnitten abgesäbelt wie von einem Metzger.
In den ein oder zwei Minuten, die ich brauchte, um die Einzelheiten aufzunehmen, wurde um mich herum plötzlich alles schwarz, und was ich zuerst für das Stampfen eines Dampfers hielt, war in Wirklichkeit das Dröhnen meines Blutes in meinen Ohren. Etwas Galliges stieg mit einem Mal in mir auf, daher drehte ich mich rasch um und hängte meinen Kopf über das Geländer.
»Commissioner!«, schrie Connor und stürzte aus dem Wachtturm. Aber Theodore war schon mit einem Sprung bei mir.
»Beruhige dich, John«, hörte ich ihn sagen, während er mich mit seiner drahtigen, aber erstaunlich kräftigen Boxerstatur stützte. »Tief durchatmen.«
In diesem Augenblick hörte ich einen lang gezogenen Pfiff von Flynn, der offenbar noch immer auf den Toten starrte. »Da sieh mal einer an«, sagte er ungerührt. »Giorgio alias Gloria, dich hat einer ganz schön fertiggemacht, was? Tja, du wirst keinen mehr einwickeln.«
»Ach, Sie kennen dieses Kind, Flynn?«, fragte Theodore, während er mich gegen die Mauer des Wachtturms lehnte. Das Karussell in meinem Kopf wurde allmählich langsamer.
»Allerdings, Commissioner.« In dem trüben Licht schien es, als würde Flynn grinsen. »Kind kann man das hier allerdings nicht nennen, wenn es nach seinem Benehmen geht. Familienname Santorelli, Alter, na ja, sagen wir so um die dreizehn. Giorgio hieß es ursprünglich, aber als es anfing, in der Paresis Hall zu arbeiten, nannte es sich Gloria.«
»Es?«, fragte ich und wischte mir dabei mit der Manschette meines Rocks den kalten Schweiß von der Stirn. »Warum sagen Sie immer wieder ›es‹?«
Flynns Grinsen wurde noch breiter. »Ja, wie würden Sie denn zu so was sagen, Mr. Moore? Ein Mann war es ja wohl nicht, so wie es sich aufführte – aber als Frau hat Gott es auch nicht erschaffen. Von dieser ganzen Brut spreche ich immer nur als ›es‹.«
Theodore stemmte seine zu Fäusten geballten Hände in die Hüften; ihm war klar geworden, was für ein Bursche dieser Flynn war. »An Ihrer philosophischen Analyse der Situation bin ich nicht interessiert, Sergeant. Der Junge hier war in jedem Fall ein Kind, und dieses Kind wurde ermordet.«
Flynn gluckste und starrte wieder auf die Leiche. »Ist wohl kaum zu bestreiten, Sir.«
»Sergeant!« Theodores Stimme, die im Gegensatz zu seinem freundlichen Aussehen immer etwas scharf wirkte, klang jetzt noch barscher, als er den nun strammstehenden Flynn anfuhr. »Kein Wort mehr von Ihnen, außer Sie werden gefragt! Ist das klar?«
Flynn nickte; aber seine leicht gekräuselte Oberlippe verriet die höhnische Ablehnung, die alle lang gedienten Polizeibeamten dem Commissioner, der in knapp einem Jahr das Polizeihauptquartier und die gesamte Hierarchie auf den Kopf gestellt hatte, entgegenbrachten. Theodore konnte das nicht entgangen sein.
»Nun denn«, bemerkte er nun, wobei seine Zähne auf eine charakteristische Weise schnalzten, als ob er sich jedes Wort aus dem Munde meißeln müsste. »Sie sagen, der Junge hieß Giorgio Santorelli und hat in der Paresis Hall gearbeitet – das ist Biff Ellisons Etablissement am Cooper Square, nicht wahr?«
»Ganz recht, Commissioner.«
»Und wo hält sich Mr. Ellison Ihrer Meinung nach in diesem Moment auf?«
»In diesem … Na, sicher in der Paresis Hall, Sir.«
»Dann gehen Sie dorthin, und richten Sie ihm aus, dass ich ihn morgen früh in der Mulberry Street erwarte.«
Flynn verlor seinen amüsierten Gesichtsausdruck. »Morgen? Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Commissioner, aber Mr. Ellison ist nicht der Mann, der das gut aufnehmen wird.«
»Dann verhaften Sie ihn eben«, erwiderte Theodore, wandte sich ab und starrte hinüber nach Williamsburg.
»Verhaften? Wenn wir alle Bar- oder Nachtklubbesitzer verhaften wollten, nur weil einer von ihren Strichern überfallen oder umgebracht wurde, dann könnten wir gleich …«
»Es würde mich interessieren, die wahren Gründe für Ihren Widerstand zu erfahren«, bemerkte Theodore, der hinter seinem Rücken die Fäuste öffnete und schloss. Dann trat er ganz nahe an Flynn heran und musterte ihn durch seine Brillengläser. »Ist Mr. Ellison nicht eine Ihrer Hauptquellen für Schmiergeld?«
Flynn riss die Augen weit auf, brachte es aber fertig, sich zu straffen und die gekränkte Unschuld zu spielen. »Mr. Roosevelt, ich bin seit fünfzehn Jahren bei der Polizei, Sir, und ich glaube, ich weiß, wie diese Stadt funktioniert. Man kann einen Mann wie Mr. Ellison nicht einfach belästigen, nur weil so ein mieser kleiner Einwanderer das bekommt, was er verdient hat!«
Das war zu viel, und glücklicherweise wusste ich das, denn wäre ich nicht im selben Moment auf Theodore zugeschossen, um seine Arme festzuhalten, dann hätte er Flynn sicher blutig geschlagen. Aber es fiel mir nicht leicht, ihn zu bändigen. »Nein, Roosevelt, nicht!«, zischte ich ihm ins Ohr. »Genau darauf warten diese Brüder doch, und du weißt das! Wenn du einen Mann in Uniform angreifst, fordern die deinen Kopf, und dann kann dir auch der Bürgermeister nicht mehr helfen!«
Roosevelt entspannte sich schwer atmend, während Flynns Grinsen zurückkehrte. Detective Sergeant Connor und der Streifenpolizist hatten keine Anstalten gemacht, in das Geschehen einzugreifen. Sie hingen zwischen den Stühlen: Auf der einen Seite war da die mächtige städtische Reformbewegung, die nach dem, was die Lexow-Kommission (zu deren gewichtigsten Vertretern Roosevelt gehörte) vor einem Jahr über die Korruption im Polizeiapparat bekannt gegeben hatte, New York im Sturm erobert hatte; auf der anderen Seite stand die vielleicht noch größere Macht ebendieser Korruption, die so alt war wie der Polizeiapparat selbst und jetzt hinter den Kulissen abwartete, bis die Öffentlichkeit sich nicht mehr für Reformen interessierte und überall wieder der alte Schlendrian um sich greifen konnte.
»Sie haben die Wahl, Flynn«, erklärte Roosevelt und klang nun erstaunlich gelassen. »Ellison in meinem Büro oder Ihre Dienstmarke auf meinem Schreibtisch. Morgen früh.«
Mürrisch gab Flynn den Kampf auf. »Sehr wohl, Commissioner.« Er machte auf dem Absatz kehrt, bewegte sich in Richtung Stiegenhaus und murmelte dabei etwas von einem »verdammten Frackmatz, der den Polizisten spielt«. In diesem Moment erschien einer der Bullen, die unterhalb des Turmes Wache hielten, und verkündete, der Wagen des Coroners sei angekommen und bereit, die Leiche abzutransportieren. Roosevelt wies ihn an, noch ein paar Minuten zu warten, und schickte dann Connor und den Streifenpolizisten fort. Wir beide waren jetzt allein auf dem Steg, abgesehen von den grässlichen Überresten eines jener unzähligen verlassenen, verzweifelten jungen Menschen, die der finstere, elende Ozean von Mietskasernen, der sich von hier weit nach Westen erstreckte, immer wieder ausspie. Gezwungen, sich irgendwie über Wasser zu halten, waren diese Kinder in einer Weise auf sich allein gestellt, wie es sich jemand, der die Gettos von New York City im Jahre 1896 nicht kannte, auch nicht annähernd ausmalen konnte.
»Kreisler meint, der Junge wurde heute am frühen Abend ermordet«, erklärte Theodore nach einem Blick auf das zerknitterte Papier in seiner Hand. »Irgendetwas mit der Körpertemperatur. Der Mörder könnte also noch in der Nähe sein. Ich lasse die Gegend gerade von ein paar Männern durchkämmen. Es gibt noch einige weitere medizinische Details … und dann diese Nachricht.«
Damit reichte er mir das Papier, und ich sah, was Kreisler offenbar in nervöser Erregung in Blockschrift darauf notiert hatte: »ROOSEVELT: FURCHTBARE FEHLER SIND BEGANGEN WORDEN. ICH STEHE AM VORMITTAG ZUR VERFÜGUNG, AUCH MITTAGESSEN WÄRE MÖGLICH. WIR MÜSSEN SOFORT BEGINNEN – ES GIBT EINEN ZEITPLAN.« Ich gab mir Mühe, einen Sinn herauszulesen.
»Irgendwie ärgerlich, dass er gar so geheimnisvoll tut«, war schließlich das Einzige, was mir einfiel.
Theodore rang sich ein Lächeln ab. »Ja, das dachte ich auch. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, was er meint. Es hat mit der Untersuchung der Leiche zu tun. Hast du eine Vorstellung, Moore, wie viele Menschen jedes Jahr in New York ermordet werden?«
»Nein, keinen blassen Schimmer.« Ich warf noch einen Blick auf den Toten, wandte mich aber sofort wieder ab, als ich bemerkte, in welch grausamer Weise das Gesicht gegen den Metallsteg gepresst war – nämlich so, dass der Unterkiefer in einem grotesken Winkel vom Oberkiefer wegstand. »Sicher ein paar Hundert. Vielleicht auch ein- oder zweitausend.«
»Ja, das würde ich ebenfalls meinen«, antwortete Roosevelt. »Aber auch ich könnte nur schätzen. Denn mit den meisten geben wir uns ja gar nicht ab. Oh, die Polizei strengt sich natürlich an, wenn das Opfer bekannt und wohlhabend ist. Aber so ein Junge – ein Immigrant, der nur sich selbst verkauft –, ich schäme mich, das zu sagen, Moore, aber um solche Morde kümmern wir uns in der Regel nicht, wie du ja an Flynns Reaktion ablesen konntest.« Erneut stemmte er die Hände in die Hüften. »Doch ich ertrage das nicht mehr. In diesen Elendsvierteln bringen Eheleute einander um, Säufer und Drogensüchtige ermorden anständige Arbeiter, Prostituierte werden abgeschlachtet und begehen Selbstmord zu Dutzenden, und die Außenwelt sieht darin nichts anderes als eine Art finsteres Kabarett. Das ist schlimm genug. Aber wenn die Opfer Kinder sind wie dieses hier und die Öffentlichkeit darauf nicht anders reagiert als Flynn – bei Gott, dann graut mir vor meinem eigenen Volk! Dieses Jahr gab es schon drei ähnliche Fälle, und die Polizei hat sich keinen Deut darum geschert!«
»Drei?«, fragte ich. »Ich weiß nur von dem Mädchen bei Draper.« Shang Draper führte ein berüchtigtes Bordell an der Kreuzung der Sechsten Avenue und der Vierundzwanzigsten Straße, wo Kunden sich die Dienste von Kindern (hauptsächlich Mädchen, aber auch Knaben) zwischen neun und vierzehn Jahren erkaufen konnten. Im Januar war in einem der kleinen holzgetäfelten Zimmer des Bordells ein zehnjähriges Mädchen erschlagen aufgefunden worden.
»Ja, und von diesem Fall hast du auch nur deshalb gehört, weil Draper mit seinen Schmiergeldzahlungen im Rückstand war«, knurrte Roosevelt. Colonel William L. Strong, der damalige Bürgermeister, und Männer wie Roosevelt führten einen mutigen, verbissenen Kampf gegen die Korruption, aber es war ihnen noch nicht gelungen, die älteste und einträglichste aller polizeilichen Tätigkeiten zu unterbinden: das Eintreiben von Schmiergeldern bei Besitzern von Saloons, Bars, Stundenhotels, Opiumhöhlen und anderen Orten des Lasters. »Irgendjemand im Sechzehnten Bezirk, ich weiß immer noch nicht, wer, hat der Presse gegenüber die Geschichte breitgetreten, um die Schrauben fester anzuziehen. Aber die beiden anderen Opfer waren Jungen wie dieser hier, auf der Straße gefunden und daher nicht als Druckmittel für ihre Zuhälter geeignet. Deshalb hat niemand davon erfahren …«
Seine Stimme wurde vom Schlag der Wellen unter uns und dem Wind über dem Fluss übertönt. »Waren die beiden auch so zugerichtet?«, fragte ich und betrachtete Theodore, der auf das tote Kind hinabblickte.
»Fast genauso. Kehle durchschnitten. Ratten und Vögel hatten sich schon über sie hergemacht, so wie über den hier. Kein angenehmer Anblick.«
»Ratten und Vögel?«
»Die Augen«, gab Roosevelt zur Antwort. »Detective Sergeant Connor führt das auf Ratten oder Aasvögel zurück. Aber alles Übrige …«
In den Zeitungen hatte über die beiden anderen Morde nichts gestanden – was mich nicht im Geringsten überraschte. Wie Roosevelt sagte: Morde, die kaum aufklärbar schienen und sich unter den Armen und Ausgestoßenen abspielten, wurden von der Polizei kaum registriert, geschweige denn untersucht; wenn die Opfer dann noch einer Schicht der Gesellschaft angehörten, deren Existenz man offiziell gar nicht zugab, sank das Interesse der Öffentlichkeit auf null. Ich fragte mich einen Moment lang, was meine eigenen Redakteure bei der Times wohl getan hätten, wenn ich einen Artikel über einen Knaben vorgeschlagen hätte, der davon lebte, dass er sich als weibliche Hure anzog und bemalte und seinen Körper erwachsenen Männern verkaufte (viele von ihnen nach außen hin rechtschaffene Bürger), um schließlich in einem finsteren Winkel unserer Stadt auf grässlichste Weise hingeschlachtet zu werden. Die Kündigung wäre wohl das Mindeste gewesen; wahrscheinlich hätte ich obendrein mit der Zwangseinweisung ins Irrenhaus von Bloomingdale rechnen müssen.
»Kreisler habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen«, murmelte Roosevelt jetzt. »Allerdings hat er mir einen sehr netten Brief geschrieben, als …«, einen Augenblick schien es, als wollte ihm die Stimme versagen, »nun, zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt.«
Ich verstand. Theodore bezog sich auf den Tod seiner ersten Frau Alice, die im Jahr 1884 bei der Geburt ihrer gleichnamigen Tochter gestorben war. An diesem Tag traf ihn ein doppelter Verlust, denn Stunden nach dem Tod seiner Frau war auch seine Mutter gestorben. Theodore hatte die Tragödie auf für ihn charakteristische Weise bewältigt: indem er die Erinnerung an seine Frau in sich vergrub und nie wieder von ihr sprach.
Er riss sich los und wandte sich an mich. »Der gute Doktor muss aber doch einen Grund gehabt haben, auch dich hierherzurufen.«
»Ich will verdammt sein, wenn ich ihn kenne«, erwiderte ich achselzuckend.
»Jaja«, bemerkte Theodore mit freundschaftlichem Lachen. »Undurchsichtig wie ein Chinese, unser Freund Kreisler. Und vielleicht habe auch ich mich wie er in den letzten Monaten ausschließlich unter Abseitigem und Scheußlichem bewegt. Aber ich glaube, seine Absicht erraten zu können. Sieh mal, Moore, ich musste die drei anderen Morde gewissermaßen ignorieren, weil der Apparat keine Untersuchung wünscht. Und selbst wenn sie’s wollten, gäbe es keinen geeigneten Mann, der die Ausbildung hat, aus solchen Schlächtereien klug zu werden. Aber dieser Junge, dieses furchtbar verstümmelte Kind – die Justiz kann nicht ewig die Augen verschließen. Ich habe einen Plan, und ich glaube, auch Kreisler hat einen Plan – und du sollst wahrscheinlich derjenige sein, der uns zusammenbringt.«
»Ich?«
»Warum nicht? So wie damals in Harvard, zu Beginn unserer Bekanntschaft.«
»Aber was könnte ich dabei tun?«
»Kreisler morgen zu mir ins Büro bringen. Am späten Vormittag, wie er sagt. Dann besprechen wir alles und legen unsere weitere Vorgehensweise fest. Allerdings bitte ich dich um äußerste Diskretion – für alle anderen soll das nur ein Treffen alter Freunde sein.«
»Aber Roosevelt, zum Teufel – was soll nur ein Treffen von alten Freunden sein?«
Aber die Begeisterung über seinen Plan hatte ihn schon ganz gefangen genommen. Meine vorwurfsvolle Frage überging er, holte tief Atem, streckte den Brustkorb heraus und wirkte auf einmal viel gelöster. »Taten, Moore, wir werden mit Taten darauf antworten!«
Und dann packte er mich bei den Schultern und drückte mich an sich, voller Enthusiasmus und soeben wiedererlangter moralischer Gewissheit. Was meine eigene Gewissheit anging – irgendeine Art von Gewissheit! –, so wartete ich vergeblich auf ihr Erscheinen. Ich wusste nur, dass ich da in etwas hineingezogen wurde, das die beiden entschlossensten Männer betraf, die ich kannte – und diese Vorstellung bot mir keinerlei Trost, als wir hinunterstiegen zu Kreislers Wagen und den Leichnam des bedauernswerten kleinen Santorelli allein auf dem Turm ließen, hoch oben im eiskalten Himmel, den noch nicht die leiseste Spur der Morgendämmerung erhellte.
KAPITEL 4
Der Morgen begann mit kaltem, dichtem Schneeregen.
Ich stand zeitig auf und genoss das Frühstück, das Harriet in ihrer fürsorglichen Art zubereitet hatte: starken Kaffee, Toast und Obst (was sie, im Dienst meiner Familie erfahren im Umgang mit trinkfreudigen Menschen, bei jedem Freund des Alkohols für unerlässlich hielt). Ich setzte mich in den kleinen verglasten Erker meiner Großmutter mit Blick über den noch nicht erwachten Rosengarten an der Rückseite des Hauses und beschloss, mich an der Morgenausgabe der Times zu erbauen, bevor ich in Kreislers Institut anrief. Der Regen trommelte auf das Kupferdach und an die Scheiben ringsherum, ich atmete den Duft der wenigen Grünpflanzen und Blumen ein, die meine Großmutter hier das ganze Jahr über pflegte, und vertiefte mich in die Zeitung. Aber im Vergleich zu dem, was gestern Abend geschehen war, schien die Welt der Zeitung ziemlich uninteressant.
HELLE EMPÖRUNG IN SPANIEN, las ich; die amerikanische Unterstützung der nationalistischen Aufständischen in Kuba (der Kongress hatte vor, ihnen den Status einer Krieg führenden Nation zuzugestehen, was praktisch eine Anerkennung ihrer Ziele bedeutete) bereitete dem üblen, morschen Regime in Madrid schlaflose Nächte. Boss Tom Platt, Anführer der republikanischen Stadtfraktion, steinalt und zutiefst böse, wurde von der Redaktion der Times der Vorwurf gemacht, er wolle die geplante Neuordnung der Stadt zu einem Großraum New York – unter Einschluss von Brooklyn und Staten Island, ebenso wie von Queens, der Bronx und Manhattan – für seine eigenen egoistischen Ziele missbrauchen. Bei den bevorstehenden Parteitagen der Republikaner wie der Demokraten würde es wohl vor allem um die Frage des Bimetallismus gehen, das heißt darum, ob Amerikas guter alter Goldstandard durch die Einführung von Silbermünzen abgewertet werden sollte.
So bedeutend das alles ohne Zweifel war, so wenig konnte es einen Mann in meiner Stimmung fesseln. Also wandte ich mich leichteren Dingen zu. In Proctor’s Theatre traten Rad fahrende Elefanten auf; in Hubert’s Museum an der Vierzehnten Straße eine Truppe von Hindu-Fakiren; in der Academy of Music gab Max Alvary einen brillanten Tristan; und im Abbey’s verkörperte Lillian Russell Die Göttin der Wahrheit. Eleonora Duse in Camille war »keine Sarah Bernhardt«, und Otis Skinner in Hamlet teilte ihre Neigung, die Tränen allzu schnell sprudeln zu lassen. Der Gefangene von Zenda im Lyceum lief schon die vierte Woche – ich hatte das Stück zweimal gesehen und überlegte kurz, ob ich es mir nicht an diesem Abend zum dritten Mal anschauen sollte. Dabei konnte man sich von den Sorgen des Alltags (von den schaurigen Bildern einer außergewöhnlichen Nacht gar nicht zu reden) so wunderbar erholen: Burgen, von Wassergräben umgeben, Schwertgefechte, ein galantes Geheimnis und betörende, häufig in Ohnmacht fallende Damen …
Doch während ich noch an das Stück dachte, überflog ich schon die Lokalnachrichten: In der Neunten Straße hatte ein Mann, der einst im Suff seinem Bruder die Kehle durchschnitten hatte, in betrunkenem Zustand diesmal seine Mutter erschossen; bei dem besonders abscheulichen Mord an dem Künstler Max Eglau im Institut für Taubstumme gab es noch immer keine Hinweise auf den Täter; ein Mann namens John Mackin, der erst seine Frau und seine Schwiegermutter umgebracht und dann versucht hatte, sich selbst zu richten, indem er sich die Kehle durchschnitt, hatte sich von der Verletzung erholt und war jetzt in den Hungerstreik getreten, doch es war den Behörden gelungen, ihn wieder zum Essen zu bringen, indem sie ihm die Zwangsernährungsmaschine zeigten – man musste ihn doch für den Henker am Leben erhalten …
Ich legte die Zeitung zur Seite. Nach einem letzten Schluck süßen schwarzen Kaffees und einem Stück Pfirsich aus Georgia beschloss ich, mich zur Vorverkaufskasse des Lyceums zu begeben, und wollte mich eben zu diesem Zweck anziehen, als das schrille Klingeln des Telefons meine Großmutter in ihrem Morgenzimmer derart erschreckte, dass sie nervös und zornig »O Gott!« schrie. Das Klingeln des Telefons hatte immer diese Wirkung auf sie, aber sie war noch nie auf die Idee gekommen, es entfernen oder wenigstens schalldämpfend umhüllen zu lassen.
Jetzt erschien Harriet aus der Küche, das weiche, ältliche Gesicht mit Seifenschaum besprenkelt. »Das Telefon, Sir«, erklärte sie und wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Dr. Kreisler ist am Apparat.«
Meinen chinesischen Morgenmantel enger um mich ziehend, schritt ich zu der kleinen Holzkiste neben der Küchentür, nahm den schweren schwarzen Hörer ab und hielt ihn ans Ohr, während ich die zweite Hand um das fest verankerte Mundstück legte. »Ja?«, sagte ich. »Sind Sie es, Laszlo?«
»Ah, Sie sind schon wach, Moore«, hörte ich ihn sagen. »Gut.« Der Ton war schwach, aber Laszlo klang so energisch wie immer. Als Kind in die Vereinigten Staaten gekommen, sprach er noch immer mit Akzent; sein deutscher Vater, ein wohlhabender Verleger, und seine ungarische Mutter hatten nach dem Aufstand im Jahr 1848 aus Europa fliehen müssen. In New York zählten sie bald zu den Glanzlichtern einer mondänen Gesellschaft politischer Immigranten. »Wann will Roosevelt uns sehen?«, fragte er, ohne den leisesten Gedanken daran, Roosevelt hätte seinen Vorschlag vielleicht ablehnen können.
»Noch vor dem Lunch!«, erwiderte ich etwas lauter, weil seine Stimme gar so leise klang.
»Warum, zum Teufel, brüllen Sie so?«, bemerkte Kreisler darauf. »Vor dem Lunch, soso. Ausgezeichnet, dann bleibt uns genug Zeit. Haben Sie schon die Zeitungen gelesen? Den Artikel über diesen Wolff?«
»Nein.«
»Dann lesen Sie ihn beim Anziehen.«
Ich blickte an mir hinunter. »Woher wussten Sie …«
»Sie haben ihn schon in Bellevue«, unterbrach Kreisler mich ungeduldig. »Ich soll ihn dort untersuchen; dabei können wir herausfinden, ob er vielleicht was mit unserer Sache zu tun hat. Dann weiter in die Mulberry Street, ein kurzer Halt im Institut, und dann Lunch bei Del – Hühnchen vielleicht, oder die Tauben-Crêpes. Ranshofers Pfeffersoße mit Trüffeln ist superb.«
»Aber …«
»Cyrus und ich fahren von mir direkt dorthin. Sie werden also eine Mietkutsche nehmen müssen. Wir werden um halb zehn erwartet – also, Moore, versuchen Sie bitte pünktlich zu sein, ja? Wir dürfen in dieser Sache keine Minute verlieren.«
Und schon hatte er eingehängt. Ich ging zurück auf die Veranda, griff nach der Times und blätterte sie noch einmal durch. Der besagte Artikel fand sich auf Seite 8:
Zwei Tage zuvor hatte Henry Wolff abends mit seinem Nachbarn Conrad Rudesheimer in dessen Mietwohnung etwas getrunken. Als Rudesheimers fünfjährige Tochter ins Zimmer kam, machte Wolff einige Bemerkungen, die Rudesheimer als nicht passend für die Ohren eines jungen Mädchens erachtete. Er machte entsprechende Einwendungen, worauf Wolff seinen Revolver zog, das Mädchen durch einen Schuss in den Kopf tötete und floh. Wenige Stunden später wurde er, ziellos herumirrend, am East River aufgegriffen. Die Zeitung sank mir aus der Hand, denn plötzlich hatte ich eine Vorahnung … so als wären die Ereignisse der vorigen Nacht auf dem Brückenturm nur ein Auftakt gewesen.
Draußen in der Diele stieß ich beinahe mit meiner Großmutter zusammen. Das Silberhaar perfekt frisiert, in ihrer grau-schwarzen Toilette elegant wie immer, maß sie mich mit einem hochmütig strafenden Blick aus ihren grauen Augen und rief so überrascht: »John!«, als beherbergte sie außer mir noch zehn weitere Männer in ihrem Haus. »Wer um alles in der Welt war denn am Telefon?«
»Dr. Kreisler, Großmutter«, antwortete ich, während ich die Treppe hinaufstürzte.
»Dr. Kreisler!«, rief sie mir entrüstet nach. »Nein, also weißt du! Für heute habe ich genug von diesem Dr. Kreisler!« Und selbst durch die schon geschlossene Tür meines Schlafzimmers konnte ich sie noch hören: »Wenn du mich fragst – dein Dr. Kreisler ist wirklich sehr, sehr merkwürdig! Und mit seinem Doktortitel kann er mir auch nicht imponieren. Dieser Holmes war schließlich auch ein Herr Doktor!« Und so ging es weiter, während ich mich wusch, rasierte und mir die Zähne mit Sozodont schrubbte. So war sie eben; und wenn es für einen Mann wie mich, der gerade eben das, was er für seine einzige Hoffnung auf häusliches Glück hielt, verloren hatte, auch etwas anstrengend war, so schien es doch immerhin noch besser als eine einsame Wohnung in einem Haus voller Männer, die sich mit dem Junggesellenleben abgefunden hatten.
Ausgestattet mit einer grauen Kappe und einem schwarzen Schirm, steuerte ich wenig später eiligen Schrittes in Richtung Sechste Avenue. Der Regen prasselte jetzt schon ganz ordentlich, dazu war ein steifer Wind aufgekommen. Als ich die Avenue erreichte, drehte der Sturm plötzlich und blies jetzt unter dem Gleiskörper der New York Elevated Railroad Line hindurch, die sich zu beiden Seiten der Straße über den Gehsteigen erhob. Ein Windstoß stülpte nicht nur meinen Schirm um, sondern auch die mehrerer anderer Menschen in der Masse, die sich unter der Hochbahn dahinschob. Die Verbindung von Regen, Kälte und heftigem Wind ließ die auch sonst schon wilde Hauptverkehrszeit heute wie ein Pandämonium erscheinen. Mit meinem nutzlosen Schirm kämpfend, steuerte ich auf eine Droschke zu, wobei mir im letzten Augenblick ein junges Paar zuvorkam, das mich recht unsanft zur Seite schob und dann eilends in die Mietkutsche kletterte. Gereizt verwünschte ich mit lauter Stimme ihre gesamte Nachkommenschaft und schüttelte meinen umgestülpten Schirm gegen sie, worauf die Frau vor Schreck laut aufkreischte und der Mann mit einem ängstlichen Blick auf mich konstatierte, ich müsse verrückt sein – was mich angesichts meines Zieles wiederum nicht wenig amüsierte und das feuchte Warten auf eine andere Droschke erträglicher machte. Als endlich eine weitere Kutsche um die Ecke des Washington Place bog, wartete ich gar nicht, bis sie stehen blieb, sondern sprang einfach auf, schloss die halbhohe Tür und schrie dem Kutscher zu, er möge mich zum Irrenpavillon in Bellevue fahren – gewiss kein alltägliches Ziel für den Cabbie. Der Ausdruck ängstlicher Verblüffung auf seinem Gesicht entschädigte mich für die Unbilden des Wetters, sodass ich an der Vierzehnten Straße nicht einmal mehr den an meinen Beinen klebenden nassen Tweed spürte.
Mit der für einen New Yorker Cabbie typischen Halsstarrigkeit beschloss mein Kutscher – den Kragen seines Regenmantels hochgeschlagen, den Zylinder mit einem dünnen Gummiüberzug geschützt –, sich seinen Weg die Sechste Avenue hinunter durchs dichteste Einkaufsgewühl zu erzwingen, bevor er sich hinter der Vierzehnten Straße ostwärts hielt. Als wir uns an fast allen großen Kaufhäusern – O’Neill, Adams & Company, Simpson-Crawford – entlangmanövriert hatten, klopfte ich mit der Faust gegen die Trennwand und versicherte meinem Fahrer, dass ich wirklich nach Bellevue wollte, und zwar noch heute. Darauf riss er das Gefährt brutal herum, wir bogen nach rechts in die Dreiundzwanzigste und ratterten dann über die vollkommen ungeregelte Kreuzung dieser Straße mit der Fifth Avenue und dem Broadway. Am Fifth Avenue Hotel vorbei, wo Boss Platt sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte und wahrscheinlich in diesen Minuten dem Plan für Groß-New-York die letzten Glanzlichter aufsetzte, bewegten wir uns längs der östlichen Ausläufer des Madison Square Park, zweigten ab in die Sechsundzwanzigste, änderten dann vor den italienischen Arkaden und Türmen des Madison Square Garden die Richtung und wandten uns wieder nach Osten. Endlich erschien das rechteckige rote Ziegelgebäude von Bellevue am Horizont, und schon wenige Minuten später hielten wir hinter einem großen schwarzen Rettungswagen unweit des Eingangs zur Irrenanstalt. Ich bezahlte den Kutscher und ging hinein.
Der Pavillon war ein einfaches rechteckiges Gebäude. Ein kleiner, mäßig einladender Vorraum nahm Besucher und Insassen auf. Durch eiserne Gittertüren fiel der Blick auf einen breiten Gang, der das Gebäude in zwei Hälften teilte. Vierundzwanzig »Zimmer« – eigentlich waren es Zellen – zeigten auf diesen Gang; genau auf halbem Weg trennten zwei schwere eiserne Schiebetüren diese Zellen in zwei Abteilungen: eine für Männer, die andere für Frauen. Hier in diesem Pavillon wurden vor allem Gewaltverbrecher untergebracht, zum Zweck der Beobachtung und Diagnose. Sobald über ihre Zurechnungsfähigkeit entschieden war und man die offiziellen Berichte verschickt hatte, brachte man die hier Internierten in andere, noch weniger einladende Institutionen.
Kaum hatte ich den Vorraum betreten, drang auch schon das übliche Schreien und Heulen an mein Ohr – darunter durchaus vernünftig klingende Protestrufe, aber auch das Toben und Zähneknirschen von Wahnsinn und Verzweiflung. Im selben Moment erblickte ich Kreisler; eigenartig, wie stark ich seinen Anblick schon immer mit solchen Geräuschen assoziiert hatte. Ganz in Schwarz gekleidet, war er, wie so oft, in die Musikrezensionen der Times versunken. Seine schwarzen Augen, die an die eines großen Vogels erinnerten, flogen über das Papier, immer hin und her, gleichzeitig trat er mit abrupten, schnellen Bewegungen von einem Fuß auf den anderen. Die Zeitung hielt er in der rechten Hand; der linke Arm, als Folge eines Unfalls in der Kindheit leicht verkrüppelt, war an den Körper gepresst. Ab und an hob er die linke Hand, um sich über den sorgfältig gepflegten Schnurrbart und das kleine Bärtchen unter der Unterlippe zu streichen. Sein dunkles, glatt zurückgekämmtes Haar, das er im Verhältnis zur damals vorherrschenden Mode viel zu lang trug, war feucht – er mochte keine Hüte. Das alles, zusammen mit der nickenden Bewegung seines Kopfes hin zur Zeitung, verstärkte die Vorstellung von einem hungrigen, unruhigen Falken, der diesem Jammertal ein Stückchen Lebensfreude abzutrotzen gedachte.
Neben Kreisler ragte der hünenhafte Cyrus Montrose auf, Laszlos persönlicher Diener, Kutscher, gefürchteter Leibwächter und Alter Ego. Wie die meisten von Kreislers Hausangestellten war auch Cyrus ein ehemaliger Patient, und zwar einer, der mich trotz seines tadellosen Auftretens und Aussehens immer etwas beunruhigte. Heute Morgen trug er graue Hosen und ein knapp sitzendes, kurzes braunes Jackett. Seinen breiten dunklen Gesichtszügen sah man nicht an, dass er mich bemerkt hatte, doch als ich näher trat, klopfte er Kreisler leicht am Arm und deutete auf mich.
»Ah, Moore!«, sagte Kreisler, nahm mit der Linken eine Uhr aus seiner Westentasche und streckte mir lächelnd die Rechte entgegen. »Sehr schön.«
»Guten Morgen, Laszlo«, erwiderte ich und schüttelte seine Hand. »Morgen, Cyrus«, fügte ich mit kurzem Nicken hinzu.
Nach einem Blick auf seine Uhr deutete Kreisler auf die Zeitung. »Ich finde das Verhalten Ihrer Redaktion unbegreiflich, Moore«, erklärte er. »Gestern Abend sah ich eine brillante Vorstellung des Bajazzo, mit Melba und Ancona, aber die Times findet nur Alvarys Tristan erwähnenswert.« Er blickte hoch und schaute mich an. »Sie sehen müde aus, John.«
»Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Was wäre wohl erholsamer, als mitten in der Nacht in einer offenen Droschke quer durch die Stadt zu irren! Würden Sie mir vielleicht verraten, was ich hier soll?«
»Einen Moment.« Kreisler wandte sich an einen Wärter in dunkelblauer Uniform und Mütze, der auf einem spartanischen Holzstuhl saß. »Fuller? Wir sind so weit.«
»Sehr wohl, Herr Doktor«, antwortete der Mann, nestelte einen gewaltigen Schlüsselring von seinem Gürtel und schritt auf den Eingang des Zellentraktes zu. Kreisler und ich folgten ihm, während Cyrus reglos zurückblieb, gleich einer schwarzen Wachsfigur.
»Sie haben also den Artikel gelesen, Moore?«, fragte Kreisler, während der Wärter das Gittertor zur ersten Abteilung aufschloss. Das Brüllen und Heulen aus den Zellen wurde plötzlich fast unerträglich laut. In dem fensterlosen Gang gab es nur das spärliche Licht weniger elektrischer Glühbirnen. Die kleinen Observierluken in den wuchtigen Eisentüren der einzelnen Zellen standen hier und da offen.
»Ja«, antwortete ich gequält. »Ich habe ihn gelesen. Und ich kann mir auch eine mögliche Verbindung denken – aber wozu brauchen Sie gerade mich?«
Bevor Kreisler antworten konnte, erschien im Fenster der ersten Tür zu unserer Rechten ein weibliches Gesicht. Die Frau hatte hochgestecktes, aber völlig unfrisiertes Haar, in ihrem breiten, verhärmten Gesicht malte sich ein Ausdruck höchster Empörung, der jedoch im Nu verschwand, als sie erkannte, wer der Besucher war. »Dr. Kreisler!«, stieß sie heiser und leidenschaftlich hervor.
Kreislers Name pflanzte sich den Gang entlang fort, von Zelle zu Zelle, Insasse zu Insasse, durch die Wände und Eisentüren der weiblichen Abteilung hinüber in den Trakt der Männer. Ich hatte das schon mehrmals miterlebt, auch in anderen Anstalten, doch es war jedes Mal wieder verblüffend: Die Worte wirkten wie Wasser auf glühende Kohlen, sie schluckten die knisternde Hitze und verwandelten sie in dampfendes Geflüster – eine vielleicht nur kurz andauernde, aber nichtsdestoweniger wirkungsvolle Erlösung aus dem sengenden Feuer.
Dieses erstaunliche Phänomen hatte einen einfachen Grund. Kreisler war in ganz New York – und nicht nur in der Welt der Patienten, sondern auch in der der Verbrecher, Mediziner und Juristen – bekannt als jener Mann, dessen Aussage vor Gericht darüber entschied, ob jemand ins Gefängnis geworfen, in eine – mit immerhin geringeren Schrecken verbundene – Anstalt für Geisteskranke gebracht oder aber auf freien Fuß gesetzt wurde. Kaum sichtete man ihn also an einem Ort wie jenem Pavillon, unterdrückten die meisten der Insassen die üblichen Wahnsinnslaute und versuchten sich halbwegs vernünftig und zusammenhängend zu äußern. Nur die Neuen, noch nicht Eingeweihten, oder aber die wirklich hoffnungslos Verwirrten ließen von ihrem Gebrüll nicht ab. Dabei war dieses plötzliche Leiserwerden alles andere als beruhigend; es wirkte eigentlich noch unheimlicher, denn man wusste ja, dass die Anstrengung dahinter eine ganz ungeheure war und dass der Wellenschlag der Angst bald zurückkehren würde – wie bei glühenden Kohlen eben, die nach vorübergehender Abkühlung durch einen Spritzer Wasser weiterglühten wie zuvor.