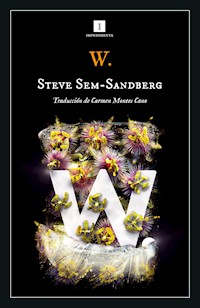12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
"Die Elenden von Lódz" ist ein einzig artiger Roman mit vielen Stimmen. Er porträtiert neben der zentralen Figur Rumkowskis das Leben zahlreicher Gettobewohner und gibt ihnen so einen Namen und ein Schicksal. "Wie ein Historiker beschwört Steve Sem-Sandberg die Vergangenheit herauf, wie ein Romancier erhöht er Geschichte ins Allgemeingültige – ein dokumentarischer Roman, der auf grandiose Weise die Stärken dieses Genres aufzeigt." Ilija Trojanow Steve Sem-Sandberg wurde für die "Die Elenden von Lódz" mit dem schwedischen "August-Priset" ausgezeichnet , der dem Deutschen Buchpreis entspricht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 889
Ähnliche
Steve Sem-Sandberg
Die Elenden von Łódź
Roman
Aus dem Schwedischen von Gisela Kosubek
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
Die Orginalausgabe erschien 2009 im Albert Bonniers Förlag, Stockholm
© 2009 by Steve Sem-Sandberg
Für die deutsche Ausgabe
© 2011 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
gegr. 1659; Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Foto: © Jüdisches Museum Frankfurt am Main / Foto Walter Genewein
Datenkonvertierung: Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, StuttgartPrintausgabe: ISBN 978–3-608–93897–5
E-Book: ISBN 978-3-608-10211-6
|5|Rundschreiben
Lodsch, am 10. Dezember 1939
Geheim!
Streng vertraulich!
Bildung eines Gettos in der Stadt Lodsch
In der Großstadt Lodsch leben m. E. heute ca. 320000 Juden. Ihre sofortige Evakuierung ist nicht möglich. Eingehende Untersuchungen aller in Frage kommenden Dienststellen haben ergeben, dass eine Zusammenfassung sämtlicher Juden in einem geschlossenen Getto nicht möglich ist. Die Judenfrage in der Stadt Lodsch muss vorläufig in folgender Weise gelöst werden:
1. Die nördlich der Linie Listopada/Novemberstraße, Freiheitsplatz, Pomorska/ Pommerschestraße wohnenden Juden sind in einem geschlossenen Getto dergestalt unterzubringen, dass einmal der für die Bildung eines deutschen Kraftzentrums um den Freiheitsplatz benötigte Raum von Juden gesäubert wird, und zum anderen, dass der fast ausschließlich von Juden bewohnte nördliche Stadtteil in dieses Getto einbezogen wird.
2. Die im übrigen Teil der Stadt Lodsch wohnenden arbeitsfähigen Juden sind zu Arbeitsabteilungen zusammenzufassen und in Kasernenblocks unterzubringen und zu bewachen.
Die Vorarbeiten und Durchführung dieses Planes soll ein Arbeitsstab ausführen, in den folgende Behörden bzw. Dienststellen Vertreter entsenden:
1. N.S.D.A.P.
2. Außenstelle Lodsch des Regierungspräsidenten zu Kalisch
3. Stadtverwaltung der Stadt Lodsch (Wohnungsamt, Bauamt, Gesundheitsamt, Ernährungsamt usw.)
|6|4. Ordnungspolizei
5. Sicherheitspolizei
6. Totenkopfverband
7. Industrie- und Handelskammer
8. Finanzamt
Weiterhin sind folgende Vorarbeiten zu leisten:
1. Festlegung der Abriegelungseinrichtungen (Anlage von Straßensperrungen, Verbarrikadierungen von Häuserfronten und Ausgängen usw.).
2. Festlegung der Bewachungsmaßnahmen der Umgrenzungslinie des Gettos.
3. Beschaffung der erforderlichen Materialien für die Abriegelung des Gettos durch die Stadtverwaltung Lodsch.
4. Treffen von Vorkehrungen, dass die gesundheitliche Betreuung der Juden innerhalb des Gettos durch Überweisung von Arzneimitteln und ärztlichen Instrumenten (aus jüdischen Beständen), insbesondere von dem Standpunkt der Seuchenbekämpfung aus, gewährleistet ist.
5. Vorbereitungen für die spätere Regelung der Fäkalienabfuhr aus dem Getto und Regelung des Abtransportes von Leichen zum jüdischen Friedhof, bzw. Errichtung eines Friedhofes innerhalb des Gettos.
6. Sicherstellung der im Getto benötigten Mengen von Heizmaterial.
Nach Erledigung dieser Vorarbeiten und nach Bereitstellung der genügenden Bewachungskräfte soll an einem von mir zu bestimmenden Tag schlagartig die Errichtung des Gettos erfolgen, das heißt, zu einer bestimmten Stunde wird die festgelegte Umgrenzungslinie des Gettos durch die hierfür vorgesehenen Bewachungsmannschaften besetzt und die Straßen durch spanische Reiter und sonstige Absperrungsvorrichtungen geschlossen. Gleichzeitig wird mit der Zumauerung bzw. anderweitigen Sperrung der Häuserfronten durch jüdische Arbeitskräfte, die aus dem Getto zu nehmen sind, begonnen. Im Getto selbst wird sofort eine jüdische Selbstverwaltung eingesetzt, die aus dem Judenältesten und einem stark erweiterten Gemeindevorstand [kehilla] besteht.
Durch das Ernährungsamt der Stadt Lodsch werden die erforderlichen Lebensmittel und Brennstoffe an zu bestimmenden Punkten des Gettos angefahren und den Beauftragten der jüdischen Selbstverwaltung zur Verwertung übergeben. Grundsatz muss dabei sein, dass Lebensmittel und Brennstoffe nur durch Tauschware wie Textilien usw. bezahlt werden dürfen. Es muss auf diese |7|Weise gelingen, dass wir die von den Juden gehamsterten und versteckten Sachwerte restlos herausholen.
Bei der Abkämmung der übrigen Stadtteile nach arbeitsunfähigen Juden, die gleichzeitig bzw. kurz nach Erstellung des Gettos in das Getto abgeschoben werden, sind auch die dort wohnenden arbeitsfähigen Juden sicherzustellen. Sie sollen zu Arbeitsabteilungen zusammengefasst und in vorher durch die Stadtverwaltung und die Sicherheitspolizei festgelegten Kasernenblocks untergebracht und dort bewacht werden.
Aus Vorstehendem ergibt sich, dass zum Arbeitseinsatz zunächst die Juden genommen werden, die außerhalb des Gettos ihren Wohnsitz haben. Die in den Arbeitskasernen arbeitsunfähigen oder krank werdenden Juden sind in das Getto zu überweisen. Die im Getto wohnenden noch arbeitsfähigen Juden sollen die innerhalb des Gettos anfallenden Arbeiten erledigen. Ich werde später bestimmen, ob arbeitsfähige Juden aus dem Getto herausgeholt und in die Arbeitskasernen gebracht werden sollen.
Die Erstellung des Gettos ist selbstverständlich nur eine Übergangsmaßnahme. Zu welchen Zeitpunkten und mit welchen Mitteln das Getto und damit die Stadt Lodsch von Juden gesäubert wird, behalte ich mir vor. Endziel muss jedenfalls sein, dass wir diese Pestbeule restlos ausbrennen.
gez. Uebelhoer
|9|Prolog
Der Judenälteste allein
(1. – 4. September 1942)
|11|Alles, was dir vor Handen kommt zu tun, das tue frisch;
denn bei den Toten, dahin du fährst, ist weder
Werk, Kunst, Vernunft noch Weisheit.
Prediger 9,10
|13|Es war der Tag, für ewig ist er dem Gettogedächtnis eingegraben, als der Judenälteste der Menge mitteilen ließ, ihm bliebe keine andere Wahl, als die Kinder und Alten des Gettos gehen zu lassen. Noch am Nachmittag vor dieser Bekanntgabe hatte er in seinem Büro am Bałucki Rynek gesessen und auf das Eingreifen höherer Mächte gewartet, gehofft, dass sie ihn retten mögen. Zu jenem Zeitpunkt hatte er sich bereits gezwungen gesehen, die Kranken des Gettos herzugeben. Nun standen nur noch die Alten und Kinder aus. Herr Neftalin, auf dessen Anordnung die Kommission ein paar Stunden zuvor erneut zusammengetreten war, hatte ihm versichert, dass alle Listen bis spätestens Mitternacht aufgestellt und der Gestapo übergeben sein mussten. Wie sollte er ihnen nur erklären, welch ungeheuerlichen Verlust das für ihn persönlich darstellte? Sechsundsechzig Jahre lebe ich nun schon und bin des Glücks, mich Vater nennen zu können, noch immer nicht teilhaftig geworden, und jetzt verlangen die Behörden von mir, dass ich all meine Kinder opfere.
Hatte auch nur einer daran gedacht, wie es ihm in diesem Augenblick erging?
(»Was soll ich ihnen sagen?«, hatte er Doktor Miller gefragt, als die Kommission am Nachmittag zusammengetreten war, und Doktor Miller hatte sein zerquältes Gesicht über den Tisch geschoben, und auch der seitlich von ihm sitzende Richter Jakobson hatte ihm tief in die Augen geblickt, und beide hatten übereinstimmend erklärt:
Sag ihnen die Wahrheit. Wenn nichts anderes möglich ist, musst du ihnen die Wahrheit sagen.
Aber wie kann es eine Wahrheit geben, wenn es kein Gesetz gibt, und wie kann es ein Gesetz geben, wenn es die Welt nicht mehr gibt?)
Den Widerhall der Stimmen der sterbenden Kinder im Kopf, griff der Älteste nach dem Jackett, das Fräulein Fuchs für ihn am Haken an |14|der Barackenwand aufgehängt hatte, führte den Schlüssel zittrig ins Schloss und bekam die Tür mit knapper Not auf, bevor ihn die Stimmen erneut überfielen. Doch vor der Tür seines Büros wartete kein Gesetz, auch keine Welt; nur jene, die von seinem persönlichen Stab noch übrig waren, ein halbes Dutzend übernächtigter Büroangestellter mit dem unermüdlichen Fräulein Fuchs an der Spitze, an diesem Tag ebenso proper wie stets gekleidet, in frischgebügelter, blau-weiß gestreifter Bluse, die Haare zum Knoten hochgenommen.
Er sagte:
Wenn der Herr die Absicht gehabt hätte, diese seine letzte Stadt untergehen zu lassen, hätte er es mich wissen lassen. Oder mir zumindest ein Zeichen gegeben.
Sein Stab aber starrte ihn nur verständnislos an:
Herr Präses, sagten sie, wir sind bereits eine Stunde verspätet.
*
Die Sonne war, wie stets im Monat Elul, eine Sonne, die dem Anbrechen des Jüngsten Gerichts glich, eine Sonne, die die Haut wie mit tausend Nadeln durchbohrte. Der Himmel war schwer wie Blei, nicht der geringste Windhauch herrschte. Eine Menge von fünfzehnhundert Menschen hatte sich auf dem Feuerwehrplatz versammelt. Der Judenälteste hielt seine Reden häufig hier. Dann waren die Leute stets aus Neugier gekommen. Sie waren gekommen, um den Präses über seine Zukunftspläne reden zu hören, über die bevorstehenden Lebensmittellieferungen und die zu erwartende Arbeit. Diejenigen, die heute gekommen waren, hatten sich nicht aus Neugier versammelt. Neugier hätte kaum genügt, die Leute dazu zu bringen, die Warteschlangen vor Kartoffeldepots und Verteilungsstellen zu verlassen und den langen Weg zum Feuerwehrplatz zurückzulegen. Keiner war gekommen, um Neuigkeiten zu erfahren, sie waren gekommen, um das Urteil zu hören, das über sie verhängt werden sollte – ein Urteil auf lebenslänglich oder, Gott verhüte, ein Todesurteil. |15|Väter und Mütter waren gekommen, um zu hören, welches Urteil über ihre Kinder gefällt würde. Greise und Greisinnen boten ihre letzten Kräfte auf, um zu hören, was das Schicksal für sie bereithielt. Der größte Teil der hier Versammelten bestand aus alten Menschen – gestützt auf dünne Stöcke oder auf die Arme ihrer Kinder. Oder aus jungen Menschen mit ihren Kindern, die sie fest an der Hand hielten. Oder aus den Kindern selbst.
Mit gesenkten Köpfen, die Gesichter von Sorge entstellt, mit verquollenen Augen und vor Weinen wie erstickt, glichen all diese Menschen – alle fünfzehnhundert hier auf dem Platz Versammelten – einer Stadt, einem Gemeinwesen in seinem letzten Stündlein; unter der Sonne ihren Ältesten und ihren Untergang erwartend.
Józef Zelkowicz: In jejne koschmarne teg
(In jenen schrecklichen Tagen, 1944)
*
An diesem Nachmittag war das Getto vollständig auf den Beinen.
Obwohl die Leibwächter den größten Teil des Mobs auf Abstand halten konnten, war es ein paar grinsenden Flegeln gelungen, den Wagen zu entern. Er hatte sich ans Verdeck zurückgelehnt, nicht fähig, wie sonst mit dem Stock nach ihnen zu schlagen. Es war, wie böswillige Zungen schon seit längerem hinter seinem Rücken raunten: Mit ihm war es vorbei, seine Zeit als Getto-Präses war zu Ende. Im Nachhinein würden sie von ihm sagen, er sei ein falscher schofet gewesen, der die falschen Beschlüsse gefasst habe, ein eved hagermanim, der keinesfalls für das Beste seines Volkes gesorgt, sondern allein die eigene Macht und den eigenen Vorteil im Auge gehabt habe.
Dennoch war es ihm nie um etwas anderes als das Beste des Gettos gegangen.
Herr, wie kannst du mir das nur antun?, dachte er.
Bei seiner Ankunft am Feuerwehrplatz warteten die Menschen bereits dichtgedrängt unter der glutheißen Sonne. Sie mussten seit Stunden hier gestanden haben. Sobald sie die Leibwächter erblickten, warfen sie |16|sich wie eine Meute wildwütiger Tiere auf ihn. Im Vordergrund bildeten Polizisten eine Kette, hieben und prügelten mit Schlagstöcken auf die Menschenmassen ein, um sie zurückzutreiben. Doch genügte das nur schwerlich. Grinsende Gesichter blickten den Polizisten noch immer über die Schultern.
Es war festgelegt, Warszawski und Jakobson als Erste reden zu lassen, während er selbst noch im Schatten des Podiums warten sollte, um den Schmerz über die harten Worte, die er ihnen würde mitteilen müssen, tunlichst zu lindern. Doch wenn es dann erst Zeit für ihn war, die provisorische, eigens errichtete Rednertribüne zu besteigen, gab es keinen Schatten mehr und auch kein Podium: nur einen simplen Stuhl auf einem wackeligen Tisch. Auf diesem schwankenden Grund würde er dann stehen müssen, während die widerwärtige schwarze Masse ihn aus der Schattentiefe des Platzes begaffte und verhöhnte. Er fühlte Entsetzen vor diesem wabernden Dunkelkörper, ein Entsetzen, das nichts von alledem glich, was er je zuvor empfunden hatte. Genauso, das wurde ihm nun klar, mussten es auch die Propheten empfunden haben, als sie vor ihr Volk traten; Hesekiel, der aus dem belagerten Jerusalem, der Blutstadt, über die Notwendigkeit sprach, den Ort von allem Übel und allem Unrat zu reinigen und jenen ein Zeichen auf die Stirn zu drücken, die sich noch immer zum rechten Glauben bekannten.
Dann sprach Warszawski:
Gestern erhielt der Präses die Order, mehr als zwanzigtausend Menschen zu evakuieren … darunter unsere Kinder und unsere Allerältesten.
Wie seltsam sich doch die Schicksalswinde drehen. Wir alle kennen unseren Präses!
Wir wissen, wie viele Jahre seines Lebens, wie viel seiner Kraft, seiner Arbeit und Gesundheit er der Erziehung und dem Gedeihen jüdischer Kinder gewidmet hat.
Und nun verlangt man ausgerechnet das von ihm, von IHM unter allen Menschen …
*
|17|Oft hatte er sich vorgestellt, dass es möglich wäre, ein Gespräch mit den Toten zu führen. Nur jene, die bereits dem Eingesperrtsein entkommen waren, konnten sagen, ob er recht gehandelt hatte oder unrecht, als er diejenigen gehen ließ, für die es dennoch kein anderes Leben gegeben hätte.
In der ersten schweren Zeit – als die Behörden soeben mit den Deportationen begonnen hatten – ließ er stets den Wagen vorfahren, um die Begräbnisstätte in Marysin zu besuchen.
Endlose Tage Anfang Januar oder im Februar, als die Ebene um Łódź, die gewaltigen Kartoffel- und Rübenäcker, in feuchtkalte bleiche Nebelschleier gehüllt lag. Nach einer Ewigkeit war dann der Schnee geschmolzen und der Frühling ins Land gezogen, die Sonne stand so tief überm Horizont, dass die Gegend wie in Bronze gegossen schien. Jedes Detail trat im Gegenlicht hervor: die strengen Raster der Bäume vor den ockerbraunen Feldern, hier und da ein scharfer violetter Spritzer, ein Teich oder ein Bachbett, verborgen hinter der Wölbung des Flachlands.
An solchen Tagen saß er zusammengekrümmt, reglos weit hinten im Wagen; vor ihm Kuper, dessen Rücken denselben Bogen beschrieb wie die Pferdepeitsche auf seinem Schoß.
Jenseits der Absperrung stand einer der deutschen Wachtposten in feldgrauer Uniform stocksteif da oder ging rastlos vor seinem Schilderhäuschen auf und ab. An manchen Tagen blies ein kräftiger Wind über die offenen Felder und Wiesen. Der Wind riss Sand und lockeren Ackerboden mit sich, wehte auch Papierfetzen über Zaun und Mauern herein; und der wirbelnden Erde folgte stechender Sulfitgeruch von den Fabriken im Inneren von Litzmannstadt, wie auch das Gegacker des Federviehs und das Brüllen der Rinder von den polnischen Bauernhöfen im Umkreis. Dann ließ sich deutlich erkennen, wie willkürlich die Absperrung verlief. Der Wachtposten stand machtlos, stemmte sich gegen den hartnäckigen Wind, sinnlos klatschte ihm der Uniformmantel um Arme und Beine.
Der Älteste aber saß weiter still und unbeweglich auf seinem Platz, während Sand und Erde um ihn stiebten. Ob ihn all das, was er sah und hörte, kümmerte, zeigte er nicht.
|18|Józef Feldman hieß ein Mann, der als Totengräber zu Baruch Praszkiers Friedhofskolonne gehörte. Sieben Tage die Woche, auch am Sabbat, da die Behörden es so befahlen, grub er Gräber für die Toten. Die Gräber, die er grub, waren nicht groß: sieben Dezimeter in die Tiefe und einen halben Meter breit. Tief genug, um einem Körper Platz zu bieten. Bedenkt man indes, dass es im Jahr zwei-, vielleicht dreitausend Gräber betraf, wird klar, um welch harte Arbeit es ging. Meist peitschten Wind und Sand den Männern ins Gesicht.
Im Winter ließ es sich nicht graben. Die Gräber für den Winter mussten im Sommerhalbjahr ausgehoben werden, und Feldman und die anderen der Friedhofskolonne arbeiteten in diesen Monaten am intensivsten. Im Winterhalbjahr zog er sich in sein »Büro« zurück und ruhte.
Vor dem Krieg hatte Józef Feldman eine kleine Gärtnerei in Marysin besessen. In zwei Gewächshäusern hatte er Tomaten- und Gurkenpflanzen gezogen, auch Gemüse: Chinakohl und Spinat; Zwiebeln hatte er gleichfalls verkauft und Samentütchen für die Frühjahrssaat. Nun standen die Gewächshäuser mit eingeschlagenen Scheiben leer und verlassen da. Józef Feldman selbst überwinterte in einem einfachen Blockhaus, gleich im Anschluss an eins der Gewächshäuser, das früher sein Büro gewesen war. Zuhinterst an der Wand stand eine niedrige Holzpritsche. Hier gab es auch einen Holzfeuerherd mit dem Abzug direkt durchs Fenster und eine kleine Kochplatte, die mit Propangas betrieben wurde.
Offiziell waren alle Grundstücke und alle alten Marysiner Gartenparzellen im Besitz des Judenältesten des Gettos, der sie ganz nach Belieben verpachtete. Das galt auch für ehemals gemeinsamen Landbesitz wie die Hachscharot der Zionisten, einundzwanzig umzäunte Parzellen mit langen Reihen sorgfältig beschnittener Obstbäume, wo die Pioniere des Gettos früher Tag und Nacht gearbeitet hatten; wie Borochovs Kibbuz, den verfallenen Hof des Haschomer-Kollektivs auf der PrÓżna, wo man Gemüse gezüchtet hatte, und die Jugendkooperative Chazit Dor Bnej Midbar. Galt im selben Maße für die großen offenen Flächen hinter den alten verfallenen Geräteschuppen, die unter dem Namen Praszkiers Werkstatt liefen, auf denen die wenigen, dem Getto verbliebenen Milchkühe weideten. All das gehörte dem Judenältesten.
|19|Doch aus irgendeinem Grund hatte Feldman das seine behalten dürfen. Den Ältesten und ihn sah man oft zusammen in Feldmans Büro sitzen. Den Großen und den Kleinen. (Józef Feldman war klein von Wuchs. Es hieß, er reiche kaum über den Rand der Gräber, die er aushob.) Bei diesen Gelegenheiten erzählte ihm der Älteste von seinen Plänen, das Gelände um Feldmans Gärtnerei in ein einziges gigantisches Rübenfeld zu verwandeln und an der Böschung zur Straße Obstbäume zu pflanzen.
Oft hörte man vom Judenältesten sagen, im Grunde zöge er die Gesellschaft einfacher normaler Leute der von Rabbinern und Getto-Ratsmitgliedern vor. Fühle sich mehr zu Hause unter den Chassidim im Lehrhaus an der Lutomierska oder unter den ungeschulten, indes tiefgläubigen orthodoxen Juden, die sich, solange es erlaubt war, zu dem großen, an der Bracka gelegenen Begräbnisplatz begaben. Dort hockten sie stundenlang zwischen den Gräbern, den Gebetsschal über dem Kopf und die abgegriffenen Gebetbücher vor dem Gesicht. Alle hatten, wie er selbst, etwas verloren – eine Ehefrau, ein Kind, einen reichen wohlhabenden Verwandten, der sie nun im Alter hätte mit Essen und Obdach versorgen können. Es war dasselbe ewige schokeln, dasselbe Wehklagen wie zu allen Zeiten:
Warum wurde das Geschenk des Lebens Jenem gegeben,
der bitter geplagt;
Jenem, der den Tod erwartet, ohne dass der Tod auch naht;
Jenem, dem allein es brächte Freude, fände er sein Grab;
Jenem, dessen Weg gehüllt ist in Finsternis:
bedrängt, umstellt von Gott?
Von den Jüngeren waren weniger erhabene Töne zu hören:
– Hätte uns Mojsche nicht aus Mizrajim fortgeführt, könnten wir nun alle im Café in Kairo sitzen, statt hier eingesperrt zu sein.
– Mojsche wusste, was er tat. Hätten wir Mizrajim nicht verlassen, wären wir nicht mit der Tora gesegnet worden.
– Und was hat uns unsere Tora gebracht?
|20|– Im ejn Torah, ejn kemach, steht geschrieben; ohne Tora, kein Brot.
– Ich bin vollkommen überzeugt, auch wenn wir die Tora hier gehabt hätten, hätten wir kein Brot.
Der Älteste bezahlte Feldman, damit er ihm den Winter über die Sommerresidenz in der Karola Miarki instand hielt. Von den leitenden Mitgliedern des Ältestenrates verfügte beinahe jeder neben einer Stadtwohnung im Getto auch über einen »Sommersitz« in Marysin, und es hieß, manche würden sich nie von dort wegbegeben, wie die Schwägerin des Ältesten, Prinzessin Helena, von der man sagte, sie würde ihre Sommerresidenz lediglich verlassen, wenn im Kulturhaus ein Konzert gegeben wurde oder einer der reichen Unternehmer für die schpizn des Gettos ein Diner veranstaltete; bei diesen Gelegenheiten fand sie sich hingegen jedes Mal ein, auf dem Kopf einen ihrer zahlreichen eleganten Hüte mit ausladender, aufwärtsgebogener Krempe und ein Vogelbauer aus Hanfseil bei sich, in dem ein paar ihrer Lieblingsfinken zwitscherten. Prinzessin Helena sammelte Vögel. Im Garten vor ihrem Marysiner Haus hatte sie ihren persönlichen Sekretär, den in vielen Dingen bewanderten Herrn Tausendgeld, eine große Voliere errichten lassen, die nicht weniger als fünfhundert verschiedene Arten beherbergte, viele von ihnen so rar, dass sie in diesen Breiten nie zuvor gesichtet worden waren, und schon gar nicht im Getto, wo man selten andere Vögel als Krähen erblickte.
Der Älteste selbst vermied alle Exzesse. Auch seine Feinde konnten bezeugen, dass sein Lebensstil maßvoll war. Zigaretten konsumierte er indes in großen Mengen, und wenn er spätabends bei der Arbeit in seinem Barackenbüro am Bałucki Rynek saß, kam es nicht selten vor, dass er sich mit einem oder ein paar Gläschen Wodka stärkte.
Dann konnte es geschehen, auch mitten im Winter, dass Fräulein Dora Fuchs vom Sekretariat anrief und mitteilte, dass der Präses auf dem Weg war, und Feldman musste nach seinen Kohleneimern greifen und den ganzen Weg zur Karola Miarki hinaufmarschieren, um den Ofen anzuheizen, und wenn der Älteste dann eintraf, war er unsicher auf den Beinen und fluchte, weil es im Haus noch immer feuchtkalt war, und Feldman fiel es zu, den Alten zum Bett zu führen. Wie nur wenige |21|andere war Feldman vertraut mit den Stimmungsschwankungen des Ältesten, kannte die Ozeane von Hass und Missgunst, die unter seinem stummen Blick und seinem sarkastischen tabakbraunen Lächeln ruhten. Feldman kümmerte sich auch um die Wartung des Grünen Hauses an der Ecke Zagajnikowa, Okopowa. Das Grüne Haus war das kleinste und entferntest gelegene der insgesamt sechs Heime für elternlose Kinder, die der Älteste in Marysin hatte einrichten lassen, und es kam häufig vor, dass Feldman ihn hier fand, gegenüber der Einfriedung, die den Spielplatz auf dem Hof umgab, zusammengesunken in Kupers Wagen sitzend.
Es war offenkundig, dass der Alte beim Anblick der spielenden Kinder Ruhe fand.
Kinder und Tote. Ihr Gesichtsfeld war begrenzt. Sie nahmen nur Stellung zu Dingen, die sie unmittelbar vor Augen hatten. Ließen sich nicht von all den Ränkespielen der Lebenden täuschen.
Er und Feldman sprachen vom Krieg. Über das mächtige deutsche Heer, das seine Expansion an allen Fronten weiterzuführen schien, und über die verfolgten Juden Europas, die sich dareinfinden mussten, zu Füßen dieses gewaltigen Amalek zu leben. Und der Älteste bekannte, dass er einen Traum hatte. Oder richtiger gesagt: Er hatte zwei Träume. Über den ersten sprach er mit vielen, es war der Traum vom Protektorat. Den anderen offenbarte er nur einigen wenigen.
Er träume davon, so sagte er, den Behörden zu zeigen, was für tüchtige Arbeiter die Juden seien, damit sie sich ein für alle Mal überreden ließen, das Getto zu erweitern. Dann würden auch andere Teile von Łódź ins Getto eingemeindet, und wenn der Krieg schließlich vorbei wäre, müssten die Behörden anerkennen, dass das Getto ein ganz besonderer Ort sei. Hier werde das Licht des Fleißes hochgehalten, hier werde produziert wie nie zuvor. Und für alle sei es von Vorteil, dass die eingesperrte Bevölkerung Litzmannstadts arbeite. Wenn die Deutschen das erst eingesehen hätten, würden sie das Getto zu einem Protektorat im Rahmen jener Teile Polens erklären, die dem deutschen Reich einverleibt waren: ein jüdischer Freistaat unter deutscher Oberhoheit, in dem man die Freiheit zum Preis harter Arbeit ehrlich erworben hatte.
Das war der Traum vom Protektorat.
|22|In dem anderen, dem geheimen Traum stand er am Bug eines großen Passagierdampfers unterwegs nach Palästina. Das Schiff hatte nach dem von ihm persönlich geleiteten Auszug aus dem Getto den Hamburger Hafen verlassen. Wer genau außer ihm zu der Elite gehörte, der die Auswanderung gestattet worden war, machte der Traum nicht deutlich. Feldman verstand die Sache so, dass die meisten Kinder waren. Kinder aus den Berufsschulen und den Waisenhäusern des Gettos, Kinder, denen der Herr Präses selbst das Leben gerettet hatte. Im Hintergrund, auf der anderen Seite des Meeres, lag eine Küste: fahl in der Sonnenhitze, mit einem Saum weißer Gebäude nahe am Wasser und auf weichen Hügeln, die unmerklich in den weißen Himmel übergingen. Er wusste, es war Erez Israel, was er da sah, genauer gesagt Haifa, es ließ sich nur nicht klarer erkennen, weil alles miteinander verschmolz: das weiße Schiffsdeck, der weiße Himmel, die weißen, sich brechenden Wellen.
Feldman gestand, dass es ihm schwerfiel, diese beiden Träume in Einklang zu bringen. Ging es um den Traum vom Getto als erweitertes Protektorat oder den Traum vom Auszug nach Palästina? Der Älteste erwiderte, was er stets zur Antwort gab, dass die Ziele von den Mitteln abhingen, dass man Realist sein müsse, sehen müsse, welche Möglichkeiten sich boten. Nach all den Jahren sei er vertraut damit, wie die Deutschen sind und denken. Obendrein habe auch er viele Vertraute in ihren Reihen gewonnen. Eins wisse er indes mit Sicherheit. Jedes Mal, wenn er aufwache und ihm klar werde, dass er diesen Traum erneut geträumt habe, fülle sich seine Brust mit Stolz. Was auch immer geschehe, mit ihm und mit dem Getto: Sein Volk würde er nie im Stich lassen.
Dennoch war es genau das, was er tun würde.
|23|Von sich selbst oder davon, woher er kam, sprach der Älteste selten. Das ist ein abgeschlossenes Kapitel, pflegte er zu sagen, wenn bestimmte Ereignisse aus seiner Vergangenheit zur Sprache kamen. Dennoch griff er zuweilen, wenn er die Kinder um sich scharte, bestimmte Vorkommnisse auf, die sich dem Vernehmen nach in seiner Jugend ereignet hatten und an die er offenbar noch immer denken musste. Eine dieser Geschichten handelte von dem einäugigen Stromka, der bei ihm daheim in Iliono Lehrer an der Talmudschule war. Wie der blinde Doktor Miller hatte auch Stromka einen Stock besessen, und dieser Stock war derart lang, dass er in dem engen Klassenzimmer jeden beliebigen Schüler wann auch immer erreichen konnte. Der Älteste zeigte den Kindern, wie Stromka mit dem Stock verfuhr, watschelte, genau wie Stromka es getan hatte, mit seinem schweren Körper zwischen den Schulbänken auf und ab, in denen die Schüler über ihren Büchern hockten, und dann und wann fuhr der Stock wütend aus und klatschte einem unaufmerksamen Kind auf Hände oder Nacken. Genau so!, sagte der Älteste. Den Stock hatten die Kinder das »verlängerte Auge« getauft. Es war, als könnte Stromka mit der Stockspitze sehen. Mit seinem blinden, echten Auge blickte er in eine andere Welt, eine Welt jenseits unserer eigenen, in der alles vollkommen war, ohne jeden Fehler und Makel, eine Welt, in der die Schüler die hebräischen Schriftzeichen mit äußerster Perfektion niederschrieben und ihre Talmudverse herunterratterten, ohne ins Stocken zu geraten oder auch nur im Geringsten zu zögern. Stromka schien es in vollen Zügen zu genießen, in diese vollendete Welt hineinzublicken, doch was er an deren Außenseite sah, hasste er.
Es gab auch eine andere Geschichte – die aber erzählte der Älteste weniger gern:
Die Stadt Iliono, in der er aufgewachsen war, lag am Fluss Lovať nahe |24|der Stadt Welikije Luki, um die später im Krieg zahlreiche heftige Kämpfe ausgefochten wurden. Die Stadt bestand zur damaligen Zeit fast ausschließlich aus schmalen, windschiefen Holzhäusern, die dicht an dicht errichtet waren. Auf den flachen Hängen zwischen den Häusern, die im Frühjahr, wenn der Regen kam und der Fluss über die Ufer trat, zu unförmigen Lehmflächen anschwollen, gab es Platz für kleine Anpflanzungen. Die hier wohnenden, hauptsächlich jüdischen Familien handelten mit Stoffen und Kolonialwaren, die mit Fuhrwerken sogar aus Wilna und Witebsk kamen. Die Gegend war arm, die Synagoge aber glich einem orientalischen Palast mit zwei soliden Eingangssäulen; alles aus Holz.
Am Flussufer lag das Badehaus. Dem Badehaus gegenüber lag ein steiniger Strand, den die Kinder häufig nach der Talmudschule aufsuchten. Der Fluss war hier seicht. Den Sommer über erinnerte er an das gelblichbraune Brunnenwasser, das seine Mutter, wenn sie Wäsche wusch, auf die Vortreppe des Hauses stellte und in das er seine Hand mit Vorliebe eintauchte – es war warm wie sein eigener Urin.
Bei Niedrigwasser wurde auch eine kleine Insel freigelegt, eine flache Sandbank in der Mitte des Stroms, auf der Vögel standen und nach Fischen Ausschau hielten. Der Boden aber war tückisch. Jenseits der »Insel« fiel der schlammige Flussgrund wieder ab, und es wurde sofort tief. Dort war ein Kind ertrunken. Es war passiert, lange bevor er selbst auf die Welt gekommen war, im Ort aber sprach man nach wie vor darüber. Vielleicht war das auch der Grund, warum seine Schulkameraden so gern hierhergingen. Jeden Nachmittag wetteiferten ganze Rudel von Kindern, wer sich zur Insel hinauswagte, die frei und bloß in der Mitte der Flussströmung lag. Er erinnerte sich, dass einer der Jungen fast bis zur Taille hinausgewatet war und mit erhobenen Ellenbogen im aufgewühlten, sonnenglitzernden Wasser stand und den anderen zurief, sie sollten ihm rasch nachkommen.
Soweit er noch wusste, war er selbst nicht unter diesen Jungen, die dann lachend durchs Wasser pflügten.
Vielleicht hatte er sich angeboten, bei dem Spiel mitzumachen, war aber abgewiesen worden. Vielleicht hatten sie (wie so oft) gesagt, er sei zu dick; zu tolpatschig; zu hässlich.
|25|Da war ihm eine Idee gekommen:
Er hatte beschlossen, zu Stromka zu gehen und ihm zu erzählen, was die anderen taten. Im Nachhinein war ihm nur dunkel bewusst, wie er sich die Sache vorgestellt hatte. Durch sein Petzen würde er bei Stromka eine gewisse Anerkennung finden, und wenn er die erst hatte, würden die anderen es nicht mehr wagen, ihn von ihren Spielen auszuschließen.
Es folgte ein kurzer Augenblick des Triumphs, als der blinde Stromka, den langen Stock vor sich hin- und herpendelnd, zum Fluss herabgeeilt kam. Dieser Augenblick des Triumphs währte indes nur kurz. Stromkas Gunst jedenfalls schien er nicht gewonnen zu haben. Hingegen starrte ihn das böse Auge von da an mit vielleicht noch größerer Tücke und Verachtung an. Die anderen Kinder gingen ihm aus dem Weg. Tag für Tag, wenn er zur Schule kam, standen sie flüsternd abseits. Eines Nachmittags, als er auf dem Heimweg war, folgten sie ihm auf allen Seiten. Er war umringt von einem Haufen rufender, lachender Kinder. Später würde er sich genau daran erinnern. An dieses plötzliche Glücksgefühl, das ihn durchfuhr, als er glaubte, akzeptiert, in ihren Kreis aufgenommen zu sein. Obgleich er sofort begriffen hatte, dass ihr Lächeln und ihr kameradschaftliches Schulterklopfen irgendwie steif und unnatürlich wirkten. Sie spielten und scherzten, forderten ihn auf, ins Wasser hinauszuwaten, sagten im selben Augenblick jedoch, er würde sich ja doch nicht trauen.
Dann geht alles ungeheuer schnell. Er steht bis zur Taille im Wasser, und hinter ihm am Strand bücken sich die Jungen in seiner Nähe nach Steinen. Und bevor er noch begreift, was geschieht, hat ihn der erste Stein an der Schulter getroffen. Ihm wird schwindlig, im Mund verspürt er Blutgeschmack. Er schafft es nicht einmal kehrtzumachen, um aus dem Wasser zu rennen, bevor der nächste Stein geflogen kommt. Er fuchtelt mit den Armen, versucht wieder auf die Füße zu kommen, fällt jedoch abermals; und um ihn herum klatschen die Steine ins Wasser. Er sieht, die Würfe sind so gerichtet, dass sie ihn zur tiefen Flussrinne treiben. In dem Augenblick, als er begreift – sie wollen, dass er stirbt –, erfasst ihn Panik. Noch heute weiß er nicht genau, wie er es geschafft hat, doch indem er das Wasser mit einem Arm wegschlägt, den anderen zum Schutz über den Kopf hält, gelingt es ihm irgendwie, ans Ufer zu |26|kommen, die Beine in die Hand zu nehmen und sich hastig humpelnd davonzumachen, gefolgt von einem Steinhagel.
Hinterher musste er mit dem Rücken zur Klasse stehen, während ihn Stromka mit dem Stock verprügelte. Fünfzehn heftige Hiebe auf Hinterteil und Schenkel, die dort, wo die Steine getroffen hatten, bereits blau und geschwollen waren. Nicht, weil er dem Unterricht ferngeblieben war, sondern weil er seine Kameraden verleumdet hatte.
Doch woran er sich im Nachhinein erinnern sollte, war nicht die Denunziation und die Strafe, sondern der Augenblick, als die lächelnden Kindergesichter am Fluss urplötzlich zur hasserfüllten Mauer wurden und er begriffen hatte, dass er wie in einem Käfig feststeckte. Ja, immer wieder würde er (auch vor »seinen eigenen« Kindern) auf diesen offenen Käfig zu sprechen kommen, durch dessen Gitterstäbe unablässig Steine geworfen oder Stöcke nach ihm gestoßen wurden, und darauf, dass er gefangen war, nirgendwo hinkonnte und nichts zu tun vermochte, um sich zu schützen.
|27|Wann beginnt die Lüge?
Die Lüge, so sagte Rabbi Fajner stets, hat keinen Anfang. Die Lüge verläuft wie ein Wurzelgeflecht in endlosen Verzweigungen nach unten. Doch folgt man den Wurzelfasern in die Tiefe, findet man nirgendwo einen Augenblick der Eingebung oder Einsicht, nur übermächtige Verzweiflung und Panik.
Die Lüge beginnt stets mit dem Leugnen.
Etwas ist geschehen – dennoch will man sich nicht eingestehen, dass es geschehen ist.
So beginnt die Lüge.
*
Am selben Abend, als die Behörden ohne sein Wissen beschlossen, die Alten und Kranken des Gettos zu deportieren, hatte er zusammen mit seinem Bruder Józef und seiner Schwägerin Helena das Kulturhaus besucht, um die vor einem Jahr erfolgte Gründung der Gettofeuerwache zu feiern. Am Tag darauf war es genau drei Jahre her, dass Deutschland in Polen eingefallen war und der Krieg und die Okkupation begonnen hatten. Das aber feierte man selbstverständlich nicht.
Die Soiree wurde mit einigen musikalischen Impromptus eingeleitet; danach folgten ein paar Stücke aus Mojsze Pulavers »Gettorevue«, die just an diesem Tag bereits ihre hundertste Aufführung hatte.
Der Älteste fand Musikvorstellungen insgesamt äußerst anstrengend. Das totenbleiche Fräulein Bronisława Rotsztad krümmte sich um ihre Violine, als würden sie ein ums andere Mal elektrische Stöße durchfahren. Fräulein Rotsztads musikalische Gefühlsausbrüche wurden indes von den Frauen hoch geschätzt. Anschließend waren die Zwillingsschwestern Schum an der Reihe. Ihr Auftritt hatte stets ein und |28|denselben Ablauf. Zunächst schauten sie fromm in die Runde und knicksten. Dann stürzten sie hinter die Kulissen und erschienen als die jeweils andere wieder. Da sie einander bis aufs I-Tüpfelchen glichen, war das natürlich kein Problem. Sie tauschten nur ihre Kleider. Dann verschwand eine von ihnen – und die andere suchte nach ihrer Schwester. In Koffern und Kisten suchte sie. Dann tauchte die Verschwundene auf und begann nach derjenigen zu suchen, die zuvor auf der Suche gewesen (und jetzt ihrerseits verschwunden) war, vielleicht aber hatte auch dieselbe Schwester die ganze Zeit gesucht.
Alles war sehr verwirrend.
Dann trat Herr Pulaver selbst auf die Bühne und erzählte plotki.
Einer der Witze handelte von zwei Juden, die sich auf der Straße begegneten. Der eine kam aus Insterberg. Der andere fragte: Was Neues aus Insterberg? Der erste erwiderte: Nichts. Der andere: Überhaupt nichts? Der erste: A hintel hot gebilt. Ein Hund hat gebellt.
Das Publikum lachte.
Der zweite: Hat ein Hund in Insterberg gebellt? Ist das alles, was passiert ist?
Der erste: Was weiß ich. Anscheinend sind eine Menge Leute zusammengekommen.
Der zweite: Sind eine Menge Leute zusammengekommen? Und ein Hund hat gebellt? Ist das alles, was in Insterberg passiert ist?
Der erste: Man hat deinen Bruder festgenommen.
Der zweite: Hat man meinen Bruder festgenommen. Weshalb denn?
Der erste: Man hat deinen Bruder festgenommen, weil er Wechsel gefälscht hat.
Der zweite: Hat mein Bruder Wechsel gefälscht? Das ist ja nichts Neues.
Der erste: Hab ich doch gesagt, nichts Neues aus Insterberg.
Alle im Saal bogen sich vor Lachen außer Józef Rumkowski. Der Bruder des Ältesten war der Einzige im Saal, der nicht begriff, dass der Witz von ihm handelte.
Es wurden auch Späße über Rumkowskis junge Frau Regina und deren unverbesserlichen Bruder Benji gemacht, von dem es hieß, der |29|Älteste habe ihn in der Klapsmühle an der Wesoła einschließen lassen, weil er »zu viel Theater gemacht hatte«; mit anderen Worten, weil er dem Präses Sachen ins Gesicht gesagt hatte, die der nicht hören wollte.
Die beliebtesten Geschichten handelten indes von Helena, der Schwägerin des Ältesten. Die erzählte Mojsze Pulaver persönlich, als er dort am Bühnenrand stand, die Hände frech in den Hosentaschen vergraben. Allein schon, dass er sie die Prinzessin von Kent nannte. Wer hot si gekent un wer wil si kenen?, fragte er, und plötzlich war die Bühne voller Schauspieler, die, eine Hand über den Augen, nach der verschwundenen Prinzessin Ausschau hielten: Prinzessin von Kent? Prinzessin von Kent? Das Publikum jubelte und zeigte auf die erste Reihe, in der Prinzessin Helena puterrot unter ihrer kessen Hutkrempe saß.
Die übrigen Schauspieler spähten weiter ins Publikum:
Wo ist sie? Wo ist sie?
Ein anderer Schauspieler kam auf die Bühne, schamlos imitierte er den watschelnden Gang der Prinzessin. Ins Publikum gewandt teilte er mit, es sei ein Notruf von der Feuerwache in Marysin eingegangen. Ein ungewöhnliches Anliegen: Eine Frau habe sich daheim eingeschlossen und weigere sich, aus dem Haus zu gehen. Von ihrem Mann ließ sie sich das Essen bringen. Sie aß und aß, und als sie endlich zum Abort musste, war sie derart aufgequollen, dass sie nicht durch die Tür kam. Die Feuerwehr musste ausrücken und sie durchs Fenster heben.
DAS WAR ALSO DIE UNBEKANNTE PRINZESSIN VON KENT!
Worauf das gesamte Ensemble auf die Bühne stürmte, sich bei den Händen fasste und ein Lied anstimmte:
S’is kaj dankeskajtn,
S’is gite zajtn
Kajner tit sich hajnt nischt schemen
Jeder wil do hajnt nor nemen;
Abi zi sajn do satt1
|30|Das war das bösartigste und unverschämteste Gesangs- und Tanzstück, das Herr Pulaver bisher in Worte gefasst hatte. Einer Majestätsbeleidigung so nahe, wie man ihr nur kommen konnte, typisch für die in den vergangenen Monaten im Getto herrschende Stimmung voll von Chaos und Verdrossenheit. Obgleich der Präses versuchte, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und an den richtigen Stellen zu applaudieren, empfand auch er deutlich Erleichterung, als das Stück zu Ende war und die Musiker wieder auf die Bühne zurückkehrten.
Fräulein Bronisława Rotsztad beendete das Ganze mit einem raumgreifenden Scherzo von Liszt und zog mit ihrem gut geharzten Bogen einen Strich unter die ganze beklemmende Veranstaltung.
*
Am Morgen darauf, es war Dienstag, der 1. September 1942, wartete Kuper wie gewöhnlich mit dem Wagen vor der Sommerresidenz in der Karola Miarki, und wie stets stieg der Älteste mit einem kaum hörbaren Grunzen als einzigem Gruß bei ihm ein. WAGEN DES ÄLTESTEN DER JUDEN stand auf den silbrigen Plaketten zu beiden Seiten des Fahrzeugs. Nicht, dass sich da jemand hätte irren können. Es gab nur einen einzigen derartigen Wagen im ganzen Getto.
Der Präses ließ sich oft durchs Getto fahren. Da alles darin ihm gehörte, sah er sich schließlich veranlasst, die Dinge dann und wann in Augenschein zu nehmen, um sicherzugehen, dass alles seine Ordnung hatte. Dass seine Arbeiter am Fuß der hölzernen Brücken ordnungsgemäß anstanden, bevor sie diese von einem Teil des Gettos zum anderen überquerten; dass seine Fabriken allmorgendlich die Tore geöffnet hielten, damit der gewaltige Strom der Arbeiter hineingelangte; dass seine Ordnungskräfte an ihrem Platz waren, damit es zu keinem unnötigen Geplänkel kam, dass seine Arbeiter sich unverzüglich zu ihren Arbeitsgeräten begaben und dort abwarteten, bis seine Fabriksirenen ertönten, möglichst alle zugleich, im selben Augenblick.
Das taten die Fabriksirenen auch an diesem Morgen. Es war ein vollkommen normaler klarer, wenn auch ein wenig kühler Tagesanbruch. Bald würde die Hitze die letzten Reste Feuchtigkeit aus der Luft brennen, |31|und es würde wieder warm werden, so wie es den ganzen Sommer über gewesen war und es auch die restliche Zeit dieses grässlichen Septembers sein würde.
Dass etwas nicht stimmte, merkte er erst, als Kuper von der Dworska in die Łagiewnicka einbog. Vor dem von Schupos bewachten Schlagbaum bei der Einfahrt zum Bałucki Rynek drängten sich Menschen, und keiner von ihnen war auf dem Weg zur Arbeit. Er sah, wie sich Köpfe in seine Richtung drehten und Hände nach dem Verdeck des Wagens ausstreckten. Einer oder mehrere Menschen schrien ihm etwas zu, die Gesichter seltsam vorgereckt. Dann kamen Rozenblats Männer angerannt, Ordnungskräfte umringten das Gefährt, und nachdem die deutschen Gendarmen den Schlagbaum geöffnet hatten, konnten sie in Ruhe auf den Platz fahren.
Herr Abramowicz hielt bereits seinen Arm ausgestreckt, um ihn zu stützen, als er vom Wagen stieg. Fräulein Fuchs kam aus dem Barackengebäude gestürzt, und in ihrem Gefolge alle Bürokräfte, Telefonistinnen und Sekretärinnen. Er schaute von einem entsetzten Gesicht zum anderen und fragte: Was starrt ihr? Der junge Herr Abramowicz war der Erste, der sich ein Herz fasste, aus dem Pulk heraustrat und sich räusperte:
Wissen Sie es nicht, Herr Präses? Der Befehl kam heute Nacht. Sie räumen die Spitäler, nehmen alle Kranken und Alten mit!
Es gibt mehrere Zeugnisse darüber, wie der Älteste reagierte, als ihn der Bescheid erst auf diese Weise erreichte. Manche sagten, er habe keine Sekunde gezögert. Gleich darauf hätten sie ihn »wie einen Wirbelwind« zur Wesoła fegen sehen, um seinen nächsten Angehörigen möglichst schnell zu Hilfe zu eilen. Andere meinten, er habe die Neuigkeit mit fast so etwas wie Heiterkeit aufgenommen. Bis zuletzt habe er abgestritten, dass eine Deportation stattgefunden hatte. Wie sollte hier im Getto etwas ohne sein Wissen geschehen?
Doch es gab auch jene, die plötzlich Unsicherheit und Angst hinter der autoritären Maske des Ältesten zu erkennen glaubten. Denn war nicht er es gewesen, der in einer seiner Reden geäußert hatte: Es ist meine |32|Devise, jeder deutschen Anordnung mindestens zehn Minuten voraus zu sein. Irgendwann im Laufe der Nacht war ein Befehl ergangen, Kommandant Rozenblat musste informiert worden sein, da die Gettopolizei bis zum letzten Mann zur Stelle war. Alle, die es unmittelbar anging, schien man benachrichtigt zu haben, mit Ausnahme des Ältesten, der im Kabarett weilte!
Als der Älteste am Dienstag kurz vor acht beim Krankenhaus ankam, war die gesamte Gegend um die Wesoła abgesperrt. Jüdische Polizisten hatten am Eingang eine Kette gebildet, unmöglich zu überwinden. Jenseits dieser Mauer aus jüdischen polizajten hatte die Gestapo breite Pritschenwagen mit je zwei oder drei Anhängern vorfahren lassen. Unter der Aufsicht deutscher Polizeikräfte waren Rozenblats Männer dabei, Kranke und Ältere aus dem Spitalgebäude zu schleppen. Einige der Insassen trugen noch immer ihre Patientenkleidung, andere kamen lediglich in Unterhosen oder splitternackt aus dem Haus, die ausgemergelten Arme über Brust und Rippen verschränkt. Einzelnen Patienten gelang es, den Kordon der Polizisten zu durchbrechen. Eine weißgekleidete Gestalt kam mit rasiertem Kopf auf die Absperrung zugestürzt, den blau-weiß gestreiften Gebetsschal wie eine Fahne hinter sich herziehend. Sofort hoben die Uniformierten ihre Gewehre. Der unbegreifliche Triumphschrei des Mannes wurde abrupt abgeschnitten, und in einem Regen aus Stofffetzen und Blut kippte er vornüber. Ein anderer der Flüchtenden versuchte sich auf den Rücksitz einer der beiden schwarzen Limousinen zu retten, die neben den Lastwagen und Anhängern vorgefahren waren, bei denen eine Handvoll deutscher SS-Offiziere seit langem stand und die tumultartigen Szenen gleichgültig betrachtete. Der Flüchtende war gerade im Begriff, durch die Hintertür ins Auto zu kriechen, als der Chauffeur des Wagens SS-Hauptsturmführer Günther Fuchs auf den Eindringling aufmerksam machte. Mit behandschuhter Hand zerrte Fuchs den wild um sich schlagenden Mann aus dem Auto, schoss ihm dann zuerst durch die Brust und danach ein weiteres Mal – als der Mann längst am Boden lag – durch Kopf und Hals. Unverzüglich stürzten zwei Ordnungskräfte herbei, packten die Arme des Mannes und schleuderten die noch immer aus dem Kopf |33|blutende Leiche auf den Anhänger, auf dem sich gut hundert bereits eingefangene Patienten drängten.
Während all dies geschah, war der Älteste ruhig und beherrscht auf den Chef des Einsatzkommandos, einen gewissen SS-Hauptscharführer Konrad Mühlhaus, zugegangen und hatte verlangt, in die Räumlichkeiten des Krankenhauses eingelassen zu werden. Mühlhaus hatte das Ansinnen mit dem Hinweis abgelehnt, hier gehe es um eine Sonderaktion unter der Leitung der Gestapo, und Juden dürften die Absperrlinie nicht übertreten. Der Älteste hatte daraufhin gebeten, das Büro aufsuchen zu dürfen, um von dort ein dringendes Telefonat zu führen. Als auch dieses Begehren abgeschlagen wurde, soll der Älteste gesagt haben:
Sie können mich erschießen oder deportieren lassen. Aber als Judenältester habe ich dennoch einen gewissen Einfluss auf die Juden des Gettos. Wenn Sie wollen, dass diese Aktion ruhig und würdig vonstatten geht, tun Sie klug daran, meinem Begehren nachzukommen.
Der Älteste war knapp dreißig Minuten fort. In dieser Zeit ließ die Gestapo noch mehr Anhänger vorfahren, und ein weiteres Grüppchen von Rozenblats Ordnungskräften erhielt den Befehl, im Krankenhausgarten nach Patienten zu suchen, die versucht hatten, durch den Hintereingang der Klinik zu fliehen. Wer sich im Park versteckt hatte, wurde mit Schlagstöcken und Gewehrkolben zu Boden geprügelt; wer sich auf die Straße verirrt hatte, wurde von deutschen Posten kaltblütig erschossen. In regelmäßigen Abständen waren Rufe und erstickte Schreie aus der vor dem Park versammelten Schar Angehöriger zu vernehmen, die nichts tun konnten, um den kraftlosen Patienten zu helfen, die man jetzt einen nach dem anderen aus dem Gebäude brachte. Zugleich richteten sich immer mehr Blicke auf die Fenster im Obergeschoss, an denen die Leute erwarteten, den weißhaarigen Kopf des Präses auftauchen zu sehen, der bekanntgeben würde, dass die Aktion beendet sei, das Ganze nur auf einem Missverständnis beruhe, er inzwischen mit den Behörden gesprochen habe und alle Kranken und Alten nunmehr ungehindert nach Hause gehen könnten.
|34|Doch als der Älteste nach dreißig Minuten am Eingang erschien, warf er nicht einmal einen Blick auf die vollbeladene Anhängerkolonne. Er begab sich raschen Schritts zu seinem Wagen und nahm darin Platz, worauf das Gespann wendete und zum Bałucki Rynek zurückfuhr.
An diesem Tag – dem ersten der Septemberaktion – wurden insgesamt 674 stationär aufgenommene Patienten aus den sechs Gettokrankenhäusern in die überall in den Vierteln verteilten Auffanglager verbracht, von wo aus sie mit dem Zug weitertransportiert wurden. Unter den Ausgesiedelten befanden sich Regina Rumkowskas beide Tanten, Lovisa und Bettina, und möglicherweise auch Reginas geliebter Bruder, Herr Benjamin Wajnberger.
Im Nachhinein zeigten sich viele erstaunt, dass der Älteste nichts unternommen hatte, um wenigstens seinen engsten Angehörigen zu helfen, obgleich man ihn doch vor dem Spital zunächst mit SS-Hauptscharführer Mühlhaus und anschließend mit Kommissar Fuchs hatte sprechen sehen.
Etliche meinten zu wissen, was der Grund für diese Gefügigkeit war. Bei dem kurzen Telefonat, das Rumkowski aus dem Krankenhaus mit dem Leiter der Gettoverwaltung Hans Biebow geführt hatte, soll er ein Versprechen erhalten haben. Als Ausgleich dafür, dass er zustimmte, alle Alten und Kranken des Gettos ziehen zu lassen, soll dem Präses erlaubt worden sein, unter den für die Aussiedlung Vorgesehenen eine persönliche Liste von zweihundert vollwertigen gesunden Männern zusammenzustellen, Männer, die für den weiteren Betrieb und die Verwaltung des Gettos von unersetzlicher Bedeutung waren und die also im Getto verbleiben durften, obgleich sie die Altersgrenze offiziell bereits überschritten hatten. Der Älteste soll sich auf diesen Teufelspakt eingelassen haben, weil er darin die einzige Möglichkeit sah, das Überleben des Gettos auf Dauer zu sichern.
Wieder andere sagten, Rumkowski habe begriffen, dass die Zeit der Versprechungen, was ihn anging, vorbei war, und zwar bereits in dem Augenblick, als man die Deportationen einleitete, ohne ihn davon in Kenntnis zu setzen. Dass alles, was die Behörden bislang versprochen hatten, nur Lügen und leere Worte waren. Was bedeutete dann schon das Leben eines einzelnen Angehörigen, wenn ihm nichts |35|weiter übrigblieb, als verwirrt und machtlos mit anzusehen, wie das gesamte mächtige, von ihm erbaute Imperium langsam in sich zusammenfiel?
|37|I
Innerhalb der Mauern
(April 1940 – September 1942)
|39|Geto, getunja, getochna, kochana,
Tisch taka malutka e taka schubrana
Der wos hot a hant a schtarke
Der wos hot ojf sich a marke
Krigt fin schenstn in fin bestn
Afile a postn ojch dem grestn
[Getto, Getto, süßes, liebes
Bist so klein und so korrupt
Wer hier ist von starker Hand
Und trägt ein Zeichen am Gewand
Kriegt vom Besten und vom Schönsten
Selbst ein Posten, gar den höchsten.]
Jankiel Herszkowicz, »Geto, getunja«
(komponiert und aufgeführt im Getto, etwa 1940)
|40|© Staatsarchiv Łódź
|43|Das Getto: platt wie ein Topfdeckel zwischen dem Aschewolkenblau des Himmels und dem Betongrau der Erde.
Zieht man nur das Fehlen geographischer Hindernisse in Betracht, könnte es ins Unendliche so weitergehen: ein Gebäudegewirr im Begriff, sich aus den Ruinen zu erheben oder aufs Neue zusammenzustürzen. Das wahre Ausmaß des Gettos wird allerdings erst gänzlich sichtbar, wenn man sich innerhalb des derben Bretterzauns und der Stacheldrahthindernisse befindet, die von den deutschen Besatzern rundum errichtet wurden. Wäre es dennoch möglich, sich – beispielsweise aus der Luft – ein Bild vom Getto zu machen, könnte man deutlich erkennen, dass es aus zwei Hälften oder »Lappen« besteht.
Der östliche Lappen ist der größte. Er erstreckt sich vom Bałucki Rynek und dem alten Kirchplatz mit der Marienkirche – deren hoher Doppelturm von überallher sichtbar ist – über die Reste dessen, was ehemals Łódźs »Altstadt« war, bis zur Gartenvorstadt Marysin.
Vor dem Krieg war Marysin vornehmlich ein marodes Kleingartengebiet, voll von anscheinend willkürlich errichteten Werkstattbuden, Schweineställen und Schuppen. Nach der Absperrung des Gettos wurden die kleinen Parzellen und Gartenhäuschen von Marysin zu einem Gelände mit Sommerwohnungen und Erholungsheimen für speziell ausgewählte Mitglieder der herrschenden Getto-Elite.
In Marysin befinden sich auch die große jüdische Begräbnisstätte und, jenseits der Umzäunung: der Güterbahnhof Radogoszcz, auf dem die schweren Materialtransporte eintreffen. Einheiten der Schutzpolizei, die auch das Getto rund um die Uhr bewacht, geleiten allmorgendlich Brigaden jüdischer Arbeiter aus dem Getto, die an der Rampe beim Be- und Entladen zupacken, und dieselbe Polizeikompanie achtet am Ende des Arbeitstages sorgfältig darauf, die Arbeiter wieder zurück ins Getto zu führen.
|44|Der östliche Gettolappen schließt sämtliche Wohnviertel östlich und nördlich der großen Durchfahrtsstraße Zgierska ein. Aller Transitverkehr, auch der Straßenbahnbetrieb zwischen dem südlichen und nördlichen Łódź, führt durch diese Straße, die an nahezu jedem Häuserblock von deutschen Gendarmen bewacht wird. Die beiden meistgenutzten der insgesamt drei Gettobrücken schlagen ihren hölzernen Bogen über die Zgierska. Die erste der Brücken befindet sich am Altmarkt. Die zweite, von den Deutschen Hohe Brücke genannt, verläuft vom Steinfundament der Marienkirche hinüber zur Lutomierska auf der anderen Seite des Kirchplatzes. Der westliche Lappen umfasst die Wohnviertel um die alte jüdische Begräbnisstätte und den Bazarowa-Platz, auf dem seinerzeit die alte Synagoge lag (jetzt zum Pferdestall umfunktioniert). Die wenigen Mietshäuser, die im Getto über fließend Wasser verfügen, befinden sich in diesen Vierteln.
Eine weitere größere Straße, die Limanowskiego, führt vom Westen ins Getto hinein und zerschneidet somit den westlichen Lappen in zwei kleinere Teile, einen nördlichen und einen südlichen. Auch zwischen diesen beiden Teilen befindet sich eine Holzbrücke, und zwar an der Masarska; allerdings wird sie nicht im gleichen Maße benutzt.
In der Mitte des Gettos, genau dort, wo die beiden Hauptstraßen Zgierska und Limanowskiego aufeinanderstoßen, liegt der Bałucki Rynek. Der Markt ist gleichsam der Magen des Gettos. Alles Material, das in dem abgesperrten Gebiet benötigt wird, läuft hier hindurch, bevor es zu den resorty des Gettos gelangt. Und von hier aus wird auch der größte Teil der Waren ausgeführt, die die gettoeigenen Fabriken und Werkstätten produzieren. Der Bałucki Rynek ist die einzige neutrale Zone im Getto, in der Deutsche und Juden aufeinandertreffen; vollkommen abgeschnitten, umzäunt mit Stacheldraht, nur mit zwei ständig bewachten »Toren« versehen: eins an der Łagiewnicka und eins an der Zgierska, hinaus zum »arischen« Litzmannstadt.
Auch die deutsche Gettoverwaltung verfügt über einen örtlichen Sitz am Bałucki Rynek, in einer Handvoll Baracken, die Wand an Wand mit Rumkowskis Sekretariat liegen: dem Hauptquartier, wie es der Volksmund nennt. Hier befindet sich auch das Zentrale Arbeitsamt (Centralne Biuro Resortów Pracy), unter Leitung von Aron Jakubowicz, das |45|die Arbeiten in den resorty des Gettos koordiniert und letztlich die Verantwortung für die gesamte Produktion und den Handel mit den deutschen Behörden trägt.
Eine Übergangszone.
Ein Niemands- oder vielleicht sollte man besser sagen ein Jedermannsland – mitten in dem strikt bewachten Judenland –, zu dem sowohl Deutsche als auch Juden Zutritt haben, Letztgenannte jedoch allein unter der Voraussetzung, dass sie einen gültigen Passierschein vorweisen.
Man könnte es auch den besonderen Schmerzpunkt des Gettos nennen, der erklärt, weshalb es das Getto überhaupt gibt. Diese gigantische Ansammlung verfallener, unhygienischer Gebäude um einen Platz, der im Grunde nur ein einziger gigantischer Ausfuhrbahnhof ist.
|46|Schon frühzeitig hatte er bemerkt, dass ihn so etwas wie Stummheit umgab. Er redete und redete, doch keiner hörte, was er sagte, oder die Worte drangen nicht hindurch. Es war, als säße er unter einer Glocke aus durchsichtigem Glas.
Die Tage, als seine erste Frau Ida im Sterben lag:
Es war im Februar 1937, zweieinhalb Jahre vor Kriegsausbruch und nach einer langen Ehe, die zu seiner großen Betrübnis keine Frucht getragen hatte. Die Krankheit, die vielleicht erklärte, warum Ida kinderlos blieb, ließ ihren Körper und ihre Seele langsam verdorren. Wenn er gegen Ende das Tablett zu dem Zimmer hinaufbrachte, in dem sie von zwei jungen Dienstmädchen gepflegt wurde, erkannte sie ihn nicht einmal mehr wieder. Zuweilen war sie höflich und korrekt wie zu einem Fremden, dann wieder schroff und abweisend. Einmal schlug sie ihm das Tablett aus der Hand und schrie, er sei ein dibek, er müsse vertrieben werden.
Er wachte bei ihr, wenn sie schlief; nur so konnte er gewiss sein, dass sie ihm noch immer ganz gehörte. Sie lag in ihren schweißgetränkten Laken verfangen und schlug wild um sich. Fass mich nicht an, schrie sie, halt deine schmutzigen Hände von mir weg. Er ging auf den Treppenabsatz hinaus und rief den Dienstmädchen zu, sie sollten nach einem Arzt laufen. Doch blieben sie nur unten stehen und starrten zu ihm hinauf, als begriffen sie nicht, wer er war oder was er sagte. Es endete damit, dass er selbst gehen musste. Wie ein Betrunkener wankte er von Haus zu Haus. Am Ende fand er einen Arzt, der zwanzig Złoty nahm, allein um sich den Mantel anzuziehen.
Doch da war es bereits zu spät. Er beugte sich hinunter und flüsterte ihren Namen, aber sie hörte nicht. Zwei Tage später war sie tot.
|47|Einstmals hatte er versucht, sein Glück als Plüschfabrikant in Russland zu machen, doch die Revolution der Bolschewiken war dazwischengekommen. Sein Hass auf alle Arten Sozialisten und Bundisten rührte aus dieser Zeit. Ich weiß so manches über Kommunisten, das sich für gebildete Salons nicht eignet, sagte er zuweilen.
Er hielt sich für einen einfachen, praktischen Menschen, ohne alle feinen Allüren. Wenn er sprach, redete er Klartext, laut und kräftig, mit dringlicher, ein wenig schriller Stimme, die so manchen voller Unbehagen den Blick abwenden ließ.
Er war langjähriges Mitglied der Allgemeinen Zionisten, der Partei Theodor Herzls, doch mehr aus praktischen Gründen als aus festem Glauben an die Sache des Zionismus. Als die polnische Regierung 1936 die Wahlen für die örtlichen jüdischen Gemeinderäte aufschob, aus Angst, die Sozialisten könnten auch dort den Ton angeben, traten alle Zionisten aus der Łódźer kehilla aus und ließen Agudat Israel die Leitung der Gemeinde allein weiterführen. Alle, außer Mordechai Chaim Rumkowski, der sich weigerte, seinen Platz im Gemeinderat zur Verfügung zu stellen. Seine Kritiker, die mit seinem Ausschluss aus der Partei reagierten, sagten, er würde, wenn es dazu käme, selbst mit dem Teufel zusammenarbeiten. Sie wussten nicht, wie recht sie hatten.
Früher einmal hatte auch er davon geträumt, ein reicher, erfolgreicher Textilunternehmer zu werden wie all die anderen legendären Persönlichkeiten in Łódź: Kohn, Rozenblat oder der unvergleichliche Izrael Posnánski. Eine Zeitlang hatte er zusammen mit einem Kompagnon eine Weberei betrieben. Doch ihm fehlte die notwendige Geduld für Geschäfte. Bei jeder verspäteten Lieferung brauste er voller Zorn auf, vermutete Betrug und Falschheit hinter jeder Rechnung. Am Ende war es auch zu Konflikten zwischen ihm und seinem Kompagnon gekommen. Dann folgten das russische Abenteuer und der Bankrott.
Als er nach dem Krieg nach Łódź zurückkehrte, versuchte er sich als Versicherungsagent für Gesellschaften wie Silesia und Prudential. An den Fenstern sammelten sich neugierige und angsterfüllte Gesichter, wenn er an die Tür klopfte, doch niemand wagte zu öffnen. Man nannte ihn Pan Śmierć, Herr Tod, und sein Gesicht glich auch dem des Todes, |48|wenn er sich durch die Straßen schleppte, denn die Zeit in Russland hatte ihm eine Herzkrankheit beschert. Oft saß er allein in einem der eleganten Cafés an der Piotrkowska, in denen Ärzte und Rechtsanwälte verkehrten, zu deren vornehmen Kreisen er gern gezählt hätte.
Doch niemand wollte den Tisch mit ihm teilen. Sie wussten, er war ein ungebildeter Mann, der zu heftigsten Drohungen und Verunglimpfungen neigte, um seine Versicherungen zu verkaufen. Zu einem Farbenhändler in der Kościelna hatte er gesagt, jener würde tot umfallen, wenn er nicht umgehend für seine Familie unterschrieb, und am Morgen darauf fand man den Mann tot unter dem hochklappbaren Teil des Ladentisches, und seine Ehefrau und die siebenköpfige Kinderschar standen plötzlich ohne alle Mittel für ihre Versorgung da. Zum Cafétisch des Herrn Tod kamen und gingen Männer mit geheimen Nachrichten, sie saßen mit dem Rücken zum Raum und wagten ihre Gesichter nicht zu zeigen. Es hieß, dass er bereits damals mit gewissen Personen verkehrte, die später im Getto dem Beirat angehörten – »drittrangige Gestalten mit mangelndem Sinn fürs Gemeinwohl und mit noch viel weniger Ehre und Anstand«. Statt der »großen Männer«, die er beneidete, schien ihm überall, wo er ging und stand, ein Vagabundenpack zu folgen.
Dann aber geschah etwas: eine Bekehrung.
Den Kindern und Kinderschwestern im Grünen Haus sollte er später berichten, dass das Wort des Herrn sich ihm plötzlich und unerwartet mit der Kraft einer Mahnung offenbart hatte. Von diesem Tag an, so sagte er, sei die Krankheit von ihm gewichen, so rasch wie die allerflüchtigste Sinnestäuschung.
Es war zur Winterzeit. Niedergeschlagen hatte er sich durch eine der dunklen Gassen von Zgierz geschleppt und war auf ein Mädchen gestoßen, das zusammengekrümmt unter dem Blechschutz einer Straßenbahnhaltestelle hockte. Das Mädchen hatte ihn angehalten und mit vor Kälte zitternder Stimme gefragt, ob er ihr etwas zu essen geben könne. Er hatte seinen langen Mantel ausgezogen, das Mädchen darin eingehüllt und gefragt, was es zu so später Stunde noch auf der Straße mache und warum es nichts zu essen habe. Das Mädchen hatte geantwortet, |49|dass seine Eltern beide tot seien und es keine Bleibe habe. Von seinen Verwandten habe es auch niemand in den Haushalt aufnehmen oder ihm etwas zu essen geben wollen.
Da nahm der künftige Präses das Mädchen mit hinauf zum Scheitelpunkt der Straße, dorthin, wo der Klient, den er zu besuchen gedachte, im obersten Stockwerk eines großen, imposanten Hauses wohnte. Er war ein Geschäftsfreund des berühmten Stoffhändlers und Philanthropen Heiman-Jarecki. Rumkowski sagte zu diesem Mann, wenn er auch nur das Geringste davon wüsste, was jüdische zdoke besagen wollte, dann würde er sich des elternlosen Mädchens unverzüglich annehmen, ihm eine nahrhafte Mahlzeit und ein warmes Bett zum Schlafen geben; und der Geschäftsmann, der zu diesem Zeitpunkt verstanden hatte, dass er bei einer Weigerung riskierte, sich dem Tod auszusetzen, wagte nichts anderes zu tun, als was Rumkowski verlangte.
Von diesem Tag an war Rumkowskis Leben radikal verändert.
Voll neuer Energie erwarb er einen verfallenen Hof in Helenówek am Rand von Łódź und gründete ein Landheim für elternlose Kinder. Sein Ziel war, dass kein jüdisches Kind ohne Nahrung, Unterkunft und zumindest eine rudimentäre Schulbildung aufwachsen sollte. Er las sehr viel, nun auch zum ersten Mal Werke der Gründerväter der zionistischen Bewegung: Achad Haam und Theodor Herzl. Er träumte davon, freie Kolonien zu schaffen, in denen die Kinder nicht nur wie richtige Kibbuzniks den Boden bestellten, sondern auch einfachere Handwerkstätigkeiten erlernten, als Vorbereitung für die Berufsschulen, die nach dem Verlassen des Kinderheims auf sie warteten.
Mittel für das Betreiben seiner Kinderkolonie bekam er unter anderem von der jüdisch-amerikanischen Hilfsorganisation JDC, Joint Distribution Committee, die alle Arten von Wohltätigkeitseinrichtungen in Polen anstandslos und großzügig unterstützte. Den Rest des Geldes trieb er auf dieselbe Weise ein, wie er zuvor Lebensversicherungen verkaufte. Er hatte da seine Methoden.
Nun wären wir also wieder bei Herrn Tod angelangt. Diesmal aber verkauft er keine Lebensversicherungen, sondern Unterstützungen für den Lebensunterhalt und die Erziehung von Waisen. Alle seine Kinder |50|haben Namen. Sie heißen Marta, Chaja, Elvira und Sofia Granowska. In seiner Brieftasche trägt er Bilder von ihnen. Kleine krummbeinige Drei- oder Vierjährige, eine Hand im Mund, die andere in der Luft, nach einem unsichtbaren Erwachsenen fuchtelnd.
Und nun können die künftigen Versicherungsnehmer sich nicht länger hinter Küchengardinen verstecken. Herr Tod hat sich einen Beruf zugelegt, der ihm erlaubt, sich über Leben und Tod zu stellen. Er sagt, es sei die moralische Pflicht eines jeden Juden, für Schwache und Bedürftige zu spenden. Und wenn der Spender nicht gibt, was er verlangt, droht er, dass er alles tun werde, um dessen Ruf zu schädigen.
Seine Kinderkolonie wuchs und gedieh.
Sechshundert Waisen wohnten im Jahr vor Kriegsbeginn in Helenówek, und alle sahen in Rumkowski einen Vater; alle begrüßten ihn freudig, wenn er von der Stadt her die lange Gutsallee entlanggefahren kam. Seine Jackentaschen waren stets mit Süßigkeiten vollgestopft, die er wie Konfetti über die Kinder regnen ließ, um dafür zu sorgen, dass sie hinter ihm herrannten und nicht er hinter ihnen.
Doch Herr Tod bleibt Herr Tod, egal, in welchen Mantel er sich hüllt:
Es gibt eine besondere Art wildes Tier, erzählte er einmal den Kindern im Grünen Haus. Es setzt sich zusammen aus kleinen Teilen aller Tiere, die der Herr je geschaffen hat. Der Schwanz dieses Tieres ist gespalten, man sieht es auf vier Beinen gehen. Es hat Schuppen wie Schlangen oder Echsen und Zähne, scharf wie ein Keiler. Unrein ist es, sein Bauch schleift auf dem Boden. Sein Atem ist heiß wie Feuer und verbrennt alles um sich herum zu Asche.
Ein solches wildes Tier ist im Herbst 1939 zu uns gekommen.
Hat alles verwandelt. Auch Menschen, die früher friedlich Seite an Seite lebten, wurden ein Teil vom Körper dieses wilden Tieres.
Am Tag, nachdem deutsche Panzer und Armeefahrzeuge auf den Łódźer Plac Wolności gerollt waren, ging eine Gruppe SS-Männer die Piotrowska, die Hauptstraße der Stadt, hinunter, betrunken vom billigen polnischen Wodka, und riss jüdische Kaufleute aus ihren Läden oder von ihren Droschken. Es hieß, irgendwo würden billige jüdische |51|Arbeitskräfte gebraucht. Die Juden hatten nicht einmal Zeit, ihre Habseligkeiten zu packen. Sie wurden in großen Haufen versammelt, in Reih und Glied aufgestellt und bekamen den Befehl, in die eine oder andere Richtung abzumarschieren.