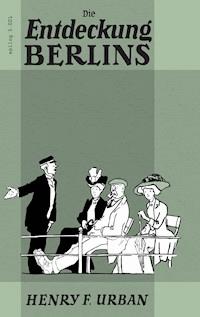
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Epilog
- Sprache: Deutsch
Ein Amerikaner entdeckt um 1910 Berlin und schildert dies in humoristischer Weise für die Leser des »Berliner Lokal-Anzeigers«. Vergleiche mit New York zeigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in dieser amüsant geschriebenen Zeit- und Sittengeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry F. Urban
Die Entdeckung Berlins
Zeichnungen von Paul Haase
• • •
Schriftreihe Epilog
Herausgegeben von Ronald Hoppe
Band 5.001
• • •
Sammelband der Epilog-Hefte:
2.005 • Die Kunst, am Sonntag Pfannkuchen zu kaufen
2.006 • Die Schwierigkeit, den Grunewald zu entdecken
2.007 • Wie der Berliner ins Seebad fährt
© copyright 2015 by epilog.de • Alle Rechte vorbehalten
Ausgewählt, redigiert und gestaltet von Ronald Hoppe
Erstveröffentlichung im Berliner Lokal-Anzeiger 1910/11
Umschlagmotiv und Zeichnungen von Paul Haase
Verlegt bei BOD – Books on Demand, Norderstedt
ISBN 978-3-7392-8275-6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar
Henry F. Urban (1862–1924) lebte als gebürtiger Berliner in New York und schrieb von dort aus für verschiedene Zeitschriften in Deutschland.
Paul Haase (1873–1925) arbeitete als Zeichner und Karikaturist, hauptsächlich für Berliner Zeitungen. Er illustrierte mehre Bücher, so u.a. die ›Onkel Franz‹-Serie.
Ronald Hoppe (*1964) war Art-Director der IHK-Zeitschrift ›Berliner Wirtschaft‹ und Herstellungsleiter beim Shayol-Verlag. Als Layouter ist er u.a. für Klett-Cotta, Piper und Random House tätig.
Inhaltsverzeichnis
Wieso und warum
1. Entdeckung
2. Entdeckung
3. Entdeckung
4. Entdeckung
5. Entdeckung
6. Entdeckung
7. Entdeckung
8. Entdeckung
9. Entdeckung
10. Entdeckung
11. Entdeckung
12. Entdeckung
13. Entdeckung
14. Entdeckung
15. Entdeckung
16. Entdeckung
17. Entdeckung
18. Entdeckung
Wieso und warum
Nichts Besonderes dünkt heute
Eine Seefahrt viele Leute.
Dieser fährt aus Deutschlands Gauen,
Um Dollarika zu schauen,
Der kommt hierher über See
An den grünen Strand der Spree.
Allzu lang am Hudson hockend,
Schien mir Letzt'res sehr verlockend.
Drum beschloss ich, jüngst zu zieh'n
Nach dem reinlichen Berlin,
Wo ein jeder als Soldat
Patriotisch dient dem Staat
Und ihm zahlt der Steuern Sold,
Da dieselben »gottgewollt«.
(Dieses Wort ist heut geflügelt,
Weil es Bismarck ausgeklügelt.)
Doch ein richtiger Mann der Feder
Sitzt am Arbeitstisch entweder
Oder geht umher und sinnt,
Wo er neue Stoffe find't.
In der Gegend nun der Panke
Kam mir folgender Gedanke:
Könnte ich zu lust'gen Zwecken
Nicht einmal Berlin entdecken?
Etwas seltsam klingt das zwar –
Manchem unverständlich gar;
Dessen ungeachtet zweifl' ich,
Dass es keinem sei begreiflich,
Denn die meisten sehen nicht,
Was da liegt vorm Angesicht.
(Goethe sprach's, ein weiser Herr,
Excellenz und Klassiker.)
Zweitens ist's ein Unterschied,
Wenn ein Humorist es sieht.
Drittens reizte der Vergleich
Mit der Stadt an Dollarn reich.
Manches hab' ich da erspäht,
Was in keinem »Führer« steht:
Menschen von besondrer Art,
Außen rauh und innen zart,
Nied're Leute und erlauchte,
Tannenschlanke und verbauchte
Solche, die mit Mägdlein kosen
An der See in Badehosen,
Solche auch, die nur entflammt,
Was verbunden mit dem Amt.
Auch das schwächere Geschlecht
Prüfte ich auf Das, was echt:
Was sie freut und was sie leiden,
Wie sie putzen sich und kleiden,
Die am Ka-De-We spazieren,
Die daheim im Kochtopf rühren,
Die als Mädchen gar für Alles
Haben etwas saftig Dralles,
Die dem Mann als Knechter fluchen,
Die nach einem neuen suchen.
Kurz und gut, was kargen Lohn
Schwer erringt in harter Fron,
Was des Lebens Bitterkeit
Mit Humor süßt jederzeit
Was bewusst nach vorwärts strebt,
Umstürzt, was sich überlebt,
Bald geschmäht mit gift'gen Zungen,
Bald als Musterstadt besungen,
Was mit einem Wort bekannt
Als »Berlin« im ganzen Land –
Das war mein Bemüh'n, zu schildern
In humordurchwebten Bildern.
Zur Erhöhung solchen Spaßes,
Lieh ich mir den Stift Paul Haases.
So wirkt alles dreifach keck –
Dieses ist des Buches Zweck.
1. Entdeckung
Die Schwierigkeiten, Berlin zu entdecken – Ein Charlottenburger, kein Berliner – Wilmersdorf als Vorspiegelung falscher Tatsachen – Aus dem Café-Leben – Von dem Ehemann, mit dem seine Frau keine Torte verzieren konnte
Amerika ist das entdeckteste aller Länder. Seit dem Jahre 1492 wurde es ununterbrochen entdeckt: von Kolumbus bis zu Goldberger. Und immer neue Entdecker kreuzen den Ozean. Da ist es also wirklich die höchste Zeit, dass jemand von drüben sich erkenntlich zeigt und zunächst einmal wenigstens Berlin entdeckt; das übrige Deutschland hat Zeit. Denn nach der Ansicht eines Berliner Freundes zerfallen die Deutschen in zwei ganz getrennte Klassen: in Berliner und Deutsche schlechthin. Übrigens ist die Entdeckung Berlins keineswegs so einfach wie die Entdeckung Amerikas. Von New York kommend, stößt man zunächst auf die Balliner; so könnte man die Bewohner Hamburgs, der Stadt des ausgezeichneten Ballin, zum Unterschied von den Berlinern nennen. Danach muss man durch eine Unmenge Sand hindurch, um Berlin zu erreichen, und wenn man glücklich irgendwo angekommen ist, so erfährt man zu seinem Entsetzen, dass man in Charlottenburg ist oder in Schöneberg oder gar in einem ganz gewöhnlichen Dorf, das den Namen Wilmersdorf führt. Als New Yorker finde ich besonders eigenartig, dass es Berlin genau genommen gar nicht gibt, sondern nur einen Haufen von Dörfern, der Berlin heißt. Und das weitere Eigenartige liegt in diesen Dörfern selber. Derartig vornehme und glänzende Bauernhäuser gibt es in New York und Umgegend nicht. Das sei hier feierlich festgestellt. Die Überraschung des Fremden ist nicht gering. Wenn er den Namen Wilmersdorf hört, so denkt er an grüne Wiesen, auf denen friedliche Rinder grasen, an dralle, rotbäckige Bauernmädchen, an idyllische Häuschen mit roten Ziegeldächern inmitten von gesegneten Obstgärten. Statt dessen findet er breite Straßen, schöne Blumenplätze, in denen die lieblichsten Kindermädchen wachsen, Paläste, in denen Köchinnen sentimentale Lieder singen und der Müllschlucker seines Amtes waltet, grüne Höfe, wo zwei Tage lang von früh bis spät aus feinen Teppichen hochfeiner Staub geklopft wird, der dann wieder in die Wohnungen zurückfliegt. Noch überraschender ist, dass der Berliner sogar im Grunewald wohnt, und dass auch dieser Wald aus aristokratischen Häusern besteht. Eigenartig ist für den Fremden auch die Eifersucht, mit der die Bewohner jedes einzelnen Dorfes über ihre lokale Getrenntheit wachen. Der Charlottenburger wohnt allemal in Charlottenburg, der Schöneberger in Schöneberg, der Wilmersdorfer in Wilmersdorf. Neulich fragte ich einen Charlottenburger, wo sein Bruder sei, und erhielt die Antwort: »Er is eben nach Berlin jejangen.« Briefe aus New York an mich tragen die Ortsbezeichnung Berlin, weil ich den Freunden in New York gesagt und geschrieben habe, dass ich mich einige Zeit in Berlin aufhalten werde. Aber die Ortsbezeichnung Berlin ist allemal auf der Post kräftig ausgestrichen und dafür Charlottenburg hingeschrieben. Entweder gibt es überhaupt kein Berlin mehr, oder es liegt in der Nähe von Charlottenburg. Ich werde das jedoch sehr bald ausfinden, und wenn ich Dr. Cooks Hilfe dazu in Anspruch nehmen müsste.
Aber sprechen wir trotzdem der Kürze halber einfach von Berlin. Der drollige George Ade, ein bekannter Chicagoer Schriftsteller mit sehr heiterer Feder, hat sich im Sommer 1908 Berlin angesehen und alsdann drüben verkündet: »Berlin ist Chicago – nur gewaschen, gestärkt und gebügelt.« Daran ist etwas Wahres. Mit New York lässt sich Berlin schwerer vergleichen, weil New York eine Seestadt mit deren eigenartigen Zügen ist. Immerhin lassen sich genug Vergleiche ziehen. Jedenfalls ist Berlin ein gewaschenes, gestärktes und gebügeltes New York, aber vor allem ist es schöner, wiewohl es keine schöne Stadt an sich ist. Neuzeitliche, schöne Städte gibt es in Deutschland überhaupt kaum. Berlin ist reicher an schönen Einzelheiten: in breiten Straßen mit Bäumen und Blumenbeeten (in der Bismarckstraße fährt die Straßenbahn sogar auf saftigem Rasen), in weiten, grünen Plätzen (der Pariser Platz ist ein Kleinod, der Matthäikirch-Platz ein Idyll), in lauschigen Winkeln und Villen darin (Tiergartenviertel), in gewissen Straßenbildern (Kanal mit Brücken und schöner Baumeinfassung am Lützow-Ufer oder manche Straße im Bayerischen Viertel mit ausgeprägter neudeutscher und zugleich feiner Häuser-Architektur). Rein architektonisch ist Berlin allzu gegensätzlich und unruhig. Zu viel Hässliches im Baustil verdirbt ganze Straßen. Auch die historische Straße Unter den Linden leidet unter zu vielen gleichgültigen oder bösen Bauwerken. Sie ist geschichtlich interessant. Ihr entspricht die 5. Avenue in New York, die Dollarkönigstraße, die in ihrem privaten Teile schöner als Unter den Linden, in ihrem Geschäftsteil dafür hässlicher ist. In New York jedoch sind die schönen Einzelheiten des Stadtbildes noch seltener. Das liegt hauptsächlich an der Eingezwängtheit der Stadt zwischen zwei Flüssen. Daher fehlt ihr alles Weite und Luftige, das Grüne und Blumige, fehlen ihr die schönen Plätze. Alles steht eng zusammengequetscht, und nur das Nötigste geschieht für die Reinlichkeit der Stadt, damit die Taschen der Politiker gefüllt bleiben. Einen eigenen Baustil hat New York (und Amerika) überhaupt nicht. Man baut jetzt in den vornehmen Vierteln mit Vorliebe in italienischer und in französischer Renaissance, zum Glück oft recht geschmackvoll. Auch die Wolkenkratzer zeigen in ihren glücklicheren Typen die Anlehnung an fremde Stile, fallen aber aus der Umgebung meistens grotesk heraus. Was noch an architektonischer Wirkung übrigbleibt, ist eine einzige gleichartige Steinmasse von fürchterlicher Eintönigkeit. Nur wenige Oasen hat diese Stein-Wüste – wie die vornehme Straße hoch oben am North River mit den schönen Uferanlagen und Bäumen (sie heißt Riverside Drive) und die nahe, baumgeschmückte Westend-Avenue; die sind wirklich reizvoll. Das Ungleiche und Gegensätzliche, das beide Weltstädte kennzeichnet, erstreckt sich selbst bis auf die Denkmäler. Aber auch hier hat Berlin den Vorrang. Es hat weniger hässliche als New York.
Das reine, das geräumige, das luftige, das grüne und das blumige Berlin – das ist das schöne Berlin. Daneben gibt es ein angenehmes Berlin, das heißt ein Berlin, das unzählige Annehmlichkeiten des Lebens bietet. Manche davon kennt New York nicht, wie Berlins billige Restaurants, in denen man besser isst als in New York. Sogar Selterwasser oder Limonade zum Essen kann man heute in Berlin haben, ohne vom Kellner und Wirt als verdächtige Persönlichkeit betrachtet zu werden. Die »Hausmannskost« gibt es in New Yorker Restaurants überhaupt nicht. Ich kenne einen Deutschen, der lange Jahre in Amerika W (übrigens nicht die feinste Gegend) gelebt hatte und auf einige Monate nach Berlin gekommen war. So oft ich ihn im Restaurant traf, schwelgte er leuchtenden Auges in Bouillon-Kartoffeln mit Rinderbrust und Meerrettich oder in Erbsen mit Pökelfleisch und Sauerkraut oder in Bratwurst mit Quetschkartoffeln und Rotkohl oder in sauren Kartoffeln mit Wiener Wurst, in Backobst mit Klößen und Speck und ähnlichen Delikatessen. »Ach, wenn ich das drüben hätte!« erklärte er seufzend. Zum Dessert ließ er sich in einem der amerikanischen Schuhläden der Friedrichstraße auf einem echten amerikanischen Putzstuhl von einem echten amerikanischen Schwarzen auf echt amerikanische Art die Stiefel putzen, las unterdessen in den bereitliegenden amerikanischen Magazinen und war der glücklichste aller Sterblichen. Was für seltsame Kombinationen das Glück zuwege bringt! Und die Cafés! Ich halte das Café schlankweg für einen Kulturbeweis. Es ist das reizvolle Stelldichein gebildeter Menschen, Fremder und Einheimischer, die auch inmitten der Berufshast einen Augenblick bei ihrer Zeitung oder im Gespräch mit Bekannten verschnaufen wollen. Wir haben in New York nur etwa zwei Cafés, und die sind auch nur ein schwacher Abklatsch eines deutschen oder europäischen Cafés. Nur wenige Menschen sind dort zu finden, die bei einer Tasse Kaffee ihre Zeitung lesen. Das Kulturelle der Muße kennt der an Dollaritis leidende New Yorker nicht. Was in New York Café heißt, ist eine Kneipe, wo man Whisky trinkt und auf den Boden spuckt.
Für mich hat ein europäisches Café sogar etwas von einem Theater, und wer Sinn für Humor hat, wird dort ganze Possen oder Schwanke erleben oder wie in einem Kinematographen-Theater die drolligsten Figuren an sich vorüberziehen sehen. Ich setze mich in eine Sofaecke, bestelle mir meinen Kaffee, zünde mir eine Zigarette an, und die Vorstellung beginnt. Da erscheinen die beiden alten Damen, die den Besuch des Cafés als das Ereignis des Tages behandeln. Nachdem ihnen der »Ober« aus den Mänteln geholfen hat, setzen sie sich behutsam immer an denselben Tisch. Dann ziehen sie ihre Handschuhe aus, die sie feierlich in die Handtasche tun, dann nehmen sie dicke Wattepfropfen aus den Ohren, die sie ebenfalls feierlich in die Handtasche tun, dann entnehmen sie der Handtasche ihre Brillen, die sie bedächtig putzen und aufsetzen, und nun vertiefen sie sich in »Gartenlaube« und »Fliegende Blätter«. Oder die Börsenleute kommen und geraten sich über ihre jüngsten Spekulationen in die wenigen noch vorhandenen Haare. Oder Schauspieler erzählen von ihren beispiellosen Triumphen und der erschrecklich überhandnehmenden Dummheit der Theater-Kritiker. Oder getreue Freundinnen haben heftige Auseinandersetzungen darüber, welche von ihnen den besten Mann habe. Die zuerst nach Hause geht – deren Mann ergeht es bitter schlecht. »Na, was die sich einbildet – neulich komme ich zu Siechen. Wer sitzt da mit einer hübschen Blondine in einer Ecke? – Ihr Hugo. Mit dem kann sie och keene Torte verzieren!« Und einmal bin ich sogar von einer entrüsteten Frau, die von den anderen als »fett« bezeichnet worden war, zum Sachverständigen ernannt worden, ob sie die Bezeichnung wirklich verdiene. Welch herzerquickende Gemütlichkeit herrscht in so einem Café! Aber man sollte für ein Extrakännchen heißes Wasser zum Tee nicht 10 Pfennig berechnen. Das stört die Gemütlichkeit. Ein Freund von mir aus Missouri war darüber so empört, dass er zwei Hörnchen aß und dem »Ober« nicht bezahlte. In solchen Fällen erwacht der Indianer in dem Yankee. Wenn er dem kleinlichen Wirt den Skalp nicht nehmen kann, nimmt er ihm die Hörnchen. Aber der Gipfel der Gemütlichkeit ist erst erreicht, wenn ich nach so und so viel Groschen Trinkgeld mein Examen als Stammtischler bestanden habe. Dann schließen mich sämtliche »Ober« in ihr Herz, dann beehrt mich die üppige Büfettdame mit ihrem Lächeln, dann darf ich Fenster nach Belieben öffnen und schließen lassen, dann entreißt der Zeitungskellner dem Provinzialen die Zeitung, die ich zu lesen wünsche, dann erwartet mich zu Weihnachten, wie ich höre, eine elegante Brieftasche, die mir der »Direktor« mit einer Verbeugung in einer dunklen Ecke überreicht.
2. Entdeckung
Berlin als Geschäftsstadt – Die Kunst, am Sonntag Pfannkuchen zu kaufen – Spree-Athens Fortschrittlichkeit – Straßenbahn und Eisbeine – Neuzeitliche Wohnungen – Das Familienbad und die Romantik des Müllschluckers
Berlin ist geschäftlich genau so regsam und so rastlos wie New York; zweitens ist es fortschrittlicher (rein städtisch gedacht) als die Weltstadt am Hudson. Wie in New York in der Frühe die Dollarjäger aller Grade, von den Kapitänen der Industrie bis herab zu den gemeinen Soldaten, in Bataillonen zu der Jagd auf den Dollar ziehen, zu Fuß und zu Wagen, so ziehen in Berlin die Markjäger auf die Markjagd. Und sie sind Virtuosen darin – genau wie in New York.
Ich kam an einem Sonntag um 3 Uhr in eine Konditorei und verlangte Pfannkuchen.
»Wir haben keine!« erwiderte lächelnd die Verkäuferin.
Ich, erstaunt: »Aber da liegen ja ganze Berge!«
Sie, lächelnd: »Ja, die sind für Gäste; verkaufen dürfen wir nach 2 Uhr nicht mehr.«
Der Geschäftsführer, milde: »Wie viel Pfannkuchen wünscht denn der Herr?«
Ich: »Acht Stück!«
Der Geschäftsführer, ganz milde: »Das lässt sich machen. Setzen Sie sich hin, bestellen Sie neun Pfannkuchen, essen Sie einen davon, und lassen Sie sich die anderen einpacken. Oder – gehen Sie wieder zu dem Fräulein und ersuchen sie um die acht Pfannkuchen, die Sie gestern bestellt haben.«
Ich, nachdem mir ein Licht aufgegangen ist: »Ausgezeichnet! Danke verbindlichst! Fräulein – ich meine die acht Pfannkuchen, die ich gestern bestellt habe.«
Sie, durchtrieben lachend: »Ach so – das ist etwas anderes!« Und ich zog mit meinen Pfannkuchen ab.
Das ist geschäftliche Virtuosität erster Klasse, die mir schmunzelnde Hochachtung abnötigte. Ich dachte an das belegte Butterbrot, das in den New Yorker Restaurants am Sonntag dem Durstigen zu Bier oder Whisky hingestellt wird, auf Kosten des Wirts, weil dieser nach dem Gesetz Alkohol am Sonntag nur zu einer Mahlzeit abgeben darf. Der höchste amerikanische Gerichtshof hat nämlich entschieden, dass ein belegtes Butterbrot eine »Mahlzeit« ist. Niemand isst es freilich, weil es von einem Tisch zum anderen wandert. Der New Yorker und der Berliner können geschäftlich Brüderschaft trinken. Gibt es in Berlin nicht »Schieber« und »Geschobene« (du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben)? Was ich von allerlei »Schiebungen« gehört habe, kann der geriebenste New Yorker »Schieber« nicht besser machen. Ich könnte himmlische Schiebergeschichten erzählen. Aber ich werde mich hüten. Ich warne Neugierige! Man braucht nur das Berliner Straßenbild zu beobachten, um sehr bald den Eindruck zu gewinnen: Hier braust New Yorker Leben. Ich kenne keine Geschäftsstraße in New York, wo die Menge in größerer Dichtheit und Gedrängtheit sich dahin wälzt als etwa am Potsdamer Platz, in der Leipziger Straße, in der Friedrichstraße und an vielen anderen Orten. Und dann die frische, sprudelnde Lebendigkeit, das Fortschrittliche im rein Städtischen, von dem ich sprach. Es springt niemand mehr in die Augen, als dem Menschen, der aus New York kommt, der munizipal rückständigsten aller Weltstädte. New York kennt nicht Berlins Reinlichkeit der Straßen oder ihre Beleuchtung, überhaupt nicht seine musterhafte Verwaltung. Und sollte man's glauben, dass die New Yorker Feuerwehr und die New Yorker Post, die beide vorzügliche Einrichtungen sind, trotzdem noch keine Automobile im Dienst verwenden? Und die Polizei beider Städte? In New York sind die Polizisten noch stattlicher und noch dicker als in Berlin, aber ihre Schmerbäuche verdanken sie den berühmten »Nebeneinnahmen«, die sie sich allenthalben, namentlich von Wirten und übel berufenen Häusern, beschaffen. Der Schmerbauch des Berliner Polizisten ist ehrlich erworben, mit Erbsen und Pökelfleisch oder Weißkohl mit Hammelfleisch.
Gewiss, in New York sind die »Blauröcke« (Bluecoats) sehr nette, liebenswürdige Leute. Man kann so einem blauen Riesen als Bekannter ruhig auf den breiten Rücken schlagen, dass es knallt, ihm lächelnd die Hand reichen und sagen: »Nun, Karlchen, wie geht's?« Das blaue Karlchen nimmt das ganz liebenswürdig auf. Ich weiß nicht, ob man das auch in Berlin kann. Vielleicht versucht's mal jemand und teilt mir schriftlich das Ergebnis mit. Sicherlich ist der Berliner Polizist eine ebenso nützliche wie angenehme Verzierung der Straße. Ich wenigstens fand ihn allemal freundlich und hilfsbereit. Er hat mir oft genug mitten auf dem Fahrdamm mit engelhafter Geduld aus seinem Taschenplan Straßen im dunkelsten Berlin gesucht. Nein, auf den Berliner Schutzmann von heute lasse ich nichts kommen, selbst wenn er einmal unsanft wird. Das kann »Karlchen« in New York noch viel mehr werden. Wenn »Karlchen« einen souveränen Bürger anherrscht »Move on«, und er geht nicht sofort weiter, so spürt er den schmerzhaften Buchsbaumknüttel in den Rippen. An der Friedrichstraße habe ich schon aus Schutzmannsmund gehört: »Aber meine Herrschaften, halten Sie doch das ›Trittoar‹ frei. Es kann ja keiner durch!« Nur eine sehr hübsche New Yorker Polizistensitte vermisse ich in Berlin. Wenn am Broadway oder an einer anderen gefährlichen Straßenkreuzung in New York Damen oder Kinder über den Damm wollen, so hält der Polizist mit majestätisch erhobenem Zeigefinger alle Wagen an und geleitet die Dame oder die Kinder von der einen Seite sicher an die andere; so ungefähr wie Moses die Kinder Israel durch das Rote Meer geleitete. Es ist ein überaus reizender Anblick, wenn das blaue »Karlchen« so eine ängstliche Großmama oder ein schönes, zartes Dollarprinzesschen oder zwei kleine Knirpse am Arm nimmt und ruhig durch die Brandung des Verkehrs steuert. Das sollte auch in Berlin so sein.
Was ließe sich nicht noch über städtischen Fortschritt in der Preußenmetropole sagen! Zum Beispiel über die Müllabfuhr, die in New York geradezu alttestamentarisch ist und die Verzweiflung aller Fortschrittlichen bildet, besonders der Hausfrauen. Alle Abfälle werden in New York vor die Türe gestellt, in zerbeulten Blecheimern. In den Küchenabfällen wühlen die Katzen und Hunde, ehe der städtische Kärrner sie in die offenen Wagen schüttet. Und die Asche fliegt beim gleichen Vorgang die halbe Straße herunter, den Leuten auf die Kleider oder in die offenen Fenster hinein. Doch über all das will ich mich nicht in Einzelheiten verlieren. Nur die Berliner Straßenbahn kann sich mit der New Yorker nicht messen. Sie ist nicht so rasch, nicht so elegant, nicht so hell erleuchtet, nicht so warm im Winter. Die schlecht geheizten Wagen – das ist das grässlichste. Meine Eisbeine vom letzten Winter mögen an den Direktoren heimgesucht werden! Und noch nicht einmal Umsteigekarten hat die Berliner Straßenbahn bei einem solchen Straßenlabyrinth! Aber man sagte mir, um die Annehmlichkeiten dieser Bahn voll zu würdigen, müsste ich Aktionär werden. Und vor allen Dingen: Man kann aus der New Yorker Bahn viel mehr herausschlagen, weil sie mehr Leute überfährt und Schadenersatz zahlt. Das ist für einen Dollarmacher keine zu unterschätzende Nebeneinnahme und ein Balsam für alle Grobheiten der Schaffner, vorausgesetzt, dass der Beschädigte Geld genug hat, um lange mit der Straßenbahngesellschaft zu prozessieren.





























