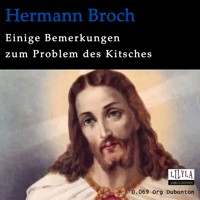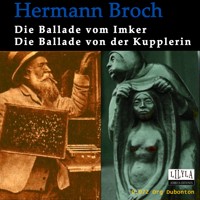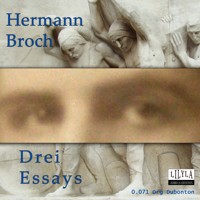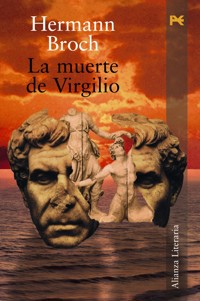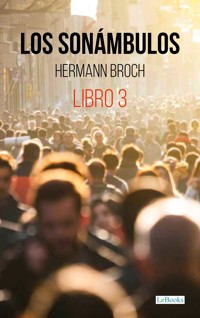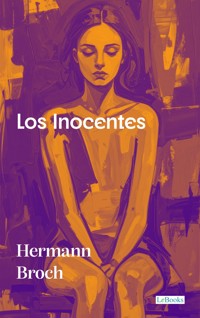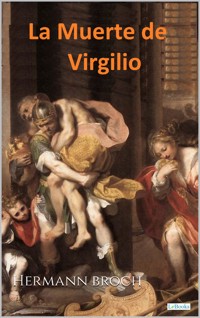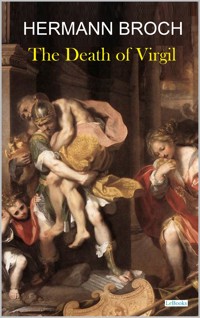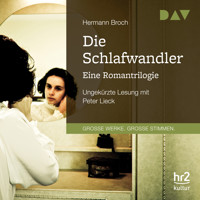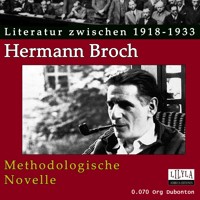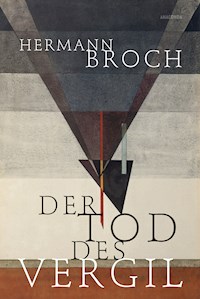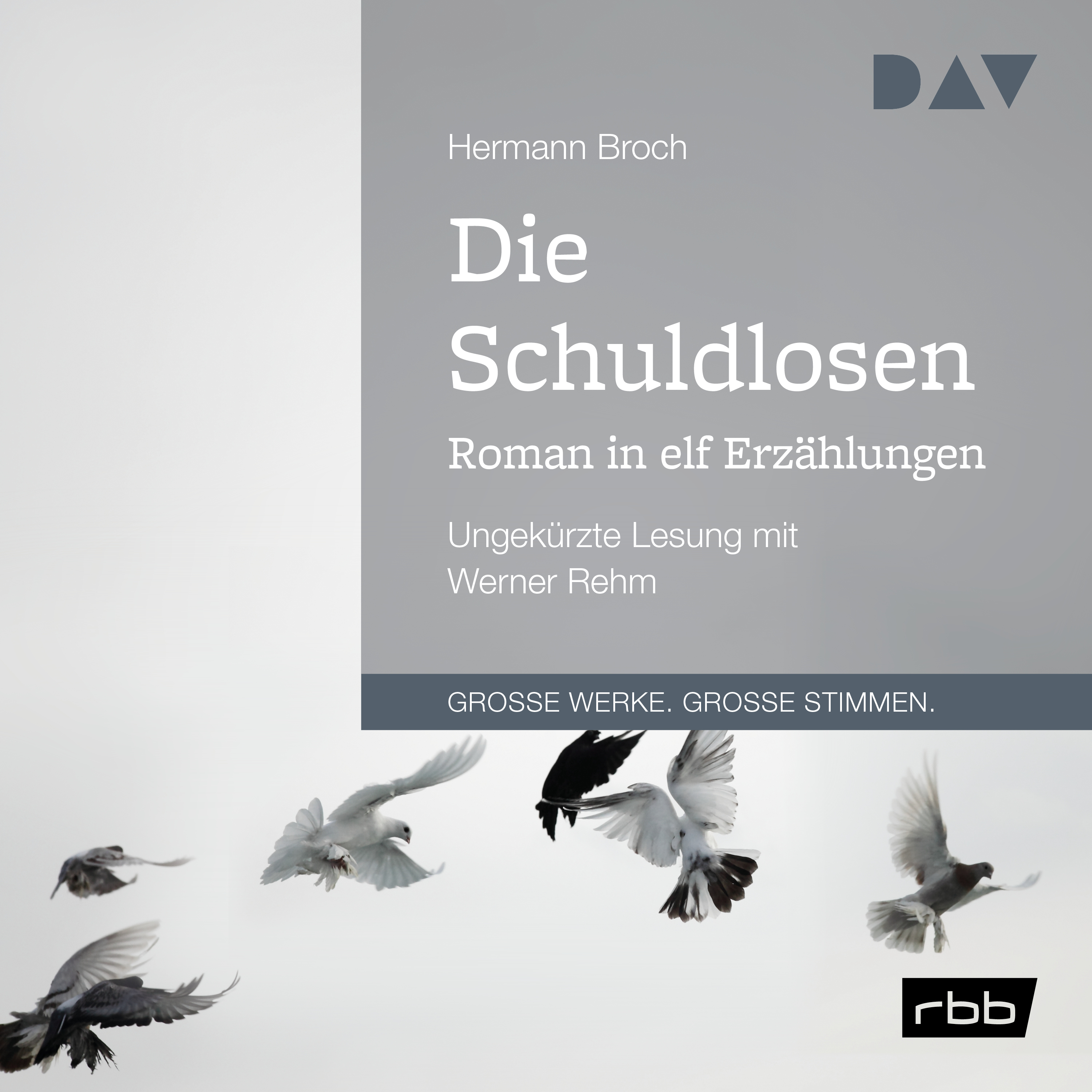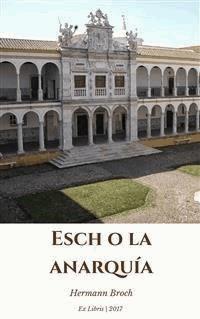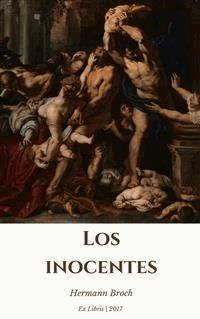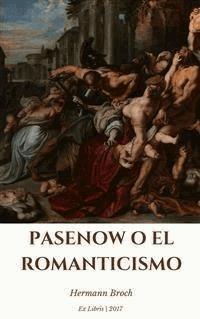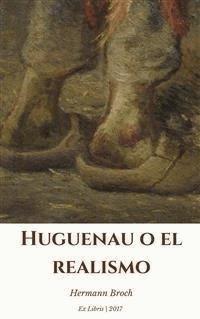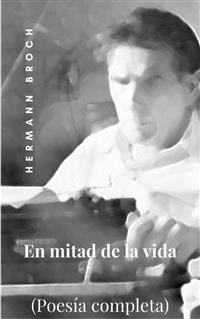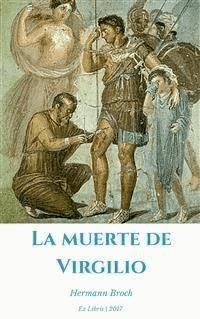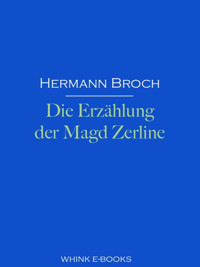
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: whink e-books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die Ballade der Zerline ist eine der größten Liebesgeschichten, die ich kenne, und mir persönlich vielleicht die liebste«. (Hannah Arendt) Hermann Brochs Werk, besonders seine ›Schlafwandler‹, wird häufig mit dem von James Joyce verglichen. Seine ›Zerline‹ ist ein idealer Einstieg, wenn man diesen viel zu unbekannten Autor kennenlernen möchte. Die kleine Erzählung stammt aus seinem Roman ›Die Schuldlosen‹ (1950) und handelt von einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung zwischen dem Baron von Juna und seiner Magd Zerline, erzählt aus der Perspektive der abhängigen, aber durchaus selbstbewussten Frau. Ihr Monolog wird zur Lebensbeichte, die so ganz nebenbei die gesellschaftlichen Verhältnisse demaskiert. – Mit einem Nachwort von Wolfgang Hink. Textvorlage Hermann Broch: Die Erzählung der Magd Zerline. In: H. B.: Die Schuldlosen. Roman in elf Erzählungen. Zürich. 1950.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
DIE ERZÄHLUNG DER MAGD ZERLINE
HERMANN BROCH
Erstdruck:Zürich 1950.
IMPRESSUM | COPYRIGHT
whink e-Books unterliegen (außer in den gemeinfreien Teilen) den Urheber- und Leistungsschutzrechten, insbes. dem § 70 des UrhG. Die Nutzung dieses e-Books ist ausschließlich zu privaten Zwecken erlaubt; es darf ansonsten weder neu veröffentlicht, kopiert, verteilt, vertrieben noch irgendwie anders verwendet werden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung. © 2025 whink e-Books10555 Berlin | Elberfelder Str. 12whink44@posteo.de
[102]
DIE ERZÄHLUNG DER MAGD ZERLINE
Die Kirchenuhren der Stadt hatten soeben in unordentlichem Durcheinanderhallen – bloß die barockal glockenspielartigen Klänge, welche die Schloßkirche droben auf der sanftgehügelten Stadthöhe ausschickte, hoben sich klarliniger heraus – die zweite Stunde angezeigt. Der sommerliche Sonntag wandte sich seinem Abstieg zu, langweiliger und wohl auch langsamer als jeder Wochentag, und A., auf dem Kanapee seines Wohnzimmers liegend, nahm es zur Kenntnis: die Langeweile des Sonntags ist eine atmosphärische; der Stillstand der Massenbetriebsamkeit hat sich der Luft mitgeteilt, und wer davon nicht ergriffen werden will, müßte den Sonntag mit doppelter und verdreifachter Arbeit ausfüllen. Wochentags hört man, selbst bei völliger Untätigkeit, keine Kirchenuhren.
Arbeit? A. dachte an die Kanzlei, die er sich im Geschäftsviertel der Stadt eingerichtet hatte; manchmal entfaltete er dort [103] eine geradezu hurtige Betriebsamkeit, öfters jedoch brachte er die Tage einfach in Untätigkeit dahin, freilich ohne daß seine Gedanken abließen, ums Geld und um Geldmöglichkeiten zu kreisen. Das ärgerte ihn. Der in ihm sitzende Spürsinn fürs Geldmachen hatte etwas Unheimliches an sich. Gewiß, er aß gern, er trank gern, und er liebte ein einigermaßen komfortables Leben. Aber er liebte nicht das Geld als solches; im Gegenteil, das Wegschenken war ihm eine Freude. Warum also diese unheimliche Leichtigkeit, mit der er, weit über seine Bedürfnisse hinaus, das Geld an sich heranzog? Das Problem der richtigen, soliden Geldanlage war für ihn stets schwieriger gewesen als das des Geldverdienens. Jetzt kaufte er Grundstücke und Häuser auf; mit entwerteter Mark bezahlt, kosteten sie ihn so viel wie nichts. Und doch hatte er keine Freude dran; es war wie lästige Pflichterfüllung.
Der Morgensonne wegen waren die Jalousien herabgelassen, und er war, trotz des Nachmittagsschattens, zu träge gewesen, sie wieder aufzuziehen. Freilich schadete das nichts; abgedämmert mochte der Raum kühler bleiben, und abends sollten die Fenster geöffnet werden. Immer wieder kehrte sich die Faulheit ihm zum Guten aus. Dabei war er nicht einmal richtig träge; er war bloß entscheidungs-schüchtern. Er vermochte dem Schicksal nichts abzutrotzen, nein, das Schicksal sollte für ihn entscheiden, und er unterwarf sich, freilich nicht ohne eine gewisse Wachsamkeit, ja Listigkeit, die um so notwendiger war, als diese Entscheidungsinstanz sich ein merkwürdiges System zu seiner Lenkung zurechtgelegt hatte: sie setzte ihm Gefahren auf den Hals, die er zu fliehen hatte, und die Flucht trug dann Geld ein. Seine rasende Angst vor dem Abitur, seine Angst vor den ertappenden Prüfern, denen das Schicksal das Furchteinflößende in die Hände gelegt hat, da sie um die letzten Geheimnisse des Prüflings wissen und ihn daher, als hätte er nie etwas gelernt, selber wissens-entleert machen, diese rasende Prüfungsangst hatte ihn vor fünfzehn Jahren zur Flucht nach Afrika getrieben; ohne einen Cent – der über das Gehaben des Sohnes erzürnte Vater hatte die Überfahrt und nichts darüber hinaus bezahlt – war er an der Kongoküste gelandet, entscheidungsschüchtern und geldlos, dennoch glücklich, weil es im Unvorhergesehenen keinen Prüfer gibt, wohl aber Schicksalsgläubigkeit: schicksalsgläubig war er damals geworden; es geschah in der Form eines wachsamen Dahindämmerns, und ebendarum, vielleicht infolge der Wachsamkeit, vielleicht infolge des Dahin[104]dämmerns, hatte es ihm fortab nie mehr an Geld gefehlt. Ob als Gärtnerbursche, als Kellner oder Clerk, er füllte solche Anstellungen, von denen er anfangs eine ganze Reihe innehatte, bloß so lange zufriedenstellend aus, als ihn niemand nach seiner Eignung und seinen Vorkenntnissen fragte; wurde er gefragt, so verließ er sofort den Posten, freilich jedesmal mit einer etwas größeren Summe in der Tasche, weil es jedesmal, wie das in den Kolonien eben ist, Gelegenheit zu vielerlei Nebengeschäften gegeben hat, und bald wurden die Nebengeschäfte zum Hauptgeschäft. Es verschlug ihn nach Kapstadt, es verschlug ihn nach Kimberley, es verschlug ihn in ein Diamantensyndikat, dessen Teilhaber er wurde, und immer war es sein Schicksal, das ihn dahin und dorthin verschlug, sein Ausweichen vor Unannehmlichkeiten, sein Ausweichen vor der Rede und Antwort, die er anderswo hätte stehen müssen; er konnte sich nicht erinnern, je wirklich mit seinem Willen eingegriffen zu haben, vielmehr war es stets die an Trägheit gemahnende Entscheidungslosigkeit gewesen, jene betriebsame Trägheit, die seine Schicksalsgläubigkeit war und mit der er es geschafft hatte. »Träge Lebensverdauung, träge Schicksalsverdauung«, sagte etwas in ihm und brachte ihn wohlzufrieden ins Heute zurück: mochte der Sonntag verrinnen und versickern, mochten die Jalousien geschlossen bleiben, es wird zum Guten ausschlagen.
Da wurde – vielleicht nach einem schüchternen Anklopfen die Tür zu einem Spalt geöffnet, und vogelgleich vorgestreckt erschien in diesem der Altweiberkopf der Dienstmagd Zerline: »Schlafen Sie?«
»Nein, nein … kommen Sie nur.«
»Sie schläft.«
»Wer?« Das war eine dumme Gegenfrage. Natürlich konnte bloß die alte Baronin gemeint sein.
Über die Runzeln huschte es verschmitzt, gleichsam wie eine Verächtlichkeitsbrise: »Die drin … fest schläft sie.« Und unmittelbar anschließend, einerseits als Beweis für die Ungestörtheit des Nachmittags, andererseits als sein erster Programmpunkt: »Die Hildegard ist ausgegangen … der Bastard.«
»Was?«
Sie war nun vollends ins Zimmer getreten, hielt sich in respektvoller Entfernung, aber der gichtischen Kniee wegen stützte sie sich mit der einen Hand am Kommodenrand auf: »Sie hat sie sich von einem andern machen lassen«, enthüllte sie, »die Hildegard ist ein Bastard.«
[105] So gerne er mehr darüber gehört hätte, er durfte darauf nicht eingehen: »Hören Sie, Zerline, ich bin ein Mieter hier, und solche Dinge sind nicht meine Angelegenheit … ich kann da nicht einmal zuhören.«
Sie schaute kopfschüttelnd auf ihn herab: »Sie denken doch daran … woran denken Sie?«
Ihr prüfender Blick ärgerte und beunruhigte ihn. War seine Hose nicht richtig geschlossen? Er fühlte sich unangenehm ertappt, und am liebsten hätte er ihr gesagt, daß er an seine Geldgeschäfte gedacht hatte. Doch was fiel ihr ein, daß er ihr Rede und Antwort zu stehen hätte? Er schwieg.
Sie spürte seine Betretenheit und gab nicht nach: »Es wird schon noch Ihre Angelegenheit, wenn sie zu Ihnen ins Bett kommen wird.