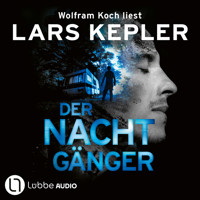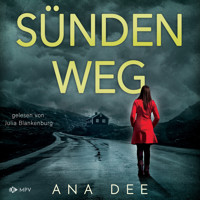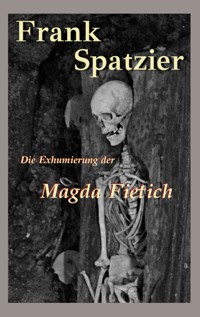
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein düsterer Friedhof, darauf zwei unheimliche Antagonisten: der Totengräber und der Totenheber. Es erfolgt die gespenstische Öffnung eines Grabes und die Exhumierung der Magda Fietich, von der vieles noch nicht gestorben ist. Dann die mystische Wandlung während eines außergewöhnlichen Rituals in der alten Kapelle und ein in die Katastrophe führendes Resonanzsystem aus Schuld, Angst und dem rastlosen Bösen. Denn mit Magda Fietich wird nicht nur ein Leichnam aus dem Grab gehoben, sondern mit ihm auch die konturlosen Dämonen aus dem Bodensatz eines verzweifelten Lebens. Die Exhumierung der Magda Fietich mag auf den ersten Blick als fantastische Fabel daherkommen, doch bei genauerem Hinsehen wird mit dem Grab nicht nur der Zugang zu einem verwesten Leichnam, sondern auch zum verschütteten Seeleben der Protagonisten eröffnet. Die Erzählung gliedert sich in drei Teile. Neben der eigentlichen Exhumierung wirkt im kurzen Intermezzo "Das Gespenst" nicht nur das grauenerregende Ritual fort, sondern auch die unheilvolle Energie des mittlerweile riesig gewordenen Friedhofs, der zu einem gespenstischen Eigenleben erwacht ist. "Magdas Martyrium" versetzt die mystische Geschichte in die Gegenwart der Hansestadt Lübeck, in der sich das Grauen vergangener Jahrhunderte beinahe nahtlos im Alltag einer durchschnittlichen Familie im schönen Stadtteil Sankt Jürgen fortsetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
Ein düsterer Friedhof, darauf zwei unheimliche Antagonisten: der Totengräber und der Totenheber. Es erfolgt die gespenstische Öffnung eines Grabes und die Exhumierung der Magda Fietich, von der noch vieles nicht gestorben war. Dann die mystische Wandlung während eines außergewöhnlichen Rituals und ein in die Katastrophe führendes Resonanzsystem aus Schuld, Angst und dem rastlosen Bösen - denn mit Magda Fietich wird nicht nur ein Leichnam aus dem Grab gehoben, sondern mit ihm auch die konturlosen Dämonen aus dem Bodensatz eines verzweifelten Lebens. Die Exhumierung der Magda Fietich mag auf den ersten Blick als fantastische Fabel daherkommen, doch bei genauerem Hinsehen wird mit dem Grab nicht nur der Zugang zu einem verwesten Leichnam, sondern auch zum verschütteten Seeleben der Protagonisten eröffnet.
Die Erzählung gliedert sich in drei Teile. Im kurzen Intermezzo Das Gespenst wirkt nicht nur das vergangene Ritual fort, sondern auch die unheilvolle Energie des mittlerweile riesig gewordenen Friedhofs, der zu einem gespenstischen Eigenleben erwacht ist. Magdas Martyrium versetzt die mystische Geschichte in die Gegenwart der Hansestadt Lübeck, in der sich das Grauen vergangener Jahrhunderte beinahe nahtlos im Alltag einer durchschnittlichen Familie im schönen Stadtteil Sankt Jürgen fortsetzt.
Inhalt:
Die Exhumierung der Magda Fietich
Das Gespenst
Magdas Martyrium
Der Autor
Die Exhumierung der Magda Fietich
Ein grauer Novembervormittag. Nieselregen und fallendes Laub von den Buchen und Eichen, die den Friedhof säumten. Warum nur hatte man früher keine Nadelhölzer gepflanzt, als die höchstamtliche und höchstpriesterliche Entscheidung gefallen war, ausgerechnet dieses erwiesenermaßen ausgesprochen fruchtbare Stückchen Land zum Totenacker zu erklären? Ein kühler Wind blies feindselig um die Grabsteine, wirbelte die graugelben Blätter umher, wälzte sie um, wirbelte sie auf, drückte sie durch allerlei unbekannte Öffnungen hinein in die heilige Friedhofskapelle, vielleicht sogar hinein in die mit blanken Särgen gefüllten Gruften, in denen sich frisch gestorbene Leichname in aller Behutsamkeit ihrem Verfall hingaben. Seit eh und je zieht besonders der Herbst das Sterbende und das Gestorbene an.
Das unablässige Rauschen des Windes und das leise Sirren des Nieselregens war alles, was ein menschliches Ohr zu hören vermochte, vielleicht noch das weit entfernte Gekreische heiserer Raben, Krähen, Aastauben, Geisterfinken, Sumpfgurken und anderer Totengreife. Es war kalt, kaum ein paar Grade über Null. Von der Sonne seit Tagen keine Spur, nur dicke, dunkle, hässliche Wolken, eisiger Wind und eine bis ins tiefste Knochenmark sickernde Nässe. Zwischen den hinter Glaskolben tänzelnden Grablichtern klebte der ein oder andere Nebelfetzen. Ein Wetter zum Sterben, Totbleiben oder Bestorben werden.
Vom rostigen Friedhofstor ziemlich weit entfernt, den Hauptweg hinunter und dann gleich rechts hinein, hinten bei den zittrigen Fichten, bibberten die Antagonisten in ihren langen Lodenmänteln mit den hochgestellten Krägen, die Filzhüte tief in ihre Stirne gezogen. Von Weitem gesehen, muteten sie kaum menschlich an, sahen aus wie schwankende Kegel oder konturenlose Spielfiguren, die zwar langsam, aber unaufhörlich hin und her pendelten, bodenwärts ohne erkennbaren Übergang Eins mit dem nassen Laub auf dem schmalen Kieselweg werdend. Außer diesen beiden hochgeschossenen Gestalten befand sich noch ein Häuflein kleinerer Menschenkegel und schließlich ein rundlicher Kasten mit grobgestaltigen Armaturen und ausladenden Greifarmen samt zangenförmiger Gebilde zu beiden Seiten auf dem Friedhof. Die Gestalten und der sonderbare Apparat hatten sich um ein Grab versammelt, das im Zentrum ihres Interesses zu stehen schien, denn sie alle hatten ihre Köpfe wie im stillen Gebet andächtig nach unten geneigt. Alle starrten sie auf die rechteckige Erdfläche, die an ihrem Kopfende von einer kleinen Platte aus Schiefer abgeschlossen wurde und ansonsten über keinerlei schmückendes Beiwerk verfügte. Lediglich ein kleines Grablicht mit einer munter tänzelnden Flamme hinter rötlichem Glas befand sich darauf. In der Nähe des Grabsteins lagen noch alte Säcke, ein Seil, einige Schaufeln und Kellen sowie eine rostende Grabgabel. Auch ein mit Öl verschmutzter Kanister und eine messingbeschlagene Truhe aus Zedernolz oder Wildkirsche waren darunter. Alles deutete darauf hin, dass ein erhebliches Maß an Arbeit bevorstand, für die man alle erdenklichen Arten von Werkzeugen benötigen würde.
—
Der Totengräber blickte seinem Gegenüber tief in die Augen, oder jedenfalls in jene eingefallenen Gesichtshöhlen, in denen sich gemeinhin Augen vermuten ließen. Sein spitzer Filzhut hatte sich voll mit Wasser gesogen, das ihm über Stirn und Nase an die Oberlippe rann und das er mit langer Zunge von Zeit zu Zeit in den Mund zog. Trotz seines schweren Mantels fror er mehr als bitterlich, was er unter Aufbietung aller erdenklichen Mühe, Disziplin und Übung vor seinem Gegenüber zu verbergen versuchte. Denn sein Gegenüber war sein Antagonist. Es war der Totenheber.
Der Totenheber war von großer, schlanker Gestalt, blasshäutig, stellenweise aufgedunsen und bestimmt einen ganzen Kopf größer als der Totengräber, dessen erbärmliches Frieren ihm nicht verborgen blieb, so sehr schlotterten seine Glieder. Auch dem Totenheber war kalt, auch der Totenheber fror und bibberte bitterlich, doch er wußte seinen feingliedrigen Körper bis hinab in jede Faser zu beherrschen, denn er musste jederzeit Herr des Geschehens bleiben, es war sein Tag, seine Stunde, sein Moment, an dem er sein schauriges Werk zu vollbringen hatte.
Der Totenheber hielt seinen Kopf jetzt leicht geneigt, um zum Totengräber und den Beihilfen zu sehen, die eigens gekommen waren, der grauenhaften Tätigkeit beizuwohnen, die nur Männer von seinem Schlage auszuführen in der Lage waren und für die es Jahre, gar Jahrzehnte der Vorbereitung, der Exerzitien, der asketischen Kontemplation und der schier endlosen selbstkasteienden Übung bedurfte. Zuweilen ging das Gerücht um, dass, um Totenheber zu werden, der Anwärter seine Seele verpfänden oder gar im strengen Zölibat als ein irdischer Bruder des Auferstandenen leben müsse, zumindest aber vom höchsten Klerus auserwählt und mit dem Blute Christi geweiht zu sein habe, bevor er das so schreckliche wie ungemein bedeutungsvolle Amt auf Lebenszeit annehmen dürfe. Ihre Zahl jedenfalls war sehr klein. Totenheber gab es so selten, dass viele glaubten, es habe im Laufe der Geschichte immer nur einen einzigen gegeben.
Dieser eine Totenheber also blickte streng zum Totengräber, zog eine Hand aus der Manteltasche und machte eine sanfte Geste, indem er seine himmelwärts geöffnete rechte Hand nach vorn ausgestreckt, langsam einen sanften Bogen beschreibend, von rechts nach links schwenkte. Es war die uralte Geste, mit der er den Beginn seiner Arbeit anzeigte, die von diesem Moment an nicht mehr abgebrochen werden konnte und ihren Lauf zu nehmen hatte, egal welche Richtung dieser auch immer einnehmen würde. Die Anwesenden erschauderten. Ein leises, ehrerbietiges Raunen kroch durch die Menschenkegel und den Apparat. Der Totenheber richtete sich hoch auf und ging ans Werk.
—
Ein halbes Jahr zuvor hatte des Totengräbers große Stunde geschlagen. Es war im beginnenden Sommer, zu jener wunderschönen Zeit, als der Baldrian an den Flussauen nach und nach zu blühen begann und seinen betörenden Geruch bis an den Rand des Dorfes schickte. Dort hatte der Totengräber seine kleine Werkstatt ganz am Ende eines ungepflasterten Weges hinter zerbröckelnden Wohnhäusern, in denen vornehmlich jene armen Menschen zu leben pflegten, die in nicht allzu ferner Zukunft auf dem kalten Präparationstisch im Häuschen des unermüdlichen Handwerksmeisters liegen würden - zur Salbung, Einbalsamierung oder Ausweidung, zur allerletzten Waschung, Gesichtsölung oder Wunderheilung. Je näher sie an der Werkstatt wohnten, sogar je öfter sie an ihr vorbeiliefen, desto weniger Zeit blieb ihnen in der Regel, und desto leichter hatte es auch der Totengräber anschließend mit seiner Arbeit. Das war allgemein bekannt.
Die Werkstatt des Totengräbers war sehr klein, nur zwei hölzerne Arbeitstische drängten sich zwischen Regalen, Schränken und Truhen, in denen sich dringend benötigtes Arbeitsmaterial und allerlei Werkzeuge stapelten: Mullbinden, Skalpelle, Scheren, Nasenhaken, Pechfässer, Nadeln, Füllmasse, Gasblasen, Klistiere, sowie allerlei Salben, Tinkturen, Pülverchen und glitzernde Kristalle, eine unüberschaubare Flut an Gegenständen, denen in all ihrer Verschiedenheit nur die eine düstere Tatsache gemeinsam war, mit Leichen in Berührung zu kommen, tief in Leichen einzudringen oder gar in ihnen verbleiben zu müssen. Durch eine trübe Fensterscheibe fiel an den seltenen guten Tagen ein bisschen Sonnenlicht, ansonsten bediente sich das stets sparsame Männlein zur Ausleuchtung seines engen Arbeitsbereiches lediglich rußender Pechkerzen, deren Flammen tänzelnde Schatten im eigenen Licht warfen.
In jenem frischen Juni also hatte der Totengräber schweigend vor seinem Präparationstisch gestanden und lange auf den nackten, wachsfarbenen Körper geblickt, der vor ihm lag. Es war der Leichnam einer älteren Frau mit fleckiger, rissiger, warziger Haut, teigigem Gesicht und winzigen Brüsten, die sich in keinem erwartbaren Verhältnis zu der ausladenden Breitbäuchigkeit oberhalb ihrer vernarbten Scham zu befinden schienen. Um den allgegenwärtigen süßlichbitteren Verwesungsgeruch aus der Luft zu vertreiben, hatte der Totengräber eine Handvoll grünlicher Weihrauchknollen auf eine glühende Kohlenscheibe in seinem Stövchen gelegt, bevor ihm ein Lächeln über seine Gesichtsfalten huschte, während sich der duftende Rauch immer dichter in der Werkstatt ausbreitete und den Leichnam von Magda Fietich in undurchdringliche Wolken hüllte. Eine ganze Nacht schließlich hatte der Totengräber in der Düsternis seiner verrauchten Werkstatt gearbeitet, oft schwebend zwischen Traum und Wachheit, zwischen Wirklichkeit und Visionen, dabei wie blind jenen Eingebungen folgend, die seine hohe Handwerkskunst regelmäßig in den Rang der erhabensten Perfektion zu versetzen vermochten.
Am nächsten Morgen war er erschöpft auf seine harte Liege getaumelt und ungewaschen aber stolz in einen sehr tiefen, traumlosen Schlaf gefallen. Im Nachbarzimmer, nur durch eine halb geöffnete Tür von seiner Schlafstätte getrennt, hatte der mit grauen Leintüchern umhüllte und zugenähte Leichnam die letzten Reste schleimiger Flüssigkeiten aus seinen Poren und Öffnungen ausgeschieden. Wie so häufig bei warmem Wetter, war auch das verwesende Fleisch dieses Leichnams von Gasen aus seinem Inneren sanft umher gestoßen worden. Der Totengräber hatte ganze Arbeit geleistet, den sehr schwer zu versorgenden Leichnam der Magda Fietich nach allen Regeln der hohen handwerklichen Kunst von innen und außen behandelt, viele bereits zu Lebzeiten im Faulen begriffene Hautfetzen entfernt, gegorenen Eiter aus Furunkeln, Abszessen und Karbunkeln abgelassen sowie die knapp zwei Quadratmeter der runzligen und bereits gelblich gefärbten Leichenhaut vom Drüsentalg befreit, gewaschen und anschließend gesalbt. Die Ruhe nach getaner Arbeit hatte er sich somit redlich verdient.
Doch allzu lange hatte sich der fleißige Mann nicht ausruhen dürfen, denn die angenehm warme Luft des Frühsommers hatte sich ungünstig auf die materielle Verfassung des leblosen Fleischklumpens ausgewirkt, dessen Zersetzung nicht zuletzt durch das Fehlen einer Kühleinrichtung rapide voranschritt. Denn trotz seiner hohen Handwerklichkeit und seines selbst weit über die Stadtgrenzen hinaus außergewöhnlich guten Rufes war der Totengräber ein armer Mann. Im Gegensatz zu der herausragenden gesellschaftlichen Bedeutung dieses Amtes verdiente man in diesem Gewerke nämlich nicht sehr gut, war von den Aufträgen der zumeist ebenfalls nicht wohlhabenden Kundschaft abhängig und hatte zudem noch ein umfangreiches Arsenal an in der Anschaffung und im Unterhalt überaus kostspieligem Spezialwerkzeug vorzuhalten, von den kostbaren Ölen, Essenzen und Tinkturen ganz zu schweigen.
In geübter Voraussicht hatte der Totengräber am Vortag vorgesorgt. Und so hatte draußen im Hofe vor seiner Wohnung und Werkstatt bereits ein fertiger Sarg bereitgestanden, in den er den recht gewichtigen Leichnam der Magda Fietich unter Zuhilfenahme zweier Flaschenzüge und einer rollbaren Bahre hineinbugsieren konnte. Anschließend wurde der Sarg mit einigen Schrauben verschlossen, von denen er wusste, dass ihre Aufgabe spätestens wenige Monate nach der Beerdigung erledigt sein würde, denn der Sarg der Verstorbenen war lediglich aus einfachstem Pressspan gearbeitet, der nach längerer Berührung mit der Erdfeuchtigkeit, den Fäulnisbakterien und allem anderen, was an ihm fleißig zu nagen hatte, recht schnell zerbröseln würde. Auch der Leichnam selbst - und damit das zerbrechliche Resultat seiner mühevollen Arbeit - würde schon kurz nach dem Verschließen des Grabes seinem endgültigen Zerfall in der feuchten Graberde anheim gegeben sein. Während der Totenfeier aber würde der Totengräber die für ihn sehr wertvolle Gelegenheit haben, die ihm zustehende Wertschätzung in Empfang nehmen können, nämlich dann, wenn der Leichnam kurz vor der Grablegung noch ein allerletztes Mal in der Friedhofskapelle vor den Augen der Trauergemeinde aufgebahrt würde.
Und so hatten die Ereignisse dann auch ihren streng geregelten Lauf genommen. Noch am selben Nachmittag wurde der Sarg der Magda Fietich mühsam in die kleine Friedhofskapelle überführt und dort vor den winzigen Altar gestellt. Sehr lange vor dem Eintreffen der Gäste hatte der Totengräber den Sargdeckel zur Aufbahrung der Überreste seiner Schutzbefohlenen sowie anschließend die Kapellentüre wegen des austretenden Fäulnisgeruchs geöffnet und einige der Leinenbinden vorläufig entfernt, um dem engen Familienkreis die Gelegenheit zu geben, die hohe Qualität seiner Arbeit an einigen ausgewählten Bereichen am Körper der Verstorbenen ausführlich in Augenschein nehmen zu können.
Ganz wie erwartet, war man mit seiner Arbeit nicht nur hochzufrieden gewesen, sondern geradezu gerührt angesichts der liebevollen Detailversessenheit des so kompetenten wie bescheidenen Handwerksmeisters. Anschließend hatte sich die kleine Prozession in bedächtigen Schritten zur Stelle des ausgehobenen Grabes begeben, in dessen Tiefe der Sarg schließlich für die Ewigkeit versenkt worden war. Eine Ewigkeit, die zunächst nur bis in den frühen Herbst andauern sollte, als die ersten Bedenken und Zweifel aus dem engeren Familienkreise bezüglich des abgeschlossenen Todesvollzugs der lieben Tante Magda laut geworden waren. Es war der Verdacht aufgekommen, ihre Seele sei wider Erwarten noch nicht in Gänze von ihr gegangen, hätte die Trennung vom physischen Leib noch nicht in einer endgültigen Weise vollziehen können, was an subtilen Hinweisen bezüglich des Verwesungsgrades ihres Körpers sowie aber auch anhand einer Serie unerklärlicher Geschehnisse in ihrem früheren Wohnumfeld hätte zu erkennen gewesen sein sollen.
So war es zum Beispiel recht häufig vorgekommen, dass bestimmte persönliche Gegenstände der Magda Fietich begonnen hatten, ein für alle Beobachter nicht erklärbares Eigenleben zu führen. Mal war ihre alte Haarbürste mit dem kostbaren Griff aus Elfenbein verschwunden und anschließend, nach sehr langem Suchen, auf einem Fenstersims im Obergeschoss wiedergefunden worden. Einige ihrer alten Schuhe hatten wie von Geisterhand bewegt das Schränkchen verlassen und waren mitten auf die Stufen der Kellertreppe gewandert. Magdas alte Haarnadeln hatte man immer wieder im Küchenschrank zwischen Lebensmitteln gefunden, wo sie niemand aus der Familie, nicht einmal im Scherz, hingetan hatte. Ihre alten Kleidungsstücke hatten sich zuweilen wild in ihrem verschlossen gehaltenen Sterbezimmer verteilt, eine gläserne Deckenlampe war nach heftigem und anlasslosem Pendeln klirrend von der Decke gestürzt, auch hatten sich offenbar ohne jeden Grund dicke Fettflecke auf ihrer Frisierkommode gebildet, die trotz allergrößter Mühen einfach nicht mehr zu entfernen gewesen waren, und die, jedenfalls bei längerem Hinsehen, deutlich erkennbare Züge ihres Gesichtes aufgewiesen hatten. Die ärgste Verängstigung der armen Familienmitglieder war jedoch durch das permanente nächtliche Geflüster verursacht worden, das stets mit dem tiefen Gefühl, ja der Gewissheit der Anwesenden verbunden gewesen war, sich nicht alleine im Raum zu befinden und gar argwöhnisch aus unmittelbarster Nähe beobachtet zu werden. Auf das Äußerste beunruhigt hatte sich die Familie daraufhin mehrfach an das frische Grab begeben und dort voller Verzweiflung versucht, betend Zwiesprache mit der alten Mutter und einigen zuständigen