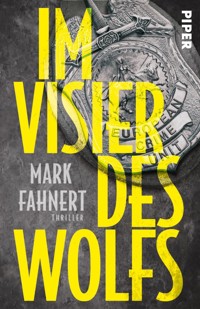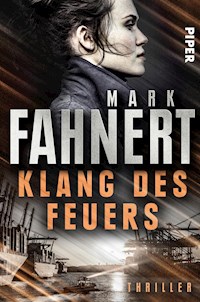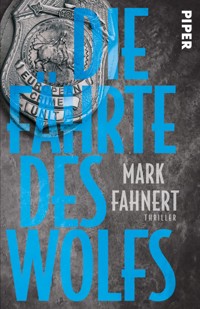
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Polizist hat dunkle Geheimnisse ... Lafdan Sadiku, Ermittler bei der European Crime Unit, und seine Führungsoffizierin Katrin Lesage werden nach Skopje in Nordmazedonien geschickt. Der dortige Polizeichef ist spurlos verschwunden, nachdem in seine private Wohnung eingebrochen worden war. Es fehlt zudem ein altes, grobkörniges Foto aus dem Safe. Lafdan wird bei der Beschreibung sofort hellhörig: Offenbar ist es das einzige Bild eines weltweit gesuchten Auftragskillers! Eines Mannes in einem Mantel, an dem ganz markant ein Knopf fehlt. Was Katrin bald vermutet, aber nicht glauben will und schon gar nicht beweisen kann: Lafdan hat dunkelste Geheimnisse. Was verheimlicht er über seine Vergangenheit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Fährte des Wolfs« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Covergestaltung: www.buerosued.de, München
Covermotiv: www.buerosued.de
Vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur.
Redaktion: Susann Harring
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vergangenheit
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Epilog
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vergangenheit
Rumänien, Karpaten, 1989
Es sind nicht immer die großen Schlachten, die das Gesicht der Welt verändern. Manchmal sind es die kleinen Geschehnisse. Sie bleiben zuerst unbemerkt, ziehen sich aber wie eine Fährte durch das Leben und enden dann erst wie ein Komet, der auf der Erde aufschlägt.
Der Junge atmete schwer. Der Schnee reichte ihm bis zu den Knien. Jeder Schritt schmerzte. Jeder Atemzug auch. Die klirrende Kälte brannte in seinen Lungen. Die beiden Männer mit den geschulterten Schnellfeuergewehren blieben stehen und unterhielten sich kurz. Ihre Worte wurden vom Wind weggetragen, verhallten zwischen den Felsen der Karpaten. Der Pfad, den sie beschritten, schlängelte sich am Felsmassiv entlang. Er war schmal, und auf der anderen Seite fiel er tödlich steil ab. Jeder Schritt Gefahr. Der kleinste Fehler konnte der letzte sein.
Der Junge schloss zu den beiden Männern auf. Hinter ihnen konnte er eine Betonbaracke erkennen, wahrscheinlich ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Strategisch günstig gelegen, um den Pfad verteidigen zu können.
Der Junge und die beiden Männer blickten sich an. In den Augen der Männer erkannte der Junge Erschöpfung und Todesangst. Jetzt trug der Wind gebellte Befehle zu ihnen herüber. Die Verfolger. Sie waren ihnen dicht auf den Fersen.
»Wir müssen etwas tun«, sagte der bärtige Mann. »Sie kommen näher.«
»Hier ist nichts. Wir können nur weiter fliehen«, sagte der junge Mann.
»Bis wir vor Erschöpfung umfallen? Du weißt, was die mit uns machen.«
Der junge Mann nickte, sagte aber nichts.
»Hey du.« Der bärtige Mann sprach den Jungen an. »Wolltest du nicht ein Held sein?«
Jetzt war es der Junge, der nicht antwortete, denn er wusste nicht so recht, was der Mann damit meinte. Er wusste nur, dass er diesen Wunsch hatte – er wollte ein Held sein, ja. Aber was konnte er in diesem Moment dafür tun?
»Siehst du den Bunker?«
»Ja.« Die Stimme des Jungen war nicht mehr als ein eisiges Krächzen. Wie der Ruf einer Krähe an einem nebeligen Wintermorgen.
»Kennst du die Legende des Himmelssoldaten?«
Der junge Mann packte den anderen am Ärmel, zog daran. »Lass das«, sagte er.
Der Bärtige riss sich los. »Wir wollen doch alle nur überleben.« Er blickte den Jungen an. »Du willst doch überleben, oder? Ist es nicht so?«
Er sprach plötzlich so schnell. Die ganze Zeit war er der Stillere von beiden gewesen. Wenn er etwas gesagt hatte, dann mit Bedacht. Und jetzt das?
»Ich hab dich was gefragt.«
Der Junge wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Die rauen Lippen kratzten über die eiskalte Haut. Überleben. Natürlich wollte er überleben. Seit zwei Tagen floh er mit den beiden Männern durch die Eiswüste, verfolgt von den Soldaten der Revolution. Hunger und Kälte zerrten an seinem Überlebenswillen. Was auch immer diese beiden Männer getan hatten, es musste extrem grausam sein, denn den Verfolgern musste es genauso ergehen wie ihnen. Mit dem Unterschied, dass sie diese Menschenjagd jederzeit beenden konnten. Die zwei Männer vor ihm hingegen mussten fliehen, bis sie entweder entkamen – oder starben. Warum nur hatte er sie in der Scheune versteckt? Was hatte er sich dabei gedacht? Ein besseres Leben? Nur, weil er den Männern des Diktators geholfen hatte? Wahrscheinlich. Er war überzeugt davon, dass der Diktator diesen Sturm der Freiheit überstehen würde. Er war überzeugt, dass danach eine klare Trennung zwischen Gewinnern und Verlierern gezogen werden würde – eine blutige Linie. Er hatte zu den Gewinnern gehören wollen. Aber jetzt war er sich nicht mehr so sicher, ob er die richtige Seite gewählt hatte.
»Natürlich will ich überleben«, sagte er.
Die Männer starrten einander an. Niemand sprach.
»Wie geht die Legende vom Himmelssoldaten?«, fragte der Junge.
»Es geht um einen Soldaten, der ehrenhafter nicht sein konnte. Ein Russe. Manche sagen, er hieß Ivan, andere sind der Meinung, es war Boris.« Der bärtige Mann nahm sein Schnellfeuergewehr von der Schulter und reichte es dem Jungen, der es zögernd annahm. »Wichtig ist, dass man ihm befohlen hatte, diesen Außenposten hier zu halten. Er sollte kämpfen, bis der Schnee rot war, bis man diese Berge nur noch ›die Blutberge‹ nennen würde. Boris oder Ivan hat versprochen, diesen Posten für immer zu halten und niemals nach Hause zurückzukehren. Niemals aufzugeben. Auch wenn es bedeute, die Leiter zum Himmel emporzusteigen. Und das hat er. Er hat Hunderten verfolgten Juden zur Flucht verholfen. Er hat hier gekämpft. Als man ihn Tage später fand, hockte er hinter der Deckung. Erfroren. Seine Haut soll ganz weiß gewesen sein. Die Augen hatte er zu den vorbeiziehenden Wolken gerichtet. Deshalb nannten ihn die Leute den Himmelssoldaten. Und man sagt, dass er auch heute noch diesen Posten hält, dass dieser Posten uneinnehmbar ist. Der Soldat ist bei dem, der hier das Unrecht aufhalten will.«
»Ich soll …?« Der Junge blickte erst zwischen den Männern hin und her und dann zurück. Dorthin, wo ihre Verfolger jeden Moment auftauchen konnten.
Der Bärtige nickte. »Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Sie werden jeden Moment hier sein. Und sie werden nicht damit rechnen, dass du den Pfad verteidigst. Die werden leichte Ziele sein.«
»Und ihr? Was macht ihr?«
»Wir werden Hilfe holen. Und zurückkommen. Versprochen.« Nachdem er das letzte Wort ausgesprochen hatte, beugte sich der bärtige Mann vor und drückte die beiden Schultern des Jungen. Beinahe wirkte es, als sei er stolz, den neuen Himmelssoldaten zu berühren.
»Aber …«, begann der Junge. »Wenn wir alle …«
»Sei nicht albern.« Er schüttelte gönnerhaft den Kopf. Sein Bart wehte im Wind. »Es ist wichtig, dass einer von uns den Treffpunkt erreicht. Unsere Informationen sind wichtig für den Fortbestand unserer Nation.«
»Wirklich?«
»Ja, das hier ist ein historischer Moment.« Er erhob sich, hielt aber inne, als er die strafenden Blicke des jungen Mannes spürte. Erst hielt er stand, aber zwei, drei Atemzüge später blickte er auf den schneebedeckten Boden.
»Es ist richtig, was wir tun«, beharrte er und stapfte davon.
Der junge Mann stellte sich neben den Jungen und gab ihm zwei Reservemagazine. »Das ist meine letzte Munition. Nimm sie und mach etwas Sinnvolles damit. Wenn du erfolgreich bist, brauche ich keine Munition mehr.«
Dann ging auch er davon.
Es dauerte nicht lange, und die Verfolger schälten sich aus der weißen Umgebung. Der Junge packte seine Waffe fester. Man konnte ihn verrückt nennen, aber in diesem Moment spürte er wirklich eine geisterhafte Präsenz. Es fühlte sich an, als wäre jemand bei ihm. Aber zwischen diesem Jemand und dem Jungen gab es einen Unterschied.
Der Junge würde nach Hause zurückkehren.
Kapitel 1
Den Haag, Niederlande, Gegenwart
Emily Rushford verließ das Gebäude, in dem das Kriegsverbrechersondertribunal untergebracht war. Sie ging die breiten Stufen hinunter, musste sich dann aber am geschwungenen Geländer festhalten. Ihr war plötzlich schwindelig. Das Grinsen dieses Mannes … mit welcher selbstherrlichen Arroganz er dort auf der Anklagebank saß. Wie konnte sich dieser Mann überhaupt im Spiegel betrachten? Malus Xhafa war der letzte mutmaßliche Kriegsverbrecher des Balkans. Die rechte Hand von Slobodan Milošević. Nach jahrzehntelanger Fahndung war er vor circa einem halben Jahr in Nicaragua festgenommen und ausgeliefert worden. Nun war er wegen Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Grausame Details wurden vor den Richterinnen und Richtern ausgebreitet. Massenhinrichtungen und öffentliche Folter. Alles im Namen irgendeines Grundes, der zu Krieg geführt hatte. Krieg. Etwas zutiefst Menschliches. Keine andere Spezies auf dieser Welt würde etwas erfinden, das der eigenen Art schadete. Selbst Affen, die Werkzeuge nutzen, um Nüsse zu knacken oder in der Erde zu graben, richten diese im Kampf nie gegen Rivalen. Nur der Mensch hatte eine Bombe erfunden, die alles vernichten konnte. Bei dieser Waffe gab es niemals Gewinner, nur Verlierer. Der einzige Unterschied war, dass die einen Verlierer schuldig waren, die anderen waren es nicht.
Das Schlimmste daran war jedoch, dass so ein Krieg immer Monster hervorbrachte. Und Dämonen. Dämonen wie Malus Xhafa. Normalerweise nannte man solche Menschen den Schlächter von irgendeinem Ort, an dem dieser Mensch sein grausames Verbrechen begangen hatte. Diese Bezeichnung reichte für Xhafa nicht. Deshalb nannte man ihn: den Menschenschlächter.
Und er saß da und grinste, als würde es ihn befriedigen, seine Grausamkeiten noch einmal durchleben zu dürfen. Er lächelte die Zeuginnen und Zeugen an, die dem Gericht von seinen Gräueltaten berichteten. Emily hatte genau auf diese Menschen geachtet. Noch immer waren sie voller Angst, saßen zusammengesunken auf dem Stuhl in der Mitte des Raumes. Ihre Worte kamen zögerlich, stotternd, was sich noch verschlimmerte, wenn sie vom Anwalt des Mörders ins Kreuzverhör genommen wurden. Bisher war jede Aussage wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Nur einmal versteinerten sich Xhafas Gesichtszüge. Eine Zeugin berichtete von einem Mord in Skopje im Jahre 1996. Aber alles, was sie wusste, war, dass das Opfer ein hohes Tier beim Militär gewesen war, Namen kannte sie nicht. Selbst die Vorsitzende Richterin hatte den Kopf geschüttelt. Es gab keine Beweise. Folgerichtig hatte Xhafas Anwalt darauf hingewiesen, dass diese Geschichte tatsächlich ein Beweis wäre – nämlich dafür, dass die Vorwürfe und Anschuldigungen gegen seinen Mandanten aus der Luft gegriffen seien.
Die Vorsitzende Richterin hatte genickt.
Er kam also davon. Das durfte nicht sein. Aber so war es. Er kam davon. Als Emily das Geländer losließ, fasste sie einen Entschluss. Es musste etwas geben. Dieser Mord in Skopje, so gering die Chance auch war, verdiente eine nähere Betrachtung. Es musste verdammt noch mal Beweise geben. Und Emily würde sie finden. Das Problem war nur, dass beim nächsten Verhandlungstag in drei Wochen die Beweisaufnahme abgeschlossen wurde. Danach kamen die Plädoyers und, nach derzeitigem Ermittlungsstand, der Freispruch. Emily hatte also drei Wochen, um etwas zu finden, das seit Jahrzehnten im Verborgenen lag.
Sie trat auf den Gehweg und sah auf. Ein ungepflegter, spindeldürrer Mann kam auf sie zu. Sie hatte ihn schon beim Verlassen des Gebäudes gesehen. Er hatte lässig an einer Hauswand gelehnt. Sein Schlendern wirkte wie zufällig. Zu spät erkannte Emily, dass sie ein Ziel war. Sein Ziel. Der Mann sprintete los, rempelte sie an und entriss ihr die Aktentasche. Sie packte fest zu, aber der Griff entglitt ihr schmerzhaft. Er stieß sie gegen das Geländer und flüchtete.
»Meine Tasche!«, schrie sie dem Mann hinterher. »Er hat meine Tasche!«
Die Passanten reagierten nicht. Sie starrten auf ihre Mobiltelefone oder blickten zu Boden. Manche machten sogar Platz, um nicht umgerannt zu werden. Was für eine Welt!
Emily rappelte sich hoch. Die Verfolgung war sinnlos. Der Mann hatte Vorsprung, und sie trug Absatzschuhe. Doch dann hörte sie einen Schrei. Sie sah, wie der Räuber gegen ein Auto geschleudert wurde. Ein Mann im blauen Anzug setzte nach, dann ein Tritt gegen die Hand. Emilys Tasche schlitterte über den Boden. Der Räuber zog ein Messer und fuchtelte damit vor dem Gesicht des Anzugträgers herum, während sich eine Traube Schaulustige bildete. Der Räuber rempelte sich durch die Menge und verschwand. Der Anzugträger hob Emilys Aktentasche auf und näherte sich ihr mit einem Lächeln.
So also sehen heute Engel aus, dachte sie. Eine fein geschnittene Nase, dünne Lippen und makellose Haut. Unter dem Anzug zeichnete sich ein Körper ab, der gut und gerne in einer dieser Softdrink-Werbungen die Hauptrolle spielen könnte.
Er sprach sie an. Emily tippte auf Niederländisch. Sie verstand die Worte nicht, sie hörten sich aber nett an. Er lächelte weiter und reichte ihr die Tasche.
»Geht es Ihnen gut?«, fragte er. Dieses Mal in einem Englisch, das man nur auf sündhaft teuren Universitäten lernte.
»Vielen Dank.« Sie nahm ihre Tasche. »Ist bei Ihnen alles in Ordnung?«
Er zuckte mit den Schultern. »Nichts passiert.«
»Sie haben mir quasi das Leben gerettet.«
»Eine Aktentasche zu verlieren, bedeutet nicht, das Leben zu verlieren.«
»Kommt auf den Inhalt an.«
Er lächelte wieder. Auf der anderen Straßenseite befand sich ein kleines Café. Draußen standen ein paar Tische unter roten Sonnenschirmen. Er deutete dorthin.
»Möchten Sie mir davon erzählen? Bei einer Tasse Kaffee?«
Natürlich wollte Emily das. Nicht nur, um ihm für seine Hilfe zu danken.
»Aber ich zahle«, sagte sie.
»Sehr gerne. Ich habe nämlich keine Brieftasche dabei.«
Nur wenige Minuten später saßen sie vor zwei Tassen Kaffee. Emily nahm ihren Keks und tunkte ihn ein. Sie brauchte jetzt unbedingt etwas Süßes.
»Wie heißen Sie eigentlich?«, fragte sie.
»Nathan. Nathan Born.«
»Sehr erfreut. Ich bin Emily Rushford.«
So etwas wie Überraschung huschte über sein Gesicht. »Warten Sie. Ich glaube es nicht. Ich meine … die Emily Rushford?« Die Betonung klang deutlich heraus.
Jetzt war es Emily, die lächelte, was aber eher ihre Verlegenheit ausdrückte. Sie nickte knapp. »Genau die.«
»Wahnsinn. Ich lese jeden Ihrer Artikel.«
Emily war es gewohnt, erkannt zu werden. Sie hatte vor drei Jahren den Pulitzerpreis erhalten. Für eine Reportage über den immer noch schwelenden Konflikt auf dem Balkan. Damit hatte sie polarisiert, denn sie hatte auch das politische Versagen der USA und weiterer Staaten argumentativ seziert und an die Öffentlichkeit gebracht. Sie hatte nur nicht gedacht, dass ihre Berühmtheit über den Großen Teich reichen würde. Zumindest hatte man ihr bisher nicht das Gefühl gegeben, dass dem so war.
»Sind Sie wegen des Kriegsverbrecherprozesses hier?«, fragte Nathan.
»Als Gerichtsreporterin.«
»Wie läuft es? Viele Informationen dringen bisher nicht nach außen.«
Die Anwälte Xhafas hatten eine Vereinbarung mit dem Gericht getroffen. Zum Schutz der Privatsphäre ihres Mandanten. Es durften keine Einzelheiten an die Öffentlichkeit dringen. Nur allgemeine Berichterstattung war erlaubt. Details durften erst im Falle einer Verurteilung bekannt werden. Ungewöhnlicher Deal, aber wenn es der schnellen Wahrheitsfindung diente, warum nicht. Ansonsten hätten die Anwälte den Prozess mit Befangenheitsanträgen und Beweiserhebungen lahmgelegt. Da war Emily sich ziemlich sicher.
»Wir müssen alle bis zum Urteil warten«, sagte sie.
»Ist das denn wahrscheinlich? Nach so langer Zeit? Viele potenzielle Zeugen müssten doch schon längst verstorben sein.«
Emily nickte. »Größenwahnsinnige Menschen hinterlassen aber immer Spuren.«
»Deswegen war es so wichtig, dass Sie die Tasche wiederhaben.«
»Was meinen Sie damit?« Sie runzelte die Stirn.
»Sie sind Reporterin. Ich denke, Ihre Notizen befinden sich in der Tasche. Die ganze große Story sozusagen.«
Zum ersten Mal fühlte sie sich in seiner Gegenwart unwohl. In seinen Worten klang der Hauch einer Gefahr mit. Sie fragte sich, welchen Grund es dafür geben sollte. Ihr Zusammentreffen war dem Zufall geschuldet.
Er legte den Kopf schief.
»Ist irgendwas?«
»Nein, wie kommen Sie darauf?«
»Sie wirken nach meiner letzten Äußerung etwas reserviert.« Jetzt schwang keine Drohung mehr zwischen den Wörtern mit.
Emily merkte selbst, wie blöd ihre Gedanken gewesen waren. Sie versuchte, die Situation mit Humor zu retten. »Ich war nur verwundert wegen Ihrer Äußerung.«
»Bezüglich der ganz großen Story?«
»Ja. Sind Sie Detektiv?«
»Investmentbanker.«
Emily lachte und schüttelte den Kopf.
»Was ist so lustig daran? Oder steht mir ein so langweiliger Job nicht?«
»Um ehrlich zu sein, habe ich mir einen Investmentbanker anders vorgestellt. Irgendwie kleiner und schwächer.«
Er zwinkerte ihr zu. »Und nicht so verdammt gut aussehend, richtig?«
Ja, auch das, dachte Emily, aber das brauchte er nicht zu wissen. Er platzte ja jetzt schon vor Selbstvertrauen. Emily entschied, Nathan noch ein wenig zappeln zu lassen und dann zu schauen, was der Tag noch so brachte. Davon hatte sie schon eine vage Vorstellung, und ja, es hatte mit weichen Matratzen und sehr viel Schweiß zu tun.
»Ich gehe mir mal die Nase pudern.« Emily stand auf. »Sind Sie noch hier, wenn ich zurückkomme?«
»Möchten Sie, dass ich noch hier bin, wenn Sie zurückkommen?«
Emily biss sich keck auf die Unterlippe, nickte dann und betrat das Café. Auf dem Weg zu den Waschräumen beobachtete sie ihn, wie er am Tisch saß und die Speisekarte studierte. Eine gute Idee, vorher etwas zu essen, dachte Emily. Als sie aber von der Toilette zurückkam, saß Nathan nicht mehr am Tisch. Dafür lag ein Umschlag unter ihrer Kaffeetasse. Ihr Vorname war kunstvoll mit einem Füllfederhalter darauf geschrieben. Sie entnahm ihm einen ebenfalls handgeschriebenen Zettel und las.
»Miss Rushford, wir schätzen Ihre Berichterstattung ganz und gar nicht, ließen Sie in der Vergangenheit jedoch gewähren. Das gilt aber nicht für diesen Fall. Deswegen möchten wir Sie höflich darum ersuchen, keine weiteren Recherchen zum laufenden Prozess durchzuführen. Glauben Sie uns, es ist in Ihrem eigenen Interesse. Sie möchten doch auch weiterhin ungestört Ihre Artikel veröffentlichen, nicht wahr?«
Es fehlte nur »Mit freundlichen Grüßen«.
Der Schein trog. Egal, wie freundlich und höflich diese Worte waren, es war eine knallharte Drohung. Die Worte sollten Angst machen. Und das gelang ihnen auch. Für Emily kein Problem. Angst gehörte zum investigativen Journalismus dazu, zwang sie doch zu umsichtigem Vorgehen, mahnte zur Vorsicht. Sie war dieses Gefühl gewohnt, trotzdem war es dieses Mal anders. Sonst wusste sie immer, vor wem sie Angst haben musste. Dieses Mal nicht. Hinzu kam die Wahl der freundlichen Worte. Solche Menschen hatten die Gewalt kultiviert. Solche Menschen sahen brutale Handlungen als legitimes Vorgehen zum Erreichen ihrer Ziele an. Dadurch hatten sie kein Unrechtsbewusstsein, eher das komplette Gegenteil, was sie niemals zögern ließ. Das machte sie noch gefährlicher. Ihr zwischenzeitliches Gefühl hatte sie also nicht getäuscht. Nathan war ein Arschloch. Höflich zwar, aber ein Arschloch blieb, was es war, egal, wie sehr man es verkleidete. Sie steckte den Brief zurück in den Umschlag und verstaute diesen in ihrer Aktentasche. Was jetzt, dachte sie. Aufgeben oder die Jetzt-erst-recht-Mentalität? Emily überlegte.
Erst Angst ermöglicht Mutigsein. Sie nahm ihr Mobiltelefon und rief eine Freundin an, die sie schon viel früher hätte anrufen sollen.
Also die Jetzt-erst-recht-Mentalität.
Einen weiteren Pulitzerpreis bekam man schließlich nicht fürs Aufgeben.
Kapitel 2
Rozvadov, Tschechien
»Sie sind sich wirklich sicher, dass Sie das durchziehen möchten?«
Katrin Lesage blickte Lafdan Sadiku tief in die Augen. Seine Besorgnis war beinahe schon niedlich. Und sie war echt. Katrin konnte auch das in seinem Blick erkennen.
»Ich bin schon groß«, sagte sie. »Ich kriege das hin!«
»Jemand anderes könnte doch … jemand mit der speziellen Ausbildung und mehr Erfahrung.«
»Es geht nicht anders, das wissen Sie.«
Er nickte. Lafdan konnte bei solchen Dingen auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Er handelte immer überlegt und konsequent, um seine polizeilichen Ermittlungsziele zu erreichen. Manche nannten sein Vorgehen bedingungslosen Pragmatismus, andere rechtswidrige Maßnahmen.
Katrin selbst war da ganz anders aufgestellt. Normalerweise. Sie prüfte jede polizeiliche Maßnahme darauf, ob sie das geringste geeignete Mittel zur Erreichung des Ziels darstellte und ob der polizeiliche Eingriff in die Grundrechte im richtigen Verhältnis zum Verfolgungsanspruch des Staates oder der abzuwehrenden Gefahr stand. Damit war sie bisher sehr gut gefahren und wollte, dass auch Lafdan sich eher in diese Richtung orientierte. Ihr war bewusst, dass man einen alten Baum nicht mehr verpflanzen konnte, aber man konnte seine Krone ein wenig stutzen. Dabei musste man allerdings vorsichtig sein, sonst gingen so alte Bäume ein.
Dennoch hatte sie sich fest vorgenommen, Lafdan zu zeigen, dass ihre Herangehensweise an polizeiliche Sachverhalte auch zu Ermittlungserfolgen führte, aber mit weniger Ärger und Stress mit vorgesetzten Personen und Justizbehörden.
Doch manchmal passierten Dinge, die Pläne nicht nur geringfügig, sondern grundlegend änderten. Völlig unerwartet gab es in einem von Katrins Fällen neue Ermittlungsansätze. Der Fall Rozvadov. Innerhalb von neun Jahren hatte ein unbekannter Täter sieben Frauen entlang der A6 und B50 in der Nähe der Grenze zu Tschechien ermordet. Zwei Morde ereigneten sich allein im letzten Jahr. Mutmaßlich ein Serienkiller. Es gab kaum Ermittlungsansätze, außer einer nicht zuzuordnenden DNA-Spur, extrahiert aus Blut und Hautpartikeln, die unter den Fingernägeln eines der Todesopfer gefunden worden waren. Sie musste ihren Mörder gekratzt haben. Diese Spur war mittlerweile drei Jahre alt und hatte bisher nicht zum Täter geführt.
Doch nun hatte sich eine Überlebende bei der Polizei gemeldet: Jenna Pavlov.
Sie wäre das jüngste Opfer des Täters gewesen, hatte aber im letzten Moment fliehen können. Jenna war monatelang wie in einer Zelle gefangen gehalten worden. Einer Zelle mit Mauern aus Angst und Gitterstäben aus Selbstzweifeln. Sie war eine junge Frau, die man als Opfer des Systems bezeichnen konnte. Sie hatte eine rosige Zukunft vor sich gehabt, hatte studieren wollen, aber nicht das Geld dazu. Um sich ihren Traum dennoch erfüllen zu können, hatte sie nach Lösungen gesucht und den vermeintlich schnellsten Weg gewählt: den Truckerstrich. Man könnte diese junge Frau dafür verurteilen, aber wäre es nicht richtiger, die Männer zu verurteilen, die ein solches Betätigungsfeld erst möglich und notwendig machten?
Als Katrin so darüber nachdachte, keimte Hass in ihr auf, blinde Wut. Auf das System. Auf die Bürokraten, die glaubten, besser zu sein, weil sie etwas zwischen den Beinen hängen hatten. Jenna hatte keine finanzielle Unterstützung bekommen, was mit irgendwelchen Paragrafen begründet wurde. Eine Entscheidung, die dennoch willkürlich wirkte. Wie so viele bürokratische Entscheidungen. Katrin wischte ihre düsteren Gedanken beiseite und atmete tief durch. Vielleicht war das ein Grund, warum Lafdan so handelte, wie er handelte?
Katrin fokussierte sich auf das Hier und Jetzt. Sie war nun die Überlebende. Äußerlich zumindest. Im Spiegel betrachtete sie die kurzen roten Haare. Die standen ihr erstaunlich gut. Die Tönung verdeckte ihr natürliches Aschblond. Vielleicht war Rot eine dauerhafte Option? Ganz sicher war sie sich nicht. Lafdan wollte sie nicht fragen, von ihm kamen höchstens blöde Sprüche. Und die konnte Katrin gerade ganz und gar nicht gebrauchen. Auch dann nicht, wenn sie kollegial gemeint waren.
»Ich frage mich, was besser gewesen wäre«, sagte Katrin zu ihrem Spiegelbild und beugte sich dann hinunter, um die Schnürsenkel der Boots zu schnüren.
»Sollen wir die Funktionen testen?« Lafdan deutete auf den versteckten Funk. Katrin trug einen Ohrstecker, der wie ein besonderer Ohrring aussah. Dazu ein Armband, von dem zwei Kettchen bis zu einem Ring liefen. Im Armband befand sich ein kleiner Sender, und im Ring war das Mikrofon. Katrin fuhr sich mit den Fingern noch einmal durch die Haare und verließ dann den Container. So nannten Observationskräfte den künstlich geschaffenen Raum in der Nähe des Zielobjekts. Ihr Container war ein alter Lieferwagen mit verblasster Werbeaufschrift einer Pizzeria. Sie schloss die Schiebetür und ging ein paar Schritte in Richtung des Flachdachgebäudes. Bei den ersten Schritten wankte sie. Taten sie wirklich das Richtige? Niemand sonst war davon überzeugt.
Das war auch der Grund, warum sie, Lafdan und Ellen, die neue spanische Polizistin in der European Crime Unit, den Einsatz nur zu dritt bewältigten. Ellen war schon in der Raststätte. Katrin fragte sich, warum Ellen hier überhaupt mitmachte, denn damit missachtete sie eine direkte Anordnung ihres Führungsoffiziers. Lag es daran, dass Ellen und Lafdan irgendetwas verband? Katrin wusste nicht, was es war, aber sie spürte, dass die beiden einander schon länger kannten. Auch wenn beide professionell genug waren, es zu verheimlichen, doch niemand konnte über einen Zeitraum von zwei Monaten alles verbergen. Erst recht nicht bei der Polizei, schließlich gehörte das Aufdecken von Geheimnissen hier zum Anforderungsprofil. Jeder hatte das Recht auf eine Beziehung, aber eine Beziehung zwischen Cops wirkte unprofessionell, fand Katrin. Wenn sie dann auch noch auf derselben Dienststelle waren, wurde es noch schwieriger. Es gab so viele Argumente dagegen, dass die Argumente dafür sofort verblassten. Aber wer war Katrin schon, darüber ein Urteil zu fällen?
»Geht es Ihnen gut?« Lafdans Stimme kam aus dem Ohrstecker.
»Was meinen Sie?« Katrin brauchte keine Sprechtaste zu drücken. Die Funkverbindung blieb ständig aufgebaut, wie bei einer Konferenzschaltung am Mobiltelefon, nur dass sie die einzige Teilnehmerin war und durchgängig sendete.
»Sie atmen schwer. Das kann ich hören.«
Verdammte Technik. »Alles gut«, sagte Katrin.
Sie kam jetzt vor der Raststätte an. Zwischen den vielen Lkw standen ein paar vereinzelte Pkw. Die Autobahn 6 war eine Haupttransportroute zwischen dem Osten und dem Westen der Europäischen Union. Dementsprechend rollten viele Lastkraftwagen über den Asphalt. Viele zahlende Kunden für Raststätten wie diese hier. Und auch für die Damen, die sich den gestressten Fahrern anboten. An solchen Haupttransportrouten gab es viele Möglichkeiten, Geld zu machen. Leider boten sie auch für Serienmörder zahlreiche Gelegenheiten.
»Sind Sie sich sicher, dass er kommt?«, fragte Lafdan.
»Warum sollte er es nicht?«, antwortete Katrin.
Sweety69. Das war der Nickname ihrer Verabredung. Eigentlich war es Jennas Verabredung. Sweety69 und Jenna hatten sich in einem Selbsthilfeforum für Opfer von Gewaltverbrechen kennengelernt. Erst hatten sie wiederholt auf die gleichen Beiträge geantwortet, dann waren sie im selben Gruppenchat gelandet, und schließlich hatten sie einander private Nachrichten geschrieben. Er war angeblich ausgeraubt worden. Drei Männer, mitten in der Nacht. Die Täter waren in die Fahrerkabine seines Lkw eingedrungen, hatten ihn mit einem Messer angegriffen und dann blutend auf den Parkplatz geworfen. Wie Müll. Anschließend waren sie mit dem Lkw über seine Beine gefahren. Er hatte Jenna geschrieben, dass es besser gewesen wäre, an diesem Abend zu sterben. Doch er lebte. Jeden Tag quälte ihn die Erinnerung an den Schmerz, an die Todesangst. Das hatte Jenna dazu bewogen, von sich zu erzählen, von den 74 Stunden in der Gewalt des Serienkillers. Sie hatte über ihre Ängste gesprochen, über die schrecklichen Erfahrungen. Jedes Detail. Als sie kurz darauf zur Polizei ging, hatte sie angegeben, dass sich in ihr etwas gelöst hätte, weil sie glaubte, einen Seelenverwandten gefunden zu haben. Eine helfende Hand zurück in die Welt.
Doch dann hatte Sweety69 sein wahres Gesicht gezeigt. Er hatte ihr geschrieben, dass sie noch etwas hätte, was ihm gehöre. Das Paar Schuhe, das sie am Abend vor zehn Monaten getragen hätte. Es gäbe nur eine Sache auf der Welt, die ihn sexuell befriedigen würde: die Schuhe toter Frauen.
»Warum er nicht kommen sollte?«, fragte Lafdan. »Vielleicht, weil er ein Mörder ist?«
»Ich bin jetzt vor der Gaststätte und gehe rein«, sagte Katrin.
»Seien Sie vorsichtig«, sagte Lafdan.
Das Innere der Tank- und Rastanlage war genau so, wie man sich das Innere einer Tank- und Rastanlage vorstellte: Am Eingang standen diese blinkenden Geldspielautomaten und die Groschengräber mit den Greifarmen. Katrin hatte das Gefühl, die Plüschfiguren in ihrem Glasgefängnis würden sie traurig anblicken. Dahinter lag der Gastraum, der mit seinem abgelaufenen grauen Linoleumboden und dem zweckmäßigen Mobiliar alles andere als gastlich aussah. Die gemauerte Theke machte da einen einladenderen Eindruck. Dort saßen einige Trucker, die meisten über ihr Bier und eine Bockwurst mit matschigem Kartoffelsalat gebeugt. Ganz hinten standen zwei Billardtische. Das Aneinanderklackern der Kugeln und der anschließende Freudenschrei rissen Katrin aus dem Beobachtungsmodus. Da war Ellen, die mit zwei jungen Männern spielte. Sie war keck gekleidet: weiße Sneakers, enge Jeans und ein etwas zu knappes T-Shirt mit Wednesday-Aufdruck. Bei nahezu jeder ihrer Bewegungen blitzte der muskulöse Bauch hervor.
Katrin setzte sich an die Theke.
Die Bedienung kam zu ihr und wischte sich im Gehen die Hände an der fleckigen Schürze ab. »Hallo, Schätzchen. Was trinken?«
»Ein Wasser.«
»Sie kommen mir irgendwie bekannt vor.« Sie kniff die Augen zusammen und musterte ihren Gast.
»Ich war lange nicht mehr hier«, sagte Katrin.
Jenna war öfter hier gewesen. Bis zu ihrer Entführung sogar jeden dritten Tag, um sich mit Männern einzulassen, die hier an der Theke lungerten. Manchmal war der scheinbar einfache Weg, an Geld zu kommen, auf den zweiten Blick doch nicht so einfach. Katrin fragte sich, wie willensstark Jenna gewesen sein musste.
»Bitte schön.« Die Bedienung stellte ihr ein Glas Wasser hin.
»Ihr Ernst?«, fragte Lafdan über Funk. »Alle trinken Bier, und Sie nehmen ein Wasser?«
»Woher wissen Sie, dass alle Bier trinken? Ist irgendwo eine Kamera verbaut? Ich muss das wissen, falls ich später mal auf die Toilette gehe.«
»Keine Kamera, aber ich war schon mal in so einer Raststätte. Die Atmosphäre ist nur alkoholisiert zu ertragen.«
»Ich möchte nüchtern bleiben.«
»Man muss nicht immer alles trinken, was man bestellt. Der Grundsatz ›Tarnung vor Wirkung‹ bekommt hier eine ganz andere Dimension.«
Katrin antwortete nicht. Sie lehnte sich rücklings an die Theke und beobachtete den Gastraum. Ein ständiges Kommen und Gehen, niemand blickte zu ihr. Niemand näherte sich ihr. Vielleicht hatten die anderen doch recht? Recht damit, dass Sweety69 sich einen Scherz erlaubt hatte, dass er nicht der Täter war. Nur Lafdan glaubte an das scheinbar Unmögliche. Und Katrin hoffte es zumindest. Sie ging noch einmal durch, was sie über Jenna wusste.
Nach der verstörenden Chatnachricht über die Schuhe toter Frauen hatte Jenna sofort die Kommunikation abgebrochen und sich in ihren Kokon zurückgezogen. Sweety69 spammte sie jedoch mit Nachrichten zu, nicht nur in diesem einen Forum, wo sie sich kennengelernt hatten, sondern auch in anderen Foren. Er spürte sie überall auf, kannte innerhalb von einer Woche alle ihre Profile und Namen, ihre Mailadressen und die Mobilfunknummer. Als Nächstes hatte sie Post bekommen. Einen richtigen Brief an ihre Wohnadresse. Jennas Kokon war aufgebrochen, ihre selbst gewählte Einsamkeit verschwunden, ihre Sicherheit praktisch nicht mehr vorhanden. Die Isolation, die sie vorher geschützt hatte, war zur Gefahr geworden. Wieder einmal hatte der Mörder Jennas Leben zerstört. Und er hatte vor, damit fortzufahren, denn im Brief schrieb er, dass er sie treffen wolle. Sie wisse, wo er wann zu finden sei. Er würde kommen und sie abholen.
Das war der Punkt, an dem sich Jenna an die Polizei gewandt hatte. Zum Glück gab es die Möglichkeit einer Onlineanzeige. Doch die tschechische Polizei glaubte ihr nicht. Ja, es gab diesen Brief des angeblichen Mörders, aber das konnte auch ein schlechter Scherz sein. Und so stand Jenna noch immer allein da. Wenigstens hatte die tschechische Polizei die European Crime Unit informiert, weil Jennas Geschichte als Cold-Case-Fall bei Katrin Lesage lag. Als die davon erfuhr, glaubte sie die Geschichte zunächst auch nicht. Doch dann stolperte sie über ein Detail: die Schuhe toter Frauen.
Katrin hatte sich sofort die Akten aller Mordopfer vorgenommen. Nach dem Lesen blieb sie entsetzt zurück. Sie und all die anderen Ermittlerinnen und Ermittler hatten es so lange vor der Nase gehabt: Das Motiv waren tatsächlich die Schuhe. Beim Auffinden der Leichen hatten immer mal wieder einzelne Kleidungsstücke gefehlt. Einmal der Büstenhalter, ein anderes Mal die Jeans oder die Bluse. Das Einzige, was bei allen Opfern gefehlt hatte, waren die Schuhe.
Mit dieser Erkenntnis war sie zu ihrem Vorgesetzten gegangen und hatte um die Erlaubnis eines Undercovereinsatzes gebeten. Katrin kannte jetzt nicht nur das Motiv, sondern auch das Wann und Wo. Alle Opfer waren an einem zweiten Dienstag im Monat verschwunden und später tot aufgefunden worden. Alle Opfer waren zuvor in dieser Raststätte an der A6 gewesen.
Dem Vorgesetzten hatten die Indizien nicht gereicht. Katrin hatte keine Genehmigung für einen Undercovereinsatz bekommen.
Deswegen war sie nun hier, verkleidet als Jenna. Zumindest so, wie sie auf ihrem Profilbild in den sozialen Medien aussah. Deswegen spielte sie den Lockvogel und nicht eine Kollegin, die dafür ausgebildet war.
Heute war der zweite Dienstag im Monat.
»Ihr Wasser wird schal«, funkte Ellen. »Wie lange warten wir noch?«
Katrin überlegte. Sie war jetzt eine Stunde hier und präsentierte sich dem mutmaßlichen Mörder als Jenna. Wie lange musste sie noch warten? Hatten die Zweifler recht? Würde der Täter gar nicht auftauchen?
»Nur noch diesen einen hier. Ein Trucker«, sagte Lafdan. »Ist grad ausgestiegen, hat durch die große Scheibe ins Innere geblickt und sich dann etwas auf dem Telefon angeschaut.«
Katrin schlug das Herz bis zum Hals.
»Jetzt geht er rein.«
Alles in Katrin war angespannt, aber sie drehte sich zur Theke und präsentierte dem eintretenden Trucker ihren Rücken.
»Ich hab ihn im Auge«, sagte Ellen. »Er bleibt stehen, blickt wieder auf sein Handy.«
»Was macht er jetzt?«, fragte Lafdan.
»Zögert. Wartet. Er geht zur anderen Seite weg.«
Katrin spürte ein Kribbeln in jedem Muskel. Ihre Hände zitterten. Das wäre es gewesen. Das hätte Sweety69 sein können. Das war das Zeichen, den Einsatz abzubrechen. Katrin atmete durch.
»Jetzt kommt er doch auf Sie zu«, sagte Ellen. »Ruhig bleiben.«
In diesem Moment roch Katrin ihn. Eine Mischung aus Kaffee, Schweiß und Nikotin mit einem Hauch von verblasstem Deodorant schwebte heran. Sie hielt den Atem an.
Der Mann winkte die Bedienung zu sich und sagte etwas zu ihr, was Katrin nicht verstand. Klang wie Polnisch. Die Bedienung nickte und ging weg. Er blieb neben Katrin stehen. Sie glaubte, seine Blicke spüren zu können, hielt den Atem an. Jede Faser ihres Körpers schrie danach, einfach wegzugehen, den Mann einfach stehen zu lassen. Ihn zu ignorieren. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Ellen sich so unauffällig wie möglich der Theke näherte. Sollte etwas passieren, würde die Spanierin direkt eingreifen. Ob Lafdan auch seinen Beobachtungsposten draußen verlassen hatte? Die Bedienung kam zurück und stellte dem Trucker eine Flasche Orangina hin. Der Mann sagte etwas und nahm die Flasche.
»Ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen«, sagte er plötzlich auf Deutsch. Jenna und ihr Peiniger hatten sich vor zehn Monaten auf Deutsch unterhalten, das hatte sie bei ihrer Zeugenvernehmung angegeben. Ein Indiz, dass Sweety69 wirklich der Serienkiller war?
Katrin lehnte sich zur Seite und blickte ihm ins Gesicht. Die Haut war pickelnarbig und ungesund gelblich. Sofort war da etwas, was Katrin an diesem Mann störte. Sie konnte diesen Zweifel jedoch nicht greifen.
»Sie sind Sweety69?« Ihre Stimme zitterte. Jennas Stimme würde in diesem Moment sicher sogar noch mehr zittern.
»Sie tragen heute Boots«, stellte er fest.
»Was wollen Sie von mir?«
»Das wissen Sie genau.«
Katrin nickte. »Ich habe sie mitgebracht. Die Tasche ist in meinem Auto. Ich gebe Ihnen meine alten Schuhe, aber danach lassen Sie mich in Ruhe, okay?«
Sie hatten verabredet, wann Ellen und Lafdan eingreifen würden. Es gab nur zwei Optionen. Wenn Sweety69 etwas sagte, was ihn als Serienmörder identifizierte, oder wenn Katrins Leben in Gefahr war. In diesem Moment sehnte Katrin sich eine der Möglichkeiten herbei. Der Druck, der auf ihr lastete, stieg immens. Nicht jeder war als Undercoverbulle geeignet. Sie war es definitiv nicht, das wusste sie nun ganz sicher.
»Was wird das hier?«, fragte er.
»Ich möchte, dass Sie mich einfach in Ruhe lassen. Sie sind doch Sweety69?«
»Ja, der bin ich.«
Darauf hatte sie gewartet. Er war der Richtige. Was jetzt kam, war einstudiert und ging sehr schnell. Ellen packte ihn am Arm und verdrehte ihn so, dass er bewegungsunfähig wurde. Sweety69 schrie und knallte auf den Boden. Ellen rammte ihm ihren Schuh ins Gesicht, um ihn zu fixieren. Plötzlich war Lafdan neben Katrin, zog sie zur Seite und hielt seine Dienstmarke in den Raum. »Polizei. Bleiben Sie ruhig!«, schrie er. »Bleiben Sie ruhig.«
Einige Trucker, die schon von ihren Stühlen aufgestanden waren, setzten sich wieder. Andere zögerten noch. Hier galt wohl noch der mittelalterliche Grundsatz: Ein Angriff auf einen der unseren ist ein Angriff auf uns alle.
»Polizei!«, schrie Lafdan wohl deshalb noch einmal.
Diejenigen, die stehen geblieben waren, rückten geschlossen näher, Schulter an Schulter.
Eine Wand aus Hass und Gewalt.
»Ich wusste, dass dies hier ein Fehler ist«, flüsterte Lafdan. Er schob seine Jacke zur Seite und zeigte der Menge sein Pistolenhalfter.
Einer der Trucker wischte sich mit dem Handrücken unter der Nase entlang, nickte dann. Die anderen Trucker setzten sich jedoch nur zögerlich wieder hin.
»Jetzt raus hier«, befahl Lafdan.
Ellen und Katrin packten Sweety69 und führten ihn ab. Auf dem Weg zum Container hielt Lafdan Katrin am Arm zurück.
»Was ist?«, fragte sie.
»Sie wirken nicht zufrieden. Ist es wegen der Menge da drin?«
Katrin schüttelte den Kopf.
»Was ist es dann?«
»Das war eine Falle, ein Test. Er ist es nicht. Er kann es nicht sein.« Katrins Stimme überschlug sich.
»Er hat Wissen, das nur der Mörder haben kann. Denken Sie an die vielen fehlenden Schuhe.«
»Vielleicht.« Katrin zwang sich wieder zur Professionalität. »Vielleicht hat er Kontakt zum wahren Täter. So etwas gibt es. Menschen, die von Mördern so fasziniert sind, dass sie ihnen schreiben, sie aufspüren, sie vergöttern. Egal, was es ist, sicher ist, dass er nicht der Mörder sein kann.«
»Wirklich ganz sicher?« Lafdan neigte den Kopf zur Seite. »Warum?«
»Kommen Sie, wie alt war er beim ersten Mord? Fünfzehn?«
Lafdan überlegte, blickte noch einmal zu dem Verdächtigen, dann nickte er und zündete sich eine Zigarette an. »Stellt sich also die Frage, warum der Mörder dieses Spielchen gespielt hat.«
»Ich fürchte«, sagte Katrin, »dass wir das sehr bald herausfinden werden.«
Kapitel 3
Skopje, Nordmazedonien, drei Tage später
Etrit Bardi schreckte hoch. Die Müdigkeit klebte an ihm, wollte ihn nicht loslassen. Genauso wenig wie die Erinnerung an den Albtraum. Es waren keine klaren Bilder, nur die Ahnung einer Erinnerung und die nun unbestimmbare Todesangst. Er fuhr sich mit den Fingern durch sein schweißnasses Haar. Zwei Atemzüge später war der Eindruck des Traums verschwunden. Etrit blickte sich um. Das hier war nicht sein Schlafzimmer. Es dauerte, bis er sich orientiert hatte. Die Hütte. Er war wohl eingeschlafen. Ein Zeichen dafür, dass er entspannt war? Oder eher Ausdruck seiner Erschöpfung? Eine Mischung? Wahrscheinlich.
Etrit nahm das Mobiltelefon vom Tisch und blickte aufs Display. Der Timer zählte runter. Drei Minuten noch, dann wäre er so oder so geweckt worden. Doch Etrit fühlte sich, wie man sich fühlt, wenn man kurz vor dem Wecker aufwachte: um drei Minuten Schlaf beraubt. Drei Minuten waren nicht viel, konnten manchmal jedoch die Welt bedeuten.
Etrit beendete den Countdown und setzte sich auf. Dann tat er das, was er immer tat, wenn er vor Sofi aufwachte. Er betrachtete sie. Sofi lag zusammengekuschelt in der weißen Bettdecke neben ihm, nackt. Ihre Haut hatte die Farbe von Wiener Melange und duftete beinahe genauso süß. Jetzt schimmerte sie sogar golden im Schein der untergehenden Sonne, der durch das riesige Panoramafenster das Innere der Hütte flutete. Etrit musste lächeln. Das hier war sein Paradies, sein Tempel, die innere Mitte. Der Ruhepol, nach dem jeder suchte. Er hatte ihn gefunden. Je länger er nachdachte, desto mehr fand er die Beschreibung »Paradies« passend. Sofi und er, wie Adam und Eva. Nur ohne Feigenblatt. Es war alles anders geplant gewesen. So wie das Paradies wahrscheinlich auch. Ohne Sünde. Ein ehrbares Ziel, aber bei Menschen unmöglich zu erreichen. Und genau wie das Paradies war dies hier von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Das war ihm bewusst, doch diese Gedanken schob er beiseite. Er wollte Glück fühlen, und das tat er, denn Sofi interessierte sich für ihn. Sie war sein Elixier, sein Jungbrunnen. Er musste nur aufpassen, dass er sich nicht in sie verliebte. Das würde alles nur weiter verkomplizieren, denn das zwischen ihm und ihr war mehr als Sünde. Es war etwas, das es nicht geben durfte. Er war ihr Vorgesetzter, und er war der Ehemann einer anderen.
Wenn das zwischen ihnen herauskäme, wären sie geliefert. Beide. Etrit war der ranghöchste Polizist in Skopje: der Polizeichef. Sofi war die beste Kriminalbeamtin, die in den letzten Jahren ausgebildet worden war, denn trotz ihrer Jugend konnte sie schon spektakuläre Ermittlungserfolge vorweisen. Und das bei Fällen, wo alte Hasen abgewunken hatten. Vor ihr lag also eine steile Karriere. Sie konnte alles erreichen.
Dementsprechend viel gab es zu verlieren.
Etrit wusste, dass er nach einer Enthüllung keine Möglichkeit mehr hätte, die Scherben aufzusammeln, um neu zu beginnen. Dafür fehlte ihm die Zeit. Und dass es Sofi trotz ihrer Jugend gelänge, bezweifelte er ebenfalls. Sie mochte mehr Zeit haben, doch der Makel, sich hochgeschlafen zu haben, würde wie Teer an ihr haften. Dabei hatte sie so etwas gar nicht nötig. Sie hatte ihre Karriere selbst in der Hand und brauchte keinen Mentor. Trotzdem war sie bei ihm. War es das, was die Beziehung für Sofi so prickelnd machte? Das Spiel mit dem Feuer? Wahrscheinlich. Anders kannte er Sofi gar nicht. Sie ging aufs Ganze. Immer. Immer die letzte Karte. Extrem erfolgreich. Doch alles hatte eine Kehrseite. Und ihre hieß Langeweile. Die kam schnell, wenn Sofi nicht gefordert wurde. Dann suchte sie sich Erlebnisse am Rand zur Hölle. Floating in Stromschnellen, Klettern ohne Seil. Balanceakte ohne doppelten Boden.
Er war da ganz anders. Typischer Beamter. Sicherheit ging vor. Aber was war es dann für ihn?
Etrit wischte die Gedanken genauso beiseite wie die Bettdecke. Er musste los. Das Fußballspiel war vor fünf Minuten abgepfiffen worden. Das war sein Alibi. Mit drei Freunden in der Hütte Fußball schauen, ein wenig grillen und den Sieg feiern. Niemand bezweifelte, dass der FC Struga gegen Renova zu Hause gewinnen würde.
»Musst du schon los?«, fragte Sofi. Ihre Stimme klang leicht verschlafen.
Er beugte sich runter und küsste ihre Stirn. Dabei strich er durch ihr seidenes Haar. »Du kannst liegen bleiben. Wir sehen uns morgen.«
Sie nickte und drehte sich zur Seite. Etrit verließ die Hütte und ging zu seinem Auto, das er unter dem Carport geparkt hatte. Das Schöne an Sofi war, dass sie niemals von ihm verlangte, er solle sich für sie von seiner Ehefrau trennen. Sie beide wussten, dass dies hier nur bis zu einem gewissen Grad funktionierte. Zumindest hoffte Etrit das.
Draußen empfing ihn ein wunderschöner Herbstabend. Es roch nach Tannenzweigen und Moos, nach feuchter Erde und frischer Luft. Er blieb kurz stehen und füllte seine Lunge mit dieser Erinnerung. Wie lange würde es dieses Mal anhalten, bis ihn der Alltag überrollte? Wie lange, bis er wieder flüchten musste. Die Abstände wurden kürzer. Das Verlangen nach Intensität größer. Er konnte immer zur Hütte. Aber wäre sie noch immer sein Paradies, wenn Sofi mal nicht da wäre? Wäre das Paradies ohne Eva komplett? Als er zu seinem SUV ging, den er unter dem Carport geparkt hatte, fragte er sich, wann Sofi einen Schlussstrich ziehen würde. Er bezweifelte nicht, dass sie es sein würde, die das hier beendete. Sie brauchte ihn nämlich nicht. Als er einstieg, überlegte er, ob er sich nicht doch schon in die junge Frau verliebt hatte.
Die geschotterte Straße schlängelte sich durch den Wald, und als er die Wiesen erreichte, gab es wieder Handyempfang. Sofort vibrierte das Mobiltelefon. Es hörte gar nicht mehr auf. Ein kurzer Blick aufs Display. Eine Push-up-Nachricht von Sport One. Das Spiel Struga gegen Renova war kurz vor dem Anpfiff abgesagt worden. Betrugsskandal. Die restlichen Nachrichten informierten Etrit darüber, dass seine Frau angerufen hatte. Mehrmals. 38 Mal, um genau zu sein. Über zwanzigmal innerhalb von fünf Minuten. Die restlichen Anrufversuche dann nach einer kurzen Pause. Ahnte sie etwas? Oder wusste sie schon von seinem Verhältnis mit Sofi? Was Theodora mitzuteilen hatte, musste extrem wichtig sein. Sie wusste eigentlich, dass er in der Hütte keinen Empfang hatte. Aber vielleicht hatte sie mitbekommen, dass das Fußballspiel abgesagt worden war.