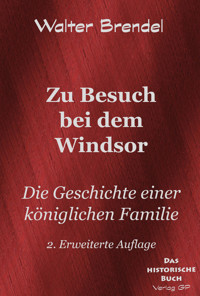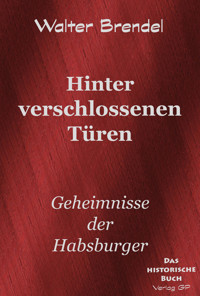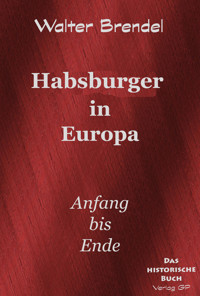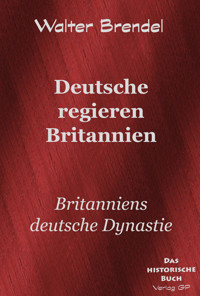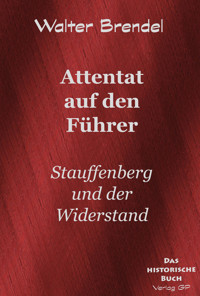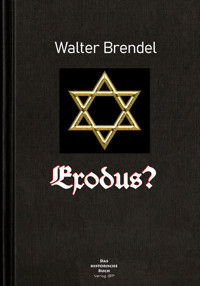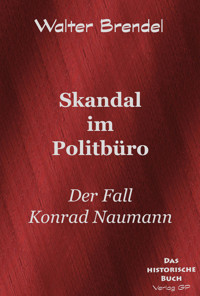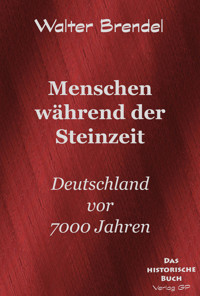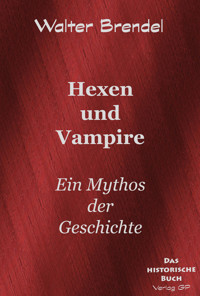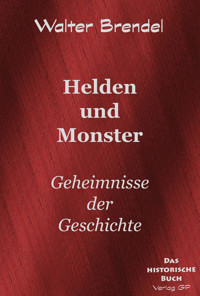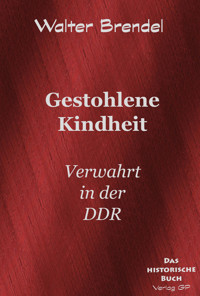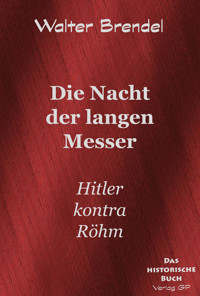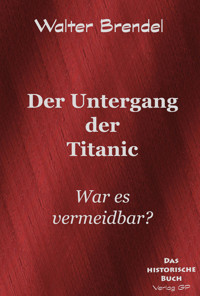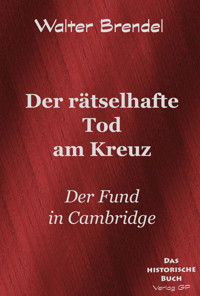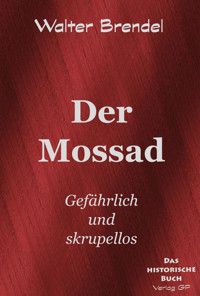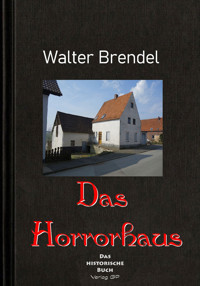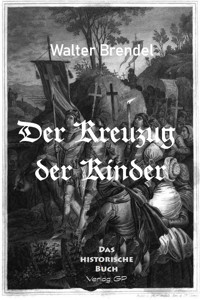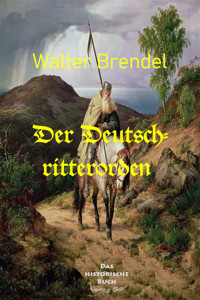4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diese Zusammenstellung der Filmhelden erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei der Auswahl wurde vor allem der Bekanntheitsgrad der Schauspieler und Schauspielerinnen berücksichtigt. Dabei wurde sich nur auf das Wirken der Filmhelden in der Sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR konzentriert. Karrieren in der Bundesrepublik nach Verlassen der DDR und nach den Wendejahren wurden nicht verfolgt. Bei der Zusammenstellung wurde auch festgestellt, dass uns leider viele Filmhelden für immer verlassen haben, auch das ist Anlass, ihr Andenken in Ehren zu halten und zu gedenken sowie zu bedanken, für die vielen schönen Stunden, die sie uns im Kinosaal oder am Fernseher geschenkt haben. Von den UFA-Darstellern über die DEFA bis hin zur Auflösung des DDR-Fernsehens vergingen Jahrzehnte, die man trotz aller Fehler und Schwächen der kulturellen Unterhaltung nicht missen möchte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Walter Brendel
Impressum
Texte: © Copyright by Walter Brendel
Umschlag: © Copyright by Gunter Pirntke
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Einleitung
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann die sowjetische Besatzungsmacht, die Filmindustrie im Osten Deutschlands schnell wieder einsatzfähig zu machen. Das Medium Film sollte nicht zuletzt als Propagandamittel genutzt werden. So erteilte am 28. Mai 1945, drei Wochen nach der Unterzeichnung der Kapitulation durch die deutsche Wehrmacht, der sowjetische Stadtkommandant von Berlin, Generaloberst Nikolai Bersarin, die Erlaubnis zur Eröffnung von Theatern und Lichtspielstätten in Berlin.
Am 22. November 1945 fand im Berliner Hotel Adlon die erste Beratung von Kulturfunktionären, Filmschaffenden und Schriftstellern über den Aufbau einer neuen Filmproduktion in der SBZ statt. Unter der Leitung von Paul Wandel trafen sich die Mitglieder des Filmaktivs sowie unter anderen Boleslaw Barlog, Hans Deppe, Hans Fallada, Werner Hochbaum, Gerhard Lamprecht, Herbert Maisch, Peter Pewas, Wolfgang Staudte, Günther Weisenborn, Friedrich Wolf und Marion Keller. Der ehemalige Patent- und Staatsanwalt Albert Wilkening übernahm auf Befehl des sowjetischen Stadtbezirkskommandanten von Berlin-Treptow am 28. November 1945 die kommissarische Leitung der Tobis Filmkunst AG. Im Januar 1946 wurde das Filmaktiv offiziell nach bürgerlichem Recht als in die Zentralverwaltung für Volksbildung eingegliederte Gesellschaft eingetragen. Am 17. Mai 1946 wurde in Potsdam-Babelsberg auf dem Gelände der Althoff-Ateliers die Deutsche Film-AG (DEFA) i. Gr. gegründet. Die Deutsche Film GmbH wurde am 11. November 1947 in eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft umgewandelt, wobei das Firmenzeichen DEFA erhalten blieb. Am 3. Dezember 1948 wurde die DEFA, die bereits über mehr als 2000 feste Mitarbeiter verfügte, als gemeinsame deutsch-sowjetische Aktiengesellschaft ins Handelsregister eingetragen.
Mit Wirkung vom 1. Januar 1953 wurden mit Sitz in Potsdam-Babelsberg das DEFA-Studio für Spielfilme, das DEFA-Studio für Kinderfilme und das DEFA-Studio für populärwissenschaftliche Filme, mit Sitz in Berlin das DEFA-Studio für Wochenschau und Dokumentarfilme, mit Sitz in Berlin-Johannisthal das DEFA-Studio für Synchronisation, das DEFA-Kopierwerk in Berlin-Köpenick und der DEFA-Filmübernahme- und Außenhandelsbetrieb in Berlin errichtet. Als volkseigene Betriebe unterstanden sie unmittelbar dem Staatlichen Komitee für Filmwesen. Die Schlussbilanz der DEFA GmbH war vom Revisionsorgan des Staatlichen Komitees für Filmwesen zu bestätigen, die Liquidation der GmbH fand nicht statt. „Den zu bildenden volkseigenen Betrieben wird das Vermögen der DEFA als Eigentum des Volkes in Rechtsträgerschaft übergeben.“
Mit dem Aufbau des Fernsehens in der DDR eröffnete sich für die DEFA ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld. Die DEFA drehte etwa 700 Spielfilme, 750 Animationsfilme sowie 2250 Dokumentar- und Kurzfilme. Etwa 8000 Filme wurden synchronisiert.
Der Deutscher Fernsehfunk (DFF; zwischen 1972 und 1990 Fernsehen der DDR) war das staatliche Fernsehen der Deutschen Demokratischen Republik. Am 21. Dezember 1952 – zu Ehren des 74. Geburtstages von Josef Stalin – startete das „öffentliche Versuchsprogramm“ mit zwei Stunden Sendezeit täglich ab 20 Uhr und dem Brandenburger Tor als Logo. Empfangsbereit waren in der DDR etwa 60 Geräte, allesamt in Berlin. Nach der Begrüßung durch Ansagerin Margit Schaumäker folgten Grußworte der Fernsehintendanz und schließlich die Aktuelle Kamera (AK) mit Sprecher Herbert Köfer. Die AK als älteste deutsche Fernseh-Nachrichtensendung blieb bis zum 14. Dezember 1990.
Am 2. Januar 1956 endete das offizielle Versuchsprogramm des Fernsehzentrums Berlin und am 3. Januar begann der Deutsche Fernsehfunk (DFF) sein Programm. Der Sender hieß politisch gewollt zunächst nicht Fernsehen der DDR. Der DFF wollte Fernsehen für ganz Deutschland sein. Trotz grenznaher Sender war es dem DFF aber physikalisch nicht möglich, die ganze Bundesrepublik zu versorgen, während die ARD später mit Ausnahme des Elbtalkessels, des sogenannten „Tals der Ahnungslosen“, und des Nordostens (u. a. Stralsund, Greifswald) die ganze DDR erreichte.
Ende 1958 waren über 300.000 Fernsehgeräte in der DDR angemeldet. Ab dem 7. Oktober 1958 wurde das Vormittagsprogramm eingeführt, als Programmwiederholung für Spätarbeiter. Einen Tag später folgte erstmals ein Abendgruß. Der Abendgruß vom Fernsehfunk wurde, ab 22. November 1959 im Rahmen der Sendung Unser Sandmännchen, zum Exportschlager.
Am 3. Oktober 1969 ging das 2. Programm des Deutschen Fernsehfunks DFF 2 aus Anlass des bevorstehenden 20. Jahrestages der Gründung der DDR als Farbprogramm erstmals auf Sendung. Damit begann beim Deutschen Fernsehfunk das Farbfernsehzeitalter. Walter Ulbricht eröffnete das Programm.
Leitungsgremium für Hörfunk und Fernsehen war seit 1952 das Staatliche Rundfunkkomitee. Am 15. September 1968 wurde ein eigenständiges Staatliches Komitee für Fernsehen gebildet. Sein Vorsitzender war von 1968 bis 1989 Heinz Adameck (Mitglied der Agitationskommission im ZK der SED).
Die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch (HfS) entstand in ihrer heutigen Form 1951 als Staatliche Schauspielschule Berlin im Range einer Fachschule. Sie ging aus der ursprünglich als Schauspielschule des Deutschen Theaters gegründeten privaten Schauspielschule hervor, deren Geschichte bis ins Jahr 1905 zurückreicht und die 1951 im Rahmen der Verstaatlichung des gesamten Ausbildungswesens der DDR zu einer staatlichen Fachschule umgewandelt wurde. 1981 erhielt die HfS den Status einer Hochschule und wurde nach dem ein Jahr zuvor verstorbenen Sänger und Schauspieler Ernst Busch benannt.
Die Geschichte der Hochschule geht zurück auf die von Max Reinhardt am 2. Oktober 1905 eröffnete Schauspielschule des Deutschen Theaters zu Berlin. Sie gehörte zu dem seit 1905 von Max Reinhardt betriebenen Deutschen Theater als Teil von Max Reinhardts privatwirtschaftlichem Theaterkonzern, der vor 1933 aus 11 Berliner Bühnen bestand. Erster Leiter der Schule war Berthold Held. Die Unterrichtsräume waren anfangs im Erdgeschoss des Wesendonkschen Palais (In den Zelten 21, in der Nähe des Reichstags) untergebracht, in dem Reinhardt selbst wohnte. Nach wenigen Jahren zog sie in den 2. Stock der Kammerspiele des Deutschen Theaters, wo sie bis zum Ende der Ära Reinhardt blieb. In dieser Zeit verfügte die Schule bereits über eine eigene Probebühne mit Proszenium. Ab 1931 übernahm Woldemar Runge die Leitung der Schauspielschule und gliederte ihr einen Regiekurs an. Das Lehrerkollegium bestand u. a. aus namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern des Deutschen Theaters wie Gertrud Eysoldt, Eduard von Winterstein, Albert Steinrück und Berthold Held.
Das DDR-Kulturministerium schloss im September 1951 formal alle bis dahin privaten Schauspielschulen in der DDR. Neben dem Deutschen Theaterinstitut in Leipzig und der Staatlichen Fachschule für Schauspielkunst in Leipzig entstand die Staatliche Schauspielschule Berlin aus der Schauspielschule im deutschen Theater und dem Schauspielstudio der DEFA.
1979 eröffnete die Schauspielschule eine Ausweicharbeitsstätte in Berlin-Marzahn, in die kurzfristig Bühnen und eine große Probebühne eingebaut wurden. In den 1980er Jahren wurde die „Staatliche Schauspielschule Rostock“ an die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin angegliedert. (1994 erfolgte in Rostock eine Neugründung als „Hochschule für Musik und Theater Rostock“.)
Bedeutende Lehrer waren neben Rudolf Penka und Kurt Veth, auch Wolfgang Engel, Thomas Langhoff, Ursula Karusseit, Hans-Georg Simmgen, Jutta Hoffmann und andere im Fach Schauspiel, die Bewegungs- und Tanz-Dozentin Hilde Buchwald und für das Fach Diktion der Lyriker Karl Mickel.
Am 21. September 1981 erfolgte in einem Festakt im gerade fertig gestellten neuen Hochschulbau neben der offiziellen Schlüsselübergabe des Hauses auch die Ernennung von Hans-Peter Minetti zum ersten Rektor. In der DDR galt die Schule als Kaderschmiede.
Zu den Schauspielern, die ihre Ausbildung an der Hochschule begonnen, aber abgebrochen haben, gehören Manfred Krug, Anja Kling, Matthias Schweighöfer und Aylin Tezel.
Am 15. Oktober hat der erste DEFA-Film - der gleichzeitig der erste deutsche Nachkriegsfilm ist - Premiere: Die Mörder sind unter uns von Regisseur Wolfgang Staudte.
Einer der erfolgreichsten frühen DEFA-Filme ist Ehe im Schatten (1947; RE: Kurt Maetzig), der - damals ungewöhnlich - in allen vier Besatzungszonen vor einem Millionenpublikum gezeigt wird und auch international Aufmerksamkeit erfährt. Der Antifaschismus wird von Beginn an zu einem der wichtigsten Anliegen des DEFA-Films.
Regisseur Kurt Maetzig, einer der Mitbegründer der DEFA und als "Halbjude" im Dritten Reich selbst verfolgt, erzählt in stark von der Ufa-Tradition beeinflussten Bildern eine wahre Begebenheit: Joachim Gottschalk, ein populärer deutscher Ufa-Schauspieler, ist mit einer jüdischen Schauspielkollegin verheiratet, die im Dritten Reich bald Berufsverbot bekommt. Als die Deportation von Frau Gottschalk ins KZ droht, geht das Paar gemeinsam mit dem kleinen Sohn 1941 in den Freitod.
Die Geschichte vom kleinen Muck (RE: Wolfgang Staudte), zweiter Märchenfilm der DEFA und bis zum Ende der DDR der meistverkaufteste Film des DEFA-Außenhandels, wird 1953 gedreht. Die DEFA ist seitdem für ihre Märchenfilme berühmt. Einige ehemalige Künstler der Ufa bringen ihr Können nach dem Krieg bei der DEFA ein.
Mitte der 50er Jahre entsteht der größte Propagandafilm der DEFA, der Zweiteiler Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse (1954) und Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse (1955), unter der Regie von Vorzeigeregisseur Kurt Maetzig. Die Filme, die Leben und Wirken des Hamburger Arbeiterführers, der im Dritten Reich von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde, repräsentativ darstellen, sind Staatsprojekte. Die Hauptdarsteller Günter Simon und Karla Runkehl verdanken den Thälmann-Filmen anhaltende Popularität und noch Jahre später werden die beiden vom Kinopublikum zu den beliebtesten DEFA-Schauspielern gewählt.
Schauspieler und Schauspielerrinnen
A
Abeßer, Doris
Doris Abeßer wurde am 15. März 1935 in Berlin geboren. Sie nahm mit 16 Jahren ihren ersten Schauspielunterricht und bewarb sich an der Staatlichen Schauspielschule Berlin-Schöneweide, wurde aber, da sie noch minderjährig war, abgelehnt. Dann volljährig absolvierte sie ihre Schauspielausbildung an der Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin. Ihr Schauspieldebüt gab Abeßer 1956 auf der Bühne in Senftenberg. Hier spielte sie drei Jahre lang Theater, ging 1959 zum Dresdner Staatstheater und danach an die Berliner Volksbühne. Sie wurde sie mehrmals in Filmproduktionen der DDR eingesetzt. In „Das Leben beginnt“ flüchtete sie in den Westen und kehrte später enttäuscht wieder zurück. In „Septemberliebe“ hielt sie ihren Freund von einem derartigen Fluchtversuch ab. Sie wirkte im DEFA-Film „Der Frühling braucht Zeit“ mit, doch der Streifen wurde kurz nach seiner Uraufführung verboten. Im Anschluss war ihre Tätigkeit als Filmschauspielerin der DEFA fast erlegen. Sie spielte wieder mehr Theater; so am Friedrich-Wolf-Theater in Neustrelitz, unter anderem im Musical My Fair Lady. Von 1968 bis 1997 gehörte sie dem Metropol-Theater in Berlin an. Beim Fernsehen wirkte sie erfolgreich in bekannten Serien wie „Rentner haben niemals Zeit“, „Geschichten übern Gartenzaun“, „Neues übern Gartenzaun“, „Der Staatsanwalt hat das Wort“ und „Drei reizende Schwestern“ sowie „Polizeiruf 110“ mit. Sie starb am 26. Januar 2016.
Alex, Hildegard
7. Januar 1942
Geboren am 7. Januar 1942 in Teplitz-Schönau; ein Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin beendete sie 1962 mit dem Diplom. Ihre Theaterkarriere führte sie unter anderem an die Volksbühne Berlin, an das Wiener Burgtheater und an das Schauspielhaus Hamburg. Sie ist eine vielschichtige Schauspielerin, die vor allem aus den Fernsehserien „Polizeiruf 110“ und „Der Staatsanwalt hat das Wort“ bekannt ist. Sie wirkte in über 100 Filmen und 150 Hörspielen mit.
Antoni, Carmen-Maja
Geboren am 23. August 1945 in Berlin. Sie begann im Alter von elf Jahren für Film und Fernsehen zu arbeiten, um ihre Familie und ihre zwei Schwestern zu ernähren. Ab 1959 war sie eines der drei „Blauen Blitze“ in einem Pionier-Kabarett im DDR-Fernsehen, das Alltagssituationen in gewitzten Gesprächen zeigte. Im selben Jahr wirkte sie in der musikalischen Pionierkomödie „Der Dieb im Warenhaus.“ mit. 1962 bestand Antoni noch vor dem Abitur die Aufnahmeprüfung an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg. Sie studierte von 1962 bis 1965 an der Staatlichen Schauspielschule Berlin-Schöneweide Noch während ihrer Schauspielausbildung wurde sie am Potsdamer Hans-Otto-Theater engagiert, 1970 wechselte sie zur Volksbühne Berlin, wo sie in meist komischen und grotesken Rollen besetzt wurde. 1975 kam sie an das Berliner Ensemble, wo sie bis 2013 festes Ensemblemitglied war. Neben ihrer Bühnenarbeit war sie ab Mitte der 1960er-Jahre verstärkt auch in Film und Fernsehen zu sehen, oftmals in prägnanten Nebenrollen. Ihr Filmdebüt gab sie 1964 in „Der Reserveheld“, danach stand sie für das Kino gedrehte Produktionen, „Das Kaninchen bin ich“, „Denk bloß nicht, ich heule“, „Fräulein Schmetterling“ und „Der Mann, der nach der Oma kam“. In der Folgezeit wurde sie in verschiedenen Nebenrollen in Film- und Fernsehproduktionen der DEFA und des DFF besetzt. Auch in zahlreichen Kinder- und Jugendproduktionen wirkte sie mit. „Blumen für den Mann im Mond“, „Zwerg Nase“, „Max und siebeneinhalb Jungen“, „Der Dicke und ich“ und „Die dicke Tilla“ und „Der Hase und der Igel“. 1987 war in der Filmbiografie „Käthe Kollwitz – Bilder eines Lebens“ zu sehen. 1989 bekam sie für ihr künstlerisches Gesamtschaffen den Kunstpreis der DDR. Sie war eine der profiliertesten Charakterdarstellerinnen der DDR. Ihren Durchbruch als Filmschauspielerin hatte sie 1989 in dem DEFA-Spielfilm „Kindheit“. Im wiedervereinigten Deutschland wurde sie vor allem durch ihre zahlreichen Nebenrollen in verschiedenen Filmen und Serien bekannt.
B
Bauer, Hans-Uwe
Geboren am 26. August 1955 in Stralsund. 1980 Schauspielstudium an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam. Theaterengagements in Görlitz, Greifswald, Potsdam, Graz und an verschiedenen Berliner Bühnen. 1982 Filmdebüt in der DEFA-Literaturverfilmung „Der Aufenthalt“ des Regisseurs Frank Beyer. Weitere Film- und Fernsehproduktionen waren „Die Besteigung des Chimborazo“, „Good Bye, Lenin!“, „Sonnenallee“, „Das Leben der Anderen“, „Westwind“, „Niemandsland“ sowie diverse Tatorte und Fernsehspielfilmformate.