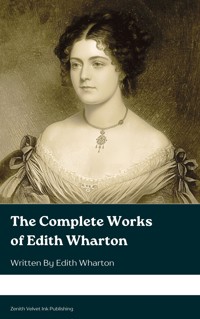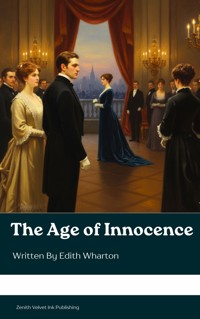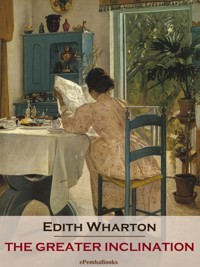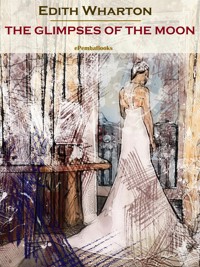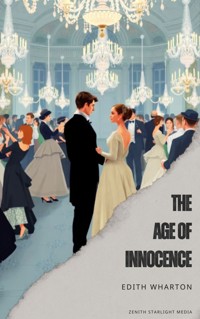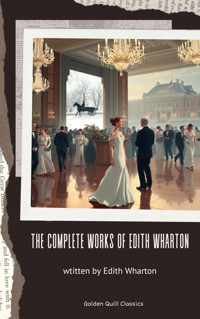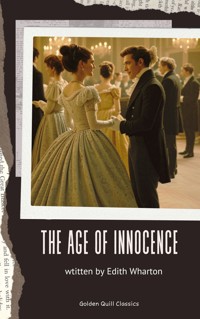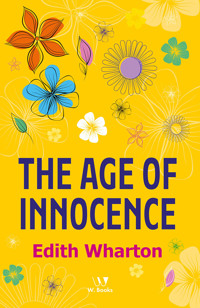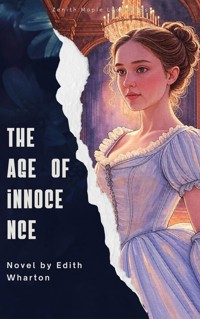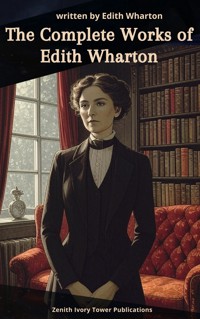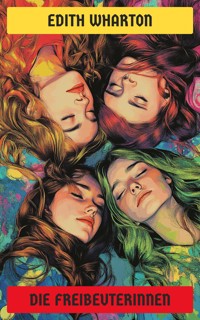
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Freibeuterinnen ist ein berühmter und bis heute hochaktueller Roman der amerikanischen Erfolgsautorin Edith Wharton. Die Geschichte erzählt von einer Gruppe außergewöhnlicher Frauen im New York der Jahrhundertwende – einer Zeit, in der alte gesellschaftliche Konventionen langsam von neuen Lebensentwürfen abgelöst werden. Die Freibeuterinnen ist der Roman, auf dem die berühmte gleichnamige Serie basiert. Im Mittelpunkt stehen die selbstbewusste, unabhängige Undine Spragg und ihre Freundinnen, die fest entschlossen sind, ihren eigenen Weg in einer von Männern dominierten Welt zu gehen. Mit Charme, Verstand und Entschlossenheit überwinden sie gesellschaftliche Barrieren und kämpfen für ein Leben nach eigenen Vorstellungen. Immer wieder geraten sie dabei in Konflikt mit den starren Regeln der feinen Gesellschaft und müssen entscheiden, wie weit sie für ihre Freiheit gehen wollen. Edith Wharton gelingt es meisterhaft, das pulsierende New York um 1900 einzufangen – eine Welt im Umbruch zwischen Tradition und Moderne. Sie schildert mit viel Gespür für Details die Zwänge und den Glanz der Oberschicht ebenso wie das Streben der Frauen nach Unabhängigkeit. Die Protagonistinnen sind ihrer Zeit weit voraus: Sie hinterfragen Rollenmuster, streben nach Selbstbestimmung und riskieren viel für ein eigenständiges Leben. "Die Freibeuterinnen" bleibt ein zeitloses Plädoyer für weibliche Selbstbestimmung und den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Die fesselnde Handlung, die starken Frauenfiguren und die kluge Gesellschaftsanalyse machen "Die Freibeuterinnen" zu einem faszinierenden Leseerlebnis. Das Buch bleibt auch heute relevant, weil es zeitlose Fragen nach Identität, Freiheit und Anerkennung behandelt. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Freibeuterinnen
Inhaltsverzeichnis
ERSTES BUCH
Kapitel I
Es war gerade die Hochsaison der Pferderennen in Saratoga.
Das Thermometer zeigte über neunzig Grad, und ein Dunst aus sonnenverstaubtem Staub hing in den Ulmen entlang der Straße gegenüber dem Grand Union Hotel und über den spärlichen dreieckigen Rasenflächen, die mit jungen Tannen bepflanzt und durch einen niedrigen weißen Zaun vor den Verwüstungen durch Hunde und Kinder geschützt waren.
Frau St. George, deren Mann einer der Herren war, die sich am meisten für die Rennen interessierten, saß auf der breiten Veranda des Hotels, einen Krug mit eisgekühlter Limonade neben sich und einen Palmfächer in der kleinen Hand, und blickte zwischen den riesigen weißen Säulen des Portikus hindurch, die kultivierte Reisende so oft an den Parthenon in Athen (Griechenland) erinnerten. An Sonntagnachmittagen war diese Veranda voll mit Herren in hohen Hüten und Gehrocken, die kühle Getränke und Havanna-Zigarren genossen und die lange, mit spindeldürren Ulmen gesäumte Landstraße überblickten; aber heute waren die Herren beim Rennen, und die Stuhlreihen waren mit Damen und jungen Mädchen besetzt, die in einer schläfrigen Atmosphäre aus fächelnden Fächern und eisgekühlten Erfrischungen lustlos auf ihre Rückkehr warteten.
Frau St. George betrachtete die meisten dieser Damen mit melancholischer Missbilligung und seufzte, als sie daran dachte, wie sehr sich die Zeiten geändert hatten, seit sie vor etwa zehn Jahren zum ersten Mal mit ihren Krinolinenröcken auf derselben Veranda auf und ab gegangen war.
Frau St. Georges viele freie Stunden waren mit solchen wehmütigen Gedanken ausgefüllt. Das Leben war nie einfach gewesen, aber es war sicherlich einfacher gewesen, als Colonel St. George weniger Zeit mit Poker und der Wall Street verbrachte, als die Kinder noch klein waren, noch Krinolinen getragen wurden und Newport noch nicht alle konkurrierenden Badeorte in den Schatten gestellt hatte. Was könnte zum Beispiel hübscher und passender für eine Dame sein als ein schwarzer Alpaka-Rock, der wie ein Vorhang über einem scharlachroten Unterrock aus Serge hochgeschlagen war, darüber eine weitärmige schwarze Popeline-Jacke mit gerüschten Musselin-Unterärmeln und ein flacher „Pork Pie“-Hut, wie ihn Kaiserin Eugénie am Strand von Biarritz trug? Aber jetzt schien es keine festen Modetrends mehr zu geben. Alle trugen, was ihnen gefiel, und es war genauso schwierig, in diesen engen, senkrechten Polonaisen, die die Pariser Modeschöpfer lieferten und die hinten hochgebündelt waren, wie eine Dame auszusehen, wie in den unverschämt tief ausgeschnittenen Abendkleidern, die Frau St. George in der Oper in New York mit missbilligendem Blick betrachtet hatte. Tatsächlich konnte man eine Dame kaum noch von einer Schauspielerin oder – äh – der anderen Art von Frau unterscheiden, und die Gesellschaft in Saratoga, wo nun alle vornehmen Leute nach Newport fuhren, war ebenso bunt und verwirrend geworden wie die Mode.
Seit die Krinolinen aus der Mode gekommen waren und die Tournüren aufgetaucht waren, hatte sich alles verändert. Wer zum Beispiel war diese neue Frau, eine Frau Closson oder so ähnlich, die eine so dunkle Haut zu ihrem rotbraunen Haar hatte, einen so fetten Körper zu ihren kleinen unsicheren Füßen und die, wenn sie nicht gerade auf dem Hotelklavier klimperte, laut glaubwürdigen Berichten der Bediensteten stundenlang auf ihrem Schlafzimmersofa lag und rauchte – ja, große Havanna-Zigarren rauchte? Die Herren, so glaubte Frau St. George, betrachteten die Geschichte als einen guten Witz; für eine Frau von Welt konnte sie nur Anlass zu schmerzhaften Überlegungen sein.
Frau St. George war immer etwas distanziert gegenüber der großen und überschwänglichen Frau Elmsworth gewesen, die in diesem Moment neben ihr auf der Veranda saß. (Frau Elmsworth war immer „aufdringlich“.) Frau St. George misstraute instinktiv den Annäherungsversuchen von Damen, die Töchter im Alter ihrer eigenen Tochter hatten, und Lizzy Elmsworth, die Älteste in der Familie ihrer Nachbarin, war ungefähr im Alter von Virginia St. George und könnte von manchen (denen, die brünette Frauen dem sehr blonden Typ vorzogen) als hübsch angesehen werden. Außerdem, woher kamen die Elmsworths, hatte Frau St. George oft ihren Mann gefragt, einen respektlosen, fröhlichen Mann, der stets antwortete: „Wenn du mir erst einmal sagen würdest, woher wir kommen!“ ... so absurd für einen so bekannten Gentleman wie Colonel St. George in einem nicht näher bezeichneten Bezirk, den Frau St. George den „Süden“ nannte.
Aber bei dem Gedanken an diese neue, dunkelhäutige Frau Closson mit dem seltsam aussehenden Mädchen, das jetzt so hässlich war, aber plötzlich zu einer Schönheit werden könnte (Frau St. George hatte solche Fälle schon gesehen), erwachte in ihrem vagen Inneren der Instinkt der organisierten Verteidigung, und sie fühlte sich zu Frau Elmsworth und den beiden Elmsworth-Mädchen hingezogen, von denen man bereits wusste, wie hübsch sie einmal werden würden.
Frau St. George verbrachte viele Stunden damit, die körperlichen Vorzüge der jungen Damen, in deren Gesellschaft ihre Töchter jeden Abend stundenlang auf den Veranden auf und ab gingen und in den langen, kahlen Hotelsalons Walzer und Polka tanzten, katalogisierte und bewertete. Die Salons waren praktischerweise durch Schiebetüren voneinander getrennt, die sich in die Wand schieben ließen und so zwei Räume zu einem verbanden. Frau St. George erinnerte sich an den Tag, an dem sie von diesem Anblick angenehm beeindruckt war, mit den erwartungsvoll aufgestellten Stühlen aus gebogenem Holz an den Wänden und den mit purpurrotem Brokat drapierten Fenstern, die von überhängenden vergoldeten Gesimsen herabhingen. Damals war der Ballsaal des Hotels für sie der Inbegriff eines Thronsaals in einem Palast gewesen; aber seit ihr Mann sie zu einem Ball in der Seventh Regiment Armoury in New York mitgenommen hatte, hatten sich ihre Maßstäbe geändert, und sie betrachtete die Pracht des Grand Union fast ebenso verächtlich wie die arrogante Frau Eglinton aus New York, die im vergangenen Sommer auf dem Weg zum Lake George dort angekommen war und nachdem sie von dem unterwürfigen Hotelbesitzer in die gelbe Damast-„Hochzeitssuite“ geführt worden war, gesagt hatte, dass sie sich das für eine Nacht wohl gehen lassen könne.
Frau St. George war in jenen früheren Jahren sogar von einer Einleitung zu Frau Elmsworth begeistert gewesen, die eine ältere Stammkundin von Saratoga war als sie selbst und einen großen, auffälligen, umgänglichen Ehemann mit glänzenden schwarzen Backenbart hatte, der angeblich ein hübsches Vermögen an der New Yorker Börse gemacht hatte. Aber das war in den Tagen, als Frau Elmsworth täglich in einer aus New York geschickten hohen Kutsche zu den Pferderennen fuhr, was vielleicht zu viel Aufmerksamkeit erregte. Seitdem hatten die Verluste von Herrn Elmsworth an der Wall Street seine Frau gezwungen, die Kutsche abzugeben und zu Hause mit den anderen Damen auf der Veranda des Hotels zu bleiben, und sie flößte Frau St. George nun keine Ehrfurcht oder Neid mehr ein. Wäre da nicht diese neue Gefahr durch die Clossons gewesen, wäre Frau Elmsworth in ihrer jetzigen Lage kaum der Rede wert gewesen; aber jetzt, da Virginia St. George und Lizzy Elmsworth „in“ waren (wie Frau St. George es beharrlich nannte, obwohl die Mädchen keinen großen Unterschied in ihrem Leben sehen konnten) – jetzt, da Lizzy Elmsworths Aussehen Frau St. George wieder mehr zu bewundern und weniger zu fürchten schien und Mabel, die zweite Elmsworth-Tochter, die ein Jahr älter war als ihre jüngste Tochter, für die Zukunft zu mager und zu kantig erschien, um noch Gefahr zu laufen, St. George wieder mehr bewundernswert und weniger furchterregend erschien und Mabel, die zweite Elmsworth-Tochter, die ein Jahr älter war als ihre jüngste Tochter, zu knochig und mit zu markanten Wangenknochen, um eine zukünftige Gefahr darzustellen, begann Frau St. George sich zu fragen, ob sie und ihre Nachbarin nicht eine Art gemeinsame Verteidigung gegen neue Frauen mit Töchtern organisieren könnten. Später würde das nicht mehr so wichtig sein, denn Frau St. Georges Jüngste, Nan, war zwar sicherlich keine Schönheit wie Virginia, würde aber faszinierend sein, und wenn ihr Haar einmal hochgesteckt war, brauchten die St. George-Mädchen keine Rivalität mehr zu fürchten.
Woche für Woche, Tag für Tag ging die besorgte Mutter die Punkte von Fräulein Elmsworth durch und verglich sie einzeln mit denen von Virginia. Was Haare und Teint anging, gab es keinen Zweifel: Virginia, ganz Rose und Perle, mit vollen, hellen Haaren, die über ihrer niedrigen Stirn zusammengebunden waren, war so rein und strahlend wie eine Apfelblüte. Aber Lizzy hatte eine mindestens zwei Zentimeter schlankere Taille (manche sagten sogar fünf), ihre dunklen Augenbrauen waren markanter geschwungen, und ihre Füße – ach, woher hatte diese hochnäsige Elmsworth nur diesen arroganten Fußrücken? Ja, aber es war ein kleiner Trost, dass Lizzys Teint im Vergleich zu Virginias blass und leblos war und dass ihre schönen Augen Temperament zeigten und wahrscheinlich die jungen Männer abschrecken würden. Dennoch hatte sie in alarmierendem Maße das, was man „Stil“ nannte, und Frau St. George vermutete, dass in den Kreisen, in die sie ihre Töchter einführen wollte, Stil noch höher geschätzt wurde als Schönheit.
Das waren die Probleme, mit denen sich ihre Gedanken während der endlosen, schwülen Nachmittagsstunden beschäftigten, wie träge Fische, die sich zwischen den müden Wänden eines zu kleinen Aquariums hin und her drehten. Doch nun drang eine neue Präsenz in dieses träge Element ein. Frau St. George verglich nicht mehr ihre älteste Tochter und Lizzy Elmsworth miteinander, sondern begann, beide mit der Neuankömmling, der Tochter der unbekannten Frau Closson, zu vergleichen. Es war ein schwacher Trost für Frau St. George (obwohl sie sich das so oft sagte), dass die Clossons völlig unbekannt waren, dass Colonel St. George zwar mit Herrn Closson Poker spielte und mit ihm, wie die Familie es nannte, „geschäftliche Beziehungen“ unterhielt, aber dass sie noch lange nicht so weit waren, dass es für einen Mann eine angenehme Pflicht war, einen Kollegen seiner Familie vorzustellen. Es spielte auch keine Rolle, dass Frau Clossons eigene Vergangenheit, wenn überhaupt, noch undurchsichtiger war als die ihres Mannes, und dass die beiden sagten, sie sei eine arme brasilianische Witwe, als Closson sie auf einer Geschäftsreise in Rio aufgegabelt hatte, was von anderen, vermutlich besser informierten Personen belächelt und korrigiert wurde, die meinten, geschieden sei das richtige Wort, nicht Witwe. Selbst die Tatsache, dass das Closson-Mädchen (so wurde sie genannt) bekanntermaßen nicht Clossons Tochter war, sondern einen seltsamen exotischen Namen wie Santos-Dios trug („Der Colonel sagt, das ist kein Schimpfwort, das ist einfach so in dieser Sprache“, erklärte Frau St. George Frau Elmsworth, als sie über die Neuankömmlinge sprachen) – selbst das reichte nicht aus, um Frau St. George zu beruhigen. Das Mädchen, wie auch immer sie wirklich hieß, war als Conchita Closson bekannt; sie nannte den unverbindlichen, grauhaarigen Mann, der sonntags mit seiner Familie im Grand Union aß, „Vater“, und es half Frau St. George nichts, sich einzureden, dass Conchita hässlich und daher unbedeutend sei, denn sie hatte genau die Art von Hässlichkeit, die, wie Mütter rivalisierender Töchter wissen, plötzlich in unwiderstehlicher Schönheit aufblühen kann. St. George sich einzureden, dass Conchita hässlich und daher unbedeutend sei, denn sie hatte genau die Art von Hässlichkeit, die, wie Mütter rivalisierender Töchter wissen, plötzlich zu unwiderstehlicher Schönheit aufblühen kann. Im Moment war Fräulein Clossons Kopf zu klein, ihr Hals zu lang, sie war zu groß und zu dünn, und ihr Haar – nun ja, ihr Haar (oh, welch ein Grauen!) war fast rot. Und ihre Haut war dunkel unter dem Puder, den (ja, meine Liebe – mit achtzehn!) Frau St. George ihr sicher auftrug; und die Kombination aus roten Haaren und fahler Hautfarbe hätte jeden abgeschreckt, der davon gehört hatte, anstatt sie triumphierend in Conchita Closson verkörpert zu sehen. Frau St. George zitterte unter ihrem gepunkteten Musselin mit Valenciennes-Rüschen und zog sich ein mit Schwanendaunen gesäumtes Tuch über die Schultern. In diesem Moment kamen ihre eigenen Töchter Virginia und Nan nacheinander vorbei, und dieser Anblick verstärkte Frau St. Georges Verärgerung noch.
„Virginia!“, rief sie. Virginia blieb stehen, schien zu zögern, ob sie der Aufforderung Folge leisten sollte, und schlenderte dann über die Veranda zu ihrer Mutter hinüber.
„Virginia, ich möchte nicht, dass du dich weiter mit diesem seltsamen Mädchen abgibst“, begann Frau St. George.
Virginias saphirblaue Augen ruhten mit einem distanzierten, gleichgültigen Blick auf den fest zugeknöpften bronzefarbenen Lederstiefeln der Sprecherin, und Frau St. George fragte sich plötzlich, ob sie vielleicht ein Knopfloch aufgerissen hatte.
„Welches Mädchen?“, fragte Virginia gedehnt.
„Woher soll ich das wissen? Wer weiß, wer die sind. Dein Vater sagt, sie war eine Witwe aus einem dieser südamerikanischen Länder, als sie Herrn Closson geheiratet hat – ich meine, die Mutter.“
„Nun, wenn er das sagt, dann war sie es wohl.“
„Aber manche sagen, sie war nur geschieden. Und ich will nicht, dass meine Töchter mit solchen Leuten zu tun haben.“
Virginia wandte ihren blauen Blick von den Stiefeln ihrer Mutter ab und ließ ihn auf den kleinen, mit Schwanendaunen verzierten Kaminsims fallen. „Ich glaube, du wirst in dem Ding noch verbrennen“, bemerkte sie.
„Jinny! Jetzt hör mir mal zu“, rief ihre Mutter ihr vergeblich hinterher.
Nan St. George hatte sich nicht an dem Gespräch beteiligt; zunächst hatte sie kaum beachtet, was gesagt wurde. Solche Streitereien zwischen Mutter und Tochter gab es täglich, fast stündlich; Frau St. George konnte ihre Kinder nur erziehen, indem sie ihnen ständig vorhielt, dies oder jenes nicht zu tun. Nan St. George war mit sechzehn Jahren in der Phase, in der sie ihre ältere Schwester leidenschaftlich bewunderte. Virginia war alles, was ihre jüngere Schwester sein wollte: wunderschön, vollkommen selbstbewusst, ruhig und selbstsicher. Nan, deren ganzes Leben eine Achterbahnfahrt war, mit heißen Wellen der Begeisterung, eisigen Schauern der Verlegenheit und Selbstverachtung, sah mit Neid und Bewunderung zu ihrer göttlichen älteren Schwester auf. Das Einzige, was ihr an Virginia nicht so gefiel, war der überhebliche Ton, den diese gegenüber ihrer Mutter anschlug; es war zu einfach, Frau St. George zu übertrumpfen, es war zu sehr das, was Colonel St. George als „auf einen sitzenden Vogel schießen“ bezeichnete. Doch Virginias Einfluss war so stark, dass Nan in ihrer Gegenwart immer denselben Ton gegenüber ihrer Mutter anschlug, in der heimlichen Hoffnung, die Gunst ihrer Schwester zu gewinnen. Sie ging sogar so weit, Virginia (die keine Mimik beherrschte) nachzuahmen, wie Frau St. George schockiert auf eine unordentliche Strumpfhose schaute („Mutter fragt sich, wo wir erzogen worden sind“), wie Frau St. George im Schlaf in der Kirche lächelte („Mutter lauscht den Engeln“) oder wie Frau St. George skeptisch die Neuankömmlinge musterte („Mutter riecht einen Abfluss“). Aber Virginia nahm solche Darstellungen als selbstverständlich hin, und als die arme Nan sich danach, von Gewissensbissen geplagt, allein zu ihrer Mutter zurückschlich und ihr unter reumütigen Küssen zuflüsterte: „Ich wollte nicht unartig zu dir sein, Mama“, antwortete Frau St. George, die nervös ihre Hand an ihr gekräuseltes Haarband legte, meist besorgt: „Ich bin sicher, dass du das nicht wolltest, Liebling; nur bring mir nicht wieder meine Haare in Unordnung.“
Unbeantwortete Sühne verbittert das Blut, und etwas in Nan schrumpfte und verhärtete sich mit jeder dieser Zurückweisungen. Aber sie setzte sich ihnen jetzt nur noch selten aus, da es ihr leichter fiel, Virginias Beispiel zu folgen und die Ermahnungen ihrer Eltern zu ignorieren. Im Moment jedoch schwankte sie tatsächlich in ihrer Loyalität gegenüber Virginia. Seit sie Conchita Closson gesehen hatte, war sie sich nicht mehr sicher, ob Gesichtszüge und Teint die Krone der Schönheit einer Frau waren. Lange bevor Frau St. George und Frau Elmsworth sich auf einen Wert für die Neuankömmlingin geeinigt hatten, war Nan ihrem Charme erlegen. Seit dem Tag, an dem sie sie zum ersten Mal um die Ecke der Veranda herumkommen sah, ihren unruhigen kleinen Kopf mit einem flatternden Leghorn-Hut mit einer Rose unter der Krempe gekrönt und einen widerwilligen Pudel mit einer großen roten Schleife hinter sich herziehend, hatte Nan die unbekümmerte Kraft des Mädchens gespürt. Was hätte Frau St. George gesagt, wenn eine ihrer Töchter pfeifend die Veranda entlanggeschlendert wäre und ein grotesk aussehendes Spielzeugtier hinter sich hergezogen hätte? Fräulein Closson schien sich darüber keine Gedanken zu machen. Sie setzte sich auf die oberste Stufe der Veranda, zog ein Stück Melassebonbon aus ihrer Tasche und forderte den Pudel auf, „aufzustehen und dafür zu walzen“, was das unheimliche Tier auch tat, indem es sich auf die Hinterbeine stellte und vor seiner Herrin eine Reihe wackeliger Kreise vollführte, während sie die Melasse von ihren Fingern leckte. Alle Schaukelstühle auf der Veranda hörten auf zu knarren, als ihre Bewohner sich aufrichteten, um das Spektakel zu beobachten. „Eine Zirkusvorstellung!“, kommentierte Frau St. George gegenüber Frau Elmsworth, die mit ihrem vulgären Lachen erwiderte: „Sieht aus, als wären die beiden daran gewöhnt, sich zu präsentieren, nicht wahr?“
Nan hörte die Kommentare mit und war sich sicher, dass die beiden Mütter sich irrten. Das Closson-Mädchen war sich offensichtlich nicht bewusst, dass jemand sie und ihren absurden Hund beobachtete; es war diese Unbefangenheit, die Nan faszinierte. Virginia war äußerst selbstbewusst; sie dachte genauso wie ihre Mutter darüber nach, „was die Leute sagen würden“, und selbst Lizzy Elmsworth, obwohl sie ihre Gedanken viel besser verbergen konnte, war nicht wirklich unkompliziert und natürlich; sie gab nur vor, unbefangen zu sein. Es erschreckte Nan ein wenig, dass sie solche Gedanken hatte, aber sie drängten sich ihr auf, und als Frau St. George ihren Töchtern verbot, mit dem „seltsamen Mädchen“ zu sprechen (als ob sie nicht alle ihren Namen wüssten!), verspürte Nan einen Anflug von Wut. Virginia schlenderte weiter, wahrscheinlich zufrieden, dass sie das Vertrauen ihrer Mutter in die Details ihrer Kleidung erschüttert hatte (eine Angelegenheit, die Frau St. George sehr beschäftigte); aber Nan blieb stehen.
„Warum darf ich nicht mit Conchita gehen, wenn sie mich dabei haben will?“
Frau St. George wurde blass. „Wenn sie das will? Annabel St. George, was fällt dir ein, so mit mir zu reden? Was interessiert dich überhaupt, was so ein Mädchen will?“
Nan grub ihre Fersen in die Ritze zwischen den Verandadielen. „Ich finde sie lieb.“
Frau St. Georges kleine Nase war vor Verachtung gerümpft. Der kleine Mund darunter hing angewidert herab. Sie war „eine Mutter, die einen Abfluss riecht“.
„Nun, wenn nächste Woche die neue Gouvernante kommt, wirst du wohl feststellen, dass sie genauso über diese Leute denkt wie ich. Und du wirst sowieso tun müssen, was sie dir sagt“, schloss Frau St. George hilflos.
Eine Welle der Bestürzung überkam Nan. Die neue Gouvernante! Sie hatte nie wirklich an dieses fernes Schreckgespenst geglaubt. Sie hatte die Vermutung, dass Frau St. George und Virginia diese Legende gemeinsam erfunden hatten, um „Annabels Gouvernante“ sagen zu können, wie sie es einmal von der großen, stolzen Frau Eglinton aus New York gehört hatten, die nur eine Nacht im Hotel verbracht hatte und zum Hotelier gesagt hatte: „Sie müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Gouvernante meiner Tochter das Zimmer neben ihr bekommt.“ Nan hatte nie geglaubt, dass die Sache mit der Gouvernante über Gerede hinausgehen würde, aber jetzt schien sie das Klicken der Handschellen an ihren Handgelenken zu hören.
„Eine Gouvernante – ich?“
Frau St. George befeuchtete nervös ihre Lippen. „Alle stilbewussten Mädchen haben im Jahr vor ihrem Debüt eine Gouvernante.“
„Ich komme nächstes Jahr nicht in die Gesellschaft – ich bin erst sechzehn“, protestierte Nan.
„Nun, sie haben sie zwei Jahre lang. Das Mädchen aus Eglinton hatte auch eine.“
„Oh, dieses Eglinton-Mädchen! Sie hat uns alle angesehen, als wären wir nicht da.“
„Nun, so sieht eine Dame Fremde eben an“, sagte Frau St. George heldenhaft.
Nans Herz wurde schwarz. „Ich bringe sie um, wenn sie sich in meine Angelegenheiten einmischt.“
„Du fährst am Montag zum Bahnhof, um sie abzuholen“, sagte Frau St. George trotzig. Nan drehte sich auf dem Absatz um und ging weg.
KAPITEL II
Das Closson-Mädchen war schon mit ihrem Hund verschwunden, und Nan vermutete, dass sie ihn zum Ballspielen auf die Wiese neben dem kargen Grundstück des Hotels mitgenommen hatte. Nan ging die Stufen der Veranda hinunter, überquerte die Auffahrt und sah die schlanke Conchita, die einen Ball hoch über ihren Kopf wirbelte, während der Hund wild um sie herumtanzte. Nan hatte bisher nur ein paar schüchterne Worte mit ihr gewechselt und hätte sich unter normalen Umständen kaum getraut, jetzt zu ihr zu gehen. Aber sie befand sich in einer akuten Krise in ihrem Leben, und ihr Bedürfnis nach Mitgefühl und Hilfe überwältigte ihre Schüchternheit. Sie sprang über den Zaun auf die Wiese und ging auf Fräulein Closson zu.
„Das ist ein hübscher Hund“, sagte sie.
Fräulein Closson warf den Ball für ihren Pudel und drehte sich lächelnd zu Nan um. „Ist er nicht ein Schatz?“
Nan stand da und drehte einen Fuß um den anderen. „Hatten Sie jemals eine Gouvernante?“, fragte sie unvermittelt.
Fräulein Closson öffnete mit einem erstaunten Blick ihre dunkel umrandeten Augen, die wie blasse Aquamarine auf ihrem kleinen, dunklen Gesicht leuchteten. „Ich? Eine Gouvernante? Um Gottes willen, nein – wozu denn?“
„Genau das meine ich! Meine Mutter und Virginia haben das zusammen ausgeheckt. Nächste Woche bekomme ich eine.“
„Du meine Güte! Wirklich? Kommt sie hierher?“ Nan nickte mürrisch.
„Nun ja ...“, murmelte Conchita.
„Was soll ich denn jetzt machen – was würdest du tun?“, platzte Nan heraus, den Tränen nahe.
Fräulein Closson kniff nachdenklich die Augen zusammen, dann bückte sie sich bedächtig zu dem Pudel und warf ihm wieder den Ball zu.
„Ich habe gesagt, ich bringe sie um“, flüsterte Nan mit heiserer Stimme.
Die anderen lachten. „Das würde ich nicht tun, jedenfalls nicht sofort. Ich würde erst mal versuchen, sie zu besänftigen.“
„Sie umstimmen? Wie soll ich das machen? Ich muss doch tun, was sie will.“
„Doch, musst du nicht. Bring sie dazu, dass sie will, was du willst.“
„Wie soll ich das machen? Oh, kann ich dich Conchita nennen? Das ist so ein schöner Name. Ich heiße eigentlich Annabel, aber alle nennen mich Nan ... Aber wie soll ich diese Gouvernante um den Finger wickeln? Sie wird versuchen, mir Datumslisten beizubringen ... dafür wird sie schließlich bezahlt.“
Conchitas ausdrucksstarkes Gesicht verzog sich zu einer Grimasse der Missbilligung. „Nun, das würde ich hassen wie Rizinusöl. Aber vielleicht macht sie das ja nicht. Ich kannte ein Mädchen in Rio, das eine Gouvernante hatte, die kaum älter war als das Mädchen, und sie musste ... nun ja, Botschaften und Briefe für sie überbringen, die Gouvernante ... und abends schlich sie sich hinaus, um ... um eine Freundin zu treffen ... und sie und das Mädchen kannten alle Geheimnisse der anderen; also konnten sie sich nicht verraten, keine von beiden konnte das ...“
„Ach so“, sagte Nan mit einer vorgegebenen Miene der Einsicht. Aber plötzlich spürte sie ein seltsames Gefühl in der Kehle, fast wie Übelkeit. Conchitas lachende Augen schienen ihr durch halb geschlossene Lider zuzuflüstern. Sie bewunderte Conchita nach wie vor – aber sie war sich nicht sicher, ob sie sie in diesem Moment mochte.
Conchita war sich offensichtlich nicht bewusst, dass sie einen ungünstigen Eindruck hinterlassen hatte. „In Rio kannte ich ein Mädchen, das auf diese Weise geheiratet hat. Die Gouvernante hat ihre Liebesbriefe überbracht ... Willst du heiraten?“, fragte sie unvermittelt.
Nan errötete und starrte sie an. Heiraten war ein unerschöpfliches Thema der vertraulichen Gespräche zwischen ihrer Schwester und den Elmsworth-Mädchen, aber sie fühlte sich zu jung und unerfahren, um sich an ihren Diskussionen zu beteiligen. Einmal, bei einem Tanz im Hotel, hatte ein junger Mann namens Roy Gilling ihr Taschentuch aufgehoben und sich geweigert, es ihr zurückzugeben. Sie hatte gesehen, wie er es bedeutungsvoll an seinen jungen Schnurrbart geführt hatte, bevor er es in seine Tasche steckte, aber der Vorfall hatte sie eher verärgert und verwirrt als aufgeregt, und sie war nicht traurig gewesen, als er seine Aufmerksamkeit bald darauf ganz offensichtlich Mabel Elmsworth zuwandte. Sie wusste, dass Mabel Elmsworth bereits hinter einer Tür geküsst worden war, und Nan vermutete, dass ihre eigene Schwester Virginia das auch schon erlebt hatte. Sie selbst hatte keine festen Vorurteile in dieser Angelegenheit, sie fühlte sich einfach noch nicht bereit, über Heiratspläne nachzudenken. Sie bückte sich, um den Pudel zu streicheln, und antwortete, ohne aufzublicken: „Mit niemandem, den ich bisher gesehen habe.“
Der andere betrachtete sie neugierig. „Ich nehme an, du magst lieber Flirten, was?“ Sie sprach mit sanfter Stimme und einem trägen Rollen der R.
Nan spürte, wie ihr das Blut wieder in den Kopf schoss; eine ihrer schnellen Röte überzog sie mit Verlegenheit. Tat sie – tat sie nicht –
„Flirten“, wie diese Frau es so derb nannte (die anderen sprachen immer von „Flirten“)? Nan hatte noch keine wärmeren Annäherungsversuche als die von Herrn Gilling erlebt, und die offensichtliche Antwort war, dass sie es nicht wusste, da sie keine Erfahrung in solchen Dingen hatte; aber sie hatte die Zurückhaltung der Jugend, ihre Jugendlichkeit zuzugeben, und sie hatte auch das Gefühl, dass ihre Vorlieben und Abneigungen diese fremde Frau nichts angingen. Sie lachte vage und sagte hochmütig: „Ich finde das albern.“
Conchita lachte auch; ein leises, bedächtiges Lachen, voller unterdrückter und verlockender Geheimnisse. Noch einmal warf sie den Ball für ihren aufmerksam zuschauenden Pudel, dann steckte sie eine Hand in eine Falte ihres Kleides und zog ein zerknülltes Päckchen Zigaretten heraus. „Hier – nimm eine! Hier draußen sieht uns niemand“, schlug sie freundlich vor.
Nans Herz machte einen aufgeregten Sprung. Ihre eigene Schwester und das Mädchen aus Elmsworth rauchten bereits heimlich und beseitigten die Spuren ihrer Indiskretion, indem sie kleine, stark parfümierte rosa Lutschtabletten konsumierten, die sie heimlich aus der Hotelbar geholt hatten; aber sie hatten Nan nie angeboten, sie in diese verbotenen Rituale einzuführen, zu deren Geheimhaltung sie sie mit schrecklichen Schwüren verpflichtet hatten. Es war Nans erste Zigarette, und während ihre Finger danach zitterten, fragte sie sich voller Angst: „Was, wenn mir vor ihr schlecht wird?“
Aber Nan war trotz ihres Zitterns nicht das Mädchen, das eine Herausforderung ablehnte oder auch nur fragte, ob sie hier auf diesem offenen Feld wirklich vor unerwünschten Blicken sicher waren. Am anderen Ende stand eine Gruppe niedriger Sträucher, zu denen Conchita schlenderte und sich auf den Zaun setzte, von wo aus ihre schlanken, unbedeckten Knöchel anmutig baumelten. Nan schwang sich neben sie, nahm eine Zigarette und beugte sich zu dem Streichholz, das ihre Freundin ihr reichte. Es herrschte eine unangenehme Stille, während sie den verbotenen Gegenstand an ihre Lippen setzte und einen ängstlichen Zug nahm; der beißende Geschmack des Tabaks traf ihren Gaumen scharf, aber schon im nächsten Moment erfüllte ein angenehmer Duft ihre Nase und ihren Hals. Sie nahm wieder einen Zug und wusste, dass es ihr gefallen würde. Sofort wechselte ihre Stimmung von Schüchternheit zu Triumph, und sie rümpfte kritisch die Nase und warf den Kopf zurück, wie ihr Vater, wenn er eine neue Zigarrenmarke probierte. „Die sind gut – wo bekommst du die her?“, fragte sie mit unbekümmerter Miene; und dann, plötzlich die Erfahrung vergessen, die ihr Tonfall verriet, fuhr sie mit atemloser Mädchenstimme fort: „Oh, Conchita, zeigst du mir, wie du diese schönen Ringe machst? Jinny kann das nicht richtig, und die Elmsworth-Mädchen auch nicht.“
Fräulein Closson warf ebenfalls den Kopf zurück und lächelte. Sie holte tief Luft, nahm die Zigarette von den Lippen, formte sie zu einem rosigen Kreis und blies eine Reihe von Rauchringen hindurch. „So geht das“, lachte sie und drückte Nan das Päckchen in die Hände. „Du kannst es heute Abend üben“, sagte sie gut gelaunt, als sie von der Brüstung sprang.
Nan schlenderte zurück zum Hotel, so begeistert von ihrem Erfolg als Raucherin, dass ihre Angst vor der Gouvernante schwächer wurde. Auf den Stufen des Hotels wurde sie noch mehr beruhigt, als sie durch die Türen der Lobby einen großen, breitschultrigen Mann in einem Panamahut und einem hellgrauen Anzug sah, der seinen Leinenstaubmantel über den Arm gelegt hatte, seine Reisetaschen zu seinen Füßen stehen ließ und innegehalten hatte, um sich eine große Zigarre anzuzünden und dem Portier die Hand zu schütteln. Nan machte einen Freudensprung. Sie hatte nicht gewusst, dass ihr Vater an diesem Nachmittag ankommen würde, und allein sein Anblick vertrieb alle ihre Sorgen. Nan hatte blindes Vertrauen in die Fähigkeit ihres Vaters, Menschen aus Schwierigkeiten zu helfen – ein Vertrauen, das nicht auf tatsächlichen Erfahrungen beruhte (denn Colonel St. George bewältigte Schwierigkeiten in der Regel mit einer abweisenden Geste, die sie auf jemand anderen abwälzte), sondern auf seiner leichten Verachtung für weibliche Aufregung und seiner Art, zu seiner jüngsten Tochter zu sagen: „Ruf mich einfach an, mein Kind, wenn etwas geklärt werden muss.“ Vielleicht würde er sogar diesen Unsinn mit der Gouvernante klären; und währenddessen klärte allein der Gedanke an seine große, mächtige Erscheinung, seine großen, nach Kölnisch Wasser duftenden Hände, seinen prächtigen gelben Schnurrbart und seinen lockeren Gang die Luft von den Spinnweben, in die Frau St. George immer gehüllt war.
„Hallo, Tochter! Was gibt's Neues?“ Der Colonel begrüßte Nan mit einem lauten Kuss, legte einen Arm um sie und musterte ihr erhobene Gesicht.
„Ich bin froh, dass du gekommen bist, Vater“, sagte sie und wich dann ein wenig zurück, aus Angst, ein Hauch von Zigarettenrauch könnte sie verraten.
„Deine Mutter macht wohl ihren Mittagsschlaf?“, fuhr der Colonel fröhlich fort. „Komm mit. Charlie“ (zum Angestellten), „schick die Sachen bitte gleich auf mein Zimmer. Da ist etwas, das die junge Dame interessieren könnte.“
Der Angestellte winkte einem schwarzen Portier, und mit seinen Taschen vor sich stieg der Colonel mit Nan die Treppe hinauf.
„Oh, Vater! Wie schön, dass du da bist! Ich wollte dich fragen, ob ...“
Aber der Colonel kramte in einem der Koffer und verstreute verschiedene Teile einer auffälligen, aber etwas zerknitterten Garderobe über das Bett. „Warte mal“, keuchte er und hielt inne, um sich mit einem feinen Batist-Taschentuch die breite weiße Stirn abzuwischen. Er zog zwei Päckchen heraus und winkte Nan zu sich. „Hier sind ein paar hübsche Kleinigkeiten für dich und Jinny; die Verkäuferin im Laden sagte, das sei das, was die Schönheiten in Newport diesen Sommer tragen. Und das ist für deine Mutter, wenn sie aufwacht.“ Er nahm die Seidenpapierverpackung von einem kleinen roten Marokko-Etui und drückte auf den Verschluss. Vor Nans geblendeten Augen lag eine Diamantbrosche in Form eines Rosenstrauchs. Sie stieß einen bewundernden Seufzer aus. „Na, wie findest du das?“, lachte ihr Vater.
„Oh, Vater ...“ Sie hielt inne und sah ihn mit einem Hauch von Besorgnis an.
„Na?“, wiederholte der Colonel. Sein Lachen klang irgendwie leer, wie die Leere unter einer lauten Welle; Nan kannte dieses Geräusch. „Ist das ein Geschenk für Mutter?“, fragte sie unsicher.
„Na, für wen denn sonst – nicht für dich?“ scherzte er, wobei seine Stimme etwas weniger selbstsicher klang.
Nan drehte einen Fuß um den anderen. „Das ist doch furchtbar teuer, oder?“
„Du kritischer kleiner Kobold, was macht das schon?“
„Na ja, als du Mutter das letzte Mal ein Schmuckstück mitgebracht hast, gab es eine nächtliche Auseinandersetzung wegen Karten oder so“, sagte Nan mit ernster Miene.
Der Colonel brach in Gelächter aus und kniff ihr ins Kinn. „Na, na! Du hast Angst vor den Griechen, was? Wie heißt es noch? Timeo Danaos ...“
„Welche Griechen?“
Ihr Vater hob seine schönen, ironischen Augenbrauen. Nan wusste, dass er stolz auf seine oberflächlichen College-Kenntnisse war, und wünschte, sie hätte die Anspielung verstanden. „Haben sie dir in der Schule nicht einmal so viel Latein beigebracht? Nun, ich schätze, deine Mutter hat recht; du brauchst wirklich eine Gouvernante.“
Nan wurde blass und vergaß die Griechen. „Oh, Vater, darüber wollte ich mit dir sprechen ...“
„Worüber?“
„Die Gouvernante. Ich werde sie hassen, weißt du. Sie wird mich zwingen, Datumslisten auswendig zu lernen, so wie das Mädchen aus Eglinton. Und Mutter wird ihr alle möglichen dummen Geschichten über uns erzählen und ihr sagen, dass wir dies nicht tun dürfen und jenes nicht sagen dürfen. Ich glaube, sie wird mich nicht einmal mit Conchita Closson gehen lassen, weil Mutter sagt, Frau Closson sei geschieden.“
Der Colonel sah scharf auf. „Oh, das sagt deine Mutter, ja? Sie hat etwas gegen die Clossons? Das habe ich mir schon gedacht.“ Er nahm den Marokko-Etui und betrachtete die Brosche kritisch. „Ja, das ist ein schönes Stück; Black, Starr und Frost. Und ich gebe zu, dass du Recht hast; es hat mich ein hübsches Sümmchen gekostet. Aber ich muss deine Mutter davon überzeugen, dass sie höflich zu Frau Closson ist – verstehst du?“ Er verzog sein Gesicht auf seine lustige Art und nahm seine Tochter bei den Schultern. „Geschäftliche Angelegenheiten, verstehst du – das bleibt unter uns. Ich brauche Closson, ich muss ihn haben. Und er ist total genervt davon, dass alle Frauen seine Frau so kalt behandeln ... Ich sag dir was, Nan: Bilden wir doch eine Verteidigungs- und Offensivallianz! Du hilfst mir, deine Mutter zu überreden, dass sie Frau Closson nicht mehr so kalt behandelt, und überredest die anderen, dass sie es auch nicht tun und das Mädchen mit euch allen spielen lassen, und ich rede mit der Gouvernante, damit du nicht so viele Daten auswendig lernen musst.“
Nan stieß einen Freudenschrei aus. Schon lichteten sich die Wolken. „Oh, Vater, du bist einfach großartig! Ich wusste, dass alles gut wird, sobald du hier bist! Ich werde alles tun, was ich kann, um Mutter zu überreden – und du sagst der Gouvernante, dass ich mit Conchita ausgehen darf, so oft ich will?“ Sie warf sich in die tröstende Umarmung des Obersts.
KAPITEL III
Hätte Frau St. George weit genug zurückgedacht, hätte sie sich an eine Zeit erinnern können, in der sie Nans Vertrauen in die heilenden Kräfte des Obersts geteilt hatte; als es ihr ganz natürlich erschien, ihre Probleme zu ihm zu tragen, und sein Lachen ihr die Illusion gab, dass sie gelöst seien. Diese Zeiten waren vorbei; sie hatte längst erkannt, dass die meisten ihrer Schwierigkeiten vom Colonel kamen, anstatt von ihm gelöst zu werden. Aber sie bewunderte ihn nach wie vor – fand ihn sogar noch attraktiver als damals, bevor der Bürgerkrieg, als er ihr bei einem Ball in White Sulphur Springs in der Uniform eines Milizkapitäns zum ersten Mal in die Augen gefallen war; und jetzt, da er in der Wall Street eine prominente Stellung innehatte wo das Leben jeden Tag hektischer zu werden schien, war es nur natürlich, dass er ein wenig Entspannung brauchte, auch wenn sie bedauerte, dass dies immer Poker und Whisky bedeutete und manchmal, wie sie befürchtete, auch das dritte Element, das in dem Lied besungen wurde. Obwohl Frau St. George nun eine besorgte Frau mittleren Alters mit erwachsenen Töchtern war, fiel es ihr genauso schwer, sich damit abzufinden, wie damals, als sie zum ersten Mal einen Brief in der Tasche ihres Mannes gefunden hatte, den sie nicht lesen sollte. Aber es gab nichts, was sie dagegen tun konnte, weder gegen den Whisky und das Pokerspielen noch gegen die Besuche in Etablissements, wo zu jeder Tageszeit Spiel und Champagner zur Seite standen und Herren, die beim Roulette oder auf der Rennbahn gewonnen hatten, in frivoler Gesellschaft zu Abend aßen.
All das war Frau St. George längst bewusst, doch wenn der Colonel sich zu seiner Familie nach Long Branch oder Saratoga gesellte, tröstete sie sich damit, dass alle anderen besorgten Frauen mittleren Alters im langen Speisesaal des Hotels sie um ihren großartigen Ehemann beneideten.
Kein Wunder, dachte Frau St. George verächtlich, als sie sich die Herren vorstellte, mit denen diese Damen sich abgeben mussten: diesen lauten, rotgesichtigen Elmsworth, der noch nicht herausgefunden hatte, dass große schwarze Backen nur noch von Leichenbestattern getragen wurden, oder den armen dyspeptischen Closson, der so resigniert und gähnend neben der Südamerikanerin saß, mit der er vielleicht gar nicht verheiratet war. Closson war Frau St. George besonders zuwider; so sehr sie Frau Closson verachtete, hätte sie sie fast bemitleidet, dass sie nichts Besseres als Ehemann vorzuweisen hatte – selbst wenn er das überhaupt war, wie Frau St. George in ihren vertraulichen Gesprächen mit Frau Elmsworth hinzufügte.
Selbst jetzt, obwohl der Colonel in letzter Zeit so ausweichend und unbefriedigend gewesen war und sie noch nicht sicher war, ob er zu den morgigen Rennen erscheinen würde, hielt Frau St. George sich dankbar vor Augen, dass sie dann nicht mit einem Mann im Speisesaal des Hotels erscheinen müsste, für den sich eine Dame entschuldigen musste. Aber als sie nach ihrer Siesta ihre Haare ordnete, bevor sie zurück auf die Veranda gehen wollte, hörte sie sein Lachen vor ihrer Tür, und ihre schlummernden Befürchtungen wurden wieder wach. „Er ist zu fröhlich“, dachte sie und faltete nervös ihren Morgenmantel und ihre Pantoffeln zusammen, denn wenn der Colonel besorgt war, war er immer in bester Laune.
„Na, meine Lieben! Ich dachte, ich überrasche die Familie und schaue mal, was ihr so treibt. Nan hat mir einen recht guten Bericht gegeben, aber Jinny habe ich noch nicht auf die Schippe genommen.“ Er legte eine Hand auf das graumelbte blonde Haar seiner Frau und strich ihr mit der Spitze seines Schnurrbarts über die sorgenvolle Stirn – eine rituelle Geste, die ihn davon überzeugte, dass er sie geküsst hatte, und Frau St. George davon, dass sie geküsst worden war. Sie sah zu ihm auf mit bewundernden Augen.
„Die Gouvernante kommt am Montag“, begann sie. Als er vor ein paar Monaten seinen letzten erfolgreichen „Turn-over“ hingelegt hatte, hatte seine Frau ihm die Erlaubnis abgerungen, eine Gouvernante einzustellen; aber jetzt fürchtete sie eine erneute Diskussion über das Gehalt der Gouvernante, und doch wusste sie, dass die Mädchen, insbesondere Nan, eine gewisse soziale Disziplin brauchten. „Wir müssen sie haben“, fügte Frau St. George hinzu.
Der Colonel hörte offensichtlich nicht zu. „Natürlich, natürlich“, stimmte er zu und maß mit großen Schritten den Raum (seine Unfähigkeit, still zu sitzen, war eine weitere Prüfung für seine sesshafte Frau). Plötzlich blieb er vor ihr stehen und tastete in seiner Tasche, fand aber nichts. Frau St. George bemerkte die Geste und dachte: „Es ist die Kohlerechnung! Aber er wusste, dass ich sie nicht weiter senken konnte ...“
„Nun, nun, meine Liebe“, fuhr der Colonel fort, „ich weiß nicht, was ihr alle getrieben habt, aber ich hatte großes Glück, und es ist nur fair, dass ihr drei Mädchen daran teilhabt.“ Er zog das Marokko-Etui aus einer anderen Tasche. „Oh, Colonel“, keuchte seine Frau, als er den Verschluss drückte. „Na, nimm es – es ist für dich!“, scherzte er.
Frau St. George starrte fassungslos auf den glitzernden Strauß; dann füllten sich ihre Augen mit Tränen und ihre Lippen begannen zu zittern. „Tracy ...“, stammelte sie. Es war Jahre her, dass sie ihn bei seinem Namen genannt hatte. „Aber das solltest du nicht“, protestierte sie, „bei all unseren Ausgaben ... Das ist zu großzügig – es ist wie ein Hochzeitsgeschenk ...“
„Nun, wir sind doch verheiratet, oder?“ Der Colonel lachte laut. „Das ist das erste Ergebnis meines Umsatzes, Madam. Und ich habe den Mädchen auch ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Ich habe Nan das Päckchen gegeben, aber Jinny habe ich nicht gesehen. Sie ist wohl mit den anderen Mädchen unterwegs.“
Frau St. George löste sich von ihrer ekstatischen Betrachtung des Schmuckstücks. „Sie dürfen die Mädchen nicht verwöhnen, Colonel. Ich habe schon genug mit ihnen zu tun. Ich möchte, dass Sie ernsthaft mit ihnen darüber sprechen, dass sie nicht mit diesem Closson-Mädchen ausgehen ...“
Oberst St. George pfiff leise durch seinen Schnurrbart und ließ sich in den Schaukelstuhl gegenüber seiner Frau fallen. „Mit der Closson gehen? Warum, was ist denn mit der Closson? Sie ist doch hübsch wie eine Pfirsich.“
„Ich denke, deine eigenen Töchter sind hübsch genug, ohne sich zu erniedrigen, indem sie diesem Mädchen hinterherlaufen. Ich kann Nan nicht von ihr fernhalten.“ Frau St. George wusste, dass Nan die Lieblingstochter des Colonels war, und sie sprach mit innerer Erschütterung. Aber es durfte auf keinen Fall diese modische neue Gouvernante (die bei den Russell Parmores in Tarrytown und bei der Herzogin von Tintagel in England gewesen war) auf die Idee kommen, dass ihre neuen Schützlinge mit den Clossons unter einer Decke steckten.
Colonel St. George lehnte sich in seinem Sessel zurück, suchte nach einer Zigarre und zündete sie nachdenklich an. (Er hatte Frau St. George längst beigebracht, dass das Rauchen in ihrem Schlafzimmer zu seinen ehelichen Rechten gehörte.) „Nun“, sagte er, „was ist denn an den Clossons auszusetzen, meine Liebe?“
Frau St. George fühlte sich schwach und leer. Wenn er sie so ansah, halb lachend, halb herablassend, lösten sich alle ihre Gründe in Rauch auf. Und da lag das Juwel auf dem Frisiertisch – und zaghaft begann sie zu verstehen. Aber die Mädchen mussten gerettet werden, und ein Funken mütterlicher Leidenschaft regte sich in ihr. Vielleicht hatte ihr Mann in seiner großspurigen, unachtsamen Art die Clossons einfach ignoriert, ohne ihnen Beachtung zu schenken.
„Ich kenne natürlich keine Einzelheiten. Man munkelt zwar ... aber Frau Closson (wenn sie so heißt) ist keine Frau, mit der ich jemals zu tun haben möchte, daher habe ich keine Möglichkeit, etwas zu erfahren ...“
Der Colonel lachte bescheiden. „Na ja – wenn du keine Möglichkeit hast, etwas zu erfahren, werden wir das schon hinbekommen. Aber ich habe geschäftliche Gründe, warum du dich zuerst mit Frau Closson anfreunden sollst; wir werden ihre Vergangenheit später untersuchen.“
Freundschaft mit Frau Closson schließen! Frau St. George sah ihren Mann bestürzt an. Er wollte, dass sie das tat, was sie am meisten demütigen würde, und es war ihm so wichtig, dass er wahrscheinlich seinen letzten Dollar für diesen Diamanten als Bestechungsgeld ausgegeben hatte. Frau St. George war solche Situationen nicht ungewohnt; sie wusste, dass die finanzielle Lage eines Gentleman jederzeit Kompromisse und Zugeständnisse erforderlich machen konnte. Alle Damen in ihrem Bekanntenkreis waren daran gewöhnt; mal ging es ihnen gut, mal schlecht, je nachdem, wie die geheimen Götter der Wall Street es wollten. Sie schätzte die aktuelle Notlage ihres Mannes anhand des Wertes des wahrscheinlich noch nicht bezahlten Schmucks ein, und ihr Herz wurde schwer.
„Aber, Colonel –“
„Nun, was ist denn mit den Clossons los? Ich mache schon seit Jahren ab und zu Geschäfte mit Closson und kenne keinen ehrlichereren Kerl. Er hat mir gerade ein großes Geschäft verschafft, und wenn du die ganze Sache ruinierst, indem du seine Frau verschmäht ...“
Frau St. George nahm all ihre Kraft zusammen, um zu antworten: „Aber Colonel, es wird gemunkelt, dass sie nicht einmal verheiratet sind ...“
Ihr Mann sprang auf und stellte sich mit gerötetem Gesicht und gereizten Augen vor sie. „Wenn du glaubst, ich würde meine große Chance auf einen Gewinn davon abhängig machen, ob die Clossons einen Pfarrer hatten, der sie traute, oder nur den Standesbeamten ...“
„Ich muss an die Mädchen denken“, stammelte seine Frau.
„Ich denke auch an die Mädchen. Glaubst du etwa, ich würde mich in der Stadt so abrackern, wenn es die Mädchen nicht gäbe?“
„Aber ich muss an die Jungs denken, mit denen sie ausgehen, wenn sie mal nette junge Männer heiraten sollen.“
„Die netten jungen Männer werden in Scharen kommen, wenn ich diesen Deal durchziehen kann. Und was ist denn an der Closson-Tochter auszusetzen? Sie ist hübsch wie ein Bild.“
Frau St. George staunte wieder einmal über die Begriffsstutzigkeit der brillantesten Männer. War das nicht genau einer der Gründe, warum man das Closson-Mädchen nicht ermutigen sollte?
„Sie pudert ihr Gesicht und raucht Zigaretten ...“
„Na ja, machen das unsere Mädchen und die beiden Elmsworths nicht auch? Ich könnte schwören, dass ich einen Hauch von Rauch gerochen habe, als Nan mich gerade geküsst hat.“
Frau St. George wurde vor Entsetzen blass. „Wenn du das von deinen Töchtern sagst, sagst du auch alles!“, protestierte sie.
Es klopfte an der Tür, und ohne darauf zu warten, dass jemand öffnete, flog Virginia in die Arme ihres Vaters. „Oh, Vater, wie lieb von dir! Nan hat mir das Medaillon geschenkt. Es ist so wunderschön, mit meinem Monogramm darauf – und mit Diamanten!“
Sie hob ihre strahlenden Lippen, und er beugte sich mit einem Lächeln zu ihr hinunter. „Was ist das für ein neuer Duft, Fräulein St. George? Oder haben Sie eine der Pastillen Ihres Vaters geklaut?“ Er roch daran und hielt sie dann auf Armeslänge von sich, beobachtete, wie sie schnell rot wurde und wie ihre tiefen Augen ihn flehentlich ansahen.
„Hör mal, Jinny. Deine Mutter sagt, sie will nicht, dass du mit dem Closson-Mädchen gehst, weil sie raucht. Aber ich sage ihr, dass ich dafür geradestehe, dass du und Nan niemals einem so schlechten Beispiel folgen würdet – oder?“
Ihre Blicke und ihr Lachen trafen sich. Frau St. George wandte sich mit einem Gefühl der Hilflosigkeit ab. „Wenn er sie jetzt schon rauchen lässt ...“
„Ich finde, deine Mutter ist unfair gegenüber dem Closson-Mädchen, und das habe ich ihr auch gesagt. Ich möchte, dass sie sich mit Frau Closson anfreundet. Ich möchte, dass sie sofort damit anfängt. Oh, da ist Nan“, fügte er hinzu, als sich die Tür wieder öffnete. „Komm, Nan, ich möchte, dass du deine Freundin Conchita verteidigst. Du magst sie doch, oder?“
Aber Frau St. Georges Groll wurde immer größer. Sie konnte für ihre Töchter kämpfen, so hilflos sie für sich selbst auch war. „Wenn du dich darauf verlässt, dass die Mädchen selbst entscheiden, mit wem sie Umgang haben! Man sagt, die heißt gar nicht Closson. Niemand weiß, wie sie wirklich heißt oder wer sie sind. Und der Bruder reist mit einer Gitarre herum, die mit Bändern verziert ist. Keine anständige Frau wird sich mit deinen Töchtern abgeben, wenn du willst, dass man sie überall mit diesen Leuten sieht.“
Der Colonel stand mit gerunzelter Stirn vor seiner Frau. Als er die Stirn runzelte, vergaß sie plötzlich alle Gründe, die sie gegen ihn hatten, aber der blinde Instinkt der Opposition blieb. „Du würdest doch nicht die Clossons zum Abendessen einladen, oder?“, schlug er vor.
Frau St. George befeuchtete ihre trockenen Lippen mit der Zunge. „Oberst ...“
„Du willst nicht?“
„Mädchen, euer Vater macht nur Spaß“, stammelte sie und wandte sich mit einer zittrigen Geste ihren Töchtern zu. Sie sah, wie Nans Augen sich verdunkelten, aber Virginia lachte – ein Lachen der Komplizenschaft mit ihrem Vater. Er stimmte mit ein.
„Mädels, ich sehe, eure Mutter ist mit meinem Geschenk nicht zufrieden. Sie ist nicht so leicht zu begeistern wie ihr jungen Dummchen.“ Er deutete auf den Schminktisch, und Virginia nahm die Marokko-Schatulle. „Oh, Mutter – ist das für dich? Oh, ich habe noch nie etwas so Schönes gesehen! Du musst Frau Closson einladen, damit sie sieht, wie neidisch sie wird. Ich glaube, das ist es, was Vater von dir will – nicht wahr?“
Der Colonel sah sie mitfühlend an. „Ich habe deiner Mutter die einfache Wahrheit gesagt. Closson hat mir etwas Gutes getan, und als Gegenleistung möchte er nur, dass ihr Damen seinen Frauen gegenüber ein wenig menschlicher seid. Ist das zu viel verlangt? Er kommt heute mit dem Nachmittagszug und bringt übrigens zwei junge Männer mit – seinen Stiefsohn und einen jungen Engländer, der auf der Estancia von Frau Closson gearbeitet hat. Der Sohn eines Grafen oder so etwas. Was sagt ihr dazu, Mädels? Zwei neue Tanzpartner! Und ihr seid in dieser Hinsicht nicht gerade gut bedacht, oder?“ Das war eine brennende Frage, denn es war allgemein bekannt, dass ihre Tanzpartner unbekannt und wenige waren, weil alle klugen und heiratsfähigen jungen Männer, von denen Virginia und die Elmsworths in den „Gesellschaftskolumnen“ der Zeitungen gelesen hatten, Saratoga verlassen hatten und nach Newport gezogen waren.
„Mutter weiß, dass wir meistens miteinander tanzen müssen“, murmelte Virginia mürrisch.
„Ja – oder mit den Schönlingen aus Buffalo!“, lachte Nan.
„Nun, ich finde das beschämend, aber wenn deine Mutter Frau Closson ablehnt, müssen die jungen Männer, die Closson mitbringt, wohl mit den Elmsworth-Mädchen tanzen, statt mit dir.“
Frau St. George stand zitternd neben dem Schminktisch. Virginia hatte die Schatulle abgestellt, und die Diamanten funkelten im Sonnenstrahl, der durch die Lamellen der Fensterläden fiel.
Frau St. George besaß nicht viel Schmuck, aber plötzlich wurde ihr klar, dass jedes Stück an ein ähnliches Ereignis erinnerte. Entweder eine Frau oder ein Geschäft – etwas, bei dem sie nachsichtig sein musste. Sie mochte Schmuck genauso wie jede andere Frau auch, aber in diesem Moment wünschte sie sich, dass all ihre Stücke auf dem Meeresgrund lägen. Denn jedes Mal hatte sie nachgegeben – so wie sie wusste, dass sie jetzt nachgeben würde. Und ihr Mann würde immer denken, dass es daran lag, dass er sie bestochen hatte...