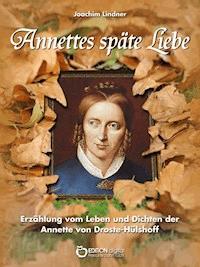7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer war E.T.A Hofmann? Wo und vor allem wie hat er gelebt? Auf ungewöhnliche Weise nähert sich Joachim Lindner in diesem Buch dem Menschen und Künstler, seinem Leben und seiner Kunst. Im Frühjahr 1882 wird ein Berliner Student, der mit Hoffmann verwandt ist, gebeten, Briefe seines Vetters wortgetreu abzuschreiben. Auf diese Weise gelingt es dem Autor, die Lebensstationen Hoffmanns zwischen Königsberg und Berlin, seine politischen und künstlerischen Auffassungen, aber auch seinen persönlichen Mut, sich für Recht und Gerechtigkeit einzusetzen, auf literarische Weise dazustellen. Gottlieb, so der Vorname des Berliner Studenten, lernt wie der Leser E.T.A. Hoffmann sehr viel genauer und ganz anders kennen als es das häufig in der Öffentlichkeit herumschwirrende Zerrbild vom ewig betrunkenen Gespensterdichter vorgibt – eine Einladung, dem wirklichen Hoffmann näher zu kommen. Bemerkenswert ist ein Vorspruch des Autors zu seinem Buch: „Die Personen sind bis auf eine, die einer Erzählung Hoffmanns entlehnt wurde, historisch verbürgt. Ähnlichkeiten sind nicht zufällig, sondern, soweit es im Vermögen des Verfassers stand, angestrebt.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Joachim Lindner
Die Frucht der bitteren Jahre
Erzählung über den Kammergerichtsrat und Dichter E. T. A. Hoffmann
ISBN 978-3-86394-624-1 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals1990 im Verlag der Nation Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Die Zitate aus Hoffmanns Erzählungen wurden entnommen aus:
E. T. A. Hoffmann, Poetische Werke, Aufbau-Verlag, Berlin 1958.
Die Personen sind bis auf eine, die einer Erzählung Hoffmanns entlehnt wurde, historisch verbürgt.
Ähnlichkeiten sind nicht zufällig, sondern, soweit es im Vermögen des Verfassers stand, angestrebt.
1. Kapitel
In keiner als in dieser düstern verhängnisvollen Zeit, wo man seine Existenz von Tage zu Tage fristet und ihrer froh wird, hat mich das Schreiben so angesprochen — es ist, als schlösse ich mir ein wunderbares Reich auf, das, aus meinem Innern hervorgehend und sich gestaltend, mich dem Drange des Äußern entrückte.
E. T. A. Hoffmann am 19. August 1813 vor der Schlacht bei Dresden an seinen Verleger C. F. Kunz
An einem Märzmorgen des Jahres 1822, einem der ersten frühlingshaften Tage jenes Jahres, verließ ein junger Mann sein Quartier in der Berliner Friedrichstraße, um seinen Vetter, den Kammergerichtsrat Hoffmann, zu besuchen. Sein Weg führte durch jenes Stadtviertel, das, in wenigen Stunden zerstört und in vier Jahrzehnten wieder aufgebaut, heute nahezu so aussieht wie zu des Kammergerichtsrats Tagen — ein Wunder, das ihn kaum in Erstaunen versetzt hätte, da er in seinen Erzählungen die guten und nützlichen, mehr noch die schlimmen, unheilvollen Seiten moderner Entwicklung erahnt und vorweggenommen hat.
Aber niemand, selbst sein leiblicher Vetter nicht, glaubte ihn ernst nehmen zu müssen, sodass dann die spätere Wirklichkeit die Fantasie des Dichters weit übertraf. Was er schrieb, meinte der junge Mann, mochte gut und ergötzlich sein, jedenfalls lasen es die Leute gern; ihm indessen, dem Studenten der Rechte an der Berliner Universität, lag mehr an der Unterhaltung des geistreichen und witzigen Mannes, so bissig und spöttisch er mitunter auch sein konnte.
Eben deswegen war er an jenem sonnigen Märzmorgen unterwegs zum Gendarmenmarkt, einem der schönsten Plätze Altberlins, mit Schinkels Theater in der Mitte, flankiert von den Türmen der deutschen und französischen Kirche. Dort, an der Ecke Tauben- und Charlottenstraße, im Hause des Geheimen Obersteuerrats von Alten, wohnte sein Vetter, der Kammergerichtsrat und Dichter E. T. A. Hoffmann. Als gewandter Zeichner und Karikaturist hatte er das belebte Viertel sehr anschaulich auf einer Skizze festgehalten und sie dem jungen Mann gezeigt, den er wie den Studenten aus dem Goldnen Topf Anselmus nannte, obwohl er Gottlieb hieß und mit jener merkwürdigen Figur nichts gemein haben wollte, die sich teils in der wirklichen, teils in einer imaginären Welt aufhielt. — Zugutezuhalten war es Hoffmann, dass es sich um ein Märchen handelte, wenn auch aus neuer Zeit; und nicht die märchenhaften Züge irritierten Gottlieb, sondern wie Hoffmann mit der Wirklichkeit umsprang. Warum machte er sich über so brave und biedere Leute wie den Konrektor Paulmann oder den Registrator Heerbrand lustig und zog ihnen den geheimen Archivarius Lindhorst vor, den er doch selbst einen wunderlichen, merkwürdigen Mann nannte?
Wie mit dieser und manch anderer Erzählung konnte sich Gottlieb auch mit des Vetters Skizze vom Gendarmenmarkt bei allem Respekt vor dessen Zeichenkünsten nicht recht befreunden, denn auch dort schienen ihm Wirklichkeit und Erfindung, Reales und Fantastisches auf eine nicht geheure Art gemischt. Dass sich auf den Straßen rings um den Platz, wie Hoffmann ihn dargestellt hatte, dessen Freunde und Bekannte aufhielten, fand er ganz amüsant: Da näherte sich in flotter Fahrt der Baron Fouqué in seiner hochherrschaftlichen Kutsche den Ständen der Gemüseweiber vor der deutschen Kirche; dort, in der Markgrafenstraße, begegnete Ludwig Tieck, gefolgt von Clemens Brentano, seinem Schwager Bernhardi. Der Vetter selbst fehlte nicht, am Fenster seines Arbeitszimmers stehend, unterhielt er sich mit dem aus dem Nachbarfenster blickenden Schauspieler Ludwig Devrient, seinem Freund und Zechbruder, wie man ihn wohl nennen musste. Doch was sollte es, dass er gleichzeitig im Schlafkabinett neben seiner Ehefrau Mischa lag?
Immerhin konnte man es gelten lassen, und vielleicht auch, dass er, als Komponist, Kapellmeister und Theaterenthusiast mit den Vorgängen im Schauspielhaus eng vertraut, wie durch die Mauern hindurch in das Innere des Musentempels zu blicken vermochte und genau wusste, was sich zur Mittagszeit, wie die Theateruhr anzeigte, dort zutrug. Im Direktionszimmer empfing eben der Intendant Graf Brühl drei Dichterlinge, die ihm devot ihre Manuskripte darboten, während sich vor dem leeren Parkett mehrere Damen und Herren mit weit aufgerissenen Mündern im Chorgesang übten und im Theaterrestaurant der schwergewichtige Kapellmeister Anselm Weber ein volles Tablett in beiden Händen vor sich hertrug. Doch wer war das schmächtige Männchen, das ihn gelassen und mit verschränkten Armen erwartete? Kein anderer als der Kapellmeister Kreisler aus Hoffmanns Erzählungen, der ihm überdies zum Verwechseln ähnelte. Und schaute man genauer hin, dann wimmelte es auf den Straßen von Figuren aus dem Reich der Dichtung. Abgesehen davon, dass nicht einzusehen war, was ein Löwe und ein Vogel Strauß zur Mittagsstunde auf dem Gendarmenmarkt zu suchen hatten nebst einem auf dem Giebel des Schauspielhauses herumturnenden Affen — war es merkwürdig, ja absonderlich, dass sich Erasmus Spikher aus den Abenteuern der Silvester-Nacht, der Doktor Dapertutto mit der Kurtisane Guilietta Arm in Arm auf der Straße bewegten, als gehörten sie ebenso dorthin wie die gestikulierenden Juden, der mit geschultertem Gewehr zur Wachablösung marschierende Soldat oder der Anonymus, der in der Nähe des Kammergerichts seine Notdurft verrichtete. Kein Wunder, dass auch der Student Anselmus, die lange Pfeife schmauchend, am Bildrand erschien und dicht neben dem großen Klecks Chamissos Peter Schlemihl, wie immer ohne Schatten.
Der Vetter war ein Schelm und trieb ein verwirrendes Spiel mit dem braven Bürger, auf der Skizze genauso wie in seinen Erzählungen. Auch ihn, den Studenten Gottlieb, verspottete er gern und oft so lange, bis ihm das Blut zu Kopf stieg. Dennoch zog es ihn immer wieder zu dem seltsamen Mann, dem an seinen Besuchen gelegen zu sein schien, besonders, seitdem er krank war und die Wohnung nicht mehr verlassen konnte. Die Beine versagten ihm den Dienst, sodass der sonst so lebhafte und bewegliche Vetter an den Lehnstuhl gefesselt war. Das ertrug er mit großer Fassung und litt mehr unter einem geistigen Versagen, das damit verbunden war. Er vermochte nämlich nicht mehr seine wie eh und je wie aus einem Quell sprudelnden Gedanken und Einfälle zu Papier zu bringen, und zwar nicht, weil ihm die Finger den Gehorsam versagten, sondern weil die Gedanken, sobald er sie schriftlich fixieren wollte, wie Rauch im Wind zerstoben.
So hatte ihm sein Hang zum Schreiben keinen Segen gebracht, sondern im Gegenteil schwarzes Unheil über ihn heraufbeschworen. Auch seine körperliche Hinfälligkeit nahm zu; die Lähmung erfasste, von den Füßen aufsteigend, allmählich den ganzen Körper. Gottlieb hatte ihn lange nicht mehr gesehen. Immer wenn er ihn besuchen wollte, öffnete ein grämlicher Invalide die Tür und erklärte ihm, er sei der Pfleger des Herrn Kammergerichtsrats, der so krank sei, dass er niemanden empfangen könne.
Daher wagte er an jenem Märzmorgen, vor dem Hause des Geheimen Obersteuerrats von Alten angelangt, kaum, den Blick zum Fenster zu heben, aus dem Hoffmann sonst das bunte Gewimmel auf dem Gendarmenmarkt beobachtete. Doch leuchtete dort nicht die rote Mütze, die der Vetter gern zu tragen pflegte? Kein Zweifel, er saß wie in guten Tagen, in seinen Warschauer Schlafrock gehüllt, am Fenster. Gottlieb zog sein Taschentuch und winkte — der Vetter winkte zurück und nickte, er durfte also kommen. Kurz darauf stand er, noch atemlos vom raschen Treppensteigen, vor der Tür, die der Invalide diesmal bereitwillig öffnete.
Der junge Mann war nicht wenig erstaunt, als er einige Wochen später alle Einzelheiten seines Besuchs in Symanskis Zuschauer gedruckt las, in einer Folge von sechs Fortsetzungen. Von einer zur anderen wurde er immer gespannter, denn was würde der Vetter wohl über ihn ausplaudern, oder verwandelte er ihn gar in eine seiner Fantasiegestalten?
Schließlich atmete er erleichtert auf: Hoffmann hatte keine Geschichte aus seinem Besuch gemacht, wahrscheinlich nicht mehr machen können, sondern einfach berichtet, was sich zugetragen hatte. Ganz einfach war die Erzählung freilich nicht. Der erfahrene Schriftsteller hatte sich, unter Anwendung eines Kunstgriffes, in ihn, den Studenten Gottlieb, verwandelt und aus dessen Blickwinkel die Vorgänge geschildert. Vorgänge konnte man eigentlich nicht sagen, denn vorgefallen war nichts weiter, als dass sie das Markttreiben beobachtet und sich Gedanken über Käufer und Verkäufer gemacht hatten.
Bei jenem Besuch hatte ihm Hoffmann recht deutlich vorgestellt, dass das genaue Erfassen der Wirklichkeit, etwa eines Markttages, nur das erste Erfordernis sei, um ein guter Schriftsteller zu werden. Gemeinsam mit ihm hatte er mancherlei Mutmaßungen angestellt über auffallende und weniger auffallende Personen, die auf dem Markt erschienen und wieder verschwanden wie Schauspieler auf der Bühne, beispielsweise über jenen langen, dürren Mann, den der Vetter zuerst für einen Zeichenmeister ausgegeben hatte, der in seinem alten Malkasten die eingekauften Waren eilig nach Hause trug, um sie sofort zuzubereiten und gierig zu verzehren - eine durchaus glaubwürdige Deutung, wie Gottlieb schien. Da ihm aber das Porträt wenig gefiel, hatte Hoffmann den nur um seinen Bauch besorgten Zeichenmeister in einen gemütlichen französischen Pastetenbäcker umgewandelt; eine wie die andere Figur so lebensecht, dass Gottlieb ihm seine Anerkennung nicht versagen konnte, dagegen seinen Zweifel zurückhielt, wo denn nun die Wahrheit läge oder ob nicht vielmehr die Wirklichkeit, befragte man den Mann nach Stand und Beruf, ganz anders aussähe.
Das Schreiben war eine vertrackte Kunst, soviel war Gottlieb bei seinem Besuch klar geworden, und wenn er eine Lehre daraus zog, dann die, dass er kein Talent zum Schriftsteller besaß - Hoffmann hatte es deutlich genug ausgesprochen. Es war überdies eine Kunst, die leicht böse Folgen haben konnte, und auch dafür bot dessen Schicksal das beste Beispiel.
Gottlieb hatte Vorbehalte gegenüber des Vetters Schriftstellerei, doch schätzte er ihn ohne jede Einschränkung als pflichttreuen Beamten. In dieser Hinsicht war er ihm Vorbild, dem er nacheifern wollte und auch musste, da ihm seine verwitwete Mutter das Studium nicht ermöglichen konnte, sodass er auf die Hilfe der Verwandtschaft angewiesen war wie Hoffmann in seiner Jugend, und wie dieser suchte er sein Studium und die darauffolgende Referendarzeit schnell zu absolvieren, um so bald wie möglich selbstständig zu werden. Aus diesem Grund hielt er sich, so schwer es ihm mitunter auch fiel, von allem fern, was ihn von seinem Ziel ablenken konnte, mied den Umgang mit den politischen Hitzköpfen unter den Studenten und war als zurückhaltender und fleißiger junger Mann bei den Professoren geschätzt. Selbst Hoffmann lobte ihn, wenn auch ein spöttischer Unterton in seinen Worten nicht zu überhören war.
2. Kapitel
Wenige Tage nach dem Besuch bei dem Kammergerichtsrat erhielt Gottlieb einen Brief von Julius Eduard Hitzig mit der Bitte, ihn aufzusuchen. Hitzig, ein Freund seines Vetters und wie dieser preußischer Beamter, war Kriminal- und zugleich Pupillenrat, nicht, weil er den Leuten gern tief in die Augen blickte, sondern weil er die Rechte von Waisen und Unmündigen, nach dem Lateinischen Pupillen genannt, wahrnahm. Er galt als maßvoller, nüchterner Mann, und das traf insofern zu, als er keinen Tropfen Alkohol zu sich nahm. Dazu gehörte Standhaftigkeit, da Hoffmann bei den Zusammenkünften mit seinen Freunden, den Serapionsbrüdern, ungern auf belebende Getränke verzichtete, selbst den Punsch zubereitete und wie eine seiner Fantasiegestalten unruhig zwischen seinen Gästen hin und her wanderte, leere Gläser emsig nachfüllte und darauf wartete, dass sich die Wirkung des Alkohols in zunehmender Gesprächigkeit zeigte, denn es ging ihm um Anregung und Belebung und um Erhebung über den Alltag.
Hitzig wurde in Hoffmanns Freundeskreis auch ohne Alkohol angeregt, und er fühlte sich dort so wohl, weil er nicht zum Trinken genötigt, sondern trotz seiner Abstinenz geschätzt wurde, zumal er sich lebhaft am Gespräch beteiligte und wie die anderen Serapionsbrüder literarische Ambitionen besaß. Da es ihm an Fantasie mangelte, versuchte er sich auf dem Felde der Biografie und arbeitete an einer Lebensbeschreibung des erfolgreichen Bühnenautors und Schicksalsdramatikers Zacharias Werner, den er ebenso wie Hoffmann seit Langem kannte.
Gottlieb wusste, dass er eigentlich Itzig hieß. Obwohl der junge Heine ihn wegen des seinem Namen Vorgesetzten H’s verspottete, beharrte er darauf, sich Hitzig zu nennen, denn wenn man es auch, sofern man sich zur Taufe entschloss, zu Rang und Ansehn bringen konnte, war es besser, sich nicht allzu deutlich als Jude zu erkennen zu geben.
Als Gottlieb das Haus Friedrichstraße Nummer 242 betrat, öffnete ein etwa zehnjähriger Junge die Tür, die zu Hitzigs Wohnung führte. Das konnte niemand anders sein als Fritz, Hitzigs Sohn, der ihm aus des Vetters Märchen vom Nußknacker und Mausekönig vertraut war.
»Fritz«, sagte Gottlieb, seiner Sache sicher, »führe mich bitte zu deinem Vater.«
»Gewiss«, erwiderte der Junge artig, »der Vater erwartet Sie bereits.«
»Wundert es dich nicht, dass ich dich kenne?«
»Nein, Onkel Ernst hat mich ja in seinem Märchen vom Nussknacker genannt, das jeder kennt, mich und meine kleine Schwester Marie, die nun nicht mehr bei uns ist. Der Onkel hat gesagt, sie ist dem höheren Leben zugeeilt, für das sie bestimmt war.«
Gottlieb nickte. Er wusste, dass der Vetter sich wirklich ähnlich ausgedrückt hatte in dem Brief, den er Hitzig nach dem Tod Maries vor einem Vierteljahr schrieb. Doch waren es wohl mehr Worte des Trostes gewesen als wirklicher Glaube an ein Leben nach dem Tod, denn wenn Hoffmann auch die rechte christliche Gesinnung besaß, so schien er ihm doch von den Heilslehren des Christentums weniger überzeugt zu sein.
Hitzig empfing seinen Besucher im Arbeitszimmer, am Schreibtisch sitzend, auf dem sich Papiere häuften.
»Es sind Briefe«, erklärte der Kriminalrat, nachdem er Gottlieb begrüßt hatte, »und sonstige Dokumente aus dem Leben Ihres Vetters, die ich sammle und sortiere. Hier ein Zeugnis aus jüngster Zeit.«
Er zog eine Karte hervor und reichte sie Gottlieb: »Die Todesanzeige des Katers Murr.«
Gottlieb las in der klaren, zierlichen Handschrift Hoffmanns:
»In der Nacht vom 29. bis zum 30. Novbr. d. J. entschlief nach kurzem, aber schweren Leiden zu einem bessern Dasein mein geliebter Zögling, der Kater Murr, im vierten Jahr seines hoffnungsvollen Alters, welches ich teilnehmenden Gönnern und Freunden ganz ergebenst anzuzeigen nicht ermangle. Wer den verewigten Jüngling kannte, wird meinen tiefen Schmerz gerecht finden und ihn — durch Schweigen ehren.
Berlin, d. 30. Novbr. 1821 Hoffmann.«
Als Gottlieb die Karte zurückgab, konnte er ein Kopfschütteln nicht unterdrücken.
»Sie wundern sich gewiss«, meinte Hitzig, »dass Ihr Vetter den Kater so betrauert, als habe er einen nahen Angehörigen verloren. Aber das war er wohl für ihn. Bedenken Sie, dass ihm das kluge Tier als Vorbild für die Lebensansichten des Katers Murr ans Herz gewachsen war. Am Abend des Tages, an dem ich die Trauerbotschaft erhielt, erzählte er mir, dass er seiner Frau als Ersatz einen sprechenden Papagei kaufen wollte, aber sie wünschte keinen Ersatz und er im Grunde auch nicht. »Nicht wahr, Freund«, sagte er, >Sie halten auch nichts von Surrogaten für geliebte Gegenstände?< — Ich ergriff seine Hand und erwiderte: >Ihre Karte liegt schon bei den Papieren, die ich über Sie gesammelt, und auch diese Herzensergießung soll unvergessen sein. Wenn ich Sie überlebe, so schreib ich Ihre Biografie, und beides soll darin nicht fehlen.< — >Ach! Sie werden mich gewiss Überleben<, antwortete er, und wir schieden tief bewegt.«
Hitzig wies auf den Schreibtisch: »Alles wohlgeordnet nach Zeit und Ort, wenn auch keineswegs vollständig. Immerhin, der Anfang ist gemacht. Hier« — er löste die Verschnürung von einem der Bündel — »der erste Lebensabschnitt Ihres Vetters von der Stunde seiner Geburt im Jahre 1776 bis 1796, als er nach der Beendigung seines Jurastudiums Königsberg verließ.«
»Dass er noch zurzeit des großen Kant in Königsberg studierte, hat er mir erzählt.«
»Ja, das ist richtig. Aber während es die meisten Königsberger Studenten damals für ihre Pflicht hielten, den berühmten Philosophen zu hören, ob sie ihn nun verstanden oder nicht, verzichtete Ihr Vetter darauf. Er besuchte nur die für sein Jurastudium unbedingt notwendigen Vorlesungen und widmete sich im Übrigen seinen Neigungen, künstlerischen und, wie es sich für einen jungen Mann gehört, amourösen. Darüber ließen sich mancherlei Betrachtungen anstellen, doch will ich auf alle literarischen Ausschmückungen verzichten, mich auf die nötigen Einführungen zu jedem Kapitel beschränken und nicht der Dichtung, sondern der Wahrheit den Vorzug geben und daher die Originalzeugnisse bringen, soweit sie überliefert sind, sodass sich der Leser selbst ein ungeschminktes Bild machen kann. Glücklicherweise liegen mir für die Jugendjahre die Briefe an seinen Freund Hippel vor.«
Da er über wenig schriftstellerisches Talent verfügt, macht er aus der Not eine Tugend und lässt, geschickt, wie er ist, die Briefe für sich selbst sprechen, dachte Gottlieb, hütete sich aber, solche Gedanken zu äußern.
»Kommen wir zur Sache«, fuhr Hitzig fort, »oder vielmehr, wir sind längst dabei. Die Briefe müssen, nachdem ich sie geordnet und eine Auswahl getroffen habe, wortgetreu abgeschrieben werden. Eben deswegen habe ich Sie hergebeten, denn diese Aufgabe kann ich keinem beliebigen, sondern nur einem verständnisvollen und verschwiegenen Mann anvertrauen. Überdies weiß ich, dass Sie am Schicksal Ihres Vetters lebhaft interessiert sind und schließlich einen kleinen finanziellen Zuschuss brauchen können.«
Hitzig vermutete richtig: Die Aufgabe reizte Gottlieb ebenso wie das Honorar, sodass er nach kurzem Zögern zusagte.
Der Kriminalrat nickte zufrieden. »Ich freue mich«, erwiderte er, »dass Sie zur Mitarbeit bereit sind, will Ihnen aber nicht verschweigen, dass Ihre Tätigkeit nicht ohne jedes Risiko ist. Sie wissen, dass Ihr Vetter in jüngster Zeit sowohl durch die Art seiner Amtsführung wie auch durch einige seiner Erzählungen großes Ärgernis bei hohen und höchsten Würdenträgern unseres Staates erregt hat. Dies kann nicht ohne Folgen für ihn bleiben. Da ich nicht nur sein Freund, sondern preußischer Beamter wie er und überdies sein Amtskollege bin, hätte auch ich unliebsame Folgen zu befürchten, wagte ich es, mich offen als Verfasser seiner Biografie zu nennen. Als Anonymus, der sich durch Verschweigen seines Namens nicht zu dem bekennt, was er geschrieben hat, will ich indes auch nicht erscheinen. Daher habe ich vor, mich auf dem Titelblatt als Verfasser des demnächst erscheinenden Lebensabrisses von Zacharias Werner zu bezeichnen, sodass die Freunde und Kenner wissen, wer der Autor von Hoffmanns Biografie ist. Das mag Ihnen wie anderen als wunderliche Ausflucht erscheinen, doch unter den leidigen gegenwärtigen Bedingungen halte ich ein solches Versteckspiel für nötig. Andererseits eröffnet es mir die Möglichkeit, von mir, der ich als Freund Hoffmanns in dessen Biografie nicht fehlen darf, in der dritten Person wie von einem Fremden zu erzählen und auf diese Weise den gehörigen Abstand zu mir selbst zu wahren. - Genug davon. Es lag mir nur daran, Sie zu Beginn unserer Zusammenarbeit auf die damit verbundenen Schwierigkeiten hinzuweisen und Ihnen deutlich zu machen, dass auch Sie sich, der Sie ja ebenfalls in den Staatsdienst treten wollen, gewissen Gefährdungen aussetzen.«
Gottlieb versicherte, dass er bei der untergeordneten Tätigkeit eines Kopisten kein Risiko für sich sehe, bereute aber bereits auf dem Heimweg, so rasch zugesagt zu haben. Es ging ihm nicht um die Befürchtungen Hitzigs, die er für übertrieben hielt, aber ihm missfiel, dass der Kriminalrat und nun auch er sich mit der Biografie Hoffmanns beschäftigten, als ob dessen Leben bereits abgeschlossen sei, während er die Mitte der Vierzig gerade erst überschritten und er ihn bei seinem letzten Besuch zwar krank, doch mit Zeichen der Besserung vorgefunden hatte. Aber zurückgeben konnte er die Arbeit unter irgendeinem Vorwand immer noch, und er trat seinem Vetter nicht zu nahe, wenn er dessen Jugendbriefe las.
Schon am Abend begann er mit der Lektüre und setzte sie am nächsten Tag fort, verwundert und irritiert, weil er in den Briefen Hoffmann nicht entdeckte, wie er ihn kannte und trotz mancher Vorbehalte schätzte, den geistreichen und gewandten, oft auch spöttischen und bissigen Mann, der gern sein Spiel mit ihm wie mit den Lesern seiner Geschichten trieb.
In den Briefen fand er einen empfindsamen Jüngling, dessen Klagen über seine Lebensumstände ihm übertrieben schienen. War er denn nicht in geordneten Verhältnissen aufgewachsen, auch wenn der Vater sich wenige Jahre nach seiner Geburt von der Mutter getrennt hatte und er im Hause der Großmutter erzogen wurde? Der Onkel Otto, der die Vaterstelle bei ihm vertrat, war gewiss ein braver, wenn auch ein wenig sonderbarer Mann. Warum nannte er ihn den Oh-weh-Onkel, den dicken Sir oder gar den Apollo aus dem Bierfass, lehnte sich gegen ihn auf und spielte ihm manchen Streich? In jener Episode aber, von der er mit Genugtuung seinem Freund Hippel berichtete, glaubte Gottlieb mehr zu erkennen als bloßen Spott. Eines Tages hatte der Onkel, da er zur Kommunion gehen wollte, aus seiner schwarzen Hose sorgfältig die Überbleibsel vom Durchfall einer unverschämten Schwalbe und die Soßenreste eines wohlschmeckenden Ragouts ausgewaschen, die Hose unter sein Fenster zum Trocknen aufgehängt und war dann zu einem Freund gegangen. Als es kurz danach heftig zu regnen begann, hatte Hoffmann, einem unwiderstehlichen Trieb folgend, fünf Gießkannen mit Wasser und drei volle pots de chambre über die Hose gegossen, um dem Regen ein wenig zu Hilfe zu kommen. »Als Sir Otto nach Hause kam, war der erste Gang zu seinen Hosen. Flossen gleich nicht helle Tränen über die rotbraunen Wangen seines Angesichts, so verrieten doch klägliche Seufzer die Angst seines Herzens und Schweißtropfen wie Perlen auf der orangefarbenen Stirne den Kampf seiner Seele. — Drei Stunden wand er die Kommunionshosen, um alles Wasser hinauszubekommen. Des Abends klagte er sein Unglück der ganzen Familie und bemerkte zugleich, dass mit dem Platzregen hässliche Teile und verderbende Dünste heruntergefallen wären, die totalen Misswachs verursachen würden, denn der Eimer Wasser, den er seinen Hosen ausgepresst, hätte ganz bestialisch gestunken, worüber denn, als eine Landplage, die ganze Familie seufzte, ausgenommen die Tante, welche lächelte und versteckt äußerte, dass der Gestank wohl aus der Auflösung gewisser angetrockneter Teile — entstanden sein könnte. — Ich gehörte zu der Partie, die die Landplage annahmen, und bewies, dass, wenn die Wolken hellgrün aussähen, es immer so wäre. — Der Onkel verteidigte die Reinigkeit seiner Hosen und sagte, sie wären so orthodox wie seine Meinungen vom Heiligen Geist.«
Gottlieb wollte Hitzig empfehlen, auf die Wiedergabe dieser Episode zu verzichten, da sie Hoffmann in einem wenig vorteilhaften Licht zeigte, denn das war kein harmloser Scherz und bloßer Bubenstreich mehr — schließlich war er nahezu neunzehn Jahre alt, als er Hippel davon berichtete —, hier äußerte sich tiefe Abneigung gegen einen Mann, der die musischen Neigungen seines Neffen gefördert, ihm den ersten Musikunterricht erteilt und, als er im Lateinischen und Griechischen zurückblieb, den jungen Hippel als Mentor ins Haus geholt hatte.
Anstatt Cicero und Xenophon zu repetieren, hatten die beiden allerdings ihre Lieblingsautoren gelesen, sich im Zeichnen geübt und auf dem Klavier tolle Kompositionen versucht, im Garten Ritterturniere gegeneinander veranstaltet und sogar einen unterirdischen Gang zum benachbarten Fräuleinsstift gegraben, so tief, dass der Onkel zwei Arbeiter mieten musste, um die Grube wieder zuschütten zu lassen.
Ein merkwürdiger Mann war dieser Onkel, der, im Beruf nicht zurechtgekommen — Hitzig schrieb von einer erfolglosen Laufbahn im Justizdienst—, sich früh ins Privatleben zurückgezogen hatte. Aber durfte man deshalb den gutmütigen Mann so hart beurteilen, wie es Hitzig tat, ihm vorwerfen, dass er ohne alle Ahnung von Hoffmanns Geist nur bestrebt war, ihn in die Lebensordnung zu zwängen, in welcher er sich selbst wohl befand, nämlich in ein diätetisch geordnetes Vegetieren, wo Schlafen, Essen und Trinken, wieder schlafen und wieder essen, mit etwas Musik und Lektüre zur Verdauung, nach Stunden und Minuten eingeteilt, regelmäßig miteinander wechselten? Konnte man von einem solchen Mann ein tieferes Verständnis für seinen Neffen erwarten, der mehr Interesse für seine Liebhabereien aufbrachte als für die Schularbeiten und später für die Studien, wenn er auch seine Pflichten keineswegs vernachlässigte?
Betrachtete man die Verhältnisse ohne Voreingenommenheit, meinte Gottlieb, dann hatte der junge Hoffmann eigentlich keinen Grund, über seine Kindheit und Jugend zu klagen, und er nahm sich vor, darüber mit Hitzig zu reden, wenn er ihm die Briefe zurückbrachte, denn je mehr er sich — fast gegen seinen Willen — damit beschäftigte, desto entschlossener war er, nicht an Hitzigs Biografie mitzuarbeiten, und sei es auch nur als Kopist.
Im Übrigen lebte ja nicht nur der Onkel in dem Hause in der Königsberger Junkergasse, und wenn sich Großmutter und Mutter auch wenig um den Jungen kümmerten — die Mutter ihrer Kränklichkeit wegen und wohl auch, weil sie über ihre unglückliche Ehe nicht hinwegkam —, so blieb noch die Tante, der Hoffmann, wie Hitzig meinte, in Kreislers Jugendgeschichte ein rührendes Denkmal gesetzt hatte.
Gottlieb sah sogleich nach und fand, dass dort wirklich von einer Tante Sophie, »Füßchen« genannt, die Rede war, zu der der Vetter ihres Lautenspiels und ihrer schönen Stimme wegen eine tiefe Zuneigung gefasst hatte, aber sie war früh gestorben, und das hatte einen so tiefen Eindruck auf ihren dreijährigen Neffen gemacht, dass er wochenlang um sie getrauert hatte, nicht weinend und nicht lachend, kaum ein Wort redend, zu keinem Spiel aufgelegt.
In Kreislers musikalischen Leiden war allerdings auch von einer Tante die Rede, doch aus einer späteren Zeit, als Hoffmann bereits Klavierunterricht erhielt und sich dabei recht ungeschickt anstellte. Offenbar war es diese Tante, die Hitzig meinte, die ebenfalls im Hause in der Junkergasse wohnte und die ebenso musikalisch war wie ihre früh verstorbene Schwester. Davon zeugte jene Episode aus den musikalischen Leiden, wo der junge Kreisler, Hoffmann selbst also, ein Stück in E-Dur einzuüben hatte, das ihm aber in dieser Tonart so missfiel, dass er es in F-Dur transponierte und so auch fehlerfrei vorspielte. Als man seine Eigenmächtigkeit bemerkte, gab es Prügel, und nur die Tante fand, gerade das Umsetzen in eine andere Tonart und das fehlerfreie Vorspiel darin zeuge von wahrem musikalischem Talent.
Gottlieb stellte fest, dass in Hoffmanns Jugenderinnerungen, wie sie sich in seinen Erzählungen widerspiegelten, immer nur von seiner Neigung zur Musik gesprochen wurde und er sich selbst in der Gestalt des unglücklichen Kapellmeisters Kreisler sah, während doch die Briefe davon zeugten, dass er im Zeichnen ebenso talentiert war und es darin zu einer beachtlichen Fertigkeit gebracht hatte. Ferner hatte er in jenen Jahren Erzählungen geschrieben und sogar Romane, wenn sich auch damals kein Verleger dafür fand.
Wie es sich damit auch verhalten haben mochte, Gottlieb war überzeugt, dass bei allen künstlerischen Neigungen des Vetters, bei seinem unablässigen Suchen und den verschiedenartigsten Versuchen ihm die Musik am wichtigsten gewesen war. Nicht ohne Grund hatte er seinen dritten Vornamen, Wilhelm, in Amadeus umgeändert, weil er keinen anderen Komponisten so schätzte wie Mozart.
Hitzig war da freilich anderer Meinung. Er berief sich auf Hoffmann selber, der behauptet habe, die Ursache sei ein Schreibfehler auf einem seiner ersten Manuskripte, und da er nun einmal mit dem A kursiere und die Münze gangbar sei, wolle er es nicht ändern. — Gottlieb glaubte nicht, dass sich Hitzig das ausgedacht hatte. Der Vetter hatte sich sicher so oder ähnlich geäußert, vielleicht seiner Neigung zur Mystifikation folgend, eher wohl, weil es ihm nicht recht war, wenn man, sich auf diese Namensänderung berufend, seine Mozartverehrung immer wieder betonte. Schließlich hatte er andere große Komponisten ebenfalls hoch geschätzt, Beethoven etwa oder Gluck, die Hauptgestalt seiner ersten Erzählung.
Weshalb kümmerte ihn dies alles, fragte sich Gottlieb und fand, dass es höchste Zeit sei, die Briefe des Vetters zurückzugeben, die ihn mehr beschäftigten, als ihm lieb war.
Hitzig war erstaunt, Gottlieb schon nach kurzer Zeit wiederzusehen, und freute sich, dass er die Abschriften so schnell und gewiss auch mit der nötigen Sorgfalt angefertigt hatte.
Um so peinlicher war es Gottlieb, ihm gestehen zu müssen, dass er noch gar nicht damit begonnen habe und es auch nicht tun wolle.
»Es ist mir nicht recht«, sagte er, wie er es sich vorgenommen hatte, »an der Biografie meines Vetters mitzuarbeiten, als sei sein Leben abgeschlossen, während er doch hoffentlich bald wieder gesund sein wird.«
Gottlieb atmete erleichtert auf, als der Kriminalrat gelassen blieb und die Worte nicht als Kritik seines Vorhabens auffasste, denn schließlich wollte Hitzig die Biografie schreiben, und er, Gottlieb, war nur ein unbedeutender Mitarbeiter daran.
»Wenn es nur das ist«, erwiderte Hitzig, »so kann ich Sie beruhigen. Sie wissen, dass Ihr Vetter meinen Plan kennt und billigt, sein Leben darzustellen, doch erst in ferner Zukunft, denn ebenso wie Sie hoffe ich, dass er weder am Ende seines Lebens noch seiner künstlerischen Entwicklung steht, wenn ich auch bei meinem letzten Besuch keine Besserung seines Leidens feststellen konnte. Geistig aber ist er aufgeschlossen und rege wie in früheren Tagen! Daher habe ich ihm nicht verschwiegen, dass ich weitere Materialien über sein Leben auftreiben und Sie als Helfer gewinnen konnte. Beides schien ihn zu erfreuen, er hielt es sogar für gut und nützlich, wenn Sie sich mit den Irrnissen und Wirrnissen seines Lebensganges beschäftigten.«
Gottlieb bezweifelte, dass sein Vetter sich wirklich so geäußert hatte, aber der Kriminalrat ließ ihn nicht zu Worte kommen.
»Sogar über Einzelheiten haben wir uns bereits verständigt«, fuhr Hitzig fort, »selbst über das Porträt, das ich der Biografie als Frontispiz und Titelkupfer voranstellen will. Die Karikatur von ihm, wie sie der Neuausgabe seiner Fantasiestücke in Callots Manier beigegeben ist, haben wir beide als geschmacklos verworfen. Besser fanden wir das von Hensel gefertigte Porträt im letzten Band der Biedenfeldschen Feierstunden, doch hat das Bild etwas Süßliches, das Hoffmann eigentlich fremd ist. So kamen wir schließlich auf jene Kreidezeichnung, die er selbst eines Tages, als seine Frau ausgegangen war, auf einen Royalfoliobogen hinhuschte und hinter ihren Blumentöpfen versteckte, damit sie, wenn sie heimkehrte, ihn zwischen den Blumentöpfen erblicke und einen kleinen Schreck bekäme. Er bat Mischa, mir die Zeichnung für die Anfertigung eines Stichs zu übergeben, aber leider fanden wir das Blatt trotz emsigen Suchens nicht. (Nach Hoffmanns Tod entdeckte Hitzig die Zeichnung, zerknittert und fast ganz verwischt, unter dem Bücherschrank und konnte es Herrn Professor Buchhorn nicht genug danken, dass er es übernahm, aus den spärlichen Resten den höchst geistvollen Stich anzufertigen, denn, so meinte Hitzig, Hoffmann hatte sich gut in der Hand, aber so sich doch nie getroffen.) Ich will damit nur sagen«, erklärte Hitzig, »dass Ihr Vetter keinerlei Einwände gegen eine biografische Darstellung seines Lebens wie auch Ihrer Mitwirkung daran hat, sondern im Gegenteil ...«
»Nun gut«, unterbrach ihn Gottlieb, »doch sind mir verschiedene Unstimmigkeiten und Ungenauigkeiten aufgefallen.«
»Da lässt sich Rat finden«, erwiderte Hitzig unbeirrt. »Zunächst kommt es darauf an, das Material zu sammeln und eine angemessene Auswahl zu treffen. Die Mitwelt, und ich zögere nicht zu behaupten, auch die Nachwelt hat ein Recht darauf, zu erfahren, unter welchen Umständen, bedrängt von welchen Schwierigkeiten, äußeren und inneren Gefährdungen Ihr Vetter Leben und Werk vollbracht hat, denn dessen bin ich sicher, wenn wir beide, Sie und ich, schon lange tot sind, wird Hoffmann noch unvergessen sein — und dazu wollen wir das unsere beitragen!«
Er reichte dem verdutzten Gottlieb die Hand, wollte ihm die Mappe mit den Briefen zuschieben, besann sich dann und sagte: »Was die Jugend Ihres Vetters betrifft, so muss man sie als höchst unglücklich bezeichnen — er selbst sprach von einem Käficht, wenn auch von einem goldenen —, unglücklich in mancherlei Hinsicht. Sie werden mir recht geben, wenn ich behaupte, dass alle Mitglieder seiner Familie als gescheiterte Existenzen zu betrachten sind. Der Onkel war im Beruf gescheitert, die Mutter in der Ehe und ihre Schwester insofern, als sie keinen Mann fand und also gezwungen war, bis zu ihrem Lebensende im Elternhause zu verbleiben — sie starb übrigens, wie auch Hoffmanns Mutter, früh. All dies wäre gewiss ohne tieferen Einfluss auf Ihren Vetter geblieben, wäre er nicht von so übergroßer Empfindlichkeit, wie sie sich schon in seinen Jugendbriefen zeigt. Später verbarg er sie hinter Ironie und Spott — eine Sensibilität übrigens, die jeden bedeutenden Künstler auszeichnet. Daraus erklärt es sich, dass ihm die Verhältnisse in dem Haus in der Königsberger Junkergasse, in dem er aufwuchs, so unerträglich erschienen, dass er sich in die Kunst flüchtete als eine höhere Sphäre, die es ihm ermöglichte, sich über das Niedere, Prosaische seiner Umgebung zu erheben. — Das Haus in der Junkergasse war überhaupt ein höchst sonderbares, als wäre es der Fantasie Hoffmanns entsprungen, der sich in vielen seiner Erzählungen gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt, wie man gewöhnlich annimmt.«