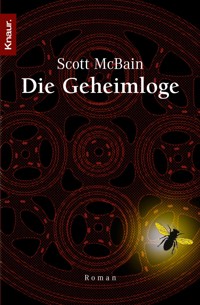
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Kollegium, eine elitäre Geheimgesellschaft, die sich der Bewahrung des Weltfriedens verschrieben hat, muss einen neuen Meister erwählen. Diesem Ziel dient ein Wettbewerb, der sich über ein Jahr erstreckt. Doch die fünf Auserwählten kennen die Regeln nicht. Einzig der Hinweis auf ein prachtvoll gearbeitetes chinesisches Kästchen leitet sie. Schnell zeigt sich, dass die fünf Anwärter zu fast allem bereit sind, um als Sieger aus dem Spiel um die Meisterschaft hervorzugehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Scott McBain
Die Geheimloge
Roman
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Das Kollegium, eine elitäre Geheimgesellschaft, die sich der Bewahrung des Weltfriedens verschrieben hat, muss einen neuen Meister erwählen. Diesem Ziel dient ein Wettbewerb, der sich über ein Jahr erstreckt. Doch die fünf Auserwählten kennen die Regeln nicht. Einzig der Hinweis auf ein prachtvoll gearbeitetes chinesisches Kästchen leitet sie. Schnell zeigt sich, dass die fünf Anwärter zu fast allem bereit sind, um als Sieger aus dem Spiel um die Meisterschaft hervorzugehen …
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
Das Wesen der Macht
1. Kapitel
2. Kapitel
Das Kollegium
3. Kapitel
Die Spieler
4. Kapitel
Der Meister
5. Kapitel
Das Spiel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Anmerkung des Autors
Für den besten Sohn der WeltAlan Hightower, USMC (United States Marine Corps)SEMPER FI
Denn man sieht die Menschen in dem,was sie sich vorgenommen haben, sei es Ruhm oder Reichtum, auf verschiedene Arten zum Ziele streben, einer vorsichtig,der andere ungestüm, einer mit Gewalt, der andere mit List,einer mit Geduld, der andere mit dem Gegenteil;und jeder kann auf seine besondere Weise dazu gelangen.Machiavelli, Der Fürst
Macht korrumpiert. Je größer die Konzentration an Macht, umso größer ist auch die Korruption.
Niemals galt dies mehr als zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Der Aufstieg der supranationalen Konzerne, die Einigung Europas und die Globalisierung der Wirtschaft sorgten dafür, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ungeheure Macht in den Händen einiger weniger konzentriert lag. Der größte Teil der Weltbevölkerung profitierte von diesen Entwicklungen in Form vermehrten materiellen Wohlstands. Sie bargen aber auch die Gefahr einer weltumspannenden Diktatur.
Diese Machtkonzentration allein war bereits bedrohlich, durch die dramatische Zunahme des Informationsflusses aber wurde sie zu einer äußerst heimtückischen Gefahr – bedeutete es paradoxerweise doch, dass sich die Wahrheit nur noch sehr schwer bestimmen ließ. Zu Beginn des neuen Millenniums wurde die Menschheit mit einem unablässig anwachsenden Datenstrom überschwemmt: einer ungefilterten Nachrichtenflut, die ihren Weg rund um den Globus antrat, ausgesandt von den Supermedien (so lautete das neue Schlagwort für das fein gesponnene Netzwerk aus Presse, Fernsehen, Satellitenübertragungen und Supernet), deren Heerscharen an Kommentatoren und selbst ernannten Experten nur allzu gern der Versuchung erlagen, die Fakten so hinzudrehen, dass sie ihren eigentlichen Zweck erfüllten – den der guten Story. Denn schließlich war der bloßen Wahrheit nur selten etwas Interessantes abzugewinnen. Den dafür zu zahlenden Preis hatten jedoch nur die wenigsten vorhergesehen. Die Bevölkerung erkannte bald, dass Informationen und mit ihnen die Wahrheit manipuliert wurden, damit zum Nachteil der Mehrheit einige wenige finanziellen und politischen Gewinn daraus erzielen konnten. Das Ergebnis: Die Gesellschaft begann den Grundfesten der Demokratie zu misstrauen.
Die Regierungen waren die Ersten, die sich versündigten. Politiker handelten mit ökonomischen und politischen Informationen, lange bevor diese der Öffentlichkeit zugänglich waren. Fakten wurden zu einer Ware, die, von den hoch dotierten Schönrednern aus Profitgründen verdreht und neu verpackt, unter die Leute gebracht wurde. Wahrheit und virtuelle Realität ließen sich nicht mehr unterscheiden.
Wer erzählte den Menschen wirklich die Wahrheit? Der US-Kongress, die russische Duma, das Europäische Parlament, die japanische Diet – saßen da ehrliche Abgeordnete? Die Männer und Frauen auf der Straße zweifelten daran. Sie erfuhren die Korruption am eigenen Leib und sahen, wenn auch nur flüchtig, schattenhaft, die Hände, die unter dem Tisch die Gelder hin und her schoben.
Das inzestuöse Verhältnis zwischen den Supermedien, den Baronen der Hochtechnologie und den Aktienmärkten wurde dabei immer enger und verlagerte sich von den Geldbörsen zu den Betten der Beteiligten. Die Bevölkerung wusste, dass sie von jenen, denen sie ihr Vertrauen geschenkt hatte, hintergangen wurde. Das einundzwanzigste Jahrhundert wurde zu einem Zeitalter des Zynismus und des Unglaubens.
Was also war die Wahrheit? Und wer war bereit, sie auszusprechen? Dies wurde nicht nur für die Mehrheit der Bevölkerung zu einem akuten Problem, sondern auch für jene, die an der Spitze des Staates standen. An wen konnten sich Präsidenten und Premierminister wenden, wenn sie korrekte, ausgewogene Ratschläge benötigten? Ihre Ministerien und Denkfabriken, die vorgaben, objektive Meinungen zu vertreten, verfolgten eigene, verborgene Ziele oder wurden insgeheim von multinationalen und kriminellen Organisationen kontrolliert. In ihrer Verzweiflung wandten sich die Staatenlenker an internationale Institute und ratgebende Gremien. Doch auch unter diesen gab es viele, die im Lauf der Zeit der Versuchung erlagen, gegen Geld Halbwahrheiten zu verschachern.
Die bedeutendste Einrichtung unter den wenigen Instituten, die noch unvoreingenommene Auskünfte erteilten, war das Kollegium. Diese Geheimorganisation, im dreizehnten Jahrhundert auf einer abgelegenen Insel vor der schottischen Westküste gegründet, galt seit langem als herausragende ratgebende Körperschaft und wurde von Staatsmännern aus allen Ländern aufgesucht. Seit ihrer Gründung stand sie dem Treiben der Außenwelt unparteiisch gegenüber und verfolgte nur ein Ziel: die politischen Vertreter aller Nationen zum Zwecke des Friedens zu beraten. Ging es darum, schwierige gesellschaftliche Probleme zu lösen, so wandten sich die Großen und Mächtigen an das Kollegium. Bei Bürgerkriegen, Umweltkatastrophen, Grenzstreitigkeiten, weltpolitischen Themen – irgendwann klopfte jedes Staatsoberhaupt an die Tore des Kollegiums, um objektive Lösungsvorschläge einzuholen. Immer geschah dies im Verborgenen.
Eifersüchtig wachte das Kollegium auf der kleinen Insel über seine Integrität. Da es keine Bildungseinrichtung im üblichen Sinn war, beherbergte es keine Studenten, hielt es keine Examen ab und war auch nicht auf fremde Finanzmittel angewiesen. Alle achtzig Kollegiumsmitglieder hatten sich durch herausragende Leistungen ausgezeichnet. Wer ernannt wurde, erhielt seine Stellung auf Lebenszeit und war finanziell abgesichert, damit er den Aufgaben nachgehen konnte, auf die er und der Meister sich verständigt hatten. Es gab nur eine Bedingung: Die Verbindung zum Kollegium und alles, was dort vor sich ging, hatten geheim zu bleiben.
Und der Meister? Obwohl die Öffentlichkeit wusste, dass es ihn gab, war über die Person, die dort die höchste Macht ausübte, nahezu nichts bekannt. Der Meister verharrte im Bereich der Spekulation; er war eine rätselhafte, brillante, einsam aufragende, nicht fassbare Gestalt. Sein Einfluss auf das Weltgeschehen allerdings ließ sich nicht bestreiten. Sogar Papst Julius IV. scherzte während einer Audienz: »Petrus hält zwar den Schlüssel zum Himmelreich in der Hand, der Meister jedoch jenen zu den Korridoren der weltlichen Macht.«
Je weiter das einundzwanzigste Jahrhundert voranschritt, umso ohnmächtiger und hilfloser wurden die Regierungen und die internationalen Organisationen; nur das Kollegium konnte sich dessen entziehen, es blieb weiterhin die reine Quelle, zu der die Regierungsvertreter aller Nationen pilgerten, wo sie ihre Fragen vorbringen konnten und vertraulichen, objektiven Rat erhielten. Doch die Staatenlenker, die die Auflösung ihrer Gesellschaften mit ansehen mussten, stellten sich die bange Frage, wie lange das Kollegium sich der anbrandenden Flut noch erwehren könne. Und was würde geschehen, wenn es ebenfalls fiel? Was wäre mit dem Meister? Wer sollte diesem mächtigen Schutzherrn nachfolgen, der im Geheimen das Treiben der Menschheit beschirmte?
Keiner unter ihnen allerdings wusste von dem Spiel noch vom Weg zur Wahrheit.
Das Wesen der Macht
1.
So ist denn ein Fürst, der das Übel erst dann erkennt,wenn es da ist, nicht wahrhaft weise,was ja nur wenigen gegeben ist.Machiavelli, Der Fürst
Eine politische Krise war der Auslöser für das Treffen zwischen dem neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten und dem Meister. Die Zusammenkunft hatte zwar keinerlei Auswirkungen auf das Spiel oder auf seine Beteiligten, aber es hatte Einfluss auf den Präsidenten. Vermutlich brachte es den mächtigsten Mann der Welt dazu, über das Wesen der Macht nachzudenken und darüber, wer sie am besten ausüben sollte; in dieser Hinsicht beeinflusste der Meister das Leben des Präsidenten, so wie er das von Millionen anderen beeinflusst hatte – ob sie es wussten oder nicht.
Bevor jedoch das Spiel begann, gab es eine politische Krise und eine Leiche.
Jack Caldwell, der Sonderberater des US-Präsidenten, war anwesend, als alles begann. Wie alle großen politischen Katastrophen ereignete sie sich völlig unerwartet, wenngleich zu einem Zeitpunkt, an dem sich Politiker vor verräterischen Umtrieben besonders in Acht nehmen sollten – an Weihnachen, dem Fest der Liebe.
»Jack, der Präsident will Sie unverzüglich sprechen.« Die Stimme des Pressesekretärs klang nervös und angespannt.
Jack erhob sich von seinem Schreibtisch und schritt durch den Gang. Er war ein großer, schlanker Mann Anfang sechzig, hatte graues Haar und eine unbewegliche Miene. Er gehörte seit langem zum Regierungsapparat und hatte unter einigen Präsidenten als Oberster Berater gedient. Es gab kaum etwas im politischen System, das er nicht kannte; die Leute vertrauten ihm und verließen sich auf sein Urteil. Kurz warf er einen Blick aus dem Fenster hinüber zum Weißen Haus. Es hatte heftig geschneit, und die beiden jungen Töchter des Präsidenten, Jessica und Karen, bauten einen Schneemann. Lachend und kichernd rannten sie durch den Garten und hatten ihren Spaß dabei. Jack lächelte. Er musste an die Kennedy-Jahre denken, an den fotogenen Präsidenten, an dessen attraktive Frau und die beiden kleinen Kinder. Präsident Davison war ebenso clever und fotogen wie Kennedy damals. Auch er konnte sich mit der Zeit zu einer großen Persönlichkeit entwickeln.
Im Gang öffnete sich eine Tür, und eine Sekretärin erschien.
»Sir, treten Sie bitte sofort ein«, sagte sie ihm.
Bei Gott, ging es Caldwell durch den Kopf, als er das Oval Office betrat, das Land hatte einen ehrlichen Präsidenten bitter nötig. Das politische System der Vereinigten Staaten steckte seit einigen Jahren in einer tiefen Krise, darin unterschied es sich kaum von dem zahlreicher anderer Länder. Ein korrupter Kongress, ein Ex-Präsident (den Caldwell nicht beraten hatte), der wegen Schmiergeldzahlungen seines Amtes enthoben worden war, und eine Regierung, die dem Volk nicht diente, sondern ihm das Geld abpresste. Die letzten Jahre waren verheerend gewesen, sodass Abscheu und Zynismus gegenüber der Politik in der amerikanischen Öffentlichkeit mittlerweile äußerst tief saßen. Und weshalb der dreiundvierzigjährige Davison mit großer Mehrheit zum Präsidenten der USA gewählt worden war. Seit zwei Monaten war er nun im Amt und war bereits einigen auf die Zehen getreten – jenen nämlich, die zu verhindern suchten, dass er ihre korrupten Machenschaften aufdeckte, und die daher alles unternahmen, um seinen wunden Punkt zu finden. Es hatte geradezu zwangsläufig so kommen müssen. Aber noch besaß Davison die Unterstützung der Wähler, und das zählte in der Politik. Noch.
»Jack, kommen Sie und nehmen Sie Platz.«
Jack folgte der ausgestreckten Hand des Präsidenten und ließ sich auf dem Sofa nieder. Ihm gegenüber saßen bereits drei weitere Personen. Er kannte sie alle. Joe Buchanan, der exzellente Vizepräsident, ein kräftiger Mann aus Nebraska. Neben ihm Paul Faucher, der Nationale Sicherheitsberater, der in den Korridoren der Macht zu Hause war und keinen Zweifel an seiner Autorität ließ noch an den Konsequenzen, wenn sich ihm jemand widersetzen sollte. Und schließlich William Olsen, der rätselhafte, Brille tragende Direktor der CIA, der, bereits Ende fünfzig, auf seine Pensionierung wartete. Sie hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Im Raum herrschte eine angespannte Atmosphäre. Caldwell fiel auf, dass kein Militär anwesend war, was seltsam erschien.
»Mr. President, es handelt sich hier um eine sehr ernste Angelegenheit«, setzte Faucher wütend die bereits begonnene Diskussion fort. »Wir haben es hier wahrscheinlich mit dem schlimmsten Anschlag auf die Sicherheit des Landes zu tun, der uns bislang widerfahren ist.«
Präsident Davison, der zwischen den beiden Sofas in einem Armsessel saß, blickte zu Caldwell. Sein berühmtes breites Grinsen fehlte. Gedankenverloren fuhr er sich durch das dichte, dunkelbraune Haar, das an manchen Stellen graue Strähnen aufzuweisen begann; augenfällige Anzeichen des Alters, die ihm aber einen Anflug von Würde verliehen und ihm sicherlich nicht schaden sollten. Davison war noch immer ein attraktiver Mann, der sich durch sein wunderbar gelassenes Auftreten auszeichnete.
»Erklären Sie Jack doch bitte, worum es geht, Paul.«
Faucher wandte sich an Caldwell. Es fiel nicht schwer, den Sicherheitsberater nicht zu mögen; er war ein durch und durch gerissener Politiker, aber in der Politik musste ein Präsident zuweilen mit seltsamen Gefährten zusammenarbeiten: mit den Guten, den Schlechten und, in Fauchers Fall, mit den abgrundtief Hässlichen.
»Im Grunde geht’s um Folgendes.« Faucher knallte einen Ordner auf den Tisch. »Letzte Nacht erhielten wir eine Nachricht von einer hochrangigen Quelle in der russischen Regierung. Sie sind im Besitz von streng geheimen Informationen: den Blaupausen unserer atomaren Raketenstellungen in Japan und in der Türkei.« Er zögerte. »Was schon schlimm genug wäre. Aber es kommt noch heftiger. Als Quelle diente ein geheimes Kabinettspapier.« Unruhig rutschte er auf dem Sofa herum, als säße er über einer Flamme, die allmählich unangenehm heiß wurde.
Caldwell war wie vor den Kopf geschlagen. »Die Informationen sind verlässlich?«
»Oh, keine Sorge, das sind sie«, knurrte Faucher und wischte die Frage mit einer abschätzigen Handbewegung fort. »Unser russischer Maulwurf hat uns eine Kopie zukommen lassen. Man könnte glauben, er habe bei uns im Kabinettszimmer gesessen und das beschissene Ding selbst gelesen.«
»Als undichte Stelle kommt nur jemand ganz oben in Betracht«, warf Buchanan ein und senkte die Stimme. »Jemand aus dem Kabinett. Jemand, der dem Präsidenten sehr nahe steht. Das heißt, wir haben einen Verräter in unseren Reihen.«
Es folgte Schweigen. »Wie viel Zeit bleibt uns, bis die Medien davon erfahren?«, fragte der Präsident.
Faucher sah auf seine Uhr. »Ich schätze, vier bis fünf Stunden. Man weiß doch, die russische Regierung ist so undicht wie ein Sieb. Außerdem tauchen im Internet bereits die ersten Gerüchte auf. Wir werden die Sache bald bekannt geben müssen.«
Alle sahen zum Präsidenten. Davison wirkte völlig gelassen. Starke Nerven gehörten zu seinen hervorstechendsten Eigenschaften. Er dachte über das Problem nach und beugte sich dann mit entschlossener Miene in seinem Sessel vor.
»Wir sollten Folgendes tun. Als Erstes, Joe«, und damit wandte er sich an den Vizepräsidenten, »will ich, dass Sie und Paul« – mit einem Kopfnicken wies er auf Faucher – »herausfinden, wo die undichte Stelle sitzt. Das hat oberste Priorität. Als Zweites werde ich für heute Abend eine außerordentliche Kabinettssitzung einberufen. Und als Drittes müssen wir von Anfang an der Berichterstattung in den Medien die Schärfe nehmen.«
»Sagen Sie das mal dem Kongress«, erwiderte Olsen mürrisch. »Das Militär hat soeben einige Milliarden Dollar für die Modernisierung dieser Stellungen ausgegeben, die Anlagen in Japan haben noch dazu offiziell nie existiert. Das ist der Auftakt zu einem neuen Rüstungswettlauf. Der Kongress wird Zeter und Mordio schreien.« Er stand kurz vor einem Wutausbruch.
»Ich weiß, ich weiß«, erwiderte Davison und erhob sich. »Und ich will, dass mir jemand bei der Pressekonferenz am Nachmittag eine Frage zuspielt. Heute Abend müssen wir wissen, wo die undichte Stelle sitzt und wie die Dokumente in die Hände der Russen gelangt sind.«
Davison und Jack tauschten einen kurzen Blick miteinander: Sie hatten sich verstanden. Es gab eine Krise, aber sie war zu bewältigen. Noch war es vielleicht möglich, die Geschichte unter den Teppich zu kehren. Dennoch, wenn sensible Kabinettspapiere den Russen in die Hände gespielt worden waren, welche anderen Geheimnisse waren dann noch preisgegeben worden?
An jenem Nachmittag, am Ende der Jahrestagung des Verbands der Amerikanischen Industrie, hielt Präsident Davison eine, wie es schien, spontan einberufene Pressekonferenz ab – deren Ablauf kaum eine Stunde zuvor bis ins kleinste Detail festgelegt worden war. Auf dem Podium stand ein entspannt wirkender Präsident, neben ihm seine Frau Christina; ein wunderbares Paar. Die Fragen wurden ihm leicht und locker zugespielt und ließen sich mühelos parieren.
»Mr. President, einige Worte zum Stand der Wirtschaft und der Inflation.« »Was ist mit dem Ölteppich vor der Küste von Miami?« »Was mit dem Einbruch des Aktienmarkts in Brasilien?« »Wollen Sie dieses Jahr noch nach Russland reisen, um sich mit Präsident Barchow zu treffen?«
Die Antworten des Präsidenten zeugten von Witz und Esprit, hin und wieder ließ er sein strahlendes Lächeln aufblitzen. Eine beeindruckende Vorstellung. Caldwell hatte es bereits hundertmal gesehen, war aber dennoch immer wieder fasziniert. Davison war der begabteste Redner, der ihm jemals untergekommen war. Dann, am Ende der Konferenz, als die Medienmaschine entspannt und eingelullt war, kam die Frage.
»Mr. President, stimmt es, dass ein Spion Einzelheiten über US-amerikanische Raketenbasen an die Russen verraten hat?«
Präsident Davison grinste verhalten. Säe den Samen des Zweifels gleich zu Beginn. »Nun, Sie wissen ja, wir leben in einer Welt, in der Verschwörungen und außerirdische Interventionen an der Tagesordnung sind.« Das Publikum lachte; jeder dachte an den in der vergangenen Woche erschienenen Zeitungsartikel, in dem ein exzentrischer Kongressabgeordneter seine Überzeugung vertreten hatte, das Weiße Haus sei von Außerirdischen infiltriert. »Natürlich sind auch uns diese Gerüchte zu Ohren gekommen, und wir werden ihnen nachgehen.« Und säe noch mehr Zweifel. »Wir denken, dass es sich dabei um veraltete Informationen über ehemalige Raketenbasen handelt.« Und dann bring dich in Sicherheit. Er zuckte mit den Schultern; seine Körpersprache schien anzudeuten, dass an den Gerüchten nichts dran sei, auch wenn er das Gegenteil sagte. »Dennoch werden wir uns sehr ernsthaft damit beschäftigen.«
»Okay, Leute, das war’s dann«, kam es laut von einem der Pressereferenten, bevor jemand eine weitere Frage stellen konnte.
Der Präsident wandte sich ab und wollte gehen. In diesem Moment, in dem noch die Kameras der Welt auf das Podium gerichtet waren, kam seine fünfjährige Tochter Karen, sanft von einer unsichtbaren Hand dazu genötigt, auf ihn zugerannt. Der Präsident erblickte sie, streckte seine Hände aus und schloss das kichernde, rothaarige Bündel in seine Arme. 58 Millionen Amerikaner an den Fernsehbildschirmen bekamen diese Vorstellung elterlicher Zuneigung zu sehen, und es dürfte kaum eine Mutter oder einen Vater gegeben haben, der oder dem es dabei nicht warm ums Herz wurde. Mit diesem bewundernswert inszenierten »choreographierten Spontanereignis«, wie es die Wortverdreher nannten, vergaß die Nation alles, was soeben gesagt worden war, und sah nur noch den stolzen, Vertrauen erweckenden Familienvater.
Präsident Davison, die Arme um seine Tochter geschlungen, zeigte sein breites Lächeln. Der Nation ging es gut – genau das verkörperte er mit diesem Lächeln, seinem gelassenen Auftreten, das die Herzen der Mitbürger berührte. Gott schütze ihn, Gott schütze Amerika.
Natürlich brach diese Illusion in sich zusammen, als die Leiche gefunden wurde.
»Ich glaube es nicht!«
Es war früh am Abend. Der Präsident war soeben von der Verbandstagung zurückgekehrt. Das gesamte Kabinett hatte sich um den Tisch versammelt, und zwei Reihen angestrengter Gesichter blickten zu ihm auf. Der Generalstabschef schien vor Wut schier zu platzen, nachdem er die Neuigkeiten erfahren hatte. Man hatte sein Spielzeug entdeckt. Nun würde er sich was Neues suchen müssen.
»Ich glaube es einfach nicht«, wiederholte der Präsident, diesmal mit flacher Stimme.
Paul Faucher, der Nationale Sicherheitsberater, beharrte allerdings auf seinen Informationen. »Es tut mir Leid, Mr. President, aber die undichte Stelle befindet sich in unserer Botschaft in Paris. Die Geheimdienste sind sich dessen sicher, außerdem wurde es von unserem hochrangigen Kontakt in der russischen Regierung bestätigt. Das grenzt den Personenkreis ein. Im Grunde …«, und dabei ließ er seinen Blick über die Versammelten schweifen, »gibt es nur einen, der Zugang zu solchen Informationen hat. Nur Ihr oberster politischer Berater kann diese Kabinettspapiere erhalten und mit nach Paris genommen haben.«
»Nein. Hören Sie«, erwiderte Präsident Davison und zeigte wütend auf Faucher, während er mit leicht belegter Stimme fortfuhr, »Botschafter Pearlman ist so unschuldig wie am Tag seiner Geburt. Ich habe ihn ernannt. Ich kenne ihn seit Jahren. Undenkbar, dass er ein Spion ist.«
Im Kabinett herrschte Schweigen. Jeder ließ sich durch den Kopf gehen, welche Konsequenzen die Worte des Präsidenten nach sich ziehen konnten. Falls dessen bester Freund Geheimnisse an die Russen verraten hatte, dann wäre der Präsident selbst in großen Schwierigkeiten.
Sie alle kannten Dan Pearlman. Er war ein bodenständiger Rinderzüchter aus Montana, der es mit dem Viehhandel zum Multimillionär gebracht hatte. Obwohl er sich durchaus einen intellektuellen Anstrich zu geben versuchte, konnte er seine einfache Weltsicht, seinen ausgeprägten Patriotismus und seine Geradlinigkeit niemals verbergen. Er war so heimatverbunden wie James Stewart und verkörperte das wahre Herz Amerikas.
»Gut.« Davison stockte kurz, aber er wusste, dass ihm keine andere Wahl blieb. »Ich werde den Botschafter anweisen, unverzüglich in die USA zurückzukehren, damit Sie ihn befragen können. In der Zwischenzeit« – er neigte seinen Kopf in Richtung des Vizepräsidenten und des Sicherheitsberaters – »fahren Sie mit Ihren Untersuchungen fort. Ich will über alle Einzelheiten informiert werden: Wer hatte eventuell noch Zugang zu diesen Kabinettspapieren, wie wurden sie an die Russen weitergeleitet und wann? Wir werden uns morgen früh um sieben Uhr erneut treffen. Die Kabinettssitzung ist hiermit beendet.«
Er erhob sich vom Tisch. »Joe«, sagte er zum Vizepräsidenten, »kann ich mit Ihnen reden? Und mit Ihnen auch, Jack?«
Sie setzten sich in einem kleinen Nebenraum zusammen. Präsident Davison betrachtete seine Berater. In einer Welt, in der die Politik Freundschaften nicht gerade förderte, vertraute er nur diesen beiden Männern. Dan Pearlman, ging ihm durch den Kopf, hatte er auch vertraut. Verräter finden sich meist in der unmittelbarsten Umgebung.
»Wir haben eine Krise«, sagte er leise. Caldwell sah die Traurigkeit in seinem Blick. »Aber ich will nicht, dass Dan Pearlman den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wird, ohne dass er die Möglichkeit hat, etwas zu seiner Verteidigung zu äußern. Ist das klar?«
Und noch während er die Worte aussprach, schoss ihm ein weiterer Gedanke durch den Kopf. Warum wurden ausgerechnet diese Papiere weitergeleitet und nicht andere? Sie waren so brisant, dass ihre Veröffentlichung ungeheuren politischen Schaden heraufbeschwören konnte. Schaden für wen? Für die Vereinigten Staaten? Oder für den Präsidenten? Er wollte bereits fortfahren, behielt dann seine Vermutungen aber für sich. Manche Geheimnisse konnten nicht erzählt werden. Sie waren einfach zu persönlich.
Sie konnten den Sturz des Präsidenten bedeuten.
Dan Pearlman nahm den Anruf in seiner weitläufigen Pariser Wohnung entgegen, die an die US-Botschaft angeschlossen war. Obwohl er bereits auf die Siebzig zuging und sich guter Gesundheit erfreute, fühlte er sich um einiges älter, als er den Hörer wieder auflegte. Er hatte sich zeit seines Lebens mit einer Unzahl von Gegnern herumgeschlagen, hinter seinem freundlichen Gesichtsausdruck verbarg sich daher stählerne Entschlossenheit: Er machte sich auf das Schlimmste gefasst. Der Wirbelsturm kam näher und hatte direkten Kurs auf ihn genommen. Aber die Flucht zu ergreifen war nicht seine Art. Er würde durchhalten. Mehr Sorgen machte er sich um seine Frau.
»Nur die Ruhe, Dan. Es wird sich alles geben«, murmelte er, während er die Treppe zum Schlafzimmer hochstieg, wo sich Ingela für den offiziellen Dinnerempfang vorbereitete.
Das Leben hatte es gut mit ihm gemeint, er war der Letzte, der das bestreiten wollte. Er war buchstäblich aus dem Nichts aufgestiegen. Seine Eltern, kleine Farmer, hatten vieles durchgemacht und während der Weltwirtschaftskrise große Not gelitten. Und sie hatten ihm eingetrichtert, ehrlich zu sein und hart zu arbeiten. Mit vierzig war Dan ein reicher Mann und zufrieden mit sich und seinem Leben. Das Schicksal jedoch hielt mehr für ihn bereit, als er sich erhofft hatte. Im Alter von dreiundsechzig Jahren, als seine geliebte erste Frau an Krebs starb, hatte er sich bereits darauf eingestellt, den Rest seiner Tage allein und einsam zu verbringen. Es sollte anders kommen.
Er betrat das Schlafzimmer. Ingela, eine schwedische Schönheit mit langem blonden Haar, einer wohl proportionierten Figur und fantastischen Gesichtszügen, war soeben mit dem Ankleiden fertig. Dan hatte sie eines Abends vor vier Jahren auf einer Dinnerparty bei einem alten Freund kennen gelernt. Eine leidenschaftliche Affäre war gefolgt, schließlich die Heirat. Natürlich wusste er, was die anderen sich dachten – dass er ein alter Trottel sei, dass die dreißig Jahre jüngere Ingela ihn nur seines Geldes wegen geheiratet hatte, dass sie die Macht wollte und sehr ehrgeizig war.
»Genau«, hatte er den engen Freunden geantwortet, die den Mut besaßen, das Thema zur Sprache zu bringen, »so ist das eben. Frauen werden von Geld und Macht angezogen, so war das schon immer.« Und dann holte er zum entscheidenden Schlag aus. »Aber sie liebt mich auch.«
Schwer ließ er sich auf dem Bett nieder und betrachtete seine Frau, während sie ihre Diamanten anlegte. Liebte sie ihn noch? Er glaubte es. Klar, ihm waren ebenfalls die Gerüchte zu Ohren gekommen, aber er ignorierte sie. Das zählte nicht. Was zählte, war ihre Liebe. Sie würde es ihm sagen, wenn sie es für richtig befand, und er würde ihr verzeihen. So war er eben, und Dan Pearlman hatte nicht vor, sich in seinem Alter noch zu ändern. Nicht für diese Welt. Wenn, dann musste sich die Welt schon für ihn ein wenig ändern.
»Meine Liebe, der Präsident hat mich unverzüglich in die Staaten zurückbeordert«, sagte er. Er erzählte ihr, was ihm ein alter Freund aus dem Kabinett soeben am Telefon mitgeteilt hatte.
Ingela nahm die schlechten Neuigkeiten mit äußerster Skepsis auf. »Sie halten dich für einen Spion? Welch infame Lügen«, sagte sie und spreizte ihre lackierten Fingernägel. »Du bist der ehrlichste Mensch, der mir jemals begegnet ist. Außerdem, warum solltest du Kabinettsgeheimnisse preisgeben? Was sollte da für dich herausspringen?«
»Gut«, antwortete er ihr, »ich hab nichts getan, so viel steht fest. Das kann also nur eines bedeuten: Jemand hat es auf mich abgesehen.«
»Wer?«
»Das weiß ich nicht, meine Liebe, aber ich werde es sicherlich herausfinden.«
Sie reagierte bestürzt. Ihre Miene verriet ihre Furcht und Panik.
»Werden sie hierher kommen?«
»Ja«, erwiderte der Botschafter. »Es wird nicht lange dauern, und es wimmelt hier von CIA-Leuten, die alles auf den Kopf stellen.« Mit einer abschätzigen Handbewegung wischte er den Gedanken fort. »Aber mir wird nichts geschehen. Ich habe nichts zu verbergen.« Er stand auf. »Mein Flug geht morgen um halb acht. Wir werden den Empfang nicht abblasen, es hat keinen Sinn, die Gäste zu beunruhigen.« Er küsste sie – ein müder, alter Mann. »Mach dir keine Sorgen, wir überstehen das. Wir sehen uns dann unten, Liebling, in ein paar Minuten.«
Ingela sah zu, wie er davonschritt. Als sie sicher war, dass er nicht mehr zurückkam, ging sie zu einem verschlossenen Schreibpult, setzte sich und verfasste hastig einen kurzen Brief; Tränen standen ihr in den Augen. Überraschend schnell war ihr Endspiel gekommen.
Die Party war ein großer Erfolg, die Gäste amüsierten sich. Dan war ein guter Unterhalter, und Ingela brillierte wie immer. Keiner kam auch nur im Entferntesten auf den Gedanken, dass etwas nicht stimmen könnte. Es war bei ihrem letzten Gang in die Küche, als Ingela beiläufig ihre philippinische Köchin Marcella bat, für sie ein Päckchen aufzugeben. Von allen unbemerkt legte sie es in Marcellas alte lederne Einkaufstasche und umarmte die Köchin flüchtig zum Abschied.
In jener Nacht, als die Ereignisse in Washington bereits aus dem Ruder zu laufen begannen, wartete Ingela, bis ihr Ehemann fest eingeschlafen war. Dann schlüpfte sie aus dem Bett und warf sich einen Morgenmantel über ihr Satin-Nachthemd.
»Leb wohl.« Sie küsste ihn sacht auf die Stirn. Dan Pearlman war ein guter Mann. Einen besseren hätte sie sich nicht wünschen können. »Ich habe dich geliebt«, sagte sie halb zu sich selbst und halb zu ihm.
Sie schritt zur Tür, trat auf den Treppenabsatz hinaus und dann nach oben, wo weitere Schlafzimmer lagen, die für Botschaftsgäste bestimmt waren und im Moment leer standen. Ihre Bewegungen waren bedächtig und fließend.
In einem der Schlafzimmer öffnete sie das Fenster, stieg auf den schmalen Sims hinaus und von dort über eine Feuerleiter nach oben. Manchmal, ging ihr durch den Kopf, gab es einfach keine Lösung mehr. Die Fähigkeit der Menschen, Böses zu tun und Grausamkeiten zu begehen, hatte sie immer überrascht, aber sie hatte gelernt, es als ein unauslöschliches Merkmal der Menschen zu akzeptieren. So war es eben, das würde sich nie ändern. Ingela stand auf dem Dachsims. Ein eisiger Wind strich über ihr Gesicht. Unter ihr funkelten die Lichter der unzähligen Gebäude und des nächtlichen Pariser Verkehrs. Vier Stockwerke tiefer lag der umschlossene Hof der Botschaft. Sie war nicht allein. Millionen Menschen lebten hier in unmittelbarer Nähe. Und doch hatte sie sich noch nie zuvor in ihrem Leben so verlassen gefühlt. Niemand konnte ihr mehr helfen.
Langsam breitete sie die Arme aus; in tiefster Verzweiflung hatte sie ihre Entscheidung getroffen. Sie sah an ihrem Körper hinab, den sie verschiedenen Männern geschenkt hatte, aber keinem mehr als Dan – und dem anderen, jenem, den sie ebenfalls geliebt hatte. Ingela wusste, dass Dan mit seiner Vermutung falsch lag. Diese Leute wollten nicht nur ihn zu Fall bringen. Es steckte mehr dahinter. Zu lange schon hatten sie versucht, sie zu erpressen.
»Mutter«, sagte sie auf Schwedisch, der Sprache ihrer Kindheit. Dann öffnete sie die Arme und trat über den Balkon. Endlich war sie frei.
»Botschafter, wachen Sie auf!«
Sie weckten ihn morgens um vier Uhr. Verschlafen drehte sich Dan Pearlman im Bett um und sah in die verängstigten Gesichter seines Ersten Sekretärs und zweier anderer Botschaftsmitarbeiter.
»Kommen Sie bitte mit.«
Sie eilten durch den Gang, die Treppe hinab und weigerten sich ihm zu erzählen, was vorgefallen war. Pearlman trat in den Hof hinaus. Dann erblickte er Ingela. Sie wirkte so ernst, wie sie so vor ihm lag – das blonde Haar im Schnee ausgebreitet, das wunderschöne Gesicht von den Hoflampen angestrahlt. Der Aufprall hatte keine äußeren Verletzungen nach sich gezogen, nur über die linke Seite ihres Kopfes zog sich ein schmales Blutrinnsal, das im Schnee versickerte. Mit schlurfenden Schritten, als wäre er ein alter Mann, näherte sich Dan seiner Frau. Ihre blauen Augen standen weit offen, und als er sie schloss, liefen ihm Tränen über die Wangen – denn in ihrem Blick lag die reine Unschuld. Nicht einmal seine Liebe hatte sie von ihrer Tat abhalten können.
»Botschafter, Sie müssen reinkommen.«
Nun hatten sie also die Leiche.
Als die Neuigkeiten bekannt wurden, galten sie als politischer Skandal des Jahrzehnts. Die Schlagzeilen waren deutlich genug:
GEHEIME KABINETTSDOKUMENTE AN RUSSEN VERRATEN
EHEFRAU DES US-BOTSCHAFTERS IN FRANKREICH BEGEHT SELBSTMORD
HAUSANGESTELLTE GIBT PÄCKCHEN AUF. EMPFÄNGER UNBEKANNT. WAREN ES BRIEFE?
Beide Pearlmans waren eng mit dem Präsidenten befreundet. Die aufgeregte Presse bohrte nach. Weitere Skandale kamen ans Licht. Ingela Pearlman hatte eine Affäre mit einer prominenten Person gehabt – aber mit wem? Die Jagd war eröffnet. Die Medien, die Kommentatoren, die Experten, sie alle waren glücklich, mit blutrünstigen Blicken erspähten sie ihr Opfer und den zu erwartenden Profit. Natürlich sei es im Interesse der Öffentlichkeit, alles schonungslos aufzudecken – was sie dieser auch beizeiten mitteilten.
Noch besser als den Medien aber erging es den Waffenlieferanten. Russland, China, Pakistan, der Iran und der Irak, alarmiert von der Veröffentlichung der atomaren Raketenstellungen und innerem militärischen Druck ausgesetzt, kündigten bald darauf an, dass sie ihre eigenen Arsenale aufstocken wollten, um der Bedrohung zu begegnen.
Natürlich kannte jeder die Wahrheit, oder? Jemand, der dem Präsidenten sehr nahe stand, hatte die vertraulichen Papiere übergeben, um den US-Interessen zu schaden. Ganz klar. Die Politiker, die sofort spürten, dass sich der Wind gedreht hatte, begannen sich vom Präsidenten zu distanzieren. Sogar Vizepräsident Buchanan machte sich auf leisen Sohlen davon, was ihn jedoch nicht daran hinderte, währenddessen lauthals seine Loyalität gegenüber seinem Vorgesetzten kundzutun. Schließlich wartete das Kabinett darauf, dass der Justizminister den Todesstreich führte: »Mr. President, ich denke, Sie sollten die Möglichkeit in Betracht ziehen …«
Und auf den Fernsehbildschirmen sah die enttäuschte und traurige Nation, wie die Tragödie ihren Lauf nahm. Denn die Menschen im Land waren sich noch zweier simpler Wahrheiten bewusst, die die Presse ignorierte – dass auch gute Menschen nur Menschen waren, und dass man erst dann ein Urteil fällen sollte, wenn alle Fakten offen auf dem Tisch lagen.
Allerdings waren sie ebenso fest davon überzeugt, dass der Präsident stürzen würde, sollten die Briefe entdeckt werden.
Es war am Morgen des dritten Tages nach Ingela Pearlmans Tod, dass Jack Caldwell das Oval Office betrat. Präsident Davison blickte aus dem Fenster. Seine Miene war angespannt, er war in den letzten Tagen sichtbar gealtert. Davison wusste, dass jemand ihn vernichten wollte, allerdings war nicht klar, wer dahintersteckte – die Russen? Ingela? Leute in Washington? Es spielte im Moment keine Rolle, denn die Briefe würden sein Schicksal besiegeln. Der Präsident hatte eine Affäre mit einer Spionin gehabt.
Jack schritt über den dunkelblauen Teppich zum Schreibtisch, der das Herz der Nation symbolisierte; er wusste, sollte dieser Präsident fallen, hätte das tiefgreifende Auswirkungen auf das demokratische Regierungssystem in Amerika. Es war schon katastrophal genug, dass der Vorgänger durch ein Amtsenthebungsverfahren seinen Sessel hatte räumen müssen. Wenn nun auch noch der Nachfolger stürzte, würde dies den gesamten Staat unterminieren. Wenn das geschah, würden jene, denen nach der Macht dürstete, die sie auf legitime Weise aber nicht erlangen konnten, die Grundfeste des politischen Systems aushebeln. Caldwell wusste, was er zu tun hatte.
»Jack …« Langsam wandte sich Präsident Davison vom Fenster ab. Seine dunkelbraunen Augen waren auf Caldwell gerichtet. Die letzten Tage waren sehr lehrreich gewesen. Er hatte über Macht nachgedacht und ihr wahres Wesen. Macht und die Gier danach fraßen die Menschen auf – wie eine ätzende Säure. Sie zersetzte ihre Seelen und verwandelte sie in böswillige Ungeheuer. Um der Macht willen waren sie bereit zu lügen, Verrat zu üben, Intrigen zu spinnen. Und dies umso mehr, je größer die Macht war. Das wusste Präsident Davison inzwischen. Er sah es tagtäglich an jenen, die ihm nahe standen, die alles taten, um ihn zu Fall zu bringen, auch wenn sie ihm die Treue schworen. Sogar er selbst war nicht mehr in der Lage, eine Lösung für sein Problem zu erkennen.
»Jack …« Er zögerte. »Ich habe beschlossen zurückzutreten.«
Bedächtig schüttelte Caldwell den Kopf.
»Nein«, antwortete er. »Sie sollten den Meister aufsuchen.«
2.
Der Berufene versteht es immer gut, die Menschen zu retten;darum gibt es für ihn keine verworfenen Menschen.Er versteht es immer gut, die Dinge zu retten;darum gibt es für ihn keine verworfenen Dinge.Das heißt die Klarheit erben.Laotse, Tao Te King
Über die öde schottische Insel fegte ein schneidender Wind, der dichtes Schneegestöber vor sich hertrieb. Der Präsident blickte aus dem Wagenfenster. Es war spätnachmittags. Sie waren im Anschluss an eine NATO-Konferenz in Paris nach Schottland geflogen und dann mit einem Helikopter vom Festland auf die Insel Tirah. Nun befanden sie sich auf dem letzten Abschnitt ihrer Reise zur Burg, die, im Zentrum der Insel gelegen, das Kollegium beherbergte.
Davison betrachtete die Schneeflocken, die gegen die Windschutzscheibe gewirbelt wurden. Ein ehemaliger Präsident hatte ihm erzählt, wie sehr er diese Ausflüge zur Insel genossen hatte. Sie wären eine willkommene Unterbrechung des sterilen Tagesgeschäfts gewesen und hätten ihm Zeit gegeben, seine Gedanken zu ordnen und die unzähligen Quatschköpfe hinter sich zu lassen. Präsident Davison dachte an die vielen anderen, die im Lauf der Jahrhunderte hierher gekommen waren – als hätten sie sich auf einer Pilgerfahrt befunden, um Antworten auf Fragen zu finden, die sie selbst nicht lösen konnten.
»Noch etwa zwanzig Minuten, Mr. President.«
Jack Caldwells Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Es war klug gewesen, Jack mitzunehmen. Jack kannte den Meister von seiner Arbeit für frühere Regierungen; das würde das Eis brechen.
»Mr. President?«
Davison drückte auf einen Knopf im Wagen. Die tiefe Stimme seines Sicherheitschefs meldete sich über Funk.
»Die Straße zum Kollegium ist geräumt, Sir. Die Fahrt sollte problemlos verlaufen.«
»Danke, Tom.«
Ein leises metallisches Klacken war zu hören, als die Präsidentenlimousine die gewölbte Fläche des Hubschrauberlandeplatzes verließ. Weitere Wagen reihten sich vor und hinter ihm in den kleinen Konvoi ein. Dann dröhnten die Motoren, und über Funk erklang das laute Stimmengewirr des Sicherheitspersonals.
Davison achtete kaum auf seine Umgebung. In zwei Tagen war Weihnachten. Er sah seine Töchter vor sich, die aufgeregt im Garten des Weißen Hauses spielten und von der Tragödie nichts wussten. Er dachte an seine Frau Christina, der er am vergangenen Abend alles gestanden hatte. Und er dachte an Ingela Pearlman, deren Berührungen er noch immer zu spüren vermeinte, deren Körpergeruch, deren sanftes Lachen noch immer bei ihm waren. Warum hatte sie ihn verraten?
»Ich hoffe, es ist die Mühe wert, Jack.«
Caldwell lächelte verhalten. »Keine Sorge, Mr. President.«
Davison wusste, dass sein Nationaler Sicherheitsberater sowie der Vizepräsident heftig gegen die Reise votiert hatten. Sie hatten ihn gewarnt, das Kollegium unterstütze nicht die USA; wahrscheinlich würde es den Russen helfen, hatten sie dunkel anklingen lassen. Außerdem sei das Kollegium eine Institution, die nicht nur undurchsichtig, sondern auch sehr mächtig war. Es wäre daher nicht klug, ihm noch mehr Einblick in die inneren Probleme der USA zu gestatten, die es, wenn es die Lage erfordern sollte, gegen das Land verwenden könnte. Nun, Davison würde es heute selbst herausfinden. Vielleicht waren sie nur neidisch, da ausschließlich Regierungschefs Zugang zum Meister hatten. Trotz aller Sorgen war Davison sehr gespannt, einen Mann zu treffen, dessen Ruf und geheimnisumwobene Stellung ihn auf das Äußerste beeindruckten.
Vor ihnen erstreckte sich eine schmale Straße, die in einem Waldabschnitt verschwand. Die Äste der Fichten, die zu beiden Seiten standen, wurden unter der Last des Schnees tief nach unten gedrückt. Die Präsidentenlimousine setzte sich in Bewegung, Schneematsch wurde von den Reifen aufgewühlt. Nach einer Kurve waren die Fähranlegestelle und der Hubschrauberlandeplatz nicht mehr zu sehen. Davison lauschte dem monotonen Geräusch der Scheibenwischer. In der Ferne waren durch das Schneetreiben hindurch die dunklen Silhouetten zweier Berggipfel zu erkennen.
»Sie sollten hier einen Flugplatz bauen oder uns wenigstens im Kollegium landen lassen.«
Jack Caldwell lachte. Es war das erste Mal seit Tagen, dass ihm wieder danach zumute war. Gewöhnlich klang er dabei heiter und selbstsicher, diesmal jedoch war seine Anspannung deutlich herauszuhören.
»Sprechen Sie doch den Meister darauf an, Mr. President, wenn Sie wollen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er Ihrem Vorschlag zustimmen wird. Bereits für die Errichtung des Hubschrauberlandeplatzes war eine Ausnahmegenehmigung nötig. Der von der UN abgezeichnete Sonderstatus von Tirah sieht lediglich eine Fähre zum Festland vor. Das Kollegium achtet sehr auf seine Abgeschiedenheit. Und selbst wenn Tirah über eine genügend große Fläche für ein Rollfeld verfügen würde, bezweifle ich, dass der Meister zustimmen würde. Außerdem«, und seine Stimme wurde wieder ernster, »lässt sich die kurze Fahrt im Auto wunderbar zum Nachdenken nutzen.«
Davison nickte. Sie waren nun gänzlich vom Wald umgeben; draußen legte sich ein weißer Kokon um den Wagen, eine andere Welt. Konnte ihm der Meister wirklich helfen? Wie sollte es möglich sein, dass er mehr wusste als der amerikanische Präsident? Und dennoch …
»Jack«, sagte Davison, ohne den Blick vom Fenster zu nehmen, »der letzte Generalsekretär der UN gab mir noch einen Ratschlag mit auf den Weg, als er vor einigen Monaten aus dem Amt schied. Er patschte mir auf seine onkelhafte Art auf den Arm und meinte: ›Vergessen Sie eines nicht, wenn die Aktien so richtig im Keller stehen, dann konsultieren Sie den Meister.‹«
»Da hatte er nicht Unrecht, Mr. President«, erwiderte Caldwell.
Davison drehte sich vom Wagenfenster weg und musterte seinen Berater. »Ja, schon, trotzdem will ich nicht recht glauben, dass er so viel weiß, wie man über ihn sagt – Staatsgeheimnisse, Einzelheiten unserer Raketenstellungen, unserer militärischen Ausrüstung, solche Dinge eben.«
»Er kennt nicht alle unsere Geheimnisse«, erwiderte Caldwell gleichmütig. Als Mitglied des Kollegiums wollte er nicht zu viel verraten. »Aber ich nehme an, er ist über das meiste unterrichtet. Er hat Zugang zu Personen und Informationen, von denen andere nur träumen können, und er trifft sich seit mehr als dreißig Jahren mit Staatsmännern aus der ganzen Welt auf einer sehr vertraulichen Ebene. Ich glaube, der Meister ist der einzige Mensch, der sowohl die Geheimarchive des Vatikan und jene der Kommunistischen Partei Chinas in Peking besucht hat. Da er über dem politischen Tagesgeschehen steht und das Vertrauen der Großen und Mächtigen besitzt, erfährt er Dinge, die noch nicht einmal die CIA den Leuten entlocken kann. Ein früherer Präsident hat mir einmal erzählt, wenn man sich mit ihm trifft, dann sei dies, als würde man zur Beichte gehen. Und wie ein Priester verrät er niemals die ihm anvertrauten Geheimnisse.«
»Niemals?«, fragte Davison misstrauisch. »Sind Sie sich dessen sicher?«
»Ja«, erwiderte Caldwell, »nach allem, was wir über ihn wissen. In seinem Fall bin ich sogar felsenfest überzeugt davon.«
»Ich hoffe, Sie haben Recht, Jack.«
Müde schüttelte Präsident Davison den Kopf und wandte sich wieder der vorbeiziehenden Landschaft zu. Eine Reihe von Fragen ging ihm durch den Kopf. Würde seine Frau ihn verlassen? Sie meinte nein, aber würde diese Antwort noch Bestand haben, wenn die Geschichte publik und sie von den Medien unter Druck gesetzt wurde? Und was war mit seinen Kindern? Wie erklärte man ihnen, die einen bedingungslos liebten, solche Dinge? Würde er ihnen begreiflich machen müssen, dass der Dad, den sie kannten, nunmehr eine ganz und gar andere, eine suspekte und weniger verlässliche Person war? Davison seufzte.
Der Wald ging über in eine felsige Berglandschaft. Die Vegetation bestand fast nur noch aus Heidekraut und Stechginster. Sie näherten sich dem Zentrum der Insel, bald würde das Kollegium zu sehen sein. Davison verfluchte sich für seine Dummheit. Liebe und Macht waren starke Aphrodisiaka. Leider vertrugen sie sich nicht.
»Reichen Sie mir die Briefing-Unterlagen.«
Erneut überflog er sie und blätterte schnell durch die Seiten. In seiner Funktion als Präsident der Vereinigten Staaten hatte er Zugang zu wesentlich mehr Informationen über das Kollegium als vor seiner Wahl. Die Öffentlichkeit und die Presse wussten zwar von der Insel Tirah, durften sie jedoch nicht betreten. Das Kollegium besaß alle Eigenschaften, die zur Legendenbildung notwendig waren; seine Geschichte faszinierte Davison ungemein. Im Mittelalter von einem berühmten schottischen Adeligen gegründet, versteckt auf einer abgeschiedenen Insel gelegen, sollte es allen Staatsoberhäuptern, sofern sie darum baten, unparteiischen Rat zukommen lassen – wie hatte es all die Jahrhunderte überdauern können? Zudem war es nicht nur bestehen geblieben, es hatte sogar noch an Größe und Einfluss gewonnen. Mittlerweile stellte es die wichtigste ratgebende Körperschaft der Welt dar. Davison war froh, dass Jack ihn dazu überredet hatte, hierher zu kommen. Zumindest würde er nun den Ort mit eigenen Augen sehen, zum ersten und wahrscheinlich auch letzten Mal in seinem Leben. Etwas, was er noch seinen Enkelkindern erzählen konnte. Er legte die Unterlagen beiseite und streckte die Beine aus.
»Jack, wie ist das Kollegium aufgebaut? Ich habe immer noch kein rechtes Bild davon.«
Caldwell zog unmerklich die Augenbrauen hoch. »Ich denke, keiner außerhalb des Kollegiums weiß das mit Sicherheit zu sagen. Wir wissen nur sehr wenig über seine innere Struktur, außer dass der Meister das Oberhaupt ist. Er wird von fünf Schiedsmännern unterstützt, hochrangigen Mitgliedern, die von ihm ernannt werden und ihm bei Verwaltungsaufgaben helfen. Insgesamt gibt es nie mehr als achtzig Personen, die dem Kollegium angehören. Wir wissen auch, dass der Meister die oberste Exekutive, Judikative und Legislative der Institution darstellt.«
»Wer ernennt wen?«
»Der Meister ernennt die Schiedsmänner; diese wiederum die Kollegiumsmitglieder. Der Meister ernennt auch seinen Nachfolger, soweit es uns bekannt ist. Aber damit, fürchte ich, erschöpft sich unser Wissen.«
Präsident Davison fühlte sich kaum klüger als zuvor. »Ja, aber wie kommt das Kollegium an die Informationen? Woher wissen sie so viel über uns?«
Caldwell beugte sich vor. »Nun, Mr. President, man kann sie vielleicht mit Freimaurern vergleichen. Die Mitglieder geben nach außen hin ihre Identität nicht preis. Sie sind in hohen Regierungsstellen beschäftigt, bei Forschungseinrichtungen, Universitäten oder internationalen Organisationen – überall dort, wo Macht ausgeübt wird und auf staatlicher Ebene Entscheidungen getroffen werden. Sie sind die Augen und Ohren des Meisters und der Schiedsmänner.«
»Und der Meister? Ist er der Einzige, der alles überblickt und versteht, wie sich alles zusammenfügt?«
»Ja«, antwortete Caldwell. »Verstehen Sie, er sitzt im Zentrum eines gewaltigen Systems zur Informationsbeschaffung, das über Hunderte von Jahren entstanden ist. Daneben sind wir aufgrund gewisser Auskünfte von Mitgliedern davon überzeugt, dass das Kollegium schon seit langem in der Lage ist, sich weltweit in jeden militärischen oder Firmencomputer einzuloggen. Sogar die Mitglieder, fürchte ich, wissen nur einen Bruchteil dessen, was in diesem fein gesponnenen Netz wirklich vor sich geht. Auf diese Weise kann das Kollegium seinen geheimen Status bewahren und ist im Grunde unangreifbar. Ein sehr ausgeklügeltes System, das sich bereits seit Jahrhunderten einer Operationsweise bediente, die derjenigen heutiger Terroristenzellen gleicht: Wird ein Teil aufgedeckt, kann nicht sofort die gesamte Struktur zerstört werden. Das alles basiert auf dem mittelalterlichen Konzept des großen Lebensrades – ähnlich der Planeten, die um die Sonne kreisen, nur stellt in diesem Fall der Meister die Sonne dar, das innerste Machtzentrum.«
Weiter erklärte Caldwell, dass das Kollegium im Zuge seiner beratenden Aufgaben, »die dem Erhalt des Friedens dienen«, nicht nur Kriege und militärische Maßnahmen, sondern alle Bereiche der menschlichen Tätigkeiten verfolge. Das Kollegium besitze Datenbanken zur Genforschung, zur Kriminalität, der Umwelt, Raumfahrttechnik, Medizin, Wirtschaft, Politik, zu den Aktienmärkten und bediene sich daraus, wenn es darum ging, den Staatsmännern mit Ratschlägen beizustehen. Auf diese Weise verfügte das Kollegium über einen weitreichenden, wenngleich schwer fassbaren Einfluss auf die Welt. Es glich in gewisser Weise einem wohlwollenden Wächter, der den Weg und die Richtung, die die Menschheit einschlug, unauffällig mitbestimmte. Wenn eine Institution über Macht, ihren Gebrauch und Missbrauch Bescheid wusste, dann das Kollegium. »Wir gehen davon aus, dass ihre Computer unseren deutlich überlegen sind.«
Präsident Davison blickte ihn kritisch an, und kurz blitzte sein breites Grinsen auf. »Sie könnten also auch zum Kollegium gehören, Jack?«
Caldwell sah geringschätzig an sich hinab. »Wer weiß? Der Chef der CIA, der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs, der Vorsitzende der Zentralbank – sie alle könnten Mitglieder sein. Nur der Meister könnte ihre Identität preisgeben, aber das ist, soweit wir wissen, bislang noch nie geschehen.«
Davison trommelte mit den Fingern gegen die Armlehne seines Sitzes. Er dachte daran, was er dem Meister sagen wollte. Wer hatte mehr Einfluss, der Meister oder der Präsident der Vereinigten Staaten? Er begann die Vorherrschaft seines Amtes, die er bislang stillschweigend immer vorausgesetzt hatte, in Frage zu stellen. Und außerdem, was erzählten ihm seine Leute wirklich?
»Jack, glauben Sie, das Kollegium missbraucht seine Macht?«
»Das ist schwer nachzuweisen«, erwiderte sein Sonderberater. »Ich persönlich glaube, dass dies nicht geschieht. Das Kollegium wurde ursprünglich geschaffen, um den Frieden zu erhalten, und ich denke, an dieser Maxime haben sie über die Jahrhunderte hinweg festgehalten. Dennoch hängt vieles vom Meister und der Integrität des Kollegiums ab. Wie alles vom Menschen Geschaffene wird es nie vollkommen sein. Ein einziger fauler Apfel, und das ganze System kann zerstört werden. Angesichts dessen nehmen wir an, dass auch im Kollegium Kontrollmechanismen vorhanden sind und die Korruption bis ganz nach oben, bis zum Meister selbst gehen muss, bevor das System zum Einsturz gebracht werden kann. Es gleicht daher ein wenig dem Papsttum; an der Spitze ist enorme Macht konzentriert, die in direkter Verbindung zu allen steht, die von Bedeutung sind, Gott vielleicht einmal ausgeschlossen.«
»Ich hoffe, man hat den Meister sorgfältig ausgewählt«, antwortete Davison trocken. Und fast beiläufig fügte er hinzu: »Können wir nicht mehr Infos über das Kollegium besorgen?«
Caldwell wusste nur zu gut, worauf Davison wirklich abzielte. Könnte die US-Regierung das Kollegium nicht infiltrieren und manipulieren, nur ein wenig, sodass es den Interessen der USA wohlwollender gegenüberstand? So wie sie es mit fast jeder internationalen Organisation getan hatten. Andere Präsidenten hatten ihm die gleiche Frage gestellt, manche Länder hatten sogar versucht, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen, bislang allerdings immer vergebens.
»Das lässt sich nur schwer verwirklichen.« Caldwell erklärte, die CIA besitze zwar Satellitenaufnahmen des Kollegiums und von Tirah, doch seien diese relativ wertlos. Man müsste schon in das Innere des Systems eindringen, was aber mit großen Problemen verbunden sei – als wollte man sich in einen Mönchsorden einschleusen; auch wenn den Mitgliedern mittlerweile erlaubt war zu heiraten.
»Und außerdem, Mr. President«, und Caldwell hüstelte höflich, »wissen Sie, dass der US-Kongress 1860 ein Gesetz zum Schutz des Kollegiums und seines materiellen sowie geistigen Eigentums verabschiedet hat. Das Gleiche gilt für die Charta der Vereinten Nationen. Jeder Präsident, der dort eindringen oder dessen Mitglieder bestechen will, wäre nicht gut beraten. Sobald das Kollegium es herausfindet, fällt der Vorhang. Das Vertrauensverhältnis wäre zerstört, und Sie wären unweigerlich der Verlierer.«
»Natürlich«, kam es hastig von Davison. »War ja nur so ein Gedanke.«
Und da es Caldwell damit nicht bewenden lassen wollte, erzählte er zur zusätzlichen Warnung vom Plan einer früheren US-Regierung, im Verbund mit der CIA die Wahl eines ihr genehmen Mitglieds durchzusetzen. Trotz gewaltiger Anstrengungen hatte es sich als unmöglich erwiesen. Caldwell wartete, bis die Botschaft angekommen war; seine Miene verriet nicht im Geringsten, dass er selbst es damals gewesen war, der den Meister gewarnt hatte. Das System besaß viele subtile und diskrete Möglichkeiten, sich zu schützen. Davison, ernüchtert ob der unausgesprochenen Zurückweisung, nickte.
Die Fahrt war fast zu Ende. Vor ihnen ragten gewaltige Burgmauern auf, und der Wagen begann den steilen Aufstieg. Gespannt spähte Davison nach draußen. »Das hier muss einzigartig sein.«
»Nur in gewisser Weise«, erwiderte Caldwell. »Die Idee, die dahintersteckt, ist nicht neu. Die alten Griechen hatten ihren berühmten Tempel in Delphi. Dorthin gingen die Menschen, um das Orakel, eine Priesterin, zu befragen. Da jede bedeutende Person bei ihr um Rat nachfragte, wusste sie mehr als jeder andere. Ihre Prophezeiungen waren daher erstaunlich genau. Nun, der Meister ist ebenfalls so etwas wie ein Orakel. Jemand hat mir mal gesagt, er lüge nie, und nach einem Besuch bei ihm sei man immer klüger als zuvor.«
»Dann weiß er also, wer den Russen die Geheimnisse verraten hat?« Davison klang zynisch und verzweifelt.
Caldwell musterte den Präsidenten, sein jugendliches, offenes Gesicht, das ehrliche Lächeln, durch das er Millionen Herzen gewonnen hatte: die Person mit dem weltweit höchsten Bekanntheitsgrad – und deren Schwächen sie so überaus menschlich machten.
»Ich denke schon«, sagte er leise.
Das Kollegium war auf einer Felserhebung inmitten von Tirah erbaut und überragte die Fichten- und Kiefernwälder, von denen es umschlossen wurde; von dort oben konnte man nahezu die gesamte Insel überblicken, nur im Westen schoben sich die vierhundert Meter hohen Gipfel des Mullach Coll und des Mullach Mor vor den Atlantik. Das Kollegium glich in allem einer mittelalterlichen Burg: Es besaß steile, glatt aufragende Wände, die direkt aus dem Fels zu wachsen schienen, Fenster, die Schießscharten glichen, und Zinnen aus wuchtigen Granitblöcken. Tatsächlich war das Gebäude als Burg erbaut worden, bevor der Lord der Inseln sie dem Kollegium vermacht hatte. Vieles hatte sich seitdem verändert. Nach außen hin hatte es sich sein altes, Ehrfurcht gebietendes Aussehen bewahrt, die Innenräume allerdings waren im Lauf der Jahrhunderte grundlegend umgebaut worden und vermittelten den Eindruck, als befände man sich in einer alten Universität.
Nur eine Straße führte zum Kollegium, kurz vor den Burgwällen bog sie zu einem kleinen Parkplatz ab. Die jeweiligen Gäste – keiner konnte ohne die Erlaubnis des Meisters auf Tirah landen – mussten daraufhin eine steile Treppe hochsteigen, wollten sie über eine Steinbrücke, den einzigen Zugang, die Burg betreten. Das Tor bestand aus einem Rundbogen, in dem große Eichentüren eingelassen waren, die untertags immer offen standen. Anschließend waren zwei Innenhöfe zu durchqueren.
Der erste und größere von beiden war nahezu rechtwinklig und geräumig. In der Mitte befand sich ein großer Brunnen, gepflasterte Wege führten um ihn herum. In den vier Ecken des Hofs standen Kiefern, die, vor langer Zeit gepflanzt, durch die hohen, zinnbewehrten Mauern vor der Gewalt der Winde geschützt lagen. An die Außenwände waren mit Sandstein verkleidete Gebäude errichtet; sie waren bereits im fünfzehnten Jahrhundert gebaut worden und besaßen Bleiglasfenster und Wendeltreppen, Efeu rankte sich über die Wände. Hier wohnten die Mitglieder, wenn sie im Kollegium weilten. Über allem lag eine akademische, klösterliche Atmosphäre, die von Ruhe, Kontemplation und Abgeschiedenheit zeugte.
Ein schmaler Gang führte vom Ende des ersten Innenhofs zum zweiten. Dieser war kleiner und wirkte pittoresker. Er verfügte über einen ausgedehnten Garten, in dessen Mitte sich ein Teich voller alter Karpfen befand. Rechts davon lag die Große Halle, in der die Mitglieder das Essen einnahmen, gleich daneben die Bibliothek, ein eleganter Bau mit einer Marmorfassade, die, wenngleich kleiner, dem Parthenon nachempfunden war. Beide Gebäude grenzten an die Außenwand des Kollegiums und wurden selbst im Winter von hohen Bäumen und Sträuchern verdeckt. An der linken Seite befand sich die Empfangshalle. Sie war ebenfalls mit Sandstein verkleidet, glich in ihrer Bauweise den Gebäuden im ersten Hof und beherbergte die Räume, in denen der Meister seine Gäste empfing.
Während der erste Innenhof Ruhe ausstrahlte, lag über dem zweiten eine Aura des Unwirklichen, als führte der schmale Gang in einen rätselhaften inneren Raum, der nur wenigen Auserwählten vorbehalten war. Beide Höfe erfreuten das Auge, vor allem, wenn man sie mit dem öden, abweisenden Äußeren der Burg verglich. Den Besuchern erschienen sie oft wie wertvolle Juwelen, die in einer grob gezimmerten Kiste verborgen gehalten wurden. Das gesamte Kollegium schien aus diesen beiden Innenhöfen zu bestehen.
Einzig und allein für den Meister – um den sich die ganze Einrichtung drehte – kam der geheime Charakter des Kollegiums auch im Bauplan der Burg zum Ausdruck. Der zweite Innenhof endete an einer hohen Mauer, die in Größe und Gestalt den Außenwänden der Burg glich, sodass sich jedem der Eindruck aufdrängte, dahinter befände sich nichts mehr. Und da es aufgrund der zerklüfteten Berglandschaft und den Wäldern nahezu unmöglich war, das Kollegium vollständig zu umrunden, ließ sich dieser Eindruck kaum widerlegen. Dennoch täuschte er.
Denn in der Ecke der Wand am westlichen Abschnitt des zweiten Innenhofs lag eine hinter Bäumen und Efeu versteckte Tür. Und hinter ihr schloss sich ein dritter Innenhof an, das innerste Heiligtum des Kollegiums, ein geheimer Ort, der nur die Räume des Meisters beherbergte. Der dritte Hof war daher unsichtbar, verborgen – Sinnbild der Geisteshaltung und der Bestrebungen seiner Bewohner.
Zusammen mit Jack Caldwell und seinen Leibwächtern stand Präsident Davison auf der Schwelle des mittelalterlichen Gangs, der in den zweiten Innenhof führte. Hinter dem schmalen Rundbogen war bereits der große Garten zu sehen, der bis auf einen geräumten Pfad von Schnee bedeckt war. Der Präsident sah zu seinen Sicherheitsleuten.
»Sie bleiben hier.«
Es folgte unangenehmes Schweigen. Nervös traten die Leibwächter von einem Fuß auf den anderen; unter ihren Anzügen hatten sie ihre Funkausrüstung verborgen.
»Wir sind gehalten, Ihnen überallhin zu folgen, Sir«, sagte einer von ihnen mit fester Stimme. »Zu Ihrer eigenen Sicherheit.«
»Aber nicht hier«, antwortete Präsident Davison. »Das ist ein Befehl.« Er trat in den Durchgang. »Kommen Sie, Jack.«
Der Präsident und sein oberster Berater schlenderten durch den Garten, bis sie nicht mehr in Sichtweite ihrer Beschützer waren. Davison, in einen dicken Wollmantel gehüllt, ließ sich auf einer Steinbank am Teich nieder. Caldwell nahm neben ihm Platz.
»Das Folgende ist sehr schwer zu erklären.« Der Präsident sah über den zugefrorenen Teich. Einen kurzen Augenblick lang spürten beide die Ruhe, die dieser Ort ausstrahlte. »Jack, könnte es sein, dass bei der Übergabe der Kabinettspapiere an die Russen die undichte Stelle bei mir lag?«
Lange schwiegen die beiden. Dann entfuhr Davison ein Seufzer. »Ingela und ich hatten eine Affäre. Sollte sie eine Spionin gewesen sein, hätte sie in meinen Räumen Zugang zu diesen Papieren gehabt. Unser letzter Abschied ist etwas unglücklich verlaufen, aber ich hätte niemals gedacht, dass sie mich oder ihre Wahlheimat verraten würde. Sie beging Selbstmord, noch bevor ich mit ihr sprechen konnte.« Er hielt kurz inne, dann fuhr er mit einem Anflug von Verzweiflung fort: »Dummheit ist eine Gabe, die die Götter zu gleichen Teilen an die Menschheit vergeben haben, Jack. Wenn ich das Geschehene ändern könnte, würde ich es tun. Doch das ist nicht möglich.«
Das also schien es gewesen zu sein. Ein Verräter, der dem Präsidenten sehr nahe gestanden hatte. Genau wie die Medien vermuteten.
»Ich denke, das Päckchen, hinter dem alle her sind, enthält Briefe, die ich Ingela geschrieben habe«, setzte der Präsident seine Beichte fort. »Sie sind sehr intimen Inhalts. Verstehen Sie, ich habe ihr vollkommen vertraut.« Davison stellte sich vor, wie er über das Eis auf dem Teich ging; tiefe Risse taten sich unter ihm auf.
Caldwell hörte zu, sagte aber nichts. Er wusste bereits alles, was der Präsident ihm gestanden hatte. »Wer, glauben Sie, ist im Besitz der Briefe?«, fragte er ihn.
»Entweder die Russen oder Personen in Washington. So oder so, ich denke, es ist vorbei«, antwortete der Präsident. »Es gibt nichts mehr zu tun. Diese Briefe werden, wenn sie veröffentlicht sind, mein Schicksal besiegeln. Der Kongress wird mir eine Affäre mit einer Agentin nicht verzeihen.«
Caldwell nickte.
»Glauben Sie, der Meister hat eine Antwort darauf?«, fragte der Präsident.
Caldwell sah ihn an, dann blickte er hoch zum stillen Himmel.
Symes, der ältliche Kammerdiener, klopfte sacht gegen die Tür zum Arbeitszimmer und trat dann ein. In einer Ecke am Fenster stand ein großer, von einer alten Tischlampe beleuchteter Schreibtisch, darauf waren unzählige Papier ausgebreitet. Symes erkannte mit einem Blick, dass der Meister die Nacht durchgearbeitet hatte. Er runzelte die Stirn. Schon seit langem war er nicht mehr erstaunt über die außerordentliche Fähigkeit dieses Mannes, Informationen in einer Vielzahl von Sprachen aufzunehmen und zu verarbeiten. Doch auch der Meister wurde älter. Unmöglich, dass er dieses Arbeitspensum beibehielt. Symes brachte noch mehr Papiere, diesmal von der indischen Regierung über die sich zuspitzende Lage in Kaschmir. Weitere Papiere, weitere Probleme, weitere dringliche Anfragen für ein Treffen mit den Staatsoberhäuptern der Welt. Was, wenn der Meister nicht mehr wäre – wer würde dann seinen Platz einnehmen? Wer würde den Ring tragen und die Staatenlenker in Friedensfragen beraten?
»Meister, der Präsident der Vereinigten Staaten ist eingetroffen.«
Der Meister sah von seinem Schreibtisch auf und nickte. Er war ein großer, gut gebauter Mann mit schiefergrauen Augen und einem Haar, das sich allmählich weiß färbte. Die hohe Stirn, die ausgeprägten Wangenknochen, die scharf geschnittene Nase sowie seine unerschütterliche Miene verliehen ihm eine Ausstrahlung, die unweigerlich die Aufmerksamkeit auf sich zog. Es war ein Gesicht, wie man es sich aus der Zeit der Renaissance vorstellte, das Gesicht eines Medici oder eines Herrschers in einem italienischen Stadtstaat. Ein Gesicht, das von der Macht und ihrer Ausübung zeugte.
»Das Bankett des Kollegiums«, fuhr Symes fort, »ist für acht Uhr abends vorgesehen.« Der Meister warf einen kurzen Blick auf die Dokumente, die Symes ihm soeben überreicht hatte, und legte sie dann zur Seite. Symes wartete. Er wusste, seine nächste Neuigkeit würde sogar das Oberhaupt des Kollegiums überraschen.
»Meister, noch ein Treffen ist für heute geplant. Der Oberste Schiedsmann wünscht Sie dringend zu sprechen. Und er bittet Sie, niemanden sonst darüber in Kenntnis zu setzen.«
Der Meister blickte von seiner Arbeit auf. Symes schien es, als huschte ein trauriger Ausdruck über sein Gesicht, als würde er sich bewusst werden, dass etwas seinem Ende zuging.
»Symes?«
»Die Gesetze des Kollegiums erlauben es dem Obersten Schiedsmann, bei besonderen Anlässen um ein solches Treffen zu bitten«, fuhr Symes fort. »Solange ich am Kollegium bin, ist dies noch nie vorgekommen. Aber es scheint mir …« Seine Stimme verlor sich. Er hatte das Gefühl, als hätte er den Meister hintergangen, nachdem er ihn nicht früher vor dem Anliegen gewarnt hatte. Aber die Worte des Obersten Schiedsmanns waren eindeutig gewesen.
»Sagen Sie bitte dem Obersten Schiedsmann«, antwortete der Meister ruhig, »dass seine Bitte gewährt wird. Das Treffen wird in meinen Räumen unmittelbar nach dem Bankett stattfinden.«
Präsident Davison und Jack Caldwell saßen im großen Empfangssaal des zweiten Hofs. Der Raum war licht und hell. Die Einrichtung bestand aus Louis-Seize-Möbeln, überall prangten vergoldete Verzierungen, große Gemälde und wunderbare Antiquitäten waren zu sehen. Besucher des Kollegiums, die noch die karge Landschaft und das einschüchternde Äußere der Burg vor Augen hatten, waren unweigerlich überrascht. Im offenen Kamin brannte knisternd ein Feuer. Unnötigerweise, wie es schien, da es im Raum bereits warm war. Eine Tür ging auf.
»Mr. President.«
Präsident Davison gab dem Meister die Hand. Der Handschlag war stark und fest. Das also war der Wächter unzähliger Geheimnisse.
»Mr. Caldwell«, und damit wandte sich der Meister an seinen zweiten Gast, »wir kennen uns ja bereits.«
Caldwell blickte zum Präsidenten.
»Danke, Jack«, kam es von Davison. »Sie können jetzt gehen. Wir treffen uns dann draußen wieder.«
Der Meister und der Präsident setzten sich. Symes schenkte Kaffee ein und zog sich zurück. Davison betrachtete sein Gegenüber, der ein Vierteljahrhundert älter war als er selbst. Das Gesicht des Meisters war von Falten überzogen, es strahlte Ruhe und Geduld aus, als lebte er zurückgezogen von der Welt, die ihn nichts anging. Präsident Davison war im Lauf seiner Politikerkarriere mit allen möglichen Menschen zusammengetroffen; er wusste, der äußere Anschein konnte täuschen. Menschen, die sich distanziert gaben, waren oft die größten Egoisten. Warum sollte es beim Meister anders sein? Und welchen Rat konnte er ihm wirklich geben? Keinen, dachte er sich. Das war ganz und gar ausgeschlossen, die Reise war verschwendete Zeit, ganz sicher. Der Präsident beschloss, ihn ebenso brüsk und entschieden zu behandeln wie sein Kabinett. Was soll’s, zum Teufel, er war doch auch nur ein Berater, eine Art Bürokrat, auch wenn man für seine Dienste nicht bezahlen musste.
»Sie haben den Hintergrundbericht über die Kabinettspapiere, die Ihnen Jack Caldwell geschickt hat, gelesen?«
»Ja«, antwortete der Meister. »Ich habe auch mit Präsident Barchow gesprochen.«
»Er reagiert nicht auf meine Anrufe.«





























