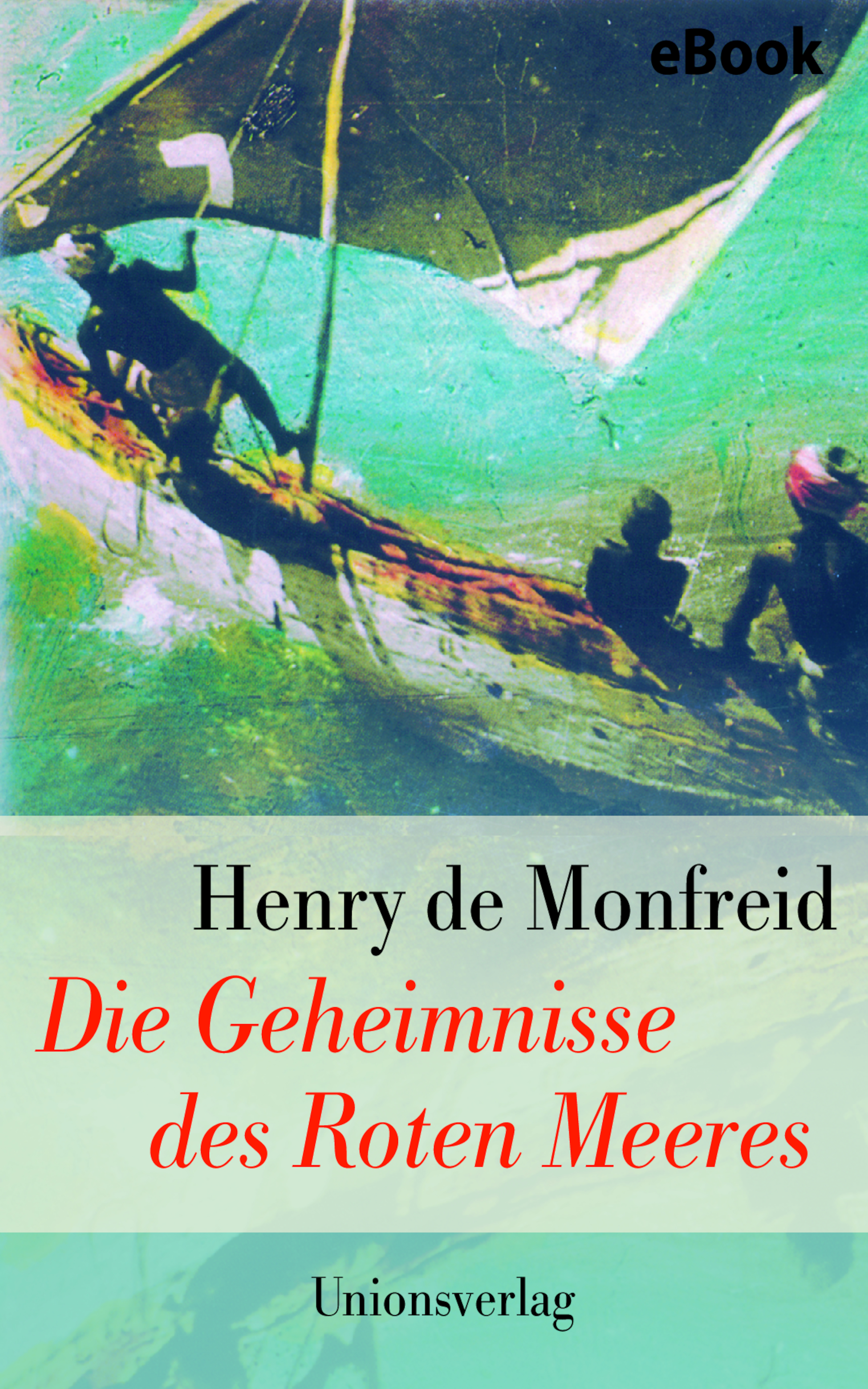
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Henry de Monfreid stammte aus bestem Hause, war befreundet mit Matisse, Gauguin, Cocteau und Teilhard de Chardin. Nach einigen frustrierenden Jahren als Ingenieur brach er 1911 auf nach Dschibuti am Roten Meer und nannte sich fortan Abd-el-Haï, »Sklave der Schöpfung«. Er kaufte sich ein Schiff und lebte unter Fischern, Perlentauchern, Schmugglern, Piraten, Waffenhändlern als einer der Ihren. Das Gesetz galt ihm wenig, und für die Beamten der Kolonialmacht hatte er nur Verachtung übrig. In dreitausend Briefen an seine Freunde hatte er bereits seine Abenteuer geschildert, als Joseph Kessel ihn überredete, doch endlich ein Buch zu schreiben. Als dann Die Geheimnisse des Roten Meeres erschien, wurde er auf einen Schlag zur Legende. Seine Erlebnisse am Roten Meer und später in Afrika sind der gigantische, berückende, mythische Stoff zu einem umfangreichen Œuvre, das bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Henry de Monfreid stammte aus bestem Hause, war befreundet mit Matisse, Gauguin, Cocteau. Nach einigen frustrierenden Jahren als Ingenieur brach er 1911 auf ans Rote Meer. Er kaufte sich ein Schiff und lebte unter Fischern, Perlentauchern, Schmugglern, Piraten, Waffenhändlern als einer der Ihren. Seine Schilderungen machten ihn zur Legende.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Henry de Monfreid (1879–1974) ist einer der großen Abenteurer und Abenteuerschriftsteller des 20. Jahrhunderts. Seine über 75 Romane und Erzählungen handeln von seinen Erlebnissen in den Regionen um das Rote Meer und am Horn von Afrika.
Zur Webseite von Henry de Monfreid.
Gerhard Meier (*1957) studierte Romanistik und Germanistik. Seit 1986 lebt er bei Lyon, wo er literarische Werke aus dem Französischen und aus dem Türkischen (Hasan Ali Toptas, Orhan Pamuk, Murat Uyurkulak) überträgt. 2014 wurde er mit dem Paul-Celan-Preis ausgezeichnet.
Zur Webseite von Gerhard Meier.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Henry de Monfreid
Die Geheimnisse des Roten Meeres
Roman
Aus dem Französischen von Gerhard Meier
Mit Fotografien des Autors
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1931 unter dem Titel Les Secrets de la mer Rouge im Verlag Grasset, Paris.
Originaltitel: Les Secrets de la Mer Rouge
© Bernard Grasset 1932
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Henry de Monfreid, eigenhändig auf der Glasplatte aquarellierte Fotografie
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30824-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 19:44h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE GEHEIMNISSE DES ROTEN MEERES
Erste Begegnung mit dem Roten Meer1 — Cheik Saïd2 — Aufbruch zum Perlenfischen3 — Von Insel zu Insel4 — Die Perleninsel Dahlak5 — Der Tod von Saïd Ali6 — Der Bericht von Cheik Issa7 — Meine erste Waffenladung oder Die Fahrt nach Khor Omeira8 — Zweite Waffenfahrt: Der Angriff9 — Die Affäre Debeleba10 — Die Spione von Ato Joseph11 — Juli 191412 — Die letzte Fahrt13 — Das Glück verlässt michBilderWorterklärungenAbbildungsverzeichnis
Mehr über dieses Buch
Über Henry de Monfreid
Über Gerhard Meier
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Meer
Zum Thema Arabien
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Abenteuer
Zum Thema Asien
Erste Begegnung mit dem Roten Meer
Nein, Monsieur, Sie fahren nicht nach Tadschura!«
»Aber Herr Gouverneur, die arabischen Händler dürfen doch auch hin?«
»Keine Diskussion, verstanden? Sie sind nun mal Franzose und kein Araber. Kein halbes Jahr sind Sie in Dschibuti, aber alles muss nach Ihrem Kopf gehen. Wenn erfahrene Menschen Ihnen Ratschläge erteilen, dann sollten Sie die auch beherzigen. Aber Sie, Sie hören ja auf niemanden. Ihnen mag es ja Spaß machen, in der prallen Sonne und ohne Tropenhelm herumzualbern und in somalischen Cafés herumzuhocken. Sagen Sie mal, schämen Sie sich nicht, wenn hergelaufene Kulis Sie mit einem hiesigen Namen anreden?«
»Nein, ganz im Gegenteil. Wenn ich aber mit anhören muss, was diese Leute von Europäern halten, dann schmerzt mich das, und ich tue mein Möglichstes, um nicht als solcher zu gelten.«
»Die Meinung dieser Wilden interessiert Sie also mehr als die unsere?«
»Das mag wohl sein.«
»Wissen Sie was, für Revoluzzer von Ihrem Schlag habe ich nichts übrig. Sollte die Kolonie Ihre Moral verletzen, dann bitte schön: In drei Tagen legt ein Schiff nach Frankreich ab.«
»Herr Gouverneur, ich habe Sie lediglich darum gebeten, nach Tadschura fahren zu dürfen.«
»Und ich sage Ihnen nochmals, dass Sie dort nicht hinfahren.«
»Auch nicht ohne Ihre Zustimmung?«
»Wie meinen Sie das?«
»Ich verstehe sehr wohl, wenn Sie nicht verantworten möchten, dass ich in ein Land fahre, das sich Ihrer Autorität entzieht. Also fahre ich wohl besser ohne Ihr Wissen.«
»An Dreistheit mangelt es Ihnen definitiv nicht.«
»Tun wir einfach so, als hätte ich nichts gesagt, da meine Präsenz in Tadschura Sie derart beunruhigen würde …«
»Wie bitte? Beunruhigen? Meinen Sie etwa im Ernst, um ein Individuum wie Sie mache ich mir Sorgen? Wenn Sie Lust haben, sich massakrieren zu lassen, können Sie das gerne tun, verdient haben Sie es.«
»Ergebensten Dank, Herr Gouverneur. Ich empfehle mich.«
Unter solchen Vorzeichen trat ich meine erste Reise nach Tadschura an.
Vor vierzig Jahren war Dschibuti nichts weiter als eine sandige Halbinsel, die auf ein Inselchen aus toten Korallen auslief. Bei stürmischem Wetter suchten manchmal Fischer dort Zuflucht. Durch das Küstenriff zieht sich eine breite Fahrrinne, die in ein großes natürliches Becken mündet. Eine sechs Kilometer landeinwärts gelegene Oase deutet auf unterirdische Wasservorkommen hin.
Heute hat man eine gänzlich weiße Stadt mit lauter Flachdächern vor sich. Sieht man sie vom herannahenden Schiff aus am Horizont erscheinen, so meint man, sie schwebte über dem Meer, doch nach und nach zeichnen sich metallene Tanks ab, Kranarme, Kohlehaufen, kurz all die Scheußlichkeiten, die die westliche Zivilisation unweigerlich überall mit sich hinschleppt.
Zur Rechten, auf der anderen Seite des Golfs von Tadschura, erheben sich wie eine riesenhafte Mauer große dunkle Berge. Trutzig ragen die Basaltfelsen vor dem geheimnisvollen, unerforschten Land der Danakil empor, der Heimat rebellischer Stämme.
Hinter der Stadt erstreckt sich über dreihundert Kilometer, bis hin zur Hochebene von Harar, in unerbittlicher Einöde eine mit dornigem Gebüsch bewachsene schwarze Lavawüste. Die Zivilisation macht halt vor dieser abweisenden Natur, die dem Leben ihrer Geschöpfe nichts gewähren will. Nur die wilden, grausamen Issa leben hier als Nomaden, stets bereit, dem weißen Reisenden, den nicht schon die Sonne verdörrt hat, mit Lanze oder Dolch den Garaus zu machen.
Durch diese glühend heiße Landschaft zieht sich jedoch ein schmales eisernes Band: die Eisenbahnlinie von Dschibuti nach Addis Abeba. Die tapferen Männer, die bei ihrem Bau ihr Leben ließen, sind längst vergessen. Chefneux, der Urheber dieser französischen Unternehmung, ist in Armut und Elend verstorben.
*
Wovon lebte Dschibuti zur Zeit meiner Ankunft?
Von etwas Transitverkehr, wegen der Eisenbahn, die bis nach Äthiopien führt. Die Millionen aber, die sich in den Zollkassen anhäuften, stammten aus einer anderen Art von Handel.
Dschibuti lebte vom Waffenschmuggel.
Waffenausfuhr war dort problemlos möglich, sofern man an den Zoll die entsprechenden Gebühren abführte. Zielort der Waffen hatte im Prinzip Maskat im Golf von Oman zu sein, doch in Wirklichkeit fuhren die Schiffe überallhin. Ich habe gesehen, wie arabische Dhaus innerhalb eines Monats drei Fahrten bewältigten, ohne dass sich irgendjemand überrascht zeigte, obwohl man für eine Hin- und Rückfahrt nach Maskat die Umkehr des Monsuns abwarten musste, also mindestens ein halbes Jahr.
In Maskat gab es die französische Faktorei von Monsieur Dieu, der mit dem unabhängigen Sultan einen Handelsvertrag geschlossen hatte. Monsieur Dieu importierte Waffen aus Belgien und verschaffte damit den Exporten aus Dschibuti einen Anschein von Legalität.
Die Engländer ließen sich dadurch nicht täuschen. Sie kauften die Faktorei auf und schlossen sie kurzerhand.
Gouverneur Pascal gab sich nicht geschlagen. Er ließ weiterhin Exporte zu, jedoch mit Zielrichtung Meer. Die Verwaltung gab auslaufenden Schiffen keine Bordpapiere mehr, und der Zoll keine Ladeliste.
Ein vom Zoll angeheuerter arabischer Tischler hobelte von den Kisten alles Verräterische sorgfältig ab.
Die Engländer konnten die Kisten zwar beschlagnahmen, doch nichts verwies auf den Ursprung der Waffen, die von rebellischen Stämmen oft genug gegen sie gerichtet wurden.
Kein Wunder also, dass ich höchst unerwünscht war, als ich wie die Einheimischen aufs Meer hinausfahren wollte. Meine Anwesenheit auf einem Waffenschmugglerboot würden die Engländer als Provokation auffassen.
Als Absatzmarkt gab es da noch Abessinien, ein freies Land, das Waffen kaufen durfte, ohne die Engländer um Erlaubnis zu fragen, und somit ein ausgezeichneter Vorwand für Exporte in Richtung Meer. Man schickte die Waffen nach Tadschura, einen ehemals wichtigen Handelshafen, von dem aus früher, vor dem Bau der Eisenbahnlinie, viele Karawanen loszogen.
Und hier kam Ato Joseph ins Spiel.
Er war ein alter, dicklippiger Schwarzer, mit syphilitischen Gebrechen behaftet, die er unablässig dem Herrn darbot, denn er war Katholik, aber so, wie ein Mann dieser Sorte es eben sein konnte, nach Art eines Tartuffe.
Ato blickte auf eine außerordentliche Karriere zurück. Der auf einer Missionsstation erzogene einstige Sklave stand eine Zeit lang im Dienst des Dichters Rimbaud, eines der ersten Pioniere in Abessinien. Danach gehörte er einem Russen namens Leontief, einem genialen Abenteurer, der sich einen einträglichen Schwindel ausdachte.
Er kündigte am Zarenhof die Ankunft eines äthiopischen Botschafters an und stellte als solchen seinen Domestiken vor.
Ato Joseph war damals jung und schön. Er wurde in Sankt Petersburg wie der Abgesandte eines großen Königs empfangen und im intimeren Kreis für die stattliche Erscheinung seines bronzenen Körpers gefeiert. Leontief seinerseits kassierte die Geschenke. Doch lange konnte das nicht gut gehen. Bei seiner Rückkehr nach Abessinien wurde Ato Joseph ins Gefängnis geworfen und meinte schon, sein letztes Stündlein habe geschlagen.
Der Negus Menelik indes mit seinem politischen Spürsinn wusste sogleich, wie aus einem derart intriganten und mit den Sitten der Europäer vertrauten Manne Nutzen zu ziehen war. Er begnadigte Ato Joseph und schickte ihn nach Dschibuti, als angeblichen Transithändler im Dienste Seiner Majestät.
Vor allem sollte jener dort Augen und Ohren offen halten.
Bald schon galt Ato Joseph den Europäern als veritabler abessinischer Beamter, eine Art Konsul gewissermaßen. Der Gouverneur von Dschibuti leistete dieser Legende ganz bewusst Vorschub, indem er vorgab, Ato Joseph wie einen Botschafter zu behandeln.
In dieser privilegierten Situation kamen die Talente von Ato Joseph so richtig zur Geltung. Er besorgte sich eine Anzahl Stempel und wurde zum König des Waffenschmuggels. Gegen Gebühr versah er jedes Schiffspapier mit dem entsprechenden Stempelaufdruck. Das verschaffte der Sache etwas Reguläres, und es ist ja bekannt, wie sehr die Engländer auf die »Formen« achten.
Der Gouverneur von Dschibuti begriff, wie sehr es in seinem Interesse lag, mit diesem Individuum zu kooperieren, dessen Fantasie-Genehmigungen dem lukrativen Handel von Französisch-Somaliland einen willkommenen legalen Anstrich verliehen.
Ato Joseph war Vertreter eines freien Staates und somit am Kauf von Waffen nicht zu hindern. Bald ging der Großteil des Geschäfts durch seine Hände. Die Ware wurde nach Tadschura geschickt, und was dort damit geschah, kümmerte niemanden. Man galt dafür nicht verantwortlich, denn Tadschura war von den Franzosen nicht besetzt.
Die Gouverneure rieten von jeglicher Intervention in der Stadt ab, die sie in ihren Berichten als regelrechtes Schreckgespenst darstellten.
Tadschura musste frei bleiben, damit die Schiebereien dort sich ohne jede Kontrolle vollzogen. Den Finanzen der Kolonie kamen die Machenschaften von Ato Joseph mehr als zugute.
Als ich in meinem jugendlichen Leichtsinn beschloss, meinerseits im Roten Meer Waffen zu schmuggeln, und zwar ohne Ato Joseph einen Tribut zu entrichten, geriet ich in arge Schwierigkeiten.
Auf einen Schlag zog ich mir die Feindschaft sowohl der französischen Verwaltung der Somaliküste als auch die von Ato Joseph zu, dessen geheime Macht nicht die ungefährlichere war.
Die französische Verwaltung verfügte über ein Kanonenboot und die schier unendlichen Ressourcen ihrer bürokratischen Mühlen. Ato Joseph besaß eine richtige Flotte und zahllose Spitzel.
Ich dagegen hatte nichts weiter als eine Dhau, eines jener kleinen Segelschiffe, wie Perlenfischer im Roten Meer sie benützen. Doch war ich jung und steckte voller Illusionen.
Für die Dhau, die ich von einem einheimischen Kapitän erworben hatte, waren meine gesamten Ersparnisse draufgegangen. Meine frühe Jugend am Cap Leucate und später das Segeln auf dem Boot meines Vaters hatten in meinem Herzen eine Sehnsucht nach dem Meer geweckt, der zuliebe ich die verheißungsvollsten Stellungen aufgab. Der Ruf des Meeres bewirkte schließlich, dass ich mich ins Abenteuer stürzte.
Bald hatte ich eine solide kleine Mannschaft beisammen: die beiden somalischen Matrosen Ahmed und Abdi und den winzigen Schiffsjungen Fara.
Mit recht bescheidenen Mitteln trat ich meine Karriere als Seebär an.
Einige Monate lang lernte ich das Perlenfischen und betrieb ein wenig Schifffahrt vor der Somaliküste.
Dann widerfuhr mir das erste Erlebnis, das einer Erzählung wert ist.
1
Cheik Saïd
Nach einer unerfreulichen Aussprache trete ich aus dem Büro meines Chefs, der mich, flankiert von seinem Prokuristen, wegen meines mangelnden Interesses für den Leder- und Kaffee-Handel mit Vorwürfen nur so überschüttet hat. Ich bin noch immer schweißgebadet, saß ich doch nicht unter dem wohltuenden Ventilator, der mit seinem friedlichen Rhythmus die donnernde Flut der berechtigten Tadel unterlegte. Als da wären: Missstände in der Buchhaltung, Fehlbestände im Lager, weil ich die Wareneingänge zu lasch kontrolliert habe, und das alles nur wegen der Fahrten auf der verfluchten Dhau, die ich erst kürzlich erstanden habe.
Im Wissen um den vertrauten Umgang, den Gouverneur Pascal mit meinem Chef pflegt, ist mir klar, dass Letzterer obrigerseits in die Pflicht genommen wurde und hinter der Suada gegen meine Nachlässigkeit nichts weiter als der Versuch steckt, mich von meinen Meeresabenteuern abzubringen.
Ich gehe zu meinem Boot, um mich von der unerquicklichen Szene zu erholen und jenes Joch abzuschütteln, das ich immer schwerer auf mir lasten fühle, das unerbittliche Joch nämlich, das jeder trägt, der sich einiges Ansehen in der Welt des Kolonialwarenhandels verschaffen will, wo das System der Dokumentenwechsel herrscht, eine Art Finanzakrobatik, ein stetes Balancieren zwischen Konkurs und Strafkammer.
Es ist Ebbe, und mein Schiffchen liegt auf dem vom ablaufenden Wasser bloßgelegten, feuchten Sand. Ahmed und Abdi schlafen selig im Schatten des Rumpfes, von der Meeresbrise gewiegt.
Das bis zur steil abfallenden Riffkante zurückgezogene Meer erfüllt die helle Luft mit seinem Rauschen. Es scheint die Stimme des weißen Schaums zu sein, der das tiefe Blau des alterslosen Ozeans in alle Ewigkeiten krönt.
Ich setze mich unter den Bauch des Schiffes. Tiefe Abscheu überkommt mich beim Gedanken an das dunkle Büro, in dem sich die Angestellten im Mief von Naphthalin und grünem Leder umtriebig geben.
Was soll ich mich zu einem Leben zwingen, das mir zum Zuchthaus wird? Warum nicht der Verlockung des blauen Horizonts erliegen, dahin fahren, wohin der Monsun mich treibt, den kleinen weißen Segeln folgen, die ich Tag für Tag im geheimnisvollen Roten Meer verschwinden sehe? Wozu mir eine Zukunft als guter Kaufmann erhoffen, wenn ich ein solcher doch niemals werden kann?
Mein Entschluss ist gefasst: Ich werde kündigen.
Da ich mir ein Hotel nicht leisten kann, ziehe ich zusammen mit meiner Mannschaft auf die Dhau.
Zunächst werde ich es mit dem Perlenfischen versuchen, denn zum Kauf von Waffen fehlt mir das Geld.
Cheik Saïd beherrscht das Tagesgespräch. Ein Journalist ist eingetroffen, um eine Reportage über dieses kleine Territorium zu schreiben, das der Foncin-Atlas meiner Kindheit in Rosa markierte, der Farbe der französischen Besitzungen.
Der Journalist kommt zu mir und sagt, er finde keine Dhau, die ihn nach Cheik Saïd hinüberfahre.
Mich überrascht das nicht. Ich begreife sehr wohl, warum kein nacouda es auf sich nehmen will, diesen gestiefelten, behelmten und in kompletter Forscherkluft ausstaffierten Pariser an Bord zu haben.
»Sie möchten also unbedingt dorthin?«, frage ich.
»Ganz gewiss.«
»Dann lassen Sie die Stiefel, den Helm und den anderen Kram lieber weg. Gehen Sie in die Sonne, bis Sie von akzeptabler Hautfarbe sind, und laufen Sie dabei barfuß herum, auf dem Schotter am Bahngleis, so gewöhnen Sie sich daran, auf Kieseln zu marschieren. Dann können Sie in Cheik Saïd an Land gehen, ohne Furcht, dort Ihr Leben zu lassen. Und vor allem finden Sie vielleicht einen nacouda, der Sie hinüberbringt.«
»Der Gouverneur hat mich in der Hoffnung gewiegt, Sie selbst könnten dies tun.«
»Mit Vergnügen, aber nur unter den genannten Bedingungen.«
Am Tag darauf verkündet mir der Journalist, er besteige lieber das Postschiff aus China; so werde er Cheik Saïd im Vorbeifahren sehen, wie schon auf der Herfahrt, doch nun in umgekehrter Richtung, und er werde die Richtigkeit seiner zuvorigen Beobachtungen überprüfen können.
Der Gouverneur bestellt mich zu sich. Der furchtbare Pascal ist zurück nach Frankreich, in den Ruhestand. Noch sehnt sich keiner nach ihm zurück, denn mit seinen Nachfolgern hat man ihn noch nicht vergleichen können, und die Auswirkungen seiner energischen, ja despotischen Politik sind noch nicht in Erscheinung getreten. Trotz der Behandlung, die er mir hat angedeihen lassen, muss ich zugeben, dass er Dschibuti zu neuem Antrieb verholfen hat. Er war ein intelligenter, tatkräftiger Mann, der sich nicht scheute, Verantwortung zu übernehmen.
Sein unmittelbarer Nachfolger entstammt nicht dem Kolonialdienst, sondern ist Präfekt gewesen. Er neigt dazu, erst einmal jenen Gunst zu erweisen, die zuvor in Ungnade waren, und diese ausgleichende Gerechtigkeit kommt auch mir zugute.
Klein, soigniert, Monokel, weißer Spitzbart, ganz Mann von Welt, in jener besonderen Spielart, wie sie hochrangigen Beamten eigen ist, Diplomaten, kurzum allen, deren Höflichkeit nicht mehr als liebliche Maske ist.
Seine Stimme ist sanft, sein Reden dezent, stets eingeschränkt und nuanciert durch ein »vielleicht« und »es mag wohl sein«.
Was für ein vornehmer Mensch im Vergleich zu dem polternden Pascal, der den Helm, den ein »Untertan« auf seinem heiligen Mahagoni-Schreibtisch abzulegen sich erfrechte, wütend zertrampelte.
»Ich vernehme, Sie hätten die Absicht, aufs Rote Meer hinauszufahren, mit einer Dhau, so wie die Einheimischen. Ein interessantes Unterfangen, möchte ich meinen. Was haben Sie unterwegs so vor?«
Ich erkläre.
»Sagen Sie mal, dann kommen Sie doch an Cheik Saïd vorbei. Davon ist derzeit viel die Rede. Vielleicht waren Sie ja schon dort? Noch nicht? Dann mag es Sie doch reizen, dieses Fleckchen Erde, das eigentlich französisch sein sollte, einmal näher in Augenschein zu nehmen? Es würde mich außerordentlich freuen, bei Ihrer Rückkehr von Ihren Eindrücken zu hören. Dieser Journalist, Monsieur X…, hat mir davon berichtet, doch recht vage, wie mir scheint, denn seine Untersuchungen mögen wohl etwas zu oberflächlich gewesen sein … Sehen Sie das bitte nicht als Verpflichtung an … Nicht das geringste Risiko sollen Sie eingehen, nur damit ein Amateurgeograf seine Neugier befriedigen kann. Ich wäre untröstlich, sollte das harmlose Steckenpferd eines alten Beamten Sie ungewollt in ein fatales oder auch nur bedauerliches Abenteuer hineinziehen … Was mich interessiert? Ach Gott, dieses und jenes … Der Zauber der Sonnenuntergänge über dem Bab el-Mandeb gewissermaßen … Und ansonsten … Was taugt wohl dieses Gebiet, im Vergleich zu Perim? Würde es unsere Nachbarn in Aden empfindlich stören, wenn wir uns dort niederließen? … Es heißt, die Türken unterhielten dort eine Garnison. Ich wäre entzückt, wenn Sie ein paar Fotos machen könnten, denn Ansichtskarten werden Sie wohl keine bekommen …«
Eine Stunde lang bekomme ich sehr genaue Anweisungen, und ich begreife, dass doch mehr auf dem Spiel steht als nur die Grille eines alten Beamten.
Diese halb offizielle Mission bewegt mich dazu, schon früher ins Land der Perlen aufzubrechen. Ich heuere drei weitere Somalier an, sodass ich über fünf Mann Besatzung verfüge.
Es ist zehn Uhr morgens. Unter strahlendem Himmel und bei frischer Meeresbrise stechen wir in See. Mein Freund Lavigne steht an der Mole und blickt mir nach. Dem guten Jungen stehen Tränen in den Augen, und er verlegt sich aufs Scherzen, um seine Trauer zu verbergen. Er wird in sein Handelshaus zurückkehren, das gleichfalls in Kaffee und Leder macht, aber viel hat nicht gefehlt, und er hätte alles liegen und stehen lassen und wäre mitgekommen.
In einer Lagune der Musha-Inseln habe ich Kisten zurückgelassen, in denen ich an Perlenaustern, den sadaf, mit der sogenannten japanischen Perlenzucht experimentiere. Nun will ich diesen Inseln einen Besuch abstatten und meine Zucht begutachten.
Unsere Route führt uns aufs hohe Meer hinaus. Dschibuti ist nur noch eine Ansammlung weißer Flecken entlang der Flachküste. Weithin dominiert das violette Massiv der Danakil-Berge mit seinen hoch aufragenden Basalttafeln. In der Ferne umgeben die Rundgipfel des Mabla-Gebirges den wie ein einsamer Riese dastehenden Goda-Berg.
Querab liegt als dünne gelbe Linie die Insel Musha im Meer. Darauf sitzt wie eine Möwe auf einem Stück Treibholz der weiße Fleck ihres Leuchtturms. Wir halsen und segeln auf Steuerbordbug das kleine Stück Land an. Von grünen Sandbänken glänzt es smaragden herauf, und unter der nun sehr frischen Brise fliegt die Sahala bald über Korallenriffe hinweg.
Es ist mir eine Freude, diese Unterwasserwelt zu betrachten, die im glasklaren Wasser von der Sonne gebadet wird. Dort unten liegen all die Schätze, für die ich mich aufs Meer gemacht habe!
Aus der blauen Tiefe tauchen ab und an Felsenkuppeln auf wie unwirkliche Kathedralen, und Myriaden bunt gestreifter Fische schwärmen gleich Traumvögeln um sie herum.
Diese gefährlichen Korallenanhäufungen – man nimmt sie als gelbe oder violette Flecken wahr – gilt es zu umfahren. Je näher wir der Insel kommen, desto enger wird das Labyrinth. Bei Nacht oder Gegenlicht wäre ein Navigieren unmöglich.
Vor der Insel Musha ankern wir in weißem Sand. Durch das Spiel des Lichts schimmert das Meer so grün wie reiner Smaragd. Die flache, simsartig geschnittene Insel bildet dort einen kleinen, schneeweißen Strand.
Der Leuchtturmwärter kommt uns entgegen, gefolgt von einer nackten Kinderschar, die in Freiheit und Licht munter herumtollt.
Der Mann ist ein Dankali namens Burhan. Ich habe ihn beauftragt, in meiner Abwesenheit über meine Austernkisten zu wachen. Seit fünfundzwanzig Jahren ist er hier im Dienst der Verwaltung tätig, mit zwei Gehilfen, ebenfalls Dankalis. Er verdient zwölf Francs im Monat, doch ist er über diese verbrannte Insel Herr und Gebieter. Eine Ziegenherde schafft es, dort zu überleben, indem sie sich von spärlichem Gras und Mangrovenblättern nährt. Jede Woche fährt Burhan mit einer kleinen Dhau nach Dschibuti und holt für die Seinen Wasser. Tagsüber ist er mit Fischfang beschäftigt, nachts mit Vermehrung, denn er hat drei Frauen. Sie haben ihm an die zwölf, fünfzehn Kinder geschenkt, die zwischen ein und zwanzig Jahren alt sind.
Das Inselinnere umfasst eine große Lagune, an der Mangroven mit dunklem Blattwerk gedeihen. Unter der Wölbung dieser Wasserpflanzen verschlaufen sich gewundene Kanäle in einem undurchdringlichen Wald, der sich auf die bizarren Bögen der roten Wurzeln stützt. Die Luft ist vom Vanilleduft der Mangroven erfüllt, und die grüne Landschaft, in der sich nur das Meeresleben regt, hüllt sich in geheimnisvolles Schweigen.
Als wir vorbeigehen, laufen große braune Krabben über die krummen Stämme und lassen sich geräuschvoll ins schwarze Wasser plumpsen. Aus Schattenlöchern zwischen den Bögen der Luftwurzeln tönt es seltsam schnalzend heraus: Das ist das geheimnisvolle Werk der Seegurken, die im feuchten Sand wühlen, sobald das Meer sich zurückzieht.
Hinter einer Biegung tut sich eine Art Lichtung vor uns auf, wie ein Wasserspiegel, und flatternd und zeternd fliegt ein Schwarm Seidenreiher auf.
Zur Nacht kehre ich an Bord zurück. Es ist Vollmond. Das große rote Rund steht über ruhigem Meer, denn der Monsun hat sich gelegt. Die um die Insel laufende Riffbank ragt nun teilweise aus dem Wasser. Weit draußen hört man das Meer an der Riffkante grollen, und sachte bläst eine laue Brise Algengeruch heran.
Von der großen flachen Insel, deren Strände im Mondlicht glänzen, steigt der durchdringende Laut der erst abends wach werdenden Sandgrillen auf. Sanft schlägt die Brandung an den Strand, in langen Abständen, wie die Atmung all der Dinge, die hier schlafen.
Während langsam die Sterne über mich hinwegziehen, denke ich an all das Unbekannte, zu dem ich aufbreche …
Allmählich steigt der Meeresspiegel wieder an. Der Mond im Zenit leuchtet den Korallenboden bestürzend deutlich aus. Es ist Zeit, in See zu stechen.
Mit dem Bootshaken verholen wir uns aus dem Riff, dann geht es bei frischer Südbrise in das schwarze Wasser der hohen See.
Bei Tagesanbruch ist backbord der gelbe Sporn von Ras Bir zu sehen. Um die Landbrisen auszunützen, fahren wir die Danakil-Küste entlang. Schließlich kommt der Monsun auf, und wir segeln raumschots in Richtung Bab el-Mandeb.
Gegen neun Uhr taucht Perim auf, das wie ein gewaltiger Lurch quer in der Meerenge liegt; dahinter wirkt der Bergkegel von Cheik Saïd wie eine Insel.
Perim teilt die Meerenge in zwei Fahrrinnen, eine große, etwa zehn Seemeilen breite auf der afrikanischen Seite, bei Ras Syan, und eine kleine, kaum zwei Seemeilen breite auf der arabischen Seite, bei Cheik Saïd. Die große Fahrrinne wird von Schiffen zur Durchfahrt ins Rote Meer benutzt, die kleine nur von Fischerbooten und von den zaroug der Tabakschmuggler. Um an den Strand von Cheik Saïd zu gelangen, entscheide ich mich für die kleine.
Sie gilt als gefährlich, wegen der starken Strömungen, die dort je nach Tide in der einen oder anderen Richtung herrschen. Ich weiß nicht, was gerade für eine Strömung vorliegt, doch scheint mir der Wind, den wir im Rücken haben, stark genug, dass wir uns nicht sorgen müssen. Etwas unwohl ist mir nur bei dem Gedanken, dass Bab el-Mandeb »Tor der Tränen« bedeutet.
Die südliche Einfahrt in die Rinne ist relativ breit. Zur Rechten ragen die Lavasäulen von Cheik Saïd direkt aus dem Meer empor, ohne jegliche Küste, auf die man einen Fuß setzen könnte.
Die Wellen, die der Monsun von Indien herangetrieben hat, brechen gegen diese schwarzen Felsen, die immer wieder aus dem wilden Geschäume herausragen, wie ewig Gemarterte.
Der Wind wird heftiger, und die tosenden Wellen scheinen gegen die Strömung zu prallen, die nun aus der Fahrrinne herausdrängt.
Für einen Kurswechsel ist es zu spät; ein derartiger Wind lässt kein Manöver zu.
Unvorsichtigerweise habe ich mein Großsegel quer zur Schiffsachse auf seiner schweren Lateinerrute entfaltet gelassen. Unmöglich, es jetzt bei der entfesselten See hinter uns einzuholen. Wir dürfen unsere Fahrt nicht verlangsamen, da die fast senkrecht aufsteigenden Wellen sonst von hinten über uns hereinbrechen.
Lieber alles auf eine Karte setzen. Hält die Takelage, sind wir gerettet. So rasen wir in das Chaos hinein, nur wenige Kabellängen von der umtosten Felsküste entfernt. Abdi, der auf dem Vorschiff kauert, ruft plötzlich etwas, was ich nicht verstehe, und deutet in Fahrrichtung.
Da sehe ich auf dem Meer lauter Wasserkegel hochschießen und wieder zusammenfallen. Schaumgekrönte, zerzauste Wellen drehen sich wild im Kreis: Die vom Wind zurückgedrängten Strömungswirbel bilden eine Art Strudel. Zwischen diesem und der Küste entdecke ich in einer halben Kabellänge eine ruhigere Zone, doch auch dort winden und bäumen sich schnelle Strömungswulste wie furchterregende Echsen.
Auf die Gefahr hin, an die Felsen geschleudert zu werden, steuere ich jene Zone an.
Da dreht das Schiff sich auf einmal, so mächtig zerren die entfesselten Kräfte daran. Ahmed stürzt sich an den Segelhals, damit das Schiff nicht halst, denn sonst würden wir unweigerlich kentern. Während er und Abdi sich in die Leinen hängen, treibt die Dhau in den Strudel hinein, und eine mächtige Welle geht auf unserem Hinterschiff nieder und schwemmt alles von Bord. Selbst das wild flatternde Segel wird fortgerissen. Da gellt ein Schrei durch den Tumult, und eine dunkle Gestalt treibt längsseits im Meeresgewühl. Es ist Ahmed, der von Bord gespült wurde. Ich werfe eine Rolle Tau ins Wasser, die das Schiff hinter sich herzieht, dann denke ich nur noch ans Steuern, um die fürchterlichen Wellen, die nun schneller dahinrasen als wir, hinter unserem Heck zu lassen. Das Großsegel wurde zum Glück weggerissen. Abdi schafft es, einen Fetzen Tuch als Sturmsegel zu setzen. So können wir weiter steuern und gegen die Strömung halten. Doch drohen wir zu sinken, denn das Schiff ist halb voller Wasser. Noch eine Sturzwelle, und wir gehen auf Grund! Ich drehe mich um und sehe, wie Ahmed sich an dem Tau festklammert. Mühevoll hangelt er sich vor, bis wir ihn wie einen geangelten Fisch an Bord hieven. Ohne zu lamentieren, macht er sich sofort ans Wasserschöpfen.
Da sind wir über die gefährliche Zone, wo Strömung, Wellen und Wind aufeinanderprallten, plötzlich hinaus. Das Meer beruhigt sich. Wir sind gerettet …
Ich verspüre auf einmal das Bedürfnis, einer überirdischen Macht zu danken, die geruht hat, mich nicht zu vernichten. Das Dankgebet entspringt vielleicht den Jahren jugendlicher Frömmigkeit, oder fetischistischem Atavismus aus der Zeit des ersten Menschenentwurfs. Unsere christlichen Matrosen haben in ihren Seesäcken Madonnen versteckt, und selbst die rauesten Gesellen legen in der Stunde der Gefahr ein Gelübde ab.
Die Muslime dagegen schicken sich in ihr Los, wissen sie doch, dass Allah allmächtig und so groß ist, dass er seine Meinung nicht ändern wird. Was geschehen muss, steht schon geschrieben, und wenn Allah seine Geschöpfe rettet, dann nur, weil es ihm so gefällt. So gilt es ihm auch nicht zu danken. Um aber einen Menschen für sich zu gewinnen, kann auch Allah Wunder tun. Den kleinen Zwischenfall und die Angst, die uns danach noch in den Knochen steckt, nehme ich zum Anlass, um meinen Leuten zu verkünden, dass ich in dem Augenblick, in dem ich dachte, das Schiff werde kentern, gelobt habe, Muslim zu werden, sollte ich denn überleben. Augenblicklich hatte eine geheimnisvolle Kraft uns aus dem Strudel befreit. Das war das Wunder.
So war es also wundersamen Umständen zu verdanken, dass ich den muslimischen Glauben und den Namen Abd el-Haï annahm.
Dem Vorhof zur Hölle entronnen, sehen wir uns an und können kaum glauben, dass wir noch leben. Der winzige Schiffsjunge ist auch noch da. Ich weiß nicht, wo er sich während des kurzen Sturmes verkrochen hat. Unsere Vorräte sind völlig durchnässt. Das in den Augen der Somalier wertvollste Gut, der Zucker nämlich, hat sich als Sirup davongestohlen. Übrig ist nur noch ein klebriger Sack, den wir bestürzt anstarren. Einzig die Tasche mit den Datteln hat überlebt; diese Wüstenfrucht hält alles aus. Der Trinkwasserkanister ist noch immer voll, allerdings nun mit Salzwasser.
Wir liegen vor Cheik Saïd, geschützt vor der schweren See, die durch die Passage hereindrängt, doch der Wind pfeift böenartig ins Mastwerk. Der Abend bricht herein, aber es kommt mir nicht in den Sinn, an Land zu gehen. Ich verzehre ein paar Datteln und gebe mich der Glückseligkeit eines sicheren Ankerplatzes hin, denke an das Wetter draußen und an all jene, die dort mit Wind und Wellen kämpfen.
Trotz unserer Müdigkeit hält immer einer Wache, denn die Küste genießt einen höchst schlechten Ruf. Ich habe keine Kette, sondern nur eine Ankerleine aus Kokosfaser.
Ein paar Stunden vor Sonnenaufgang weckt Ahmed mich behutsam auf. Er zeigt mir, in etwa einer Kabellänge Entfernung, einen vagen Schemen, der eine große Piroge sein könnte. Mit dem Fernglas mache ich tatsächlich einen zaroug mit umgelegtem Mast aus, auf dem Männer bedachtsam paddeln. Ich halte ihn für ein Fischerboot, das sich zum Ablegen anschickt, und die Furcht meiner Somalier scheint mir übertrieben. Dennoch ist das Manöver etwas seltsam. Plötzlich drückt Abdi meinen Arm, und ich sehe, wie sich etwa zwanzig Meter vor uns in der Achse des Schiffs ein schwarzer Punkt in phosphoreszierenden Kreisen lautlos auf uns zubewegt. Es ist ein vorsichtig schwimmender Mann. Da fällt mir auf, dass sich unser Schiff durch die von der Strömung bewirkten Strudel um den Anker dreht und mit dem Heck auf die Riffspitze zutreibt, die den Ankerplatz vor dem Wind schützt. Sollte unsere Ankerleine reißen, würde die Strömung uns innerhalb weniger Minuten auf das Riff befördern. Nun wird mir klar, was der leise Schwimmer bezweckt: Da er uns im gefährlichen Schlaf der frühen Morgenstunden wähnt, will er die Leine zerschneiden und unser Schiff zerschellen lassen. Aus einem ersten Antrieb heraus würde ich den Kerl am liebsten mit einer Kugel auf den Meeresboden schicken, doch scheint es mir im Hinblick auf unsere morgige Expedition nicht ratsam, Aufsehen zu erregen. So richte ich mich auf und rufe: »Wer da?« Augenblicklich taucht der Mann unter und lässt im Mondenschein nur einen kleinen Strudel zurück. Erst an die fünfzig Meter weiter kommt er zum Vorschein, verschwindet wieder und wird von der Nacht verschluckt. Kein Laut hat seine unterseeische Flucht verraten.
Als der Tag anbricht, ist am Horizont kein Boot zu sehen, und mir ist, als hätte ich geträumt.
Nun gilt es, an Land zu gehen. Ich habe einen Steilstrand vor mir, eine Art Sandböschung entlang der Küste. Hinter einem Einschnitt lässt sich eine Bucht vermuten; jenseits des natürlichen Walls sieht man gerade noch die Spitzen einiger Rundhütten. Aufgrund der schweren See, die in die Meerenge drückt, ist die Brandung sehr stark und gefährlich, und in einem houri, wie man hier die kleinen, als Beiboote benutzten Pirogen nennt, schafft man es kaum an Land, ohne dass die Wellen über einen hereinbrechen. Daher sorge ich mich um meinen Fotoapparat, den ich unbedingt mitnehmen möchte. Da kommt mir der Gedanke, ihn in einer tanika zu verstauen, einem Wasserbehälter. Ich schicke einen Mann mit der kostbaren Fracht los. Er wird zwar von einer Woge erfasst, doch sehe ich, dass er die tanika noch immer über dem Kopf trägt. Schließlich schafft er es durch die Brandung und erreicht den Strand. Zusammen mit Abdi gehe nun auch ich an Land; Ahmed und den Rest der Besatzung lasse ich an Bord. Die Piroge muss in Strandnähe bleiben, damit wir uns schnell davonmachen können. Ahmed, ein guter Schütze, bekommt von mir den Auftrag, auf jeden zu schießen, der sich ihm in unserer Abwesenheit nähern sollte.
Ich trage nichts weiter als einen Lendenschurz. Das Gewehr nach Einheimischenart geschultert, gehen wir den Strand entlang.
Nur wenige Meter vom Ufer liegt das Grabmal des Scheichs, von dem die Gegend ihren Namen hat. Ein Gürtel räudigen Gestrüpps umfasst einen aus Steinen geformten Kreis, in dessen Mitte auf einem irdenen Teller noch die Kohle liegt, auf der Weihrauch verbrannt wurde. Ein roter Stofffetzen flattert im Wind und scheint diesem einsamen Fleck übernatürliches Leben einzuhauchen. Was das Meer an Wrackteilen an Land wirft, wird von den seltenen Besuchern dieses verlassenen Strandes als Gabe hierhergeschafft.
Abdi wirft sich nieder und rezitiert die Fatiha. Windböen blasen Sand über die reglosen Wellen des makellos geriffelten Strands. Inmitten all der verbleichten Wrackstücke, die ihre Geschichte längst vergessen haben, knattert in rotem Glanze die kleine Fahne.
Als die religiösen Pflichten erfüllt sind, erkunden wir den oberen Teil der Nehrung. Da sehe ich die Bucht von Cheik Saïd vor mir. Es ist ein großes Becken von etwa vier- bis fünfhundert Metern Durchmesser, das durch eine schmale, seichte Fahrrinne mit dem Meer verbunden ist. In dem kleinen, von ein paar Stroh- und Schilfhütten umstandenen Naturhafen liegen zahlreiche Fischerboote.
Drei Eingeborene kommen auf uns zu. Es sind Fischer, Zaranig-Araber, prächtige Burschen. Sie tragen einen sehr kurzen Lendenschurz, Oberkörper und Beine sind nackt, die Körper von schöner kupferner Farbe, und ihre langen schwarzen Haare fallen ihnen lockig auf die Schultern. Ihre Gesichtszüge sind bewundernswert fein und regelmäßig, die Augen schwarz und schmal. Auf Fischjagd gehen sie mit einem Wurfnetz, das sie anmutig in den Wind schleudern. Ihre bevorzugte Beute sind arabi genannte barschartige Fische. Diese beißen sie jeweils tot und fädeln sie mit einer Holznadel durch die Augen auf eine Schnur, die sie im Wasser hinter sich herziehen.
Ich kaufe ihnen Fisch ab und gebe ihnen ein paar Patronen dafür. Im Sand kauernd, kitzle ich aus ihnen heraus, was mich interessiert. Sie zeigen auf den Berg, auf dem das türkische Fort steht, das nur auf einem Ziegenpfad zu erreichen ist. Hundertzwanzig Mann seien dort stationiert, die jeden Monat abgelöst würden.
Dann besichtige ich die Ruinen der französischen Faktorei Rabaud, die 1885 im Hinblick auf die Öffnung der Meerenge von Sues eröffnet wurde. Rabaud, ein Marseiller Händler, hatte die Konzession für das gesamte Gebiet erstanden, und so hätten wir dort die französische Fahne hissen können. Nichts dergleichen geschah aber. Rabaud wurde durch den Siebziger Krieg ruiniert, seine Faktorei wurde aufgegeben und verfiel. Daraufhin besetzten die Türken den Berg von Cheik Saïd.
Das Fort ist über eine Telegrafenleitung mit Mokka verbunden. An einigen Masten hängt der Eisendraht noch in der Luft, meist aber schleift er durch den Sand. Dennoch scheint die Leitung zu funktionieren.
Ich nehme ein paar Bilder auf und skizziere einen Plan, der den Zugang zum Fort darstellt.
Man erzählt mir auch vom Sklavenhandel, für den die Bucht von Cheik Saïd zu manchen Jahreszeiten ein Anlaufpunkt sei. Ähnlich verhalte es sich mit Waffen aus Dschibuti. Die Türken versuchten diesen Handel in keiner Weise zu unterbinden, veranstalteten aber ab und an einträgliche Razzien. Sie würden von den Arabern nicht geliebt, sondern nur geduldet, wie Schmarotzer. So kann ich nun dem Gouverneur doch einiges berichten. Ich erachte meine Mission für beendet und gedenke, ein wenig einzukaufen, um meine abgesoffenen Vorräte zu ersetzen. Ich betrete eine Hütte, in der ein schmutziger Araber Reis, Salz und andere Grundnahrungsmittel verkauft.
Da eilt Abdi herbei, der draußen geblieben war, und meldet, dass türkische Soldaten den Berg herunterkommen.
Ich lasse meine Einkäufe liegen, und wir laufen zu unserer Piroge. Die türkische Patrouille kommt im Laufschritt auf uns zu. Zweifellos sollen wir näher begutachtet und gegebenenfalls festgenommen werden. Wir springen in die Piroge. Ahmed an Bord der Dhau hat alles gesehen und bemüht sich, den Anker zu hieven. Gerade als die Patrouille den Strand erreicht, steigen wir an Bord. Die Soldaten scheinen sich zu besprechen und winken herüber, was wir als den Befehl deuten, wieder an Land zu kommen. Ich bin darauf gefasst, dass sie auf uns schießen. Für alle Fälle hisse ich unsere Flagge, ziehe aber auch schon den Anker hoch.
Ich hatte die Lateinerrute mit dem eingerollten, nur von ein paar Bastschnüren festgehaltenen Segel oben gelassen. Ein kurzer Ruck an der Schot, und das Segel entfaltet sich. Es ist zwar nur unser Sturmsegel, das kleiner ist als das im Bab el-Mandeb verlorene Großsegel, doch bei dem starken Wind kommen wir gut voran. Bald ist der Strand von Cheik Saïd verschwunden.
Draußen herrscht schlechtes Wetter, der Monsun weht mit einer steifen Brise, und die See ist sehr grob. Zum Glück segeln wir vor dem Wind.
Ich bin mit Süßem übersättigt, da ich nur noch Datteln habe, und nichts, um Durrabrot zu backen. Am besten, ich steuere Mokka an, wo ich bestimmt Vorräte bekomme. Die Nachricht von unserer Expedition nach Cheik Saïd kann noch nicht bis dorthin gedrungen sein, falls sie die Türken überhaupt beunruhigt haben sollte.
So segle ich also die arabische Küste entlang und sehe immer wieder vereinzelte Palmenhaine oder den hellgrünen Teppich eines Durrafelds. Manchmal liegen weiße zaroug auf dem Strand. In diesen kleinen, über die Küste zwischen Dubab und Al-Hudaida verteilten Dörfern wohnen Zaranig. Diese Gelegenheitspiraten betreiben Fischfang und das Dörren von Fisch. Auch der Tabakschmuggel gehört zu ihren zahlreichen Einkommensquellen, neben dem Transport von Sklavenkonvois von einem Ufer zum anderen. Bei dieser letzten und einträglichsten Art von Handel sind sie mit ihren lang gezogenen, leichten Booten kaum zu erwischen.
Und so gehen sie vor. Sie fischen an der afrikanischen Küste an einem zuvor mit dem nagadi, dem Karawanenleiter, verabredeten Ort, in der Regel zwischen Syan und Baheita. Ein Riffeinschnitt genügt, um sie vor dem heftigen Südwind zu schützen, dem die Gegend ein halbes Jahr lang, von Oktober bis März, ausgesetzt ist. Die zaroug wird mit umgelegtem Mast auf den Strand gezogen, dann fischen die Leute in aller Seelenruhe, trocknen ihren Fang und bauen sich eine Behelfshütte, indem sie ihr Segel auf Spieren ausbreiten. Die für die Versorgung der menschlichen Ladung nötigen Vorräte an Nahrung und Trinkwasser vergraben sie vorsichtshalber im Sand. Bei Leuten, die von Muscheln und gegrilltem Fisch leben, würde so viel Proviant nämlich verdächtig wirken und den Neid anderer Fischer hervorrufen, deren Schweigen dann erkauft werden müsste. Die Patrouillen und die braven Küstenwächter können nicht erahnen, was das friedliche Fischerboot, das so vielen anderen gleicht, in Wahrheit für Absichten hat.
Wenn die Karawane aus dem Landesinneren eintrifft, verbleibt sie zunächst in den Bergen, etwa fünf, sechs Stunden Fußmarsch entfernt, und nur ein Mann wird an die Küste geschickt. Schließlich zieht die Karawane los, um gegen neun Uhr abends am Meer zu sein. An jenem Tag holen die vermeintlichen Fischer die Fässer mit dem Trinkwasser aus dem Sand, denn die Sklaven werden durstig sein, und sie machen ihre Barke flott. Bei Sonnenuntergang beobachten sie von einer Erhöhung aus das Meer und die Umgegend; ist nichts Verdächtiges auszumachen und keine Patrouille in Sicht, so ist die Nacht ihnen günstig. Dann wird ein großes Feuer angezündet, als wollte man das Abendessen zubereiten. Irgendwo in den Bergen gibt ein zweites Feuer Antwort. Bald danach tritt ein leiser Trupp aus dem Schatten. Es sind die Sklaven, begleitet von einigen Askaris, abessinischen Soldaten des nagadi. Die restlichen Askaris haben an zwei Stellen entlang der Küste Posten bezogen, um nicht doch von einer Patrouille überrascht zu werden, was im Übrigen höchst unwahrscheinlich wäre. Wer unseligerweise in jenem Moment dort aufkreuzte, würde augenblicklich erschossen, ohne den Hauch einer Chance, sich zu verteidigen, denn jene nächtens im Gestrüpp ausgestreckten erdfarbenen Männer sind absolut unsichtbar.
Innerhalb weniger Minuten ist der meist fünfundzwanzig- bis dreißigköpfige Trupp an Bord. Die Leute werden auf dem Boden der zaroug zusammengepfercht, und man breitet ein Segel über sie. Der Südwind, der fast immer stürmisch weht, lässt das leichte Boot raumschots dahinschießen, während die gesamte Besatzung auf der Windseite in den Wanten hängt, um der Krängung entgegenzuwirken. Bei solcher Geschwindigkeit ist das Rote Meer, an jener Stelle kaum fünfzehn Seemeilen breit, in weniger als zwei Stunden überquert. Wie sollte ein Boot, das in einsamer Nacht durchs aufgewühlte Meer schießt, je von einer Patrouille aufgebracht werden? Viele Sklaven erinnern sich auf der Arabischen Halbinsel nicht einmal, das Meer gesehen zu haben, so rasch war die nächtliche Überfahrt.
Aber lassen wir nun die Sklaven, von denen ich noch berichten werde, und kommen wir zu meiner eigenen Fahrt zurück.
Gegen Abend sehe ich am Horizont die hohe Säule des Leuchtturms von Mokka, und später erscheint der Sandstreifen, auf dem sie steht. Dahinter die Stadt Mokka, eine Masse weißer Häuser, zwischen denen grazile Minarette aufragen.
Mokka! Ruhmreicher Name, einem Kaffee verliehen wie ein Adelstitel; endlich habe ich die imponierende Stadt vor mir.
Ich sehe mehrstöckige Häuser im arabischen Stil, die Fassaden von Muscharabie durchsetzt. Ob sich wohl hinter den gedrechselten Holzgittern laszive Frauen räkeln?
Hohe, von Bastionen flankierte Mauern verteidigen stolz die Stadt. Als ich näher heranfahre, sehe ich auf einmal, dass in die Anlage große Breschen geschlagen sind. Sie wirkt wie eine Ruine … Es ist eine Ruine.
Da kommt auf einmal auch den hohen Häusern ihr nobles Aussehen abhanden. Wo ich reich geschnitzte Muscharabie gewähnt hatte, gähnen in Wahrheit nur Löcher wie leere Augen. Nur die Fassaden stehen noch der Meeresfront gegenüber und vermitteln dem in der Ferne vorbeiziehenden Reisenden die Illusion längst erloschenen Glanzes.
Die Nacht bricht herein, und im Schutze der Halbinsel gehe ich außerhalb der Reede vor Anker. Am Morgen fahren wir so weit wie möglich an Land heran.
Wir ankern vor einer Ansammlung jämmerlicher Ruinen. Es ist eine Geisterstadt, und ich erwarte fast das Erscheinen fantastischer Wesen, von Gespenstern aus einer anderen Zeit.
Doch entsteigt den Trümmern vielmehr wie von Zauberhand eine Menge höchst lebendiger Araber, die sich inmitten all der Ruinen anscheinend sehr wohlfühlen.
Wir gehen an Land. Ein sehr dunkler Araber fragt uns nach unseren Papieren. Er hat Patronengürtel umhängen, trägt auf dem Bauch Dolche mit Silberknauf und um die Schulter ein Remington-Gewehr. Vermutlich ein türkischer Soldat. Er soll mich zu Omer Bahar geleiten. In seinem Gefolge betrete ich die tote Stadt.
Zwischen von der Mittagssonne aufgeheizten Mauern gehen wir durch gewundene, von Trümmern verstopfte Gassen. Vierstöckige Fassaden mit aus Teakholz geschnitzten Eingangstoren lassen an orientalische Prachtentfaltung denken.
Inmitten all der Ruinen haben arabische Familien ihre Nomadenlager aufgeschlagen, völlig gleichgültig gegenüber der Trostlosigkeit um sie herum, als habe in keiner der verlassenen Stätten die Erinnerung an Verschwundenes eine untröstliche Seele hinterlassen.
Durch ein Mauerloch erblicke ich im Sonnenstrahl, der durch eine Bresche blitzt, einen schattigen, marmorgefliesten Hof; in dessen Mitte die Reste eines zur Hälfte mit Mist angefüllten Beckens, daneben Packesel voll schwärender Wunden, die träge sinnen, wo einst der kluge alte Sultan sich in den heißen Stunden der Mittagsruhe vor dem frischen Bassin am Anblick der Favoritinnen weidete.
Aus freien Räumen, wahren Trümmerbuckeln, ragen kreuz und quer Balken heraus, Spuren der Grundfesten, als sei von einer Katastrophe alles fortgerissen worden.
Schließlich bleibt mein Führer – oder Wächter – vor einer grob gezimmerten Tür stehen und lässt mich in ein großes, dunkles Haus treten. Über mir im Halbdunkel die geborstenen Decken zweier Etagen. In den Höhen dieses beklemmenden Hohlraums gurren Tauben. Durch die offene Tür fällt schräges Licht auf den mit Schutt übersäten Boden. In der Stille schwebt ein Geruch nach Ziegenmist. Ich sehe nichts. Wo bin ich?
Schließlich nehme ich ganz hinten menschliche Gestalten wahr, auf einem herrlichen Perserteppich kauernd, der auf die wackeligen Marmorplatten gebreitet wurde. Das müssen Omer Bahar und sein Gefolge sein, denn wer im Orient auf sich hält, ist umgeben von einer kleinen Hofschar, und bestehe sie auch nur aus Domestiken.
Es ist ein zäher alter Mann von lakritzfarbener Haut, dessen Gesicht von einem riesenhaften weißen Schnurrbart wie zweigeteilt wird. Er raucht eine abseitsstehende Wasserpfeife und vergräbt dabei das elfenbeinerne Mundstück der rotsamtenen Schlange in dem buschigen Schnurrbart. Das gleichförmige Gluckern der Wasserpfeife klingt wie ein zufriedenes Schnurren des auf silbernen Füßen stehenden Tiers, auf dessen hochgerecktem Hals die Glut erglänzt wie rote Augen.
Dann entrollt sich die große Schlange und geht von Mund zu Mund.
Ich grüße landesüblich, man weist mir einen Hocker zu, das Verhör beginnt.
Der schnurrbärtige alte Spitzbub wechselt mit seinen Gefährten knappe Sätze auf Türkisch. Von irgendwoher treten auf einmal vier bewaffnete Soldaten heran. Der Alte spricht mit ihnen und sieht dabei immer wieder zu mir. Was wird mit mir geschehen? Wird man mich pfählen oder mich verschnürt wie ein Paket in eine Karronade stecken? Da bekomme ich Tee serviert, süß wie Sirup. Ich muss an das Gläschen Rum denken, das man dem zum Tode Verurteilten einschenkt.
Meine Augen haben sich mittlerweile an das Dunkel gewöhnt, und die Züge der Umsitzenden stehen mir deutlicher vor Augen. Lediglich der Alte hat einen Charakterkopf, den eines barbarischen Kriegers. Die anderen sehen roh, oder vielmehr verroht aus. Das beruhigt mich. Es handelt sich also um Untergebene, denen ich als Zerstreuung diene, bevor sie mich zum Wali schicken, von dem ich erwartet werde.
Als ich die Höhle verlasse, blendet mich die Sonne. Eskortiert werde ich von vier baumlangen Türken, vermutlich Sklaven, denn von schwarzem Blut. Von einer Uniform kann bei ihnen keine Rede sein, sie haben nur ihre Patronengurte und die Repetiergewehre mit aufgepflanztem Bajonett umhängen. In solcher Begleitung wirke ich nicht anders als ein Gefangener, der überführt wird. Ich versuche, mit den Kerlen zu reden, doch sprechen sie nicht Arabisch oder tun zumindest so.
Wieder ein Spaziergang durch ein Wirrwarr verwaister Gassen.
Ich gäbe viel darum, einen meiner Männer zu sehen.
Wir kommen an einem kleinen Café vorbei; das heißt, im Schatten eines Mauerstücks wird auf einem irdenen Ofen Tee gekocht; acht oder zehn alte Kisten dienen als Tische und Stühle. Lässige Araber rauchen in einer Wasserpfeife Kokostabak. Da sehe ich, wie aus ihrer Runde Abdi aufsteht. Ich fordere ihn auf, mir unbedingt zu folgen, ob von nah oder fern, so gut er eben kann.
Meine Eskorte hält vor dem Tor eines weniger beschädigten Gebäudes. Dort residiert der Wali. Wir kommen durch einen Pferdestall und treten danach über eine Holztreppe hinaus auf eine sonnengleißende Terrasse. Auf dieser großen Plattform steht, wie ein auf dem alten Koloss hochgeschossener weißer Pilz, die neu erbaute Wohnstätte des Wali.
Es ist ein junger Türke im rosa Pyjama und roten Babuschen. An dem kleinen, mit elfenbeinernen Einlegearbeiten verzierten Tischchen sitzen noch zwei Offiziere, gleich dem Wali auf türkische Art im Schneidersitz. Aus winzigen Tassen trinken sie Kaffee, der von einem schwarzen Sklaven behutsam serviert wird. Mit stiller Geste und einem Lächeln fordert der Wali mich zum Sitzen auf, und es wird ein Stuhl herangeschoben. Ich hüte mich, diesen zu benützen, und kauere mich nieder. Schmunzeln der beiden Offiziere. Mir werden Zigaretten mit Goldmundstücken angeboten. Die Offiziere rauchen mit langen Zigarettenspitzen und streifen die Asche mit regelmäßigen Gesten und exquisit angewiderter Miene ab.
Kleine rote und blaue Fensterstücke färben das Licht und werfen einen seltsamen Glanz auf die Teppiche und die Marmorplatten. Es riecht nach Weihrauch.
Ich gebe mich als Franzose zu erkennen. Das Gesicht des Wali leuchtet auf. Er behauptet, Französisch zu sprechen, und ist stolz darauf, doch verstehen tut er mich anscheinend nicht. Also zurück zum Arabischen, das er leidlich beherrscht.
Nach einem sehr langen Verhör fragte er mich abrupt: »Waren Sie in Cheik Saïd?«
Leugnen hat keinen Zweck. Ich erkläre, das schlechte Wetter habe uns gezwungen, dort ein paar Stunden haltzumachen.
»Ich weiß, ich weiß.«
Süffisantes Lächeln.
Ich habe das Gefühl, dieser liebenswerte Gentleman in Babuschen ist einfach entzückt, mich zu seiner Verfügung zu haben.
Kaffee, Zigaretten, Kaffee.
Er spricht Türkisch. Die Zeit vergeht.
Für einen Verbleib meinerseits gibt es keinen Grund mehr. Ich erkläre, Proviant kaufen zu müssen. Außerdem wolle ich seine Gastfreundschaft nicht länger beanspruchen, und so weiter.
»Es eilt doch nicht, und draußen ist es zu heiß. Sie haben Zeit.«
Praktisch bin ich sein Gefangener. Ich danke ihm und überdenke meine Lage. Bei den merkwürdigen Landessitten ist nicht abzusehen, wie dieses Abenteuer enden wird. Ich lasse eine halbe Stunde vergehen.
Zwei türkische Soldaten treten ein, erhalten halblaute Befehle, grüßen, machen aus Prinzip zackig kehrt und gehen hinaus. Mich erstaunt dieses Militärische, das mit der orientalischen Nachlässigkeit so gar nicht in Einklang steht.
Da erst fällt mir auf, wie blond der eine Offizier ist, und als ich ihn vor meinem geistigen Auge seiner orientalischen Attribute entledige, kommt er mir ausgesprochen germanisch vor. Gesprochen hat er nur zwei Mal, ein paar Worte auf Türkisch, doch der Wali hat ihm aufmerksam zugehört, und seine Züge haben gewissermaßen Habtachtstellung angenommen. Seltsam.
Die Sache muss ein Ende haben. Ich stehe auf. »Entschuldigen Sie mich, ich muss zum Telegrafen, nach Dschibuti kabeln.« Meine Geste zeugt von einer Entschlossenheit, gegen die mit einem Lächeln nicht anzukommen ist.
Der blonde Offizier und der Wali wechseln einen Blick. Ein Wort im Befehlston, und der Wali setzt wieder sein liebenswürdigstes Lächeln auf. »Ich lasse Sie begleiten. Heute Abend erwarte ich Sie aber zum Essen.« Der andere Offizier, ein echter Türke jener, geht hinaus und kommt fast augenblicklich mit vier wiederum bewaffneten Männern zurück. »Ihre Eskorte«, sagt der Wali. »Die Stadt ist derzeit nicht sicher.«
»Wegen herabfallender Mauerteile?«
»Nein, aber im Landesinnern gibt es Unruhen, und man weiß nie, was geschehen kann. Ich bin für Ihre Sicherheit verantwortlich.«
Für so viel Fürsorglichkeit kann ich mich wieder nur bedanken.
In einem verfallenen Haus mit Schafen und Ziegen im Erdgeschoss hängt aus einem Loch in der Mauer schlaff ein Draht: die Telegrafenleitung. Es scheint kaum möglich, dass über eine so wenig respektable Anlage ernsthafte Nachrichten übermittelt werden.
Eine Behelfsleiter führt in den ersten Stock hinauf. Zu meiner Überraschung finde ich dort auf einem uralten Toilettentisch einen Morseapparat vor. Ein sehr alter, zur Umgebung passender Mann sitzt auf einer leeren Kiste und transkribiert die Nachricht, die nervös auf den blauen Papierstreifen rattert.
Zu seinen Füßen liegt friedlich ein Zicklein und kaut an Papieren.
Mein Eintreffen wird nicht weiter gewürdigt. Der Alte erwidert mechanisch mein salam aleikum, ohne aufzusehen.
Mir fällt auf, dass er von links nach rechts schreibt. Beim Nähertreten stelle ich fest, dass die Nachricht auf Deutsch ist. In einer Ecke kauert ein Soldat. Bestimmt erwartet er die Antwort auf Fragen, die man über mich gestellt hat. Nun verstehe ich, warum man mich zurückhalten wollte. Man wartet auf Anordnungen des Wali in Taizz. Kein Zweifel mehr also: Es gibt eine Art deutschen Generalstab, der im Geheimen wirkt, aber das Gerüst der türkischen Regierung in Arabien bildet. Ich will es nun genau wissen.
»Kannst du ein Telegramm nach Cheik Saïd für mich aufnehmen? Ich will dem europäischen Offizier dort etwas mitteilen«, sage ich zu dem Alten, als er mit seiner Arbeit gerade fertig wird.
Abrupt hört er auf, am Spieß seines Morseapparats zu drehen, und sieht mich mit runden Augen an. »Welchem Offizier?«
»Du weißt schon, wen ich meine, du kannst ja Deutsch. Ich will bloß vor deinen Leuten hier den Namen nicht sagen.«
»Ich weiß nicht, was du meinst.« Er dreht wieder an der Ratsche des Apparats, die Nase dicht über dem blauen Papierstreifen, als sei er urplötzlich kurzsichtig geworden.
»Gut«, erwidere ich, »dann gebe ich das dem Wali.« Die offensichtliche Verlegenheit des Mannes verschafft mir die Gewissheit, dass sich im Fort von Cheik Saïd tatsächlich ein deutscher Offizier aufhält.
»Nach Dschibuti müsste ich aber auch ein Telegramm schicken.«
Der Alte gibt mir Papier und Tinte. Ich schreibe: »Gouverneur Dschibuti. Bin Mokka. Schicke Nachricht, falls Hilfe unnötig.« Daraus geht ziemlich deutlich hervor: Falls ich mich nicht melde, werde ich von irgendwelchen Schwierigkeiten oder einer Gefahr davon abgehalten. Und man kann meine Spur verfolgen, zumindest bis hierher. Doch wird das Telegramm auch wirklich abgehen? Der Alte zählt die Wörter, von vorne und von hinten, rechnet herum, schlägt in Registern nach, kratzt sich mit einem Lineal den Rücken. Schließlich hält er mir einen Zettel hin und verlangt eine türkische Lira. Es erfolgt ein Umrechnen meiner Taler zu einem lukrativen Kurs. Dann noch ein fragender Blick zum Einfordern des Bakschischs, das er für das Papier und die Tinte will.
»Und wann schickst du es?«
»Nachher.«
»Nein, schick es gleich. Schau, da ist noch ein Taler für dich.«
»Ich versuche es.«





























