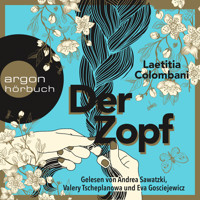Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mare Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ein intensiver Roman, so erschütternd wie ein zwischen Liebenden aufkeimender Verdacht Sie begegnen sich auf einer Schiffsüberfahrt von Italien nach Griechenland: der Erzähler, der in einem Zeitungsarchiv arbeitet, und die attraktive, kapriziöse Sinologin. Es ist der Beginn einer leidenschaftlichen Beziehung, die auch die Rückkehr nach Neapel überdauert. Lange scheint sein Hadern mit dem Zusammenziehen der einzige Wermutstropfen zu sein - er befürchtet, seine kleine Tochter aus geschiedener Ehe vor den Kopf zu stoßen. Doch eines Tages entdeckt er bei der Arbeit das Zeitungsfoto eines Raubüberfalls: Unter den Umstehenden meint er seine Geliebte zu erkennen, nur kann sie seines Wis- sens zur fraglichen Zeit gar nicht am Ort des Geschehens gewesen sein. Hintergeht sie ihn womöglich? Besessen von dem Drang, die Wahrheit über ihre Beziehung herauszufinden, stürzt er sich in ein psychologisches Katz-und- Maus-Spiel mit seiner Geliebten, bei dem bald die Grenzen zwischen Jäger und Gejagtem verschwimmen. Sie gesteht ihm einen Seitensprung und verstrickt sich immer öfter in Widersprüche; er versucht sich mit einer Affäre zu rächen. Die Welt des Erzählers gerät zunehmend ins Wanken... Luigi Trucillos Debütroman beeindruckt durch seine intensive Sprache, poetische Bilder und einen geradezu hypnotisierenden Erzählrhythmus. Zeitlos und hochaktuell zugleich, ist "Die Geometrie der Liebe" eine glänzende Betrachtung über Leidenschaft und Eifersucht und ein hellsichtiger Blick auf unsere unstillbare Sehnsucht nach Wahrheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
mare
Luigi Trucillo
DIE GEOMETRIE DER LIEBE
Roman
Aus dem Italienischen von Valerie Schneider
mare
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetunter http://dnb.ddb.de abrufbar.
Die Arbeit der Übersetzerin wurde durch denDeutschen Übersetzerfonds gefördert.
© 2015 by mareverlag, Hamburg
CovergestaltungNadja Zobel / Petra Koßmann, mareverlag, Hamburg
Coverabbildung© plainpicture / NTB scanpix / Arne Strømme
Typographie (Hardcover)Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg
DatenkonvertierungeBook bookwire
ISBN eBook: 978-3-86648-318-7
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-225-8
Als Eifersüchtiger leide ich vierfach: weil ich eifersüchtig bin, weil ich mir meine Eifersucht zum Vorwurf mache, weil ich fürchte, dass meine Eifersucht den anderen verletzt, weil ich mich von einer Banalität knechten lasse.
Roland Barthes
I
»DER FUCHS WEISS viele Dinge, aber der Igel weiß eine große Sache«, hast du einmal in einem Buch von Isaiah Berlin gelesen. Viele Jahre lang bist du um diesen Satz gestrichen, ohne genau zu wissen, warum. Jetzt, da es zu spät ist, hast du verstanden, dass die vielen Dinge, die der Fuchs weiß, dem Interpretationsgewirr angehören, während die eine Sache, die der Igel weiß, in dir brennt wie die Glut der Obsession.
Sie klingt für dich wie das Rauschen des Meeres. Du hast sie zufällig auf der Fähre nach Piräus getroffen. Sie ist allein, nach der Trennung von ihrem Freund kurz vor dem Sommer hat sie beschlossen, nach Griechenland zu fahren, um ihrer inneren Unruhe zu entkommen. Über gemeinsame Bekannte seid ihr euch schon ein paarmal begegnet, doch jetzt, als du sie auf See wiedertriffst, ist es anders.
Plötzlich siehst du sie. Eher goldgelb als blond, flattert sie wie eine losgelöste Haarsträhne im Meltemi, dem Wind, der über das Deck des Schiffes fegt. Weit weg, in einem anderen Land, ist sie verlassen worden und schlingert nun aus Selbstschutz in einer verzweifelten Ironie. Du umwirbst sie, küsst sie, ohne wirklich zu wissen, weshalb. Sie ist kraftlos. Bei jeder Berührung zuckt sie zusammen, doch sie braucht einen Mann. Ihr verbringt die Nacht miteinander, aber als du versuchst, mit ihr zu schlafen, gelingt es dir zum ersten Mal nicht.
»Tut mir leid, das ist mir noch nie passiert …«, murmelst du mit einer Beschämung, die du kaum erträgst.
»Das macht nichts«, versichert sie dir und klingt dabei mit einem Mal erschreckend ruhig. »Wir werden noch genug Zeit dafür haben. Wirklich, für mich spielt das keine Rolle …«
Du bist verwirrt, hast das Gefühl, in der Dunkelheit der Kajüte zu versinken. Durch das Bullauge scheint pulsierend der Mond auf eure nackten Rücken, wie eine rötliche Hostie. Du legst ihr die Hand auf die Hüfte und tust so, als würdest du vom Schaukeln des Bootes einschlafen, eingelullt von der Nähe ihres Körpers, der langsam in die Sanftheit des Schlafes zurückfindet.
Als du mitten in der Nacht aufwachst, strahlt sie dich aus nächster Nähe an, als warte sie darauf, dass du etwas sagst. Du bewegst dich nicht, flüsterst ihr nur zu, wie glücklich du bist, dass sie da ist, dann schläfst du wieder ein.
Am nächsten Morgen beschließt ihr, die Reise gemeinsam fortzusetzen und euch von Insel zu Insel treiben zu lassen. Ihr lasst euch Zeit. Erkundet die aus dem türkisfarbenen Wasser von Naxos ragenden Felsen und die Strände von Amorgos, entdeckt die steinernen Schmetterlingsflügel, die Astypalea zum Flug ausbreitet. Auf Karpathos, im klaren Wasser der kleinen Buchten von Diafani, fordert ihr euch jeden Tag zu endlosen Kraulwettkämpfen heraus, in denen ihr die Wellen durchpflügt. Eines Nachmittags, nachdem du dich als Erster auf eine Klippe hochgezogen hast, drehst du dich um, um ihr heraufzuhelfen, und bist wie geblendet. Ein Lichtschein umgibt sie, als sie keuchend aus dem Meer auftaucht. Wie ein schwankender Regenbogen. Auf ihrer Haut verschwimmen die Sonnenreflexe zu kristallisierten Wasserzellen, in denen das Plankton der Erinnerung schimmert. Du siehst sie an, und dir ist, als würde ihr Bild, wie im Märchen, von nun an für immer in deinen Augen flimmern.
Ihr zieht weiter in Richtung Osten, das ist eure einzige, von der Hitze bestärkte Gewissheit. Und nach und nach waschen euch die Inseln von allem rein, was vor ihnen war. Mittlerweile schlaft ihr miteinander, jedoch hastig, in blinder Ungeduld, als suchtet ihr intuitiv die Richtung für eine Zukunft, die nicht gefunden werden will. Und währenddessen, im Rhythmus der klapprigen Fährenmotoren, gewöhnt ihr euch aneinander. Du bemerkst, dass sie weniger welk aussieht, im Lächeln länger verweilt.
Eines Abends, auf der Veranda eines Kafeneion auf Chios, forderst du sie zu einer Partie Backgammon heraus. Es ist eine Offenbarung. Immer wieder gewinnt sie. Mit einer kindlichen Seligkeit, die ihre Melancholie aus dem Gesicht vertreibt wie einen Schwarm Krähen von einem Feld. Ihr Gesicht leuchtet mit einem Mal. Da sitzt sie, an den blauen Tischen der Cafés, und wirft die Würfel, trunken vom Nervenkitzel und von ihrem Glück. Sie ist schön geworden, die Sonnenbräune hat ihrer zu hellen Haut etwas Verwegenes verliehen, doch vor allem scheint die Euphorie des Siegens sie zu beleben. Im Spiel ist sie eine Draufgängerin. Einfallsreich und geschickt, wie sie ist, fordert sie jeden heraus, der ihr in die Schusslinie kommt, Ausländer ebenso wie die griechischen Stammgäste der Bars, und schlägt alle mit unerhörter Leichtigkeit.
Das hat sich auf der Insel herumgesprochen. Inzwischen erwarten die Alten sie bereits, um ihre Taktik zu studieren, wenn ihr in die Cafés kommt. Nur ein einziges Mal, als sie gegen einen alten Bienenzüchter spielt, ist sie kurz davor zu verlieren. Sie sitzt mit vier Spielsteinen in ihrem Startfeld fest, während ihr Gegner bereits losgezogen ist. Doch dann riskiert sie alles, hat unverschämtes Glück und gewinnt, begleitet vom Raunen der kleinen Menge, die sich um sie geschart hat, erneut. Als die Würfel ein letztes Mal zum Stillstand kommen, bricht sie in Gelächter aus und schüttelt ihren blonden Kopf, berauscht von der Faszination, die sie in den anderen weckt. »Das war reines Glück«, hat sie gelernt, auf Griechisch zum jeweiligen Verlierer zu sagen. Doch in ihren Augen blitzt die Freude dessen, der seine Unverwundbarkeit entdeckt.
Während sie spielt, schaust du dich um, lässt dich von dem durchdringen, was du siehst. Du erkennst in der Nacktheit der griechischen Formen und Farben die notwendige Essenz der Dinge, die offene Klangfülle des Anfangs. Und du fragst dich, ob die Klarheit dieses Ortes nicht wie ein Wind auf euer Verhältnis einwirkt, wobei unklar ist, ob er es auslöscht oder anfacht.
»Hast du wirklich noch nie vorher gespielt?«, fragst du sie eines Nachts, während ihr euch nackt gegenüberliegt und dem ersten Vogelzwitschern lauscht. Und es ist, als würdest du sie fragen: »Glaubst du wirklich, dass wir uns lieben könnten?« Sie nickt energisch. Dann zwinkert sie dir zu und flüstert: »Jedes Mal ist das erste. Zumindest für mich.«
Am Ende der Reise erreicht ihr Samos, üppige Wasserläufe, Mastixsträucher, Jasmin. Sie wird sofort zu deiner Lieblingsinsel, in Stille gehüllt, wie sie dir vom ersten Moment an erscheint, da du sie von der Fähre aus siehst. Es ist die Insel Heras, der Göttin der Ehe, und alles auf ihr scheint vom klebrigen Strom der Vereinigung mitgerissen zu werden: die Früchte, der Honig, der Duft der Maulbeerbäume und der Weinstöcke, die ihre Berghänge entzünden. Ihr bleibt zwei Wochen, schwimmt und unternehmt lange Spaziergänge auf den von Steineichen überhangenen Wegen.
Inzwischen klingt ihr im anderen nach: Ihr verschwitzter Körper ist das Erste, was du suchst, wenn du morgens die Augen aufschlägst. Die geschwungene Linie ihres Mundes, die dich trifft wie ein Pfeil. In den seltenen Momenten, in denen du innehältst und es bemerkst, erschrickst du und würdest gern Zeit gewinnen, um zu verstehen, in welcher Art von Verlangen ihr zusammenfließt. Doch es ist schon zu spät dafür, wieder zu Fremden zu werden. Auf Samos findet eure Beziehung eine Heimat.
Obwohl du nun endlich aus den Ferien zurückgekehrt bist, ist die Kleine untröstlich. Sie hasst die älteren Cousinen und die Tante auf dem Land, bei denen du sie untergebracht hast und die sie gezwungen haben, sich jeden Morgen gründlich zu waschen.
»Ich bin doch keine Ente! Und ich konnte sie nicht mal mit meinem Zauberstab wegzaubern!«, erklärt sie enttäuscht und meint damit einen Kirschbaumzweig, den sie im Wald gefunden hat. Stundenlang spricht sie kein Wort mit dir, entschlossen, in ihrer Entrüstung gefangen zu bleiben, bis sie schließlich in rückhaltloses Schluchzen ausbricht, während du ihr hilfst, ihre Schuhe zuzubinden. Es klingt wie das Husten eines Hundes.
»Versprich mir«, fleht sie, »dass du mich in den Ferien nie mehr dahin schickst. Versprich es! Und wenn du das Versprechen brichst, fallen dir die Ohren und die Augen ab …«
Du versprichst es ihr.
Zurück in der Stadt, trefft ihr euch weiterhin. Tag für Tag lernst du, das Vergehen der Jahreszeiten auf ihrer Haut zu genießen: die ledrige Bräune des Sommers, die herbstliche Häutung, die frische Blässe des Winters … Von Anfang an hast du gewusst, dass es in ihr einen Platz für dich gibt. Dennoch, sie ist eine erschöpfte Frau. Kraft deiner Gegenwart versuchst du, sie davon zu überzeugen, sich nicht von den Fehlschlägen der Vergangenheit lähmen zu lassen, sondern wieder zu vertrauen. Doch um dies zu erreichen, musst du den verborgenen Kern unter ihrer Leichtigkeit wieder zum Leben erwecken. Nahezu jeden Tag geht ihr zusammen aus, ins Kino oder am Meer spazieren, und es scheint dir, als würdest du ihr wieder beibringen, nachzugeben, zu fließen. Sie ist verhärtet, hat sich daran gewöhnt, im Stillen Angst zu haben, doch du stemmst dich gegen ihre Angst und zwingst sie zum Rückzug, wirst zum Schutzgeländer mitten in der Schlucht. Allmählich seid ihr nicht mehr nur das Zitat einer Liebe, lasst die Geziertheiten des Anfangs hinter euch.
»Weißt du«, gesteht sie dir eines Tages, als bilde sie sich zum ersten Mal ein Urteil über dich, »dass du viel besser bist, als ich dachte?«
Du siehst noch ihr Gesicht vor dir, als sie es dir sagt: ein Gesicht, aus dem das Staunen alles andere herausgeschwemmt hat. Es ist heiß. Das Licht dringt durch die Ritzen der Fensterläden und verbreitet jene Art von Klarheit im Zimmer, die ohne Absicht daherkommt. In einer Nachbarswohnung schreit ein Neugeborenes, dann hörst du es nicht mehr. Vor wenigen Tagen hast du ihr gesagt, dass ihr nie werdet zusammenleben können, deine Tochter würde das nicht ertragen und du willst es ihr, nach der Trennung von ihrer Mutter, nicht aufzwingen.
»Ist mir recht«, hat sie dir, beinahe gleichgültig, geantwortet. »Solange du nicht versuchst, mich aufzuhalten, wenn ich gehen will. Du weißt, dass ich mich nur schlecht zur Wehr setzen kann.«
Es war ein Pakt. Du hast ihr die Hände hingehalten, und sie hat sie dir nicht abgehackt. Im Grunde hast du damit auch deine Unfähigkeit, zu leben, ohne auf wer weiß was zu warten, verteidigen wollen, dein »Leben auf Stand-by«, wie du es nennst, und sie hat es akzeptiert.
Nun dringen der Geruch von karamellisiertem Zucker und das Donnern der Mittagskanone durchs Fenster. Du streichst ihr sanft über die Wange, genießt es, unter den Fingerspitzen die Elastizität ihrer Haut zu spüren: Wer sich verändert, berührt den anderen, und ihr seid dabei, euch zu verändern. Dann trittst du noch näher an sie heran und streifst ihr die Träger des Leinenkleids von den Schultern, sodass es zu Boden fällt. Plötzlich steht sie nackt vor dir, entblößt. Als du in sie eindringst, möchtest du mit deinem Glied am liebsten bis hinauf in das Zentrum ihres Blickes dringen, der dich durchtränkt wie eine flüssige Flamme. Ihre Augen trinken aus deinen, ihr Mund überflutet dich, und während du fühlst, wie sie sich um dich herum auflöst, scheint es dir, als würdest du mit jedem Stoß über sie hinausgehen. Unter dir ist sie wie fliehendes Wasser. Wer bleibt, bist du. Sie schreit, lächelt. Du machst weiter, immer weiter. Willst zurückkehren, auch wenn du nicht genau weißt, wohin. Während du langsam und methodisch in sie eindringst, streichst du ihr plötzlich über die Seite, sodass sie aufstöhnt. Die Linie, die du so markierst, ist der Weg, den du für eure Liebe vorzeichnest, die Schwelle, die deine Leidenschaft entschlossen überschreiten will. Nun kann eure Beziehung beginnen.
Anfangs ist sie eine zarte Hirschkuh, die zögerlich deiner ungeahnten Kraft entsteigt. Sie hat ein feines Gehör und große Hände. Sie trinkt aus deinen Quellen und zeigt sie dir so. Wenn du mit ihr sprichst, hast du Angst, sie zu zerbrechen, wenn du sie berührst, fürchtest du, zu spät gekommen zu sein, um sie auf deinen Namen abzurichten. Nachts äst sie deine Wärme. Ihr goldener Körper riecht nach Beeren und Geißblatt, ihre Brustwarzen duften nach Heu. Du dringst in ihr vor, indem du dich vorsichtig durch den Schleier aus Morgennebeln bewegst: Du bist in einem gedämpften Traum, in dem ihr Gesicht bei jedem Rascheln wieder blutjung wird und gleich darauf wunderbar unergründlich. Sie steigt in die falschen Züge, vergisst die Schlüssel, verliert ihren Schmuck. »Weil ich so von dir verzaubert bin«, flüstert sie. Und ihr Mund ist aus Moos. Wie Sertorius, der römische Feldherr, der eine überirdische Hirschkuh liebte, die ihm am Waldrand erschienen war, lauschst du ihren Vorahnungen und verwandelst sie in eine unerwartete Leichtigkeit, in einen Fluchtweg. Ihr Mund ist aus Moos.
Auch wenn du das eigentlich nicht willst, musst du sie mit der Kleinen bekannt machen. Du arrangierst ein Abendessen bei deiner besten Freundin, die eine Terrasse mit Blick auf den Hafen hat. In der Hoffnung, dass die Anwesenheit weiterer Personen die beiden zu Verbündeten werden lässt oder sie zumindest ablenkt.
Es ist ein windiger Abend. Zwischen den gelblichen Lichtpünktchen der beleuchteten Fenster rundum wirkt die Terrasse wie eine schwimmende Plattform kurz vor dem Kentern. Damit du dich wohler fühlst, hat deine Freundin noch ein anderes Paar mit Kind eingeladen und unterhält nun alle mit ihrer gelassenen Heiterkeit. Du bist nachdenklich. Kurz bevor du hergekommen bist, hast du am Telefon bei ihr darüber geklagt, dass deine Arbeit dir seit einiger Zeit Bauchschmerzen bereitet.
»Wenn das so weitergeht«, hast du gewitzelt, »bringt die Arbeit mich noch ins Grab.«
Doch du hast sofort bemerkt, dass sie am anderen Ende der Leitung erstarrte.
»So was darfst du noch nicht mal im Spaß sagen«, rief sie mit sich beinahe überschlagender Stimme. »Du musst mir versprechen, dass du niemals sterben wirst. Niemals!«
»Nein, werde ich nicht. Oder vielmehr erst einen Moment nach dir«, hast du mit einem verlegenen Lachen erwidert. Doch ihr schriller Tonfall hat dir nicht gefallen.
Bei ihrer Ankunft ist sie vollkommen aufgedreht. Sie trägt den weißen Pullover, den du ihr ein paar Tage zuvor geschenkt hast.
»An manchen Abenden weiß eine Frau einfach nicht, was sie anziehen soll«, sagt sie schäkernd auf deinen komplizenhaften Blick hin. Dann stürzt sie sich in die neuen Bekanntschaften, ergießt sich in den sprudelnden Bläschen, die sie selbst produziert. Sie ist so geistreich und schlagfertig, wie du sie noch nie erlebt hast. Die Kleine am anderen Ende des Tisches ist hingegen todernst. Als sie kam, begrüßte sie sie förmlich und reserviert, dann lief sie weg, um mit ihrem Altersgenossen zu spielen.
»Du siehst aber hübsch aus! Trägst du die Haare gerne so kurz?«, hatte sie das Mädchen Vertrauen heischend gefragt.
»Wenn ich könnte, würde ich sie mir wachsen lassen«, hatte die Kleine kühl zurückgegeben. »Ich hab nur Angst, dass ich dann schlechter denken kann.«
Sie hat ihren Kirschbaumzweig dabei, mit dem sie Dinge wegzaubert, streift nun über die Terrasse und tippt auf alles, was ihr begegnet.
»Heute Abend wollen die Sachen wohl nicht verschwinden«, sagst du augenzwinkernd zu ihr.
»Natürlich nicht!«, schnaubt sie. »Heute ist das ja auch ein Zauberstab, mit dem man unsichtbare Kängurus fangen kann. Erst wenn es sein muss, verwandelt er sich wieder in einen zum Verschwindenlassen.«
Die letzten Gäste kommen, und ihr könnt endlich essen. Du fühlst dich nicht wohl, findest keine Ruhe auf deinem Stuhl. Der ganze Abend scheint unter ihrem Bann zu stehen, sich ihrem zu hochtourigen Rhythmus anzupassen. Deine Freundin hat dir bereits einen fragenden Blick zugeworfen: Dir ist klar, dass sie sie später als »Partylöwin« bezeichnen wird. Vielleicht wird sie aber auch nichts sagen, in ihrer loyalen Art, die auch eines Schweigens fähig ist. Außerdem scheint die Partie zwischen deiner »Sie« und der Kleinen unterschwellig schon längst entschieden zu sein.
Während du dich auf die Fischsuppe konzentrierst, schnappst du Fetzen ihrer provokativen Reden auf, so wie: »Für mich muss der ideale Mann drei Dinge können: gut tanzen, Auto fahren und romantisch sein«, die dir klarmachen, wie sehr es ihr gefällt, vor Publikum die Grenzen der Undifferenziertheit auszureizen.
»Stehst du denn wirklich auf solchen Kitsch?«, fragst du sie spöttisch, als ihr allein in der Küche seid und den Wein entkorkt.
»Na ja«, erwidert sie lachend, »wie könnte ich sonst mit einem wie dir zusammen sein?«
Du nickst und hast auf einmal das Gefühl, dich in einer amerikanischen Sitcom zu befinden.
Über der Terrasse ist ein prall mit Wasser gefüllter Mond aufgegangen. Vom Meer kommen Windböen, die sich in den Servietten verfangen und sie gegen die Brüstung wehen. Du stehst ein, zwei Mal auf, um sie wieder aufzuheben. Beim dritten Mal läuft die Kleine dir hinterher, um dir zu helfen, stolpert jedoch über den Gartenschlauch und fängt an zu weinen. Du nimmst sie in den Arm, küsst ihr tröstend das aufgeschürfte Knie und drückst sie an dich, um sie zu beruhigen. Als du dich umdrehst, siehst du, dass sie hinter euch steht und euch wie in Trance beobachtet, in einem Klumpen Zeit gefangen wie ein flämisches Mädchen auf einem alten Gemälde. Du weißt sofort, dass sie eifersüchtig ist. Auch die Kleine spürt es und fährt hoch, als sie sie entdeckt.
»Na los, wir gehen jetzt mal alle zusammen dein Knie desinfizieren«, schlägst du vor.
»Die aber nicht!«, quengelt die Kleine lautstark, und so kommt sie nicht näher.
Seit diesem Vorfall liegt eine Frostschicht auf ihr. Du beobachtest sie heimlich, während sie ihrem Tischnachbarn, der den Clown spielt, einsilbige Antworten gibt, und erschrickst darüber, wie leicht empfänglich sie für Risse ist. Gleichzeitig verspürst du auch den unwiderstehlichen Drang, sie zu küssen. Seit sie sich so jäh in ihre Traurigkeit verkrochen hat, scheint ihre Haut transparent zu sein wie ein Blatt Reispapier. Du rückst mit deinem Stuhl dicht an sie heran und berührst unter dem Tisch ihr Knie. Abwesend lässt sie ihr Glas gegen deines klirren, sieht dich mit undefinierbarer Miene an.
Im Sturmwind endet das Essen vorzeitig, und die Kleine, mittlerweile wieder munter, kommt mit ihrem Zauberstab in der Faust an.
»Zeig mal deine Hand«, verlangt sie von ihr. Und als sie sie ihr hinhält: »Ist die aber groß!«
»So groß wie eine Bärentatze. Vielleicht, damit ich dich besser packen kann.«
»Und?«, mischst du dich ein. »Bist du immer noch auf Kängurujagd?«
Die Kleine antwortet dir nicht, wendet sich nur an sie, sagt: »Guck, wie klein meine dagegen ist«, und als sie sich vorbeugt, um die kleine Hand zu betrachten, tippt die Kleine sie plötzlich mit dem Zweig an. »So, jetzt kannst du verschwinden, wenn du nach Hause gehst.«
»Na, schönen Dank auch!«, antwortet sie pikiert, und du begreifst, dass das eine Kriegserklärung ist.
Später, beim Abschied, flüsterst du ihr zu: »Morgen Abend gehen wir zusammen essen. Nur wir beide.«
»Das war ein Desaster, oder? Ich bin zu nichts zu gebrauchen.«
»Ach was«, versuchst du, sie zu beruhigen. »Mit manchen Kindern gibt es einfach keine halben Sachen, entweder man findet einen Draht zu ihnen oder eben nicht. Es wird schon noch andere Gelegenheiten geben.«
»Von mir aus muss man da nichts forcieren«, erwidert sie mit plötzlicher Würde. »Ab jetzt überlassen wir das dem Zufall.«
II
DER ZUFALL KENNT keine Erinnerung. Du arbeitest in einem Zeitungsarchiv, an einem Ort, an dem die Augen nach einer Gegenwart suchen, die nicht mehr gegenwärtig ist, nach Nachrichten, die bereits veraltet sind.
Du überlebst inmitten von Papier. Tag für Tag archivierst du, bündelst du, sortierst du die Jahrgänge der Zeitungen, die sich massenweise auf dem Rücken der Zeit stapeln. Du hast aus den Tagen eine Entdeckungsreise im Rückwärtsgang gemacht. Hast sie in einen Blick gefüllt, in dem die Taube, die verfroren mit den Flügeln gegen das Fenster schlägt, von einem Eisenbahnunglück vertrieben wird, das vor einem Jahr passierte. Das Blätterrascheln auf den Lesetischen, das Quietschen der Stühle, die in dem Saal gären, in dem du arbeitest, sind nichts als eine immer gleichförmigere Choreografie angesichts des Stroms an Ereignissen, der aus den Seiten hervorbricht, die du kontrollierst. Du verwaltest das Buch der Welt, auch wenn es eine bereits vergangene Welt ist. Du bist der Wächter dessen, was geschehen ist, derjenige, der es nicht entrinnen lassen darf. Doch auch wenn deine Verantwortung gewaltig ist, beinahe so gewaltig wie die Regale, die du hütest, kennt der Zufall keine Erinnerung. Er schert sich nicht um dich. Das wird dir klar, als einer deiner Kollegen, der mit dem Mausebärtchen, ohne ersichtlichen Grund im November-Band der Tageszeitung einer anderen Stadt herumblättert. »Sieh mal«, sagt er und hält dir den aufgeschlagenen Band hin. »Ist das nicht deine Freundin?« Du schaust hin. Die Zeitung berichtet von einem Raubüberfall mit blutigem Ausgang, in der Mitte des Artikels ein Foto. Im Vordergrund ist der leblose Körper eines der Opfer, eines Polizisten, zu sehen; direkt dahinter eine Gruppe Schaulustiger, in der eine Frau auffällt, die die Szene verstört beobachtet. Diese Frau sieht aus wie sie. Wie die gleiche Sie, der du vor ein paar Stunden noch die auf dem Kissen aufgefächerten Haarspitzen gestreichelt hast. Die gleiche Sie, von der deine Hände noch immer durchtränkt sind. Ihr geöffneter Mund. Ihr nackter, in der Morgendämmerung bleicher Körper …
»Das ist nur eine zufällige Ähnlichkeit«, behauptest du abrupt und rechnest indessen eilig aus, dass sie zu dem Zeitpunkt keinesfalls in dieser Stadt gewesen sein kann. Sie war zu Besuch bei ihrer Mutter gewesen, Hunderte Kilometer von dort entfernt. Doch der Mantel sieht wirklich genauso aus wie ihrer, beinahe kannst du unter den Fingern die Erhebungen des Stoffes spüren. Dazu ihr Oberkörper, der leicht nach links geneigt ist. Sodass sie sich zu der Blutlache zu beugen scheint, die unten in einer Ecke das Foto befleckt.
»Nein, ich bin mir sicher, sie sieht ihr nur ähnlich«, sagst du nochmals barsch zu deinem Kollegen, der sich perplex entfernt.