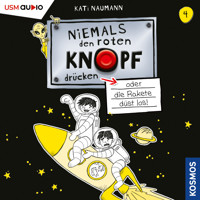6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine charmante Komödie über verlorene Träume, neue Chancen und die Erkenntnis, dass es nie zu spät ist, sein Glück zu finden. Mimi Balu steht kurz vor dem internationalen Durchbruch als Sängerin. Die hochtalentierte und äußerst fotogene Künstlerin hat es aus ihrem sächsischen Geburtsort bis nach London geschafft. Das Einzige, was ihrer Karriere als Weltstar im Weg stehen könnte, ist ihr fortgeschrittenes Alter, denn Mimi geht unaufhaltsam auf die Vierzig zu. Nichts liegt Mimi ferner als der Gedanke an ihre Heimat, doch ein familiärer Notfall zwingt sie zur Rückkehr - eine unerwartete Heimkehr mit ungeahnten Folgen. In diesem humorvollen und herzerwärmenden Roman begleiten wir Mimi Balu auf ihrer Reise der Selbstfindung, während sie lernt, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen und die Liebe zu finden. Die große weite Welt der Mimi Balu ist eine charmante Geschichte über Familie, Sinnsuche und die Kunst, sein eigenes Glück zu schmieden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Kathi Naumann
Die große weite Welt der Mimi Balu
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Hier kommt Mimi Balu! Diesen Namen sollten Sie sich merken, denn Mimi steht kurz vor dem internationalen Durchbruch als Sängerin. Sie ist hochtalentiert, äußerst fotogen und hat es aus ihrem sächsischen Geburtsort bis nach London geschafft. Das Einzige, was ihre Karriere als Weltstar behindern könnte, ist ihr fortgeschrittenes Alter, denn Mimi geht unaufhaltsam auf die Vierzig zu. Nichts liegt Mimi ferner als der Gedanke an ihre Heimat, doch genau dorthin muss sie wegen eines familiären Notfalls zurück – eine Heimkehr mit ungeahnten Folgen …
Inhaltsübersicht
Hier kommt Mimi Balu!
Eine Reise in die Vergangenheit
Grüne Klitscher
Audienz bei der Königin des guten Geschmacks
Eine äußerst wichtige Person kündigt sich an
Die Assistentin des Gauklers
Konzert mit Samtbestuhlung
Entenbraten mit Schnabel
Die fabelhafte Wirkung von Morphium
Bilder von alten Londoner Bäckereien
Kein Hubschrauber und ein Mondfahrzeug
Mimi Balus große Chance
Eine schwere Entscheidung
Die Fahrt auf der Themse
Eine ziemlich komplizierte Geschichte
Urlaub mit Vollpension
Die Bestimmung der Balutzke-Frauen
Das Leben in geregelten Bahnen
Die Kunst des Fluchens
Siebenunddreißig Urkunden und Abschlüsse
Applaus für Mimi Balu!
Danksagung
1.
Hier kommt Mimi Balu!
Der folgenreichste Unterschied zwischen den Einwohnern von Limbach-Oberfrohna und London liegt in der Wahl ihrer Garderobe. Während in Limbach-Oberfrohna die Tagestemperatur ausschlaggebend ist, wird die Kleidung in London von der Tageslaune bestimmt. Um das auszugleichen, gibt es in England hochwirksame Medikamente gegen Blasenentzündung rezeptfrei.
Mit ausgebreiteten Armen balancierte ich über die Asphaltbeulen zwischen den Pfützen auf der Regent Street. Die Fransen meiner hellen Wildledersandalen wischten den Schmutz auf und schlenkerten Spritzer an meine nackten Beine. Vor mir lief eine Frau mit furchtbar zweckmäßigem Schuhwerk – ganz sicher eine Touristin. Wir Einheimischen würden uns von ein wenig Kälte und Regen niemals die Frühlingsstimmung verderben lassen!
Mit einer Welle von Menschen überquerte ich die riesige Kreuzung am Oxford Circus diagonal. Diese Ampel, die tatsächlich schräg über den zentralen, unübersichtlichen Knotenpunkt führt, symbolisiert für mich die Londoner Philosophie. Alle Wege, die hier zum Ziel führen, sind unkonventionell, äußerst direkt und fühlen sich beim Betreten ein bisschen verboten an.
Der Strom der Passanten zog mich die Oxford Street entlang in Richtung Marble Arch. In dieser großen Geschäftsstraße liegt ein Laden neben dem anderen, ein Kaufhaus übertrumpft das nächste durch noch raffiniertere Arrangements, noch elegantere Farben in den Auslagen.
Es fühlte sich berauschend an, Teil dieser Stadt zu sein. Ich liebte alles an ihr. Diese Lässigkeit, die Überraschungsmomente und diese herrliche Lautstärke, die eine tieffliegende Boeing über mir scheinbar lautlos durch die Luft gleiten ließ.
Schon tauchte die neoklassizistische Fassade von Selfridges auf, die eher an einen römischen Tempel als an ein Kaufhaus erinnert. Die Säulen wuchsen vor mir in die Höhe, die Fahnen am Rand der Dachterrasse flatterten zum Himmel, die Königin der Zeit breitete ihre Bronzeflügel über dem Eingang aus, als mache sie sich bereit zum Abflug.
Meistens sah ich mir hier nur die Schaufenster an. Es gibt keine sensationelleren, keine verrückteren als die bei Selfridges in der Oxford Street. Explodierende Flugzeugturbinen, blau schimmernde Unterwasserwelten oder ganze U-Bahn-Züge, alles war möglich!
An diesem Tag ließ ich mich von der schweren Bronzedrehtür ins Innere schubsen.
Eine Mixtur von edlen Parfüms schwebte in der Luft, und ich atmete tief ein, um den wunderbaren Duft nach Eleganz und Luxus in mich aufzunehmen.
Überall an den Ständen der verschiedensten Kosmetikmarken tippelten zu stark geschminkte Angestellte in den typischen kleinen schwarzen Kostümen herum. Sie umschwirrten Kundinnen, die vor ihnen auf Barhockern sitzend mit geschlossenen Augen darauf warteten, noch schöner zu werden.
Auf der Rolltreppe glitt ich nach oben zu den Designergalerien, die wie eine Kunstausstellung mit unzähligen Sitzgelegenheiten wirkten. Die Stühle, Chaiselongues und Sessel waren alle von Puppen besetzt, als wären die ermüdeten Besucher zu Pappmaché erstarrt.
Die Kunstobjekte bestanden aus schwereloser Seide, weichen Wollstoffen, gewichtigem Jacquard und schimmernder Spitze. Manche Designer hatten ihre Modelle nach Farben geordnet. Ganze Wände hingen voll verschiedener Grüntöne, und dann gab es wieder eine Ecke nur in Rosa, als hätte jemand mit einem riesigen Pinsel die verschiedenen Röcke, Kleider, Blusen und Kostüme angestrichen.
Auch hier standen Angestellte im kleinen Schwarzen herum. Sie musterten mich abschätzend, so dass ich schnell an mir heruntersah, ob auch alles in Ordnung war.
Ich drehte mich im Kreis. Roberto Cavalli, Pucci, Valentino, ich war ein wenig unschlüssig und steuerte dann auf Stella McCartney zu. Ich berührte ein nachtblaues Modell aus kostbarem Seidentaft. Sofort stand eine Verkäuferin hinter mir, als besäße das Kleid einen Überwachungssensor. Sie nahm es von der Messingstange, hielt es mir prüfend an und behauptete, es sei wie für mich gemacht. Dieses Kleid habe geradezu auf mich gewartet!
Das bedauernswerte Kleid würde wohl weiter warten müssen. Ich konnte mir nichts aus der Designeretage dieses Kaufhauses leisten. Genau genommen hätte es nicht einmal für ein Haargummi bei Selfridges gereicht. Trotzdem ließ ich mich mit der Gelassenheit des vermögenden Kunden zur Anprobe bringen.
Schwarze Schuhe klackten vor mir über den Marmorboden, der Stoff vor der Kabine wurde wie ein Theatervorhang aufgerissen und gleich darauf magisch von meinen Beinen angezogen. Die Luft war elektrisch geladen wie vor einem kräftigen Wetterumschwung. So viel stand fest: Etwas Außergewöhnliches würde passieren!
Ich streifte das Kleid über und ließ mir beim Reißverschluss helfen. Der Stoff duftete nach Puder. Ist es nicht erstaunlich, dass sich unerreichbare Dinge ganz anders anfühlen als alltägliche? Ich sah an mir herunter. Der schwere Seidentaft bauschte sich genau an den richtigen Stellen, ohne aufzutragen. Ich erforschte die Nähte und fand schnell heraus, wie die Passform erreicht worden war. Bedauerlicherweise hatte ich keine Nähmaschine mehr, aber ich würde schon jemanden finden, der mir aushelfen konnte. Das Kleid sollte rechtzeitig fertig sein.
Entspannt bog ich den Rücken durch und drehte meinen Kopf dem körperhohen, schwenkbaren Rückspiegel zu. Die doppelte Reflexion irritierte mich, und ich strich den Taft zunächst an der falschen Seite glatt. Amüsiert beobachtete ich mich selbst, als würde ich eine Fremde auf einer Party begutachten. Billiger Bettelschmuck zum Designerkleid, eine aufgekratzte Stelle an der Wade, lange, in den Spitzen fransige, helle Haare, nichts passte zusammen, und alles wirkte deshalb frisch und unbekümmert. Ich schätzte das Alter dieser Frau, die ich nur von hinten sah, auf Mitte zwanzig. Das war Mimi Balu! Äußerst fotogen, hochtalentiert und mit einer besonderen Stimme beschenkt.
Ich hatte es bis nach London geschafft. Von hier aus sollte es weitergehen in die Welt! Meine Fantasie war grenzenlos. Ich konnte mir alles vorstellen. Einen Wanderpfad auf dem Regenbogen, ein Kleid aus Seifenblasen und mich selbst vor einem Millionenpublikum.
Der Grund für meine Zuversicht war nagelneu und wartete in meinem Wohnzimmer auf mich. Ich hatte einen Peavey-Bassverstärker gesponsert bekommen! Und warum auch nicht? Katie Melua bekam von Opel eine ganze Tour spendiert.
Ich verschwendete keinen Blick an den Frontspiegel, drückte der Frau im schwarzen Kostüm nachlässig das Kleid in den Arm, fuhr die Rolltreppe hinab und nahm die Illusion mit nach draußen.
Von hinten war meine Welt noch in Ordnung.
Von vorn war ich zu diesem Zeitpunkt neununddreißig Jahre alt. Außerdem heiße ich eigentlich Michaela Balutzke und stamme aus Limbach-Oberfrohna.
An diese Tatsachen dachte ich damals nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Nirgendwo war es leichter gewesen, die zu werden, die ich sein wollte, als in einem Land, in dem eine simple Telefonrechnung genügte, um sich ausweisen zu können. Und hier, in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, hatte ich endlich meine Bestimmung gefunden. Angesichts der Tatsache, dass andere ihre Bestimmung niemals finden, lag ich ganz gut in der Zeit.
Den Bassverstärker brauchte ich, weil ich zwei Wochen zuvor mit Eva in Muswell Hill gewesen war, in dieser Presbyterianerkirche, die sie zu einem Pub umfunktioniert hatten. Eva stammt aus Polen und wohnte damals bei mir im Haus. Wir kamen gerade in den Pub, als Abbys Band spielte. Abby ist eine waschechte Londonerin, deren kenianische Familie sich schon vor zwei Generationen hier angesiedelt hatte. Sie tobte über die Bühne und lieferte sich mit dem Publikum eine Wurfschlacht mit biergefüllten Plastikbechern.
Zu unserem großen Glück ließen die anderen Musiker sie unmittelbar nach dem Auftritt sitzen. Noch in der gleichen Nacht gründeten wir drei die Band Girls Club: Abby natürlich an der Gitarre, Eva am Schlagzeug, und ich wollte singen! Nun fehlten uns nur noch ein Bass und jemand, der ihn spielen konnte. Wie gut, dass ich Mike kannte, der die Frontscheiben im Café Renoir polierte und eigentlich Bassist war. Er sollte mir die Grundlagen zeigen!
Am nächsten Morgen tauschte ich wie Hans im Glück beim Cash Converter an der Ecke meine Bernina-Nähmaschine gegen eine schwarz-rote Wesley-Bassgitarre ein. Wie jedes Mal verließ ich den Laden höchst zufrieden, auch wenn in mir wie immer irgendetwas argwöhnte, schlechter weggekommen zu sein.
Mike borgte mir für den Anfang einen Miniverstärker, damit wir proben konnten. Und nun, zwei Wochen später, hatten wir schon unser erstes Demoband aufgenommen, Fotos gemacht, Flyer von uns drucken lassen, und ich besaß meinen eigenen, hochwertigen, unglaublich gut klingenden Verstärker!
Alles, was uns jetzt noch fehlte, war neben eindrucksvoller Bühnengarderobe ein erster Auftrittsort.
Der war gar nicht so leicht zu finden in dieser Stadt, in der jeder Briefträger, jeder Kellner und jeder Straßenkehrer im Grunde seines im Backbeat schlagenden Herzens Musiker war. Ich hatte unsere Demoaufnahmen schon in unzähligen Clubs und bei verschiedenen Veranstaltern hinterlassen und wollte nun noch ein paar Pubs in der Nähe meiner Wohnung ablaufen. Ich lebte damals im Künstlerviertel Camden Town im Norden Londons.
Mit der Northern Line fuhr ich zurück und aß mein Frühstück in der U-Bahn, während ich Zeitung las. Neben mir lackierte sich eine Frau ihre Fußnägel. Wir Londoner lieben unser transportables Wohnzimmer! Es spart Zeit, und man muss es am Abend nicht aufräumen. Kurz bevor ich ausstieg, schminkte ich mich nach – mein Lippenstift war zusammen mit dem Müsliriegel verschwunden – und bürstete mir die Haare. Ich hatte das Gefühl, dass ich es diesmal anders angehen sollte.
The World’s End ist ein traditioneller Eck-Pub in leuchtendem Dunkelrot direkt gegenüber der U-Bahn-Station Camden Town, die an den Wochenenden immer wegen Überfüllung geschlossen werden muss. Die Kreuzung, an der ein Spinnennetz von Straßen aufeinandertrifft, ist Sammelpunkt für Fahrzeuge, Menschen und Missionare.
Ich drückte die Schwingtür auf, und der Lärm draußen wurde durch den Lärm im Inneren übertönt.
Es war ein sehr großer Pub, und doch wirkte er gemütlich durch die olivgrüne Tapete mit den Barockmustern, das dunkle Holz, die vielen Séparées, die samtbespannten Treppen, die nach oben und unten führten, und die Erweiterungen in die hinteren Räume, in denen es statt dunkler immer heller wurde. Durch eine verglaste Eisenkuppel fiel Licht auf die Barinsel herab. Es war, als betrete man eine Theaterkulisse, die einen Marktplatz mit Ladenstraße, Terrasse und überdachter Markthalle vorgaukelte.
Ich zog mir einen Hocker an die Bar und bestellte zwei Guinness. Das eine schob ich dem Barkeeper gleich wieder hin, und so kamen wir ins Gespräch. Er hatte eine Rockabilly-Frisur, und mir gefielen die Tarotkarten auf seinem Arm. Er fragte nach meiner Telefonnummer, und ich schrieb sie ihm auf einen Bierdeckel. Sofort tippte er sie in sein Telefon und klingelte mich an, damit ich auch seine Nummer hätte, wie er sagte. In Wahrheit wollte er natürlich testen, ob ich ihn nicht an der Nase herumführte. Da ich seinen Namen sofort wieder vergessen hatte, speicherte ich ihn unter »Barkeeper World’s End« ab und kam zu meinem eigentlichen Anliegen.
Unter dem Pub war das Underworld. Und genau dort wollte ich mit Girls Club spielen. Der Barkeeper nahm meine CD und versprach, ein gutes Wort für mich einzulegen. Ich wusste, wie wenig ernst das zu nehmen war und dass ich dranbleiben musste.
Als er mich beim Verbschieden fragte, woher eigentlich mein Akzent käme, fiel mir wieder ein, dass ich aus Limbach-Oberfrohna stamme. Schlimmer noch: dass ich schon am nächsten Tag dorthin aufbrechen würde.
Ich kehrte nicht oft nach Limbach-Oberfrohna zurück, meistens nur zu den unumgänglichen Feiertagen. Alle waren davon überzeugt, dass auch ein vierzigster Geburtstag dazuzählte. Vermutlich deshalb, weil sich das Lebensalter ähnlich der Körpertemperatur verhält. Alles über vierzig ist bedenklich und könnte schlimm enden.
Ich kann nicht sagen, dass ich ungern in meine Heimat reiste, aber dieser Geburtstag erwischte mich zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Es fühlte sich an, als würde ich mitten in einem Pubquiz weggerufen, bei dem mein Team gerade dabei war, zu gewinnen.
Deshalb war ich ein wenig ungehalten wegen der Aufmerksamkeit, die mir die bevorstehende Reise abverlangte. Aber der Flug war längst gebucht, und meine Familie erwartete mich. Mit der gleichen Intensität, mit der ich mich eigentlich um meine Zukunft kümmern wollte, musste ich mich nun um meine Vergangenheit bemühen. Schließlich hatte ich in Limbach-Oberfrohna einen Ruf zu verteidigen.
Um meine Welterfahrenheit und Stilsicherheit zu unterstreichen, brachte ich jedes Mal ausgefallene Geschenke mit. Dinge, die heute als ganz alltäglich angesehen werden, wie diese übergroßen Brillen mit Fensterglas oder das universell einsetzbare Designmotiv des Schnurrbarts, führte ich in Deutschland ein. Der Infektionsherd für ihre Verbreitung über die ganze Republik liegt in Limbach-Oberfrohna.
Solche Zauberdinge fand ich auf dem Camden Market. Ich mochte das Gedränge, das Gewirr verschiedener Sprachen, die Punks, die Mods, die Cyberfans, die schreiend bunten Häuserfassaden, alles so unterschiedlich wie nicht zusammengehörende Puzzleteile, die jemand mit einem Gummihammer passend geklopft hatte. Und ich klemmte mittendrin.
Ich betrat den Markt am Gilgamensch, einem panasiatischen Restaurant, und ließ mir an einem Thai-Imbiss eine Kostprobe aufdrängen. Danach verlor ich mich in den engen Gängen des überfüllten Marktes und steckte vorsichtshalber meine Handtasche unter die Jacke. Es war so eng, dass ich nur noch schrittweise vorwärtskam. An einem kleinen Stand kaufte ich Plastikerdbeeren, die sich als Knöpfe verwenden ließen. An einem anderen entdeckte ich ein Paar künstliche Daumen, die in der Dunkelheit glühten und meine Neffen begeistern würden. Das Wichtigste aber hatte ich noch nicht gefunden.
Ich hielt ein Tuch mit asiatischen Motiven hoch und hängte es zurück. Das war nicht das Richtige. Ich ließ meine Finger durch die kleinen Kugeln an einem Perlenstand gleiten und lauschte dem Klackern. Nichts war mir gut genug. Ich ging durch das Tor mit den bronzenen Pferdeskulpturen in die gemauerten Gewölbe des ehemaligen Pferdehospitals. In den von Trödel überquellenden Lattenboxen, in denen früher die Tiere untergebracht worden waren, fand ich schließlich ein silbernes Teesieb. Der Griff war mit einem orientalischen Muster durchbrochen, und das Tropfschälchen ließ sich zur Seite schwenken. Genau so etwas hatte ich gesucht! Oma Trude vertrug keinen Kaffee mehr.
Der Verkäufer bemerkte meine Begeisterung und behauptete, dies wäre ein fantastisches Unikat und eine unglaubliche Rarität, mit der schon Heinrich V. seinen Tee geseiht hätte.
Da es im 14. Jahrhundert noch gar keinen Tee in England gegeben hatte, bekam ich das Sieb dann doch zu einem guten Preis. Vorsichtig wickelte ich es in ein Stück Papier und legte es beinah zärtlich in meine Umhängetasche.
Danach packte ich zu Hause nur noch meinen Koffer. Die Wechselschuhe und einen Pullover musste ich dalassen, sonst hätte mein Handgepäck die von der Fluggesellschaft erlaubten zehn Kilo überstiegen. Ich druckte das Ticket aus und holte meinen Pass. Alles war bereit für die Reise – außer mir.
2.
Eine Reise in die Vergangenheit
Der verständlichste Unterschied zwischen den Einwohnern von Limbach-Oberfrohna und London besteht in ihrer Reaktion auf liegenbleibenden Schnee. Im Vorerzgebirge gehört eine geschlossene Schneedecke von November bis April zum normalen Straßenbild. In London wird Schnee als seltenes Naturspektakel betrachtet und führt zu einer Art Schneefrei für alle.
Die Reisen zu meiner Familie fanden meistens in der kalten Jahreszeit statt.
Nach dem Kalender sollte es längst Frühling sein, aber die Temperaturen lagen nachts immer noch im Bereich des Gefrierpunkts, und ich hoffte bis zuletzt, es würde schneien.
Dann wäre der Flug nämlich gestrichen worden. Ich wäre nicht einmal bis zum Flughafen gekommen, weil der Bus nicht fahren konnte. Es gab keine Räumdienste für die Autobahn. Der Betrieb der U-Bahnen, die oberirdische Teilstrecken hatten, wäre auch eingestellt worden. Bestimmt wäre nicht einmal der Stansted-Expresszug gefahren und auch kein Taxi aufzutreiben gewesen, weil niemand in London Winterreifen besaß. Ich hätte hierbleiben müssen, und es wäre nicht meine Schuld gewesen.
Damit es so weit kam, musste gar nicht viel Schnee fallen. Schon zwei Zentimeter genügten für das wunderbarste Chaos. Dann schlossen die Schulen, ebenso die Kindergärten und Arztpraxen, die Läden, die Kaufhäuser, die Pubs, die Clubs, es starteten keine Flugzeuge, keine Autos verstopften die Straßen, das Leben verstummte, die ganze lärmende Stadt war auf einen Schlag still.
Dieser Zustand galt für den Tag, an dem der Schnee lag, und auch für die beiden darauffolgenden, nur zur Sicherheit.
Aber sosehr ich diesen erlösenden Schnee auch herbeisehnte, so kalt es war, der Himmel blieb klar.
Ich fuhr mit dem Bus zum Flughafen Stansted. Das war die zeitaufwendigste, aber auch die billigste Variante. Der Bus schlich im dichten Verkehr die Autobahn entlang.
Meine Jacke lag auf meinen nackten Knien, und ich fröstelte. Wie die meisten Londonerinnen trug ich keine Strümpfe, und die Zehen, die vorn aus meinen Peeptoe-Pumps herausguckten, waren bläulich angehaucht und fühlten sich an, als ob sie nicht zu mir gehörten. Ich hatte keine andere Wahl gehabt. Es waren nur diese Schuhe in Frage gekommen. Wenn ich nach Limbach-Oberfrohna reiste, musste ich immer darauf achten, dass ich ausreichend Londoner Flair mitbrachte. Im Winter trug ich kurze Hängerkleidchen und große Sonnenbrillen, im Sommer dagegen Pelzstiefel und schicke Strickbaskenmützen. Das genügte in der Regel, um im Erzgebirge Aufmerksamkeit zu erregen.
Immer wenn ich in diesem Bus fuhr, der mich Limbach-Oberfrohna wieder näher brachte, hatte ich das Gefühl, in einer Zeitmaschine zu sitzen. Unweigerlich musste ich daran denken, wie ich zum allerersten Mal mit demselben Koffer, der auch jetzt im Bauch des Busses lag, hier angekommen war.
Nicht einmal ich selbst hätte damit gerechnet, dass ich so lange in London bleiben würde. Es war eben nicht leicht, sich zu entscheiden, wenn es so viele Möglichkeiten gab. Ich musste sie doch alle ausprobieren! Wie sonst sollte ich meine wahre Bestimmung finden? Wer niemals einen Sidecar getrunken hat, kann unmöglich wissen, ob er ihn scheußlich findet oder zu seinem neuen Lieblingsgetränk erklärt.
Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätte ich die letzten zwanzig Jahre in der Bäckerei meiner Eltern in Oberfrohna hinter der Ladentheke verbracht und Bierbrötchen, Roggenecken oder Milchhörnchen in graubraune Papiertüten stopfen müssen. Das war seit Generationen die Bestimmung der Frauen in meiner Familie.
Mein Vater gibt der nicht mehr existierenden Mauer die Schuld, dass es nicht nach Plan gelaufen war. Wer das Gatter öffnet, muss sich nicht wundern, wenn alle Kaninchen davonstieben.
Im Sommer 1990, drei Monate nach meinem zwanzigsten Geburtstag, war der richtige Moment gekommen, in dem ich alles hinter mir lassen konnte.
Im Leben eines jeden Menschen gibt es einen unwiederbringlichen Moment, in dem er seine Bedeutung ändern kann, wenn er nur das Richtige tut. Norma Jeane Mortenson Baker entschied sich für Blondiercreme und einen Künstlernamen. Rosemarie Nitribitt ließ sich ermorden. Wenn der richtige Moment da war, durfte man nicht zimperlich sein. Oma Trude hatte ihren verpasst. Mir sollte das nicht passieren.
Das erste Mal hörte ich von London, als ich noch sehr klein war, und es erschien mir wie die Smaragdenstadt. Ein unwirklicher, magischer Ort, an dem alles möglich war! Oma Trudes Bruder Ernst, der Omas Mädchennamen Schulze trug, hatte versucht, eine Geschäftsverbindung dorthin aufzubauen, und wenn der Krieg nicht dazwischengekommen wäre, wäre der Schulzekuchen jetzt vielleicht so bekannt wie die Sachertorte. Aber Ernst fiel, Opa Herrmann heiratete meine Großmutter und steuerte das Unternehmen sicher und ohne hochfliegende Expansionspläne durch unruhige Zeiten. Ihm war es zu verdanken, dass die kleine Privatbäckerei der Familie Balutzke den Untergang der DDR ebenso unversehrt überstand wie den des Dritten Reiches und der Weimarer Republik.
Ich hatte aufgrund fehlender Alternativen eine Lehre als Bäckereifachverkäuferin durchlaufen, und es sah ganz so aus, als würde auch ich der Familientradition folgen. Aber wenn ich im Laden meiner Eltern stand, spürte ich ganz deutlich, dass noch etwas anderes kommen musste. Ich trat auf dem Stadtparkfest vor großem Publikum auf. Ich malte die Plakate für den Tag der offenen Tür an meiner Berufsschule. Ich war jahrelang Mitglied der Tanzgruppe Mata Hari in Hohenstein-Ernstthal. Und damit schienen alle Möglichkeiten meiner Heimat ausgeschöpft zu sein.
An dem Tag, an dem ich mein Abschlusszeugnis erhielt, verriet ich meinen Eltern, dass mir etwas Größeres vorschwebte. Das ganze Land war in Aufbruchsstimmung! Da würde ich bestimmt nicht in Limbach-Oberfrohna bleiben. Ich wollte dorthin, wo Billy Idol und Helena Bonham Carter wohnten!
»Aber wieso denn ausgerechnet London?«, stammelte meine Mutter immer wieder wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat.
»Weil es nicht Limbach-Oberfrohna ist«, war meine Antwort.
»Aber dann könntest du doch nach Karl-Marx-Stadt gehen! Das ist auch nicht Limbach-Oberfrohna.« Meine Mutter glaubte einen Ausweg gefunden zu haben.
»Chemnitz! Das heißt jetzt wieder Chemnitz!«, verbesserte sie Oma Trude triumphierend. Erst im Juni desselben Jahres hatte die Stadt nach einer Volksabstimmung ihren alten Namen zurückerhalten, und wir mussten uns erst noch daran gewöhnen. Nur Oma Trude nicht. Sie war immer beharrlich bei Chemnitz geblieben und freute sich, dass sie recht behalten hatte.
»Ich will in eine Weltstadt, mit Festivals und Konzerthallen!«, erklärte ich.
Meine Mutter holte ihren letzten Trumpf heraus: »Aber in Chemnitz gibt’s die Stadthalle!«
Kurze Zeit später saß ich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Flugzeug und düste meinem Schicksal davon.
Meine Ankunft in London war wie eine Landung auf dem Mars. Ich stieg in der Liverpool Street im Zentrum aus dem Zubringerbus, stand am Straßenrand und schnappte nach Luft. So muss sich Kaspar Hauser gefühlt haben, als er das erste Mal nach Nürnberg kam. Ich stammte aus einer verträumten Kleinstadt im tiefsten Ostdeutschland, wo die westliche Konsumkultur in einer zum Diska-Markt umfunktionierten Turnhalle gipfelte. Das gigantische London überrollte mich mit seinen verrückten Menschen, der eigenartigen Mode, den paradiesischen Plattenläden, den Drogerien, den Obstständen, dem Verkehr und den sagenhaften, rund um die Uhr geöffneten Supermärkten.
Eigentlich hatte ich nur ein einziges Jahr bleiben wollen. Ein Jahr kann sehr lang sein, wenn man wie meine Mutter, Renate Balutzke, allein im Bäckerladen steht, keine Vertretung für die Toilettenpause hat und darauf hofft, dass die einzige Tochter endlich wieder zur Vernunft kommt. Aber ein Jahr war viel zu kurz, wenn man viele Talente besaß und nicht sicher war, worin das größte bestand. Ich wusste damals nur: Es musste noch etwas Besseres kommen! Und es war sehr unwahrscheinlich, dass ich es in Limbach-Oberfrohna finden würde.
Mir schwirrte der Kopf von der verwirrenden Fülle an eintrittsfreien Museen und überquellenden Läden, ich konnte mich kaum entscheiden zwischen all den wunderbaren Freilichttheatern und Galerieangeboten, den Club-Konzerten und riesigen Festivals in den blumenüberwucherten Parks. Hypnotisiert taumelte ich hin und her wie eine der Wespen, die sich immer wieder in die Bäckerei Balutzke verirren und im Zuckerrausch nicht wissen, von welchem Kuchen sie zuerst naschen sollen.
Meine ersten Londonjahre verbrachte ich als Au-pair-Mädchen im Haus einer wohlhabenden griechischen Familie im reichen und sicheren Kensington. Ich wohnte damals in einem Haus mit weißen Säulen und Palmen davor, über dessen Eingang sich verschwenderisch blühender Blauregen rankte. Es war eines dieser typischen schmalen englischen Reihenhäuser, die auf jeder Etage nur zwei Zimmer haben und in deren Mitte sich ein enger Treppenschacht nach oben windet. Das machte den Transport meines Bettes in die Dachkammer zu einem tagfüllenden Problem, das mit dem Leistenbruch eines hilfsbereiten Nachbarn endete.
Manchmal führten mich Besorgungen in die elegante Kensington High Street, und ich schlenderte bis zu St. Mary Abbots, einer hübschen, neugotischen Gemeindekirche. Wenn ich am Blumenstand vor dem Kirchentor vorbeiging und die Glocken zufällig läuteten, hielt ich jedes Mal entzückt an und ließ Blumenduft und Töne auf mich einprasseln. Scheinbar ungeordnet und überschwenglich tönten sämtliche der zehn verschieden gestimmten Glocken durcheinander und überschütteten mich mit einem lärmenden Klangteppich. So fühlt es sich noch immer an, wenn ich glücklich bin.
Ich betreute in dieser Zeit den kleinen Niklas und lernte nebenbei nahezu perfekt Englisch sowie die wichtigsten griechischen Schimpfwörter. Ich liebte Niklas wie ein eigenes Kind, und in meiner Erinnerung nimmt die Zeit mit ihm einen so mächtigen Raum ein, dass ich beinahe glaube, damit meine Schuldigkeit für die Fortpflanzung der Menschheit getan zu haben.
Am liebsten wanderte ich mit Niklas über den Brompton-Friedhof, in dessen Nähe wir wohnten. Zwischen halb versunkenen, von Süßdolde und wilden Hyazinthen überwucherten Grabsteinen spielte ich Theater für ihn. Ich schaffte es, dass mein Schützling vor Entsetzen schrie, wenn ich mich in einen Wolf verwandelte und seinem kleinen Plüschschweinchen näherte. Am Ende schluchzte er vor Erleichterung, weil Jäger Mimi alle rettete, das Schweinchen, Niklas und ein paar zufällig vorbeikommende Spaziergänger. Ich verneigte mich ausdauernd, um das Abklingen des Beifalls noch ein wenig hinauszuzögern und den beglückenden Rausch zu verlängern, der mich in etwas Besonderes verwandelte.
Solange ich in Kensington wohnte, bekam ich gelegentlich Besuch von meiner Cousine Carmen. Sie durfte dann in meinem Zimmer schlafen, die Eltern von Niklas luden uns zum Essen ins Ritz ein, und wir fühlten uns großartig. Ich ging gern mit Carmen aus. Sie ließ mich nicht wie meine einheimischen Freundinnen für einen romantisch aussehenden Mann oder ein kostenloses Getränk mitten in der Nacht im wildesten Osten Londons einfach stehen.
Aber dann kam Niklas in die Schule, und ich wurde nicht mehr gebraucht. Damit verlor ich nicht nur eine angenehme Arbeit und ein freies Zimmer im unbezahlbaren Kensington, auch mein Publikum kam mir abhanden. Ich musste ein neues erobern und Schauspielerin werden. Also buchte ich einen Abendkurs an der Kunst- und Designschule Saint Martins und tröstete mich mit dem Gedanken, nach Kensington zurückzukehren, sobald ich den Filmpreis der Britischen Akademie gewonnen hatte.
Und noch etwas veränderte sich. Meine sonst so geduldige Mutter hatte das Warten satt, und Carmen nahm den Platz neben ihr im Laden ein, obwohl diese gar nicht Balutzke heißt und eigentlich Näherin im VEB Feinwäsche gelernt hat. Das trübte unser Verhältnis nachhaltig.
Plötzlich hatte ich das Gefühl, als nähme die Welt keine Notiz von mir. Sobald ich einen Ort verließ, verlor ich den Einfluss darauf.
Carmen kam danach nicht mehr. Sie gab vor, im Laden unersetzlich zu sein. Später war sie wirklich mit ihren Jungs ausgelastet. Auch sonst besuchte mich niemand aus Limbach-Oberfrohna. Mein Vater behauptete, die Bäckerei nicht einfach schließen zu können, und traute dem Flughafenpersonal nicht. Meiner Mutter wurde es schon schwindlig, wenn sie ein Leinsamenbrot verkaufen musste, das in der obersten Regalreihe lag und nur unter Benutzung des Trittbänkchens erreicht werden konnte. Und Oma Trude verreiste nicht mehr, seit Opa Herrmann gestorben war.
Ich probierte es mit Wohnungen in Tottenham und Chingford, aber sie waren zu abgelegen. Ich brauchte das Pulsieren der Großstadt und das rhythmische Rumpeln der U-Bahn, irgendwo in der Tiefe unter meinem Schlafsofa. Sonst hätte ich schließlich auch in Limbach-Oberfrohna bleiben können.
Meine mehrjährige Bäckereifachverkäuferinnenlehre erwies sich bei der Arbeitssuche als keine große Hilfe. In London kann jeder nach ein paar Minuten Einarbeitungszeit Lebensmittel verkaufen. Ich begann zu kellnern und schloss den Schauspielkurs mit Auszeichnung ab. Oma Trude war sehr stolz auf mich. Leider zeigte sich, dass die Hälfte der Londoner Bevölkerung aus Schauspielern bestand. Es war beinahe unmöglich, ein festes Engagement, eine Agentur oder auch nur einen Gelegenheitsauftritt zu bekommen. Während ich im Café Nero die Espressomaschine bediente und dabei die wesentlichen italienischen Schimpfwörter lernte, kam ich ins Grübeln. War Schauspiel wirklich meine Bestimmung? War es so sehr meine Leidenschaft, dass ich bereit war, mein Leben in der um mehrere Häuserblocks reichenden Warteschlange für ein Vorsprechen zu verbringen? Gab es noch einen anderen Weg für mich?
Ich beschloss, an einem Kunstkurs bei city lit in Covent Garden teilzunehmen. Aus unzähligen Ausgaben der kostenlosen U-Bahn-Zeitung METRO und viel Kleister schuf ich eine zwei Meter hohe Papierskulptur von Rübezahl und gewann damit den alternativen Kunstpreis des Stadtteils Shoreditch. Leider schreckte die Unhandlichkeit der Skulptur potenzielle Käufer ab, und die Fluggesellschaft weigerte sich, sie nach Limbach-Oberfrohna zu transportieren. Rübezahl verstopfte den Hausflur und verschwand eines Nachts daraus. Ich verdächtigte damals einen Kunstschmugglerring, dem diverse Einbrüche in verschiedenen Villen zugeschrieben wurden. Heute bin ich mir über diesen Punkt nicht mehr ganz sicher.
Dieser Vorfall machte mir bewusst, dass bestimmte Richtungen der bildenden Kunst gewisse praktische und logistische Probleme aufwerfen. Deshalb besuchte ich anschließend einen Kurs für Malerei. Meine Bilder waren in der Regel zweidimensional, und ich konnte sie platzsparend an die Wand hängen oder hinter einen Schrank stellen. Aber auch die Malerei hat ihre Nachteile. Leinwände sind sehr teuer, Ölfarben ebenfalls, und wenn ich vergaß, meine Pinsel mit Terpentin auszuwaschen, wurden sie knochenhart wie die Brotreste, die meine Mutter zur Herstellung von Semmelbröseln verwendet.
Ich glaubte, einen Kompromiss eingehen, etwas praktischer denken zu müssen, und meldete mich für einen Visagistenkurs an. Immerhin gibt es bei der Oscar-Verleihung eine eigene Kategorie für Make-up-Artisten. Ich lernte, Theatermasken zu schminken, und investierte mein letztes Geld in einen gut ausgestatteten Schminkkoffer. Anschließend besuchte ich noch einen Hutmacherkurs. Das hatte keinen besonderen Grund. Ich mag Hüte einfach. Danach kam, wenn ich mich recht erinnere, die Schnittmusterklasse, geleitet von einer exzentrischen Zypriotin, die herrlich fluchen konnte, wenn sie sich mit einer Stecknadel in den Finger stach.
Als Visagistin und auch als Schneiderin bekam ich lediglich kleine, unbezahlte Aufträge. Es gab einfach zu viele Mitbewerber. Mir dämmerte die unangenehme Erkenntnis, dass es bessere Chancen in den Arbeitsbereichen gab, die keinerlei Vergnügen machten. Ein ganzes Wochenende quälte ich mich durch einen Klempnerkurs in Edgware, geleitet von Julio, den ich allerdings sehr mochte. Er brachte uns die Abflussanschlussarten und alle für die Montage notwendigen spanischen Schimpfwörter bei. Ich erhielt ein Diplom und das Selbstvertrauen, die Toilette meines Vermieters zu reparieren. Es misslang mir gründlich. Brauchte es einen eindeutigeren Beweis, dass ich wirklich künstlerisch begabt war?
Im Laufe der Zeit sammelte ich Diplome als Sängerin, Ausdruckstänzerin und Stoffdruckerin, aber ich erhielt auch Zertifikate in nützlichen Gewerken, wie dem Massieren und Frisieren, und ich besaß sogar einen Abschluss in Konfliktmanagement. In jedem dieser Berufe versuchte ich mich. Ich arbeitete in einem thailändischen Schönheitssalon. Dort ging es sehr gesittet zu, und es wurde nicht besonders viel geschimpft. Danach bediente ich in einer schlecht besuchten libanesischen Bar, wo ich am Anfang in Naturalien ausbezahlt wurde und, als ich mich in den Besitzer verliebte, nicht einmal mehr das. Daraufhin fing ich in einem Friseursalon an, in dem die nassen Kundenhandtücher nicht in die Waschmaschine, sondern lediglich in einen Trockner geworfen wurden. Ich arbeitete in einer Werbedruckerei, wo ich Steven kennenlernte, mit dem ich eine Zeitlang zusammenlebte. Ich hätte nicht wieder bei ihm ausziehen sollen, denn ich besitze noch heute mindestens fünfhundert Künstler-Visitenkarten mit dieser Adresse, die ich unentgeltlich für mich drucken durfte. Danach stapelte ich Kartons in einem Supermarktlager, und zwischendurch bediente ich immer wieder in Cafés und Teehäusern. Am liebsten wurde ich als Putzfrau eingesetzt, denn meine deutsche Abstammung suggerierte einen besonderen Sinn für Sauberkeit. Manche Arbeit machte mir Spaß, andere brachte Geld, aber all die Jobs, all die Beziehungen, all die Projekte, auf die ich mich im Laufe dieser Zeit einließ, waren nicht das, wonach ich gesucht hatte, nichts, worauf ich mich festlegen mochte. Es schien mir, als wäre alles nur eine Kostümprobe und nicht das wirkliche Leben. Immer fehlte das Gefühl von Vollkommenheit. Abgesehen davon musste ich bemerken, dass feste Arbeitszeiten und feste Beziehungen die Kreativität bremsen.
Das Leben in London war schon immer teuer. Ich war nicht besonders anspruchsvoll und kaufte bei Billigketten wie Tesco und Primark. Ich guckte mir bei den anderen Frauen all die kleinen Tricks ab, mit denen sich Geld sparen lässt. Ich huschte mit nassen Haaren zum Friseur, damit ich nur das Schneiden bezahlen musste. Am Abend ging ich im schulterfreien Kleid ohne Jacke aus, um die teuren Garderobengebühren in den Clubs zu vermeiden. Und nur wenn ich es gar nicht mehr aushielt, ging ich ins Theater. Ich sah Judi Dench in Madame de Sade, erkannte, dass ich niemals die Größe dieser kleinen Frau haben würde, und war froh, nach einer Alternative zur Schauspielerei gesucht zu haben. Und obwohl ich also sparsam lebte, wollten Miete und Kurse und Kleider bezahlt werden, Lebensmittel musste ich an manchen Tagen auch einkaufen, und an anderen lud ich mich bei Freunden ein.
Trotzdem brauchte ich mir niemals ernsthafte Sorgen zu machen. Ich besaß einen großherzigen Kunstmäzen, der mit unumstößlicher Gewissheit an mich glaubte. Es gab jemanden, der unter dem Siegel der Verschwiegenheit die Farben für meine Malereien, diverse Tanzschuhe, mein Mikrofon, die Stoffe für die Bühnengarderobe und gerade eben meinen nagelneuen, unglaublich gut klingenden Bassverstärker bezahlt hatte. Jemanden, der die Rechnungen der Collegekurse übernahm und, ohne dass ich es aussprechen musste, wie durch die Kraft der Telepathie, am Klang meiner Stimme spürte, wenn es ganz schlimm stand, und dann stillschweigend die Miete für mich überwies.
Mein Sponsor saß in Limbach-Oberfrohna und hieß Oma Trude.
Der Gedanke, dass am Ende meiner Reise Oma Trude auf mich wartete, versöhnte mich ein wenig mit meinem Schicksal, das mich im entscheidenden Moment weit weg von London führte.
3.
Grüne Klitscher
Der anstrengendste Unterschied zwischen den Einwohnern von Limbach-Oberfrohna und London ist ihr Umgang mit der Nachtruhe. In Limbach-Oberfrohna wird sie sehr ernst genommen und notfalls mit Hilfe der Polizei durchgesetzt. In London existiert sie gar nicht.
Ich startete auf dem glitzernden Großflughafen London Stansted mit seinen Hunderten von Läden, Restaurants, Cafés und Bars und landete im Thüringischen, auf einem alten Militärflughafen, dessen Landebahn ein wenig holprig und für mein Gefühl einen Hauch zu kurz war. Der Flugplatz Altenburg in der Nähe meiner Heimatstadt war früher ein Fliegerhorst gewesen und später lange Zeit von der Roten Armee besetzt. Es gab meistens nur diesen einen Flug am Tag, und die einzige Bewirtungsmöglichkeit für hungrige Reisende bestand aus einer Bockwurstbude. Ich vermute, die Abneigung meines Vaters, ein Flugzeug zu besteigen, hat hier ihren Ursprung.
Ich verdächtige meinem Vater außerdem, einen Anteil an der traurigen Tatsache zu haben, dass auf diesem Flughafen inzwischen kein Linienverkehr mehr stattfindet.
Draußen vor der Ankunftsbaracke, mit dem Blick auf die grau-braune Menge der erwartungsvollen Angehörigen, fühlte sich die Welt plötzlich klamm an, als trüge ich einen Mantel, den ich zu früh von der Leine genommen hatte.
Ein zitterndes Taschentuchfähnchen markierte die Stelle, an der Oma Trude stand. Meine Mutter reckte ihren Kopf nervös und ruckartig wie ein Huhn und versuchte, mich zwischen den herausströmenden Reisenden zu entdecken. Unter ihrem Mantel blitzte der weiße Ladenkittel hervor. Obwohl die beiden nicht blutsverwandt sind, ähnelten sie einander. Sie trugen beige Mäntel im gleichen Stil, und ihre Löckchen lagen besonders straff an den Köpfen an. Sie hatten zur Feier meiner Ankunft beim gleichen Friseur ihre Haare auffrischen lassen, aber nun ruinierte das feuchte Wetter alles. Hinter ihnen steckte mein Vater seinen Kopf aus dem alten VW-Transporter, den meine Mutter manchmal zum Ausliefern von Bestellungen benutzte. Er wollte es nicht riskieren, das Auto zu verlassen, weil er in einer Kurzzeithaltebucht stand.
Wir umarmten uns verlegen, und mein Vater tätschelte mich, ohne seinen Sitz zu verlassen. Aus seinem Ärmel quoll schwallweise der warme Hefeduft, der alle Balutzkes umhüllte und bei jeder Bewegung aus den Falten und Öffnungen der Kleidung dampfte, mir aber nicht mehr anhaftete. Ich roch nur nach billigem Haarspray. Vielleicht fühlte ich mich deshalb plötzlich so fremd und verloren.
Ich setzte mich mit Oma Trude auf die Mittelbank. Sie wickelte ein Eukalyptusbonbon aus, schob es mir, ohne zu fragen, in den Mund und leckte anschließend mit einer schnellen Bewegung, wie eine Katze, ihre klebrigen Finger ab. Sofort fühlte ich mich ein wenig besser.
Mein Vater beobachtete mich im Rückspiegel.
»Blass bist du geworden, wie ein Käse«, stellte er missbilligend fest. »Du musst mehr Roggenschrot essen.«
»In England gibt es kein Vollkornbrot«, sagte ich geduldig, als hätten wir noch nie über diesen wunden Punkt der britischen Lebensmittelindustrie gesprochen. Mein Vater schnaubte anklagend durch die Nase. Was sollte ein Bäcker von einem Land halten, in dem es nur Weißbrot gab? Ich sah aus dem Fenster, und die Welt erschien mir kahl und trostlos.
»Es gibt heut grüne Klitscher! Die magst du doch so gern!«, versuchte meine Mutter dem Gespräch vom Beifahrersitz aus eine erfreuliche Wendung zu geben. Sie glaubte fest daran, dass sich mit einem soliden Essen sämtliche Probleme aus der Welt schaffen ließen. Bei dem Gedanken an die Kartoffelpuffer musste ich unwillkürlich schlucken.
»Ihr müsst das Kind aufpäppeln«, bestimmte mein Vater.
»Oma Trude wird eine dreistöckige Torte für deinen Geburtstag zaubern!«, stimmte ihm meine Mutter zu.
Oma Trudes Buttercremetorte war berühmt. Allerdings erschienen mir drei Etagen sehr übertrieben. Eigentlich hatte ich gehofft, es würde eine gemütliche, kleine Familienfeier werden. Runde Geburtstage empfand ich als eine Zumutung für alle Beteiligten.
»Ich hab schon die Einladungen verschickt!« Meine Mutter fing mit glücklichem Eifer an, Namen aufzuzählen, mit denen ich nichts anfangen konnte.
Als ich nachfragte, rief sie verwundert: »Der Wennemann Harald! Weißt du nicht mehr? Das ist der, der neben dem Bremsenwerk wohnt und sich früher immer mit den Kubanern geprügelt hat! Und Porstig Lore! Das ist die, die bei der Unterwäschemodenschau im Kulturhaus mitgemacht hat! Das sind alles treue Kunden!«
Jeder gute Limbach-Oberfrohnaer konnte mit einem einzigen treffenden Satz charakterisiert werden. Wer auf dem Stadtparkfest zu viel trank und ein wenig Pech hatte, war sein Leben lang der, dem etwas in die Hose gegangen war. Mit so einem Namenszusatz konnte er nicht als Bürgermeister kandidieren, und egal wie viel er für Wohltätigkeitsorganisationen spendete und wie erfolgreich er in der Schweiz wurde, in Limbach-Oberfrohna blieb er der Hosenscheißer. Die Balutzkes waren die mit der Bäckerei. Und Balutzke Michaela war die, die in London Künstlerin war. An diesem Gedanken fand ich zunehmend Gefallen, während meine Mutter unermüdlich Namen aufzählte. Ich begann mich zu fragen, ob die Torte vielleicht doch ein wenig knapp berechnet worden war.
»Festhalten!«, rief mein Vater und fuhr in eine Haarnadelkurve. Ich wurde an Oma Trude gedrückt, und sie hielt mich fest. Plötzlich fühlte ich mich ganz klein und geborgen. Ich kuschelte meinen Kopf in die weiche Hautfalte unter ihrem Kinn und wusste wieder genau, wie sich ein wackelnder Milchzahn anfühlt, kurz bevor er herausfällt.
Am Fenster fuhren endlose Felder vorbei. Lehmklumpen verschmutzten die Straße, klebten sich an unsere Reifen und wurden wieder abgeschleudert. Der Boden wellte sich sanft, es gab keine Berge, aber es war auch nicht flach. Dazwischen standen verlorene Bauminseln, die von den Traktoren umzirkelt werden mussten. Nur ein paar Bäume, kein richtiger Wald. Hier war alles nur halb, als wäre Limbach-Oberfrohna ebenso unentschlossen wie ich.
Wir fuhren an den ersten Wohnblocks vorbei, an grau-braunen Klötzern aus den Sechzigern. Hier hatten einige meiner Schulfreunde gewohnt.
Sondermann Jan, dessen Gitarre, Verstärker und Mikrofon bei dem Feuer im Strandcafé verbrannt worden waren, und Selle Manuela, die sich in der Kinderdisco im Sportlerheim beim Versuch, Rock’n’Roll zu tanzen, das Bein gebrochen hatte.
»Jan kauft noch immer jeden Tag seine Brötchen bei uns!«, stellte meine Mutter vorwurfsvoll fest.
Daran war er wohl selbst schuld.
Die Häuser wurden größer, zurückgesetzte Villen und Klinkerbauten wechselten einander ab. Als ich damals Limbach-Oberfrohna verlassen hatte, war alles grau gewesen. Jetzt strahlten viele Fassaden in Sonnengelb, Pastellblau, Altrosa, abgesetzt mit weißen Kanten, die den adretten Eindruck unterstrichen.
Das Kopfsteinpflaster bremste die Geschwindigkeit. Vor einem Gemüseladen standen Tische mit Obst und unzählige Pflanztöpfchen. Ein paar Frauen steckten die Köpfe zusammen und begutachteten die Kräuter. Von weitem sahen sie alle aus wie meine Mutter und Oma Trude. Meine Cousine Carmen stand ebenfalls kurz vor ihrer Verwandlung. Als unser Auto vorbeifuhr, stockte das Gespräch, und wir wurden beobachtet, bis wir um die nächste Kurve bogen.
Oma Trude legte großen Wert darauf, dass unsere Familie schon immer in Oberfrohna lebte, in der etwas wohlhabenderen Gegend. Das große Wohn- und Geschäftshaus, in dem sich die Backstube und der Verkaufsraum der Bäckerei Balutzke sowie die Wohnungen meiner Eltern und Oma Trudes befanden, war 1902 errichtet worden. Damals stand über dem Schaufenster noch Bäckerei & Konditorei Schulze. Das Gebäude zeugte von solider Handwerkskunst mit einem Hauch von Eleganz in den schüchternen Stuckverzierungen über den Fenstergiebeln. Als Kind hatte ich sie gar nicht wahrgenommen, sie waren schwarz und zerfressen von Vogeldreck gewesen. Nun leuchteten sie weiß aus dem Taubenblau der liebevoll restaurierten Fassade hervor. Den Balutzke-Schriftzug hatten sie beibehalten, er erinnerte an Kinowerbung aus den Fünfzigern.
Meine Mutter stieg auffällig umständlich aus dem Auto und sah sich dabei immer wieder verstohlen um. Mein schauspielerisches Talent habe ich ganz sicher nicht von ihr geerbt. Endlich entdeckte sie eine wackelnde Gardine im Haus gegenüber. Noch vor dem Abendessen würden alle ihr wichtigen Persönlichkeiten in Oberfrohna wissen, dass die Balutzke Michaela gut angekommen war. Und zur Sicherheit würde sie es auch noch gleich im Laden erzählen.
Durch das Schaufenster konnte ich sehen, wie Carmen mit missmutigem Gesicht Kuchen für eine Kundin verpackte. Es war Hauptverkaufszeit, und mehrere Leute warteten.
Mein Vater legte großen Wert darauf, dass der Laden blitzte und seine Verkäuferinnen Handschuhe trugen. An den Wänden gab es schmucklose weiße Fliesen, spiegelblanke Metallregale, eine auf Hochglanz polierte Glastheke. So zweckmäßig die Ausstattung des Ladens war, so solide war sein Inhalt. Abgesehen von den verschiedenen Brötchensorten und Brotarten gab es nur noch Streuselkuchen, belegt mit verschiedenen einheimischen Obstsorten. Meine Mutter hatte einen Vertrag mit einem der ortsansässigen Bauern und kaufte bei ihm das ganze Jahr über tiefgefrorene Früchte. Die Kuchenrezepte waren alle noch vom Firmengründer überliefert. Es gab keinen Grund, etwas daran zu verändern, denn sie schmeckten unübertroffen nach guter Butter und Heimat.
Das Glöckchen klingelte, als die Tür darunter entlangstrich. Meine Mutter warf noch im Gehen den Mantel ab, zog den Kittel glatt und nahm sofort ihren Platz hinter der Kasse ein.
Ich suchte Carmens Blick. Sie machte keine Anstalten, meinetwegen ihre Tätigkeit zu unterbrechen.
Dieses hochnäsige Nicken sollte mir sagen: »Während du dich in der Welt herumtreibst, arbeite ich.«
Ich hatte nicht vor, mich hinten anzustellen, um meine Cousine begrüßen zu dürfen. Ich war sicher, wir würden uns noch über den Weg laufen.
Mit meinem Vater und Oma Trude ging ich ins Wohnhaus.
Wenn Oma Trude ihren Mantel auszog, unterschied sie sich doch von ihrer Schwiegertochter. Während meine Mutter ein durch und durch praktischer Mensch war, weshalb es mir oft schwerfiel, ihr eine Freude zu machen, liebte Oma Trude ein klein wenig Eleganz. Sie trug über ihrer dunkelblauen Bluse eine Kette aus Perlen, deren Echtheit bei einer Dame ihres Alters natürlich niemand anzweifeln würde.