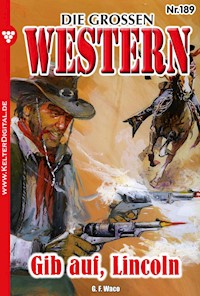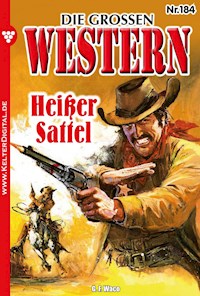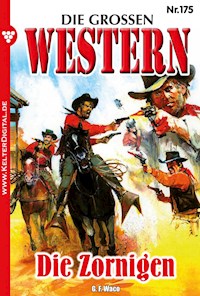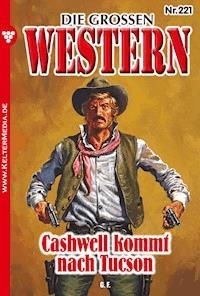Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Hier ist Oregon! Ein Land, das den Biber in seinem Wappen führt und dessen Regenfall knappe zweiundzwanzig Zoll im Jahr beträgt. Ein Land der Sonne und des Windes. Ein Land, dessen Menschen immer kämpfen müssen. Ein Land der Prärien und der Berge. Berge, die so hoch sind wie die Alpen oder die kaukasischen Felsriesen. Gletscher und murmelnde Bäche – Biber, die neugierig ihre Köpfe aus den Erdhöhlen an Flüssen stecken. Und da ist die Wüste. Eine weite Fläche von den Cascade Ranges bis zu den Steen Mountains im Osten. Zweihundert Meilen Wüste. Lavafelder aus Urzeiten her und kleine Kraterseen. Diese Wüste droht. Sie greift nach jedem Reiter. Und viele läßt sie nicht los. Bleiche Knochen im Sand, über die der Wind hinwegzieht und die langsam begraben werden. Viele bleiche Knochen, die viele grausame Geschichten erzählen. Da ist die Stadt Eugene, und nordwestlich von ihr die University of Oregon. Viele dicke Bücher in den Regalen. In einem steht die Geschichte eines Mannes. Man hat diese Geschichte festgehalten. Zur Ehre und zur ständigen Mahnung an die Lebenden. Vielleicht waren sie Helden, diese Männer in einem wilden Land. Hier ist er: James Monty Terrigan Delaware. Kein großer Mann der Figur nach. Kein Mann, dem man ansah, daß er ein Kämpfer war. Und der es doch auf eine fast grausame Art dazu brachte, daß sein Name in diesem Buch steht. James Delaware. Schlank und falkenäugig. Braungebrannt und sehnig. Am ganzen Körper kein überflüssiges Gramm Fett. Flintsteingraue Augen und schlanke Hände voller Lassonarben. Eine leicht gebogene Nase und ein fester und schmallippiger Mund. Schwarzes Haar
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 194 –
Oregon-Express
G.F. Waco
Hier ist Oregon!
Ein Land, das den Biber in seinem Wappen führt und dessen Regenfall knappe zweiundzwanzig Zoll im Jahr beträgt.
Ein Land der Sonne und des Windes. Ein Land, dessen Menschen immer kämpfen müssen. Ein Land der Prärien und der Berge. Berge, die so hoch sind wie die Alpen oder die kaukasischen Felsriesen. Gletscher und murmelnde Bäche – Biber, die neugierig ihre Köpfe aus den Erdhöhlen an Flüssen stecken.
Und da ist die Wüste. Eine weite Fläche von den Cascade Ranges bis zu den Steen Mountains im Osten. Zweihundert Meilen Wüste. Lavafelder aus Urzeiten her und kleine Kraterseen. Diese Wüste droht. Sie greift nach jedem Reiter. Und viele läßt sie nicht los.
Bleiche Knochen im Sand, über die der Wind hinwegzieht und die langsam begraben werden. Viele bleiche Knochen, die viele grausame Geschichten erzählen.
Da ist die Stadt Eugene, und nordwestlich von ihr die University of Oregon. Viele dicke Bücher in den Regalen. In einem steht die Geschichte eines Mannes. Man hat diese Geschichte festgehalten. Zur Ehre und zur ständigen Mahnung an die Lebenden. Vielleicht waren sie Helden, diese Männer in einem wilden Land.
Hier ist er:
James Monty Terrigan Delaware.
Kein großer Mann der Figur nach. Kein Mann, dem man ansah, daß er ein Kämpfer war. Und der es doch auf eine fast grausame Art dazu brachte, daß sein Name in diesem Buch steht.
James Delaware.
Schlank und falkenäugig. Braungebrannt und sehnig. Am ganzen Körper kein überflüssiges Gramm Fett. Flintsteingraue Augen und schlanke Hände voller Lassonarben. Eine leicht gebogene Nase und ein fester und schmallippiger Mund. Schwarzes Haar und ein schmaler Bart über der Oberlippe. Rötlichbraune Haut.
James Delaware.
*
James Delaware starrt vor sich hin. Manchmal ist es ihm, als tanzte der Horizont vor seinen Augen. Dann verschwimmt die Luft zu einer gläsernen Fläche.
Da ist die breite Main Street, in die der Wagen holpernd einfährt. Und da ist der General-Store von Bud Taylor.
»Wo ist Luke, James?« fragt Taylor, als er den Wagen hinter dem Haus an die Rampe lenkt.
»Hier«, sagt James. »Sieh ihn dir nur gut an.«
Bud Taylor hat sich neugierig über die Kante gebeugt und blickt in den Wagen, auf das wächserne Gesicht seines alten Freundes Luke, als James die Decke wegzieht. Bud Taylor taumelt mit einem japsenden Laut zurück, lehnt sich an die Wand.
»James, wer war der Schuft?« fragt er entsetzt.
Er hat Fieber. Jetzt weiß er es plötzlich genau. Aber er ist noch in seinen Gedanken fast klar.
»Manner Wolfe, Glenn Weadow und Thor MacKenzie. Sie hatten den Auftrag von Nat und Hank Boone. Ich ritt drei Meilen vor und kam zu spät. Aber ich konnte sie noch erwischen, alle drei. Dabei kam ich unter den Gaul des Wolfes zu liegen. Mein rechtes Bein ist hin. Hole den Doc, er soll es sich ansehen. Und hilf mir aus dem Wagen. Stütze mich an der rechten Seite, Bud. Hast du heißes Wasser?«
»Wasser?« fragt Taylor und sieht in James’ Augen. »Du hast Fieber, James. Junge, du mußt ins Bett. Natürlich habe ich Wasser. Weißt du genau, daß es die Boones waren, James?«
»Thor konnte noch reden. Genug, um die Wahrheit zu sagen. Er hatte den Tod vor Augen und log nicht. Ins Bett bekommen mich keine zehn Pferde. Dad soll zu Hause in die Erde kommen. Er wollte immer dort begraben werden. Hilf mir jetzt hinunter.«
Bud Taylor faßt ihn unter, ruft nach seinem Gehilfen. Sie tragen ihn ins Haus und legen ihn auf das Ledersofa.
James sagt heiser: »Bud, ich habe hier etwas. Einen Topf mit heißem Wasser auf das Feuer und das Zeug aufkochen. Nimm erst die Hälfte und lasse es fünf Minuten brodeln. Dann bringe es mir her. Ich will es austrinken. Wenn es auch bloß Indianermist ist, aber ich will es wenigstens versuchen. Hast du verstanden? Ach so, deinen Whisky habe ich zur Hälfte verbraucht und ein Stück Leinen. Etwas Mehl auch. Schlimm?«
»Red nicht so dummes Zeug daher«, knurrt ihn Taylor an. »Du hättest mir die Ladung nicht zu bringen brauchen. Es ist ein Umweg für dich, James. Hm, was ist das für ein Kraut? Hast du das etwa von einem Indianer bekommen? Auf dem Leder sind seltsame Zeichen, wie sie ein Roter macht.«
»Es war ein Roter, ein ganzer Haufen«, sagt James Delaware trocken. »Modocs, Bud. Ihr Häuptling hieß Starker Elch. He, was hast du denn auf einmal?«
Bud Taylor steht da und starrt ihn an.
»Starker Elch hast du gesagt? Und du lebst noch? Junge, das ist der schlimmste aller Teufel, die rot sind. Wie hast du das angestellt?«
»Er kannte angeblich Monty, meinen Großvater. Er hat mir noch alles Gute gewünscht. Und er sagte etwas von bösen Geistern, die hinter mir sind. Wasser, Bud, zum Teufel, vergiß das Wasser nicht.«
»Er hat…« stottert Taylor. »Böse Geister? Die Modocs reden nur von Geistern, wenn sie Krieg machen wollen. Ja, du bekommst dein Wasser.«
Er geht in die Küche, und James hört ihn mit Töpfen hantieren. Es dauert eine ganze Weile, ehe er mit dem dampfenden Topf und einer Tasse hereinkommt. James Delaware verbrennt sich fast die Zunge, aber er trinkt die brühendheiße Flüssigkeit, die seltsam grün schimmert. Es schmeckt bitter wie Galle. Aber James schluckt. Dann wird er müde. Er schläft ein. Und er wacht auch nicht auf, als der Doc mit ihm hantiert.
Nach einer Weile verläßt der Arzt das Haus, und Bud Taylor stampft in den Laden. Aber es dauert keine drei Stunden, dann ist James schon wieder wach. Er richtet sich auf und starrt auf den Gips an seinem Bein.
Prüfend stampft James Delaware mit dem Bein auf.
»Gut«, sagt er grimmig. »Ich kann gehen. Und ich werde mich wenigstens wehren können. Zum Angreifen tauge ich nicht viel. Noch nicht. Das muß erst heilen. Boones, ihr lauft mir nicht weg, verdammt. Lauft so weit ihr wollt, aber ich treffe euch schon noch. Teufel, was ist mit meinem Kopf los?«
Er blickt auf den Topf.
»Das ist ein Ding«, sagt er. »Der alte Indianer hat recht behalten. Kein Fieber mehr. Ich fühle keine Schmerzen in meinem Bein, und mein Kopf ist klar. Bud, wo steckst du?«
»Alle Teufel!« sagt Bud Taylor und rennt in das Zimmer. »Du lebst wirklich noch, James? Wie gefällt dir dein Pflaster?«
»Gib mir gefälligst eine Nadel und einen Faden. Ich will die Hose zunähen, Bud. Und dann brauche ich noch einige Dinge. Mutter… Mein Gott, was wird sie sagen? Verdammt, ich habe direkt Angst, nach Hause zu fahren. Nun gut, Bud, ich brauche zwei Tonnen Mehl und einen halben Sack Salz, einige Pfund Schmalz und Zucker. Vielleicht auch etwas Hirse. Packe es auf den Wagen, und dann will ich fahren.«
*
James Delaware sieht seine Mutter. Sie sitzt auf der Veranda in ihrem Schaukelstuhl. Dann steht sie auf und legt die Hand über die Augen, läßt die Strickarbeit fallen und läuft los.
»Luke!« sagt sie mit entsetzten Augen. »James, wo ist Vater?«
Sie kann nicht auf den Wagen sehen. Aber sie sieht das Gesicht ihres Sohnes. Und plötzlich weiß sie die Wahrheit.
»Luke!« sagt sie zerrissen und klammert sich am Kasten fest. »Mein Gott, Luke! James, wie konnte es geschehen?«
»Mutter, da war ein anderer Händler. Er war noch nicht so lange im Geschäft wie Vater. Er hat drei Wagen und fährt selber auch noch einen mit seinem Sohn. Er drängte sich in unsere Linie. Aber die Storehalter wollten nichts mit ihm zu tun haben. Er wurde immer giftiger auf Luke und mich. Nun ja, da hat er drei Männer seiner Mannschaft losgeschickt. Ich ritt vor dem Wagen und hörte den Schuß. Ich kam zu spät, Mam. Und sie schossen auch auf mich. Ich… Mam, reg dich nicht auf, bitte. Du mußt stark bleiben. Ich mußte mich wehren.«
»Und, mein Junge?« sagt sie mit blutleeren Lippen. »Hast du sie getötet? Sage mir, ob du deinen Vater wenigstens rächen konntest?«
»Ich konnte es, Mam. Keiner kam davon. Aber ein Pferd fiel auf mein rechtes Bein. Es brach. Ich wollte Dad nicht in fremder Erde beerdigen, weil er immer hier neben dem Haus liegen wollte. Mam, bitte geh ins Haus und sieh nicht her. Ich…«
»Du bist ein prächtiger Sohn, James«, sagt sie. »Hast du wenigstens einen Sarg gekauft?«
»Das habe ich, Mam. Ich habe für Dad alles getan, was ich tun konnte. Ich habe auch genug Vorrat mitgebracht für uns beide, denn ich werde einige Zeit nicht fahren können.«
»Er ist mein Mann gewesen«, sagt Linda Delaware leise und verweht. »Vielleicht war ich ihm nicht immer eine gute Frau. Ich weiß erst jetzt, wie sehr er mich gebraucht hat und wie sehr ich ihn liebte. Und weil ich seine Frau bin, will ich dir helfen, ihn in sein Grab zu bringen. Das ist die Pflicht jeder guten Frau! Steige ab, Sohn.«
James Delaware zieht den Sarg auf eine Bohle. Dann beginnt der Holzkasten zu rutschen. James hält ihn fest, und bald steht Luke Delawares letztes Bett auf dem Boden.
»Ich hole den Spaten, Mam«, sagt James. »Geh ins Haus und beschäftige dich eine Weile. Ich sage dir dann schon, wann du ihn…«
Er verschluckt das andere, als seine Mutter ihn starr ansieht. Ihr Blick ist ohne Regung, und ihre Augen sind ohne Tränen.
»Mache ihn auf, Sohn«, sagt sie müde. »Mache ihn auf, denn ich will ihn gleich sehen.«
»Wie du willst, Mutter.«
Er hebt den Deckel an, als er glaubt, daß es genug ist. Der Geruch nach Tod und Verwesung steigt hoch. Es ist noch kein schlimmer Geruch.
Da liegt Luke Delaware. Der Sohn stützt seine Mutter. Sie sieht auf das friedliche Gesicht ihres Mannes hinab.
»Ich komme, Luke«, sagt Linda Delaware. Ihr Gesicht leuchtet verklärt. Sie hebt die Arme und will einen Schritt tun. Es ist ein leichter Schritt, der sie auf eine Wolke trägt. Eine lichte Wolke, die mit ihr steigt. Und von dieser Wolke sieht sie in das Gesicht ihres Sohnes James.
»Sei immer gut, mein Sohn«, sagt Linda Delaware und vertraut sich ganz der Wolke an, die sie höher und höher trägt.
»Mutter!« sagt James Delaware stöhnend.
Sie lächelt in seinen Armen. Friedlich und gelöst in einer Art, wie er sie noch nie lächeln sah. James Delaware hat seine rechte Hand auf ihrem Herzen liegen. Er spürt es nicht mehr. Dieses Herz schlägt nicht mehr. Es hat seinen letzten Schlag getan.
»Mutter!« sagt der Mann noch einmal schmerzzerrissen. »Ich schwöre es in eurem Angesicht. Ich werde sie töten.«
Dann nimmt er seine Mutter auf den Arm und trägt sie in das Blockhaus. Er läßt sie sanft auf das Bett gleiten, in dem sie siebenundzwanzig Jahre geschlafen hat und in dem er geboren wurde. Mit starrem Gesicht dreht sich James Delaware um und geht aus dem Haus. Er geht in den Schuppen und nimmt die Säge. Da liegen Bretter genug. Er schneidet sie passend und nimmt Maß an jenem anderen Sarg, der schon auf der Erde steht.
Es ist genau Mitternacht, als die ersten Schollen auf die Särge fallen. Dumpf poltert es von unten, und die Laterne wirft bizarre Schatten auf die Wand des Hauses. Zwei Hügel und zwei Steine auf jedem Grab. Er wälzt sie heran und legt sie zu den Füßen hin. Dann verschwindet er wieder im Schuppen, und wieder kreischt die Säge und zischt der Hobel. Es ist ein hartes Stück Akazienholz. Mit einem kleinen Dach darüber und einem meterlangen Stab.
James Delaware macht Feuer. Er nimmt einen Schürhaken vom Herd im Haus und beginnt zu brennen. Tiefe Buchstaben, die von einer harten Hand in das Holz gebrannt werden.
Hier ruhen Luke und Linda Delaware.
Er starb an einer hinterhältigen Kugel.
Und sie aus Gram über seinen Tod. Gott gebe ihren Seelen Frieden.
Er spricht ein Gebet über die Grabstätte hinweg. Er betet keine Stelle aus der Schrift, sondern das, was er fühlt und denkt.
Er geht aufrecht und steif mit dem rechten Bein in das Haus. Und er sieht die Augen nicht, die ihn aus dem Busch beobachten, der den Waldessaum einnimmt.
Kohlschwarze Augen, die seltsam funkeln. Erst als er schon schläft, kommt der eine Mann aus dem Wald. Er hat eine lange Stange mit Menschenhaar und bunten Bändern und Lederstreifen in der roten Faust. Diese Stange rammt er zu Füßen des Grabes in die Erde. Dann verschwindet er wieder. Und nur der Wind hört seine Worte.
»Er ist der Sohn meines Freundes«, sagt Belo Catingon, den sie den Starken Elch nennen, guttural. »Kein Indianer soll jemals dieses Haus betreten. Das ist mein Zeichen.«
*
»Bill Clayborn?« wiederholt James. »Er hat doch nicht etwa nach mir gefragt?«
»Genau«, sagt Taylor. »Er wollte dich eigentlich bei mir finden. Nun, ich wollte nicht mit der Sprache heraus. Er hat aber keine Ruhe gelassen. Und der Mann kann schweigen wie ein Grab. Weißt du, was ich dir bestellen soll?«
»Was wird er schon wollen? Er hat einen Namen als Wegeöffner und Pionier. Vielleicht wollte er Dad und mir anbieten, für ihn zu fahren? Der Mann ist zu groß, um sich mit kleinen Leuten abzugeben.«
»Denkst du, mein Freund. Er will im nächsten Jahr eine Straße ziehen lassen und eine Stagecoach-Linie einrichten. Von Eugene zum Sumner Lake und von dort quer durch die Wüste nach Idaho. Sie soll in Boise enden. Er will die Verbindung mit dem Mittelwesten haben. Und du sollst ihm einen Teil seiner Arbeit abnehmen. Nun, du wirst es doch nicht ablehnen, James. Vielleicht ist das eine Aufgabe, wie sie ein Mann nur einmal im Leben zu erfüllen hat. Du sollst sein Wagenboß sein.«
»Was?« fragt James ungläubig. »Aber ich bin noch zu jung dazu. Ich und Wagenboß. Das ist ja zum Lachen. Wie kommt er auf die verrückte Idee?«
»Ich erzählte ihm die Geschichte mit den Boones. Er hat sie sich angehört. Und dann sagte er, daß du genauso wärest, wie er es sich gedacht hätte. Er braucht einen Mann, der das Land kennt und hart genug ist. Er hat dich eine Zeit beobachten lassen. Und Clayborn ist keiner, der sich etwas nicht dreimal gründlich überlegt. Das also wartet auf dich. Zweihundert Meilen Wüste und Berge. Eine Aufgabe, James, um die es sich zu träumen lohnt. Ich habe ihm versprochen, daß du kommen würdest. Vielleicht war das voreilig. Aber ich dachte daran, daß es ein Job für ein Leben werden kann.«
James Delaware denkt nach. Er raucht und sieht hinaus auf das Grabkreuz und die beiden Hügel nebeneinander.
»Wann will er anfangen, Bud?« fragt er dann.
»Wir haben jetzt Dezember«, sagt der Storebesitzer. »Anfang April soll es losgehen. Du wirst bis dahin gesund sein, denke ich.«
»Wenn du ihn siehst, dann bestelle ihm, daß ich kommen werde. Das ist eine Aufgabe für mich. Well, ich schaffe es. Er wird nicht enttäuscht sein.«
*
Er hört das Klopfen der Äxte und das schnarrende Geräusch der Sägen. Dann kommt er an ein Camp aus Zelten. Nicht weit von der Straße errichten vielleicht zwanzig Männer ein festes Blockhaus. Es liegt genau an der Paßhöhe. Seine Wände sind dick und haben Schießscharten. Daneben ist der Stall, und ringsherum ist man dabei, einen Palisadenzaun zu ziehen.
Drei Indianer hocken auf ihren Pferden wie Bildsäulen, und nur ihre Augen leben. Sie sehen den weißen Männern zu und reden nicht. Nur die Augen sprechen. Dann wenden die arbeitenden Weißen und auch die Roten ihre Köpfe.
Die Indianer starren sofort wieder weg. Trotzdem sieht James das schnelle Zucken der Augenbrauen des einen.
»Jagt doch endlich diese verdammten Paviane weg!« brüllt einer der Männer wütend. »Diese Hunde machen mich nervös. Was starren sie bloß dauernd? Los, verschwindet, ihr Menschenfresser! Ich hole sonst mein Gewehr und schieße.«
Dieser rotschopfige Mann mit den aufgekrempelten Hemdsärmeln schwingt drohend seine Flachaxt. Die Indianer rühren sich nicht. Aber sie sprechen leise. Und James weiß nun, daß wenigstens der eine die Sprache der Weißen versteht.
»Er will sein Gewehr nehmen und uns erschießen«, sagt er kehlig zu seinen beiden Brüdern. »Dort kommt Sela Panka Delaware. Was will er hier?«
James Delaware hat die Worte des Indianers gehört. Und er denkt, daß sie ihm einen guten Namen gegeben haben. Sela Panka Delaware – der tapfere und mutige Delaware. Ein Indianername, der entstanden ist. Und sie sind Modocs.
Ehe ein Mann zu seinem Pferd gehen kann, sagt James ruhig: »Du kannst hierbleiben. Ich verstehe sie und werde mit ihnen reden.« Die Männer sehen hoch und mustern ihn.
»Er sieht wie ein halber Roter aus«, sagt der Rotschopf grinsend.
»Paß auf, daß er dir nicht deine großen Ohren abschießt«, bellt ein anderer und schielt grinsend von der Seite auf James. »Zwei Eisen trägt er ja. An der linken Seite die Artillerie der Armee. Gott, was für eine Kanone.«
»Ich bin ganz friedlich, solange mich niemand ärgert«, sagt James Delaware. »Wo ist Bill?«
»Du gehörst doch nicht etwa zu uns?« fragt der Rotschopf überrascht. »Mann, so einen Vogel wie dich gibt es hier noch nicht. Da ist ein ganzer Haufen Leute, die einen Colt tiefgeschnallt tragen, aber du bist ’ne Sondernummer.«
»Vielleicht gehöre ich hierher«, dehnt James. »Ihr werdet es schon sehen.«
Er wendet sich an die Indianer und hebt beide Hände flach hoch. Sie nicken und grunzen ein wenig.
»Hier werden Häuser gebaut für Pferde und Wagen«, sagt James ruhig. »Meine Brüder mögen es ihrem Häuptling sagen, daß hier keine Pferdesoldaten kommen werden. Die Häuser werden immer weiter auf die Wüste zuwachsen. Sie werden sie überbrücken. Und viele Wagen werden dann auf den Straßen rollen. Die weißen Männer brauchen Mehl und Fleisch aus dem Land jenseits des Snake River. Keinem roten Mann soll sein Wigwam zerstört werden.«
Die Indianer starren ihn an und nicken.
»Ich werde die Männer führen, die die Häuser aufrichten. Meine Freunde sollen sich keine Sorgen machen. Richte das dem Häuptling aus.«
»Du wirst für deine Männer gutsagen müssen, Sela Panka Delaware. Vergiß das nicht. Tötet einer einen roten Mann, werden wir zehn Weiße töten. Ich werde es dem Häuptling sagen. Halte dein Wort, Wasigun.«
»Aah, verdammt!« brummt James grimmig. »Der Bursche treibt mich in die Enge. Was soll ich machen? Ich muß erst mit Bill Clayborn reden.«
Die Indianer verschwinden mit ihren Mustangs im Wald auf der anderen Seite.