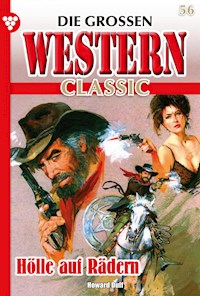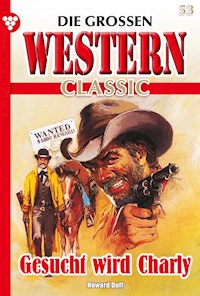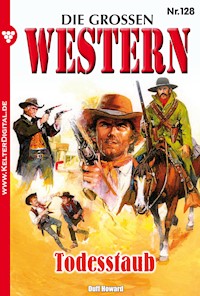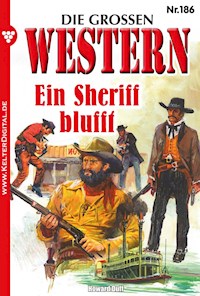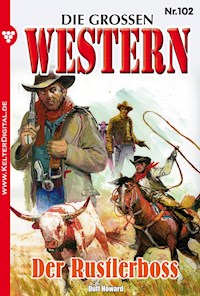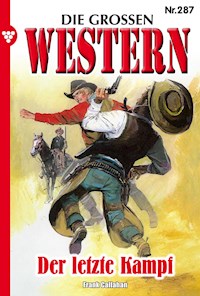Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western Classic
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Nun gibt es eine exklusive Sonderausgabe – Die großen Western Classic Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Dieser Traditionstitel ist bis heute die "Heimat" erfolgreicher Westernautoren wie G.F. Barner, H.C. Nagel, U.H. Wilken, R.S. Stone und viele mehr. Das Frieren saß plötzlich in David Jerichos Nacken und kroch dann nach beiden Seiten davon: Einmal über die Kopfhaut, zum anderen über das Rückgrat. Er dachte gar nichts mehr, er senkte nur den Blick an dem Wasserschlauch vorbei, den er gerade hatte eintauchen wollen. Noch war der Wasserspiegel still, glatt und silbrig wie ein Spiegel. Und im Spiegel, da war eine Gestalt zu sehen. Allmächtiger! In diesem Augenblick wusste Jericho, was er falsch gemacht hatte. Nachdem er heruntergestiegen war, hätte er am Ufer entlanggehen müssen, weil er mit dem Wagen hier nicht an das Wasserloch gekommen wäre. Der Wagen stand über dem Steilufer des Hassayampa Rivers, der manchmal auf zehn, fünfzehn Meilen kein Wasser führte, wenn der Sommer heiß und die Nächte kurz waren. Gerechter Gott, dachte Jericho, ein Gewehr, ich habe das Gewehr auf mich zeigen sehen. Der Bursche steht jenseits zwischen den Büschen. Die Spuren dort drüben – von oben konnte ich sie nicht sehen, auch dann noch nicht, als ich am Ufer stand. Die Sonne wirft Schatten auf, verwischte Spuren – und ich Narr sehe sie erst, als ich mich hingekniet habe. Nur ruhig bleiben, dachte David Jericho, nur nicht rühren. Vielleicht wartet der Kerl darauf, dass ich etwas tue, damit er einen Grund hat, den Finger krumm zu machen. Und das passiert mir! In diesem Moment sah er noch einmal auf das Spiegelbild und erstarrte. Plötzlich hatte er ein Schlucken im Hals. Eine Frau stand breitbeinig jenseits des Wasserloches über ihm auf dem Hang. Jericho sah ihr Spiegelbild, aber in erster Linie das Gewehr, das die Frau im Hüftanschlag hielt. Er schielte nach links, nach rechts und löste etwas aus damit, weil sie sehen musste, dass er schielte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western Classic – 31 –
Ein Sarg für Don Carlos
Howard Duff
Das Frieren saß plötzlich in David Jerichos Nacken und kroch dann nach beiden Seiten davon: Einmal über die Kopfhaut, zum anderen über das Rückgrat.
Du großer Gott, dachte David Jericho Graves, Undertaker, Sargmacher, Posaunenkünstler und Townmarshal von Jerome in Arizona, da ist jemand gewesen und …
Er dachte gar nichts mehr, er senkte nur den Blick an dem Wasserschlauch vorbei, den er gerade hatte eintauchen wollen. Noch war der Wasserspiegel still, glatt und silbrig wie ein Spiegel. Und im Spiegel, da war eine Gestalt zu sehen.
Allmächtiger!
In diesem Augenblick wusste Jericho, was er falsch gemacht hatte. Nachdem er heruntergestiegen war, hätte er am Ufer entlanggehen müssen, weil er mit dem Wagen hier nicht an das Wasserloch gekommen wäre. Der Wagen stand über dem Steilufer des Hassayampa Rivers, der manchmal auf zehn, fünfzehn Meilen kein Wasser führte, wenn der Sommer heiß und die Nächte kurz waren.
Gerechter Gott, dachte Jericho, ein Gewehr, ich habe das Gewehr auf mich zeigen sehen. Der Bursche steht jenseits zwischen den Büschen. Die Spuren dort drüben – von oben konnte ich sie nicht sehen, auch dann noch nicht, als ich am Ufer stand. Die Sonne wirft Schatten auf, verwischte Spuren – und ich Narr sehe sie erst, als ich mich hingekniet habe. Nur ruhig bleiben, dachte David Jericho, nur nicht rühren. Vielleicht wartet der Kerl darauf, dass ich etwas tue, damit er einen Grund hat, den Finger krumm zu machen.
Und das passiert mir!
In diesem Moment sah er noch einmal auf das Spiegelbild und erstarrte.
Plötzlich hatte er ein Schlucken im Hals.
Eine Frau stand breitbeinig jenseits des Wasserloches über ihm auf dem Hang.
Jericho sah ihr Spiegelbild, aber in erster Linie das Gewehr, das die Frau im Hüftanschlag hielt.
Er schielte nach links, nach rechts und löste etwas aus damit, weil sie sehen musste, dass er schielte.
»Manos arriba!«, schrie die Frau jäh los, dann erkannte sie ihren Fehler und wiederholte es im kehligen Amerikanisch: »Hände hoch!«
Irgendetwas war in diesem Gesicht, das Jericho warnte und höllisch vorsichtig machte. Dieses Gesicht verriet Erschöpfung, eine nervöse, zitternde Anspannung, in der ein Mensch anders als normal reagierte, vielleicht zu schnell und unüberlegt.
»Hände hoch!«
Jesus Maria, dachte Jericho und ließ seinen Wasserschlauch nur fallen, wagte es nicht, ihn zur Seite zu werfen, weil ihm bewusst wurde, dass schon der kleinste Fehler die Frau zum Schießen bringen konnte, nur die Nerven behalten. Reden hilft vielleicht, wenn man mit ihr in ihrer Sprache spricht, oder?
»Si, si, Señora«, sagte er sanft, ganz freundlich und langsam, damit es beruhigend wirkte. »Non tirar – nicht schießen, nicht schießen. Ich bin ein friedlicher Mensch – un hombre pacilico, Señora. Da Sie meinen Wagen gesehen haben, müssten Sie doch wissen, dass Leute meines Berufes die friedliebendsten Menschen der Welt sind. Ein Totengräber ist immer ein friedfertiger Mensch – oder? Sie werden doch nicht glauben, dass ich Ihnen etwas tue, oder? Ich tue niemand etwas, ich helfe vielmehr allen Leuten, die Hilfe brauchen, wenn ein persönliches Unglück sie heimgesucht hat. Sie werden doch nicht auf einen Totengräber schießen wollen, der keine Reichtümer besitzt – oder?«
»Ist – gut«, sagte die Frau im nächsten Moment kehlig. Sie hatte eine sehr dunkle und raue Stimme. »Sie sind ein amerikanischer Totengräber, ja? Hören Sie, Señor, ich will Sie nicht töten, ich brauche Hilfe, aber ich kenne Sie nicht, ich traue niemand, den ich nicht kenne, verstehen Sie? Gut, dass Sie spanisch sprechen, sehr gut. Ich spreche nicht gut Amerikanisch, nur sehr schlecht. Sie – Sie haben einen Revolver?«
»Ja«, gab er zu. Seine Jacke war geöffnet, und sie hatte die Waffe wahrscheinlich gesehen. »Ich werde ihn aber nicht benutzen, ich verspreche es.«
»Sie haben einen Revolver«, sagte die Frau, und nun klang ihre Stimme hart. »Nehmen Sie die Waffe vorsichtig mit der linken Hand und lassen Sie sie ins Wasser fallen, sonst schieße ich. Señor, ich warne Sie, wenn Sie etwas versuchen, drücke ich ab. Dann sind Sie tot, verstehen Sie mich?«
»Natürlich«, gab Jericho sanft zurück. »Keine Angst, Señora, ich werde den Revolver ganz langsam mit zwei Fingern aus meinem Hosenbund ziehen und ihn dann ins Wasser fallen lassen – einverstanden?«
»Ja, Mistär – ich passe auf, Mistär!«
Er zog die Waffe behutsam und ließ sie ins Wasser fallen.
»Nun?«, fragte Jericho. »Zufrieden, Señora?«
»Das Messer!«, sagte sie scharf. »Wo haben Sie Ihr Messer, Mistär?«
»Ich habe nur ein kleines Federmesser, Señora«, erwiderte Jericho sanft. »Ich besitze kein Messer, das man Waffe nennen könnte. Es ist wirklich nur ein kleines Federmesser – so lang wie mein Finger!«
Er hielt den Mittelfinger der Linken hoch.
»Sie lügen bestimmt nicht, Señor?«
»Ich lüge nicht«, sagte Jericho und hob den Blick. Er sah sie an und schwieg dann, weil dieses Gesicht viel jünger war als jenes im Wasserspiegel, der es doch nicht so deutlich und klar widergespiegelt hatte. Mein Gott, das war ja keine Frau, das war ein Mädchen, höchstens zwanzig Jahre alt.
Das Mädchen sah ihn über den Lauf des Gewehres hinweg an und hatte die Waffe nun an die Schulter genommen. Es zielte auf ihn.
»Gut«, murmelte das Mädchen nach einem Augenblick des Schweigens. »Vielleicht lügen Sie nicht – ich weiß nicht, ich traue niemandem in diesem Land. Nehmen Sie beide Hände hoch und stehen Sie auf, Mistär!«
»Hören Sie, Señora, ich tue Ihnen nichts, ich schwöre es«, erklärte Jericho. »Sie können mir trauen.«
»Ich weiß nicht«, antwortete sie unsicher. »Dies ist ein fremdes Land, ich kenne nur wenige Amerikaner. Steigen Sie den steilen Hang herauf und halten Sie die Hände oben, sonst schieße ich. Gehen Sie jetzt los nach rechts, Mistär.«
»Und wenn ich auf dem Steilhang abrutsche?«, fragte Jericho, den Hang rechts musternd. »Ich müsste dann die Hände herunternehmen, verstehen Sie?«
»Sie werden nicht abrutschen, Mistär. Sie kommen herauf und bleiben oben stehen. Versuchen Sie nicht in die Büsche zu springen – ich passe auf, ich schieße!«
»Also gut, ich versuche hochzusteigen«, erklärte Jericho kopfschüttelnd. »Sollte ich straucheln und meine Arme herunternehmen müssen, um mich zu halten, ist das kein Trick. Sie werden jemanden aus Versehen töten, Señora, fürchte ich. Ich tue Ihnen bestimmt nichts, ich habe keine bösen Absichten, wirklich nicht. Sie haben gesagt, dass Sie Hilfe brauchen – für wen, für Sie selbst?«
»Mein Begleiter – er ist krank, er hat hohes Fieber«, erwiderte das Mädchen, das Jericho dennoch aus Höflichkeit mit Señora anredete. »Mein Begleiter braucht unbedingt Hilfe – er …, er kann nicht aufstehen, er redet wirr – Sie müssen helfen, Señor!«
»Ja«, sagte Jericho und stieg vorsichtig den Hang empor, um ja nicht zu straucheln. »Wenn ich kann, werde ich ihm helfen, Señora. Keine Angst, ich komme Ihnen nicht zu nahe.«
Sie wich jetzt zurück, nutzte geschickt den freien Raum, als sie hinter den Büschen heraustrat.
Angst, dachte Jericho, sie hat Angst und scheint sehr erschöpft zu sein. Dies ist für sie ein fremdes Land.
Vielleicht hat sie über die Gringos und die andere Moral hier einige Dinge gehört. Wahrscheinlich befürchtet sie, ich könnte über sie herfallen. David Jericho stieg über die Kante und blieb stehen, sah in das Gewehr, das auf seine Brust zeigte.
»Rechts«, sagte das Mädchen scharf. »Gehen Sie nach rechts zu dem Baum zwischen den hohen Büschen drüben. Mein Begleiter liegt dort im Schatten. Sie müssen helfen, Mistär.«
»Si«, versprach Jericho. »Wenn ich kann – si, si!«
Er ging los, sah ihren Schatten, den die Sonne über den Boden warf, sich bewegen. Sie blieb hinter ihm, das Gewehr jetzt wieder im Hüftanschlag. Und dann schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, dass der Mann, der dort zwischen den Büschen unter der schattenspendenden Baumkrone war, vielleicht gar nicht lag, dass er vielleicht stand oder kniete und vielleicht kein Pferd besaß, dass dieses Mädchen ihn dem Mann zutrieb.
Du großer Gott, wenn der wirklich Fieber hat und ein Pferd braucht, erschießt er mich, dachte Jericho beklommen. Mexikaner sind geborene Pferdediebe, die bringen jemand kaltblütig um, wenn sie sein Pferd haben wollen. Der Bursche dort wird nicht gehen können, aber schießen kann er bestimmt noch. Warum bin ich Narr nicht auf dem Fahrweg geblieben, warum musste ich abkürzen und quer durch die Gegend fahren?
Jericho schielte buchstäblich nach hinten. Das Mädchen war gut fünf Schritt hinter ihm und hatte todsicher den Finger am Abzug. Sie hatte das Gewehr ihres Begleiters, also hatte der Mann nur seinen Revolver.
Das ist es, überlegte Jericho blitzschnell, er hat den Revolver, also wird er kaum gehen können. Bis zu den Büschen und dem Baum sind es gut sechzig Schritt. Ist der Bursche zu sehen?
Jericho äugte scharf nach vorn, aber er sah nichts zwischen den Büschen. Sand, dachte Jericho – Kakteen und Sand. Dort liegt die Chance für mich – an den Kakteen. Ich lasse mich doch nicht wie ein Stück Vieh vor den Revolver irgendeines fiebernden und ein Pferd brauchenden Mexikaners treiben. Nicht mit mir, Señorita!
Er hielt die Arme hoch, ging scharf links an den Kakteen vorbei und sah die Sandwächte rechts neben sich, die der Wind zusammengeblasen hatte.
David Jerichos Blick flog nach unten, huschte über den Boden zu dem Schatten, der nur noch knappe vier Schritt hinter ihm war. Anscheinend hatte die Señorita nicht bemerkt, dass Jericho den Schritt unmerklich verlangsamt hatte. Sie hielt die Winchester zwar im Anschlag, jedoch schien der Lauf mehr zu Boden zu zeigen als vorher.
Jetzt, dachte Jericho, jetzt!
Er sprang jäh los, stieß sich mit dem linken Fuß blitzschnell ab und warf sich auch schon herum, indem er sich über die Sandwächte hinweg hinter die Kakteen hechtete.
Hinter ihm gellten die beiden Worte: »Ich schieße!«
Und dann war das Brüllen auch schon da, raste der Knall durch das Buschgelände. Die Kugel fetzte mit einem seltsam schmatzenden und klatschenden Geräusch durch die dicke Saguaro-Kaktee, doch sie fuhr viel zu hoch durch den Stamm und jagte dann in den Sand. Der flog hoch, als Jericho schon die Hände in den Sand gekrallt hatte, mit einem wilden Satz links der Kaktee erschien und dann den Sand nach dem Girl schleuderte.
Der Sand schien eine Wolke zu bilden, weil er so fein wie Staubzucker war. Das Mädchen hebelte bereits durch. Es stand zusammengekrümmt vor Jericho, die großen Augen vor Schreck geweitet, den Mund geöffnet und jetzt einen schrillen Angstschrei ausstoßend.
»Miguel – Miguel!«
Dann brach der Schrei jäh ab. Die Sandwolke fuhr der Señorita jäh ins Gesicht. Jetzt schrie sie nicht mehr nach Miguel, sie schrie vor Schmerz, sah nichts mehr, aber sie hebelte wieder zurück, sodass Jericho das Einrastklicken des Unterhebels laut hörte.
In diesem Moment war er schon heran und trat zu. Sein linker Stiefel schnellte blitzschnell in die Höhe. Der Tritt fegte das Gewehr zur Seite, brachte den Lauf aus der Richtung und riss auch die Señorita herum.
Rumms!
Der brüllende Knall fuhr aus der Gewehrmündung, die Kugel jagte irgendwohin gegen Geröll und irrte heulend ab, aber da hatte Jericho schon die Rechte herausgestoßen. Seine Hand traf die Hüfte des Mädchens, wirbelte das Girl noch weiter herum, sodass es taumelnd zu Boden ging und nicht mehr durchhebeln konnte.
David Jericho bückte sich rasend schnell, packte das Gewehr, drehte es mit einem harten Ruck und hatte dann die Waffe, während die Señorita beide Hände zu den Augen riss und wieder gellend schrie:
»Miguel – Mikel – Mikel, schnell, Mikel – socorro, Mikel – Hilfe, Mike! Hilfe!«
Mikel, dachte Jericho verstört, als er sich duckte, den Saguro als Deckung gegen die Büsche nutzte, das Mädchen liegenließ und an ihm vorbeistob, um hinter sie zu kommen Mikel, nicht mehr Miguel? Was ist das denn – warum schreit sie nach Mikel?
Er war schon hinter ihr, hatte sie jetzt zwischen sich und die Büsche gebracht und stieß das Gewehr ziemlich grob in ihre Hüfte.
»Ruhig«, fauchte Jericho messerscharf. »Halten Sie den Mund, Señorita schweigen Sie doch endlich, ich tue Ihnen nichts!«
»Mikel – Mikel!«
David Jericho hatte viel erlebt. Nur das, was nun passierte, hätte er nie erwartet. Statt liegen zu bleiben, weil das Gewehr sie bedrohte, sprang das Mädchen, dem die Tränen aus den Augen liefen und das wahrscheinlich kaum etwas sehen konnte, plötzlich auf. Das Girl heulte richtig, das merkte Jericho erst, als es schluchzend vor ihm herlief.
»Bleiben Sie stehen, zum Teufel!«, brüllte Jericho los und rannte nun auch.
Das Mädchen erreichte die Büsche, zwischen denen sich nichts rührte. Es blieb still hier, Mikel antwortete nicht, während Jericho keine zwei Schritt hinter dem Mädchen herrannte und die Winchester schussbereit hielt.
»Miguelito – mi amor!«
Zwei Schatten tauchten auf – ein brauner und ein schwarzer Schatten – Pferdeleiber nahe des Baumstammes, der seine riesige Krone über die Büsche breitete. Dann war die Lichtung auch schon erreicht. Das Mädchen stürzte an den links stehenden drei Pferden vorbei und auf den Mann zu, der unter dem Baum auf einer Decke im Schatten lag und sich nicht rührte.
Der Mann lag dort wie tot, die Hände auf der Brust, ein Halstuch zusammengefaltet und klatschnass, wie es schien, auf der Stirn.
Das Mädchen rief:
»Mikel, Mikel – oh, mein Gott, hilf mir doch!«
Jerichos Blick flog zu Mikel, der sich nicht rührte.
Du großer Gott, dachte Jericho, kein Irrtum, er ist es.
Mike Shannon – Mike … hier?
Jericho knurrte finster: »Mein Gott, ich will nichts von Ihnen, wie oft soll ich das noch sagen müssen? Señorita, was hat er – was ist passiert, was fehlt ihm?«
»Er«, wimmerte das Girl. »Oh, dios – dios, er ist verwundet. Er …, er heißt Mikel Miller, ein Americano, mein Beschützer, mi amor, Señor. Er hat eine Kugel in der Seite – Bravados haben auf ihn geschossen – ein Bravado. Señor, kennen Sie Mikel, Señor?«
David Jericho blinzelte nur einmal, schwieg eine Sekunde und verdaute es, dass Mikel Shannon also Miller heißen sollte. Nur die Gedanken rasten durch Jerichos Kopf. Er dachte an John Shannon, an die Ranch bei Chino Valley, an den Besuch vor sechs Wochen, den Mann, der durch Jerome geritten war und nach der Ranch von John Shannon gewollt hatte. Und dann fiel Jericho noch seine Schublade ein, in der viele schöne Blätter lagen mit Beschreibungen von Männern. Manche dieser Blätter hatten sogar ein Bild, damit man den Mann auch besser erkannte, um ja keinen Falschen einzulochen.
»Mikel Miller?«, fragte Jericho. »Nein, ich kenne diesen Miller nicht, Señorita. So, ein Bravado hat ihm in die Seite geschossen? Ja, ich sehe jetzt den Verband unter dem Hemd. Hören Sie, wollen Sie vernünftig sein? Dann sehe ich mir Mikel Miller an.«
Er sprach und dachte dabei unausgesetzt an Shannon, den dieses Mädchen Miller nannte, den es als seinen Geliebten bezeichnete.
Großer Gott, was ist passiert, dachte Jericho bedrückt, was denn nur? Mikel hätte sich doch nie einem Girl als Miller vorgestellt, der und ein Girl – unglaublich. Aber immerhin, dieses Mädchen hier ist schön, wirklich schön. Wie muss es erst in einem Kleid und richtig frisiert aussehen? Mikel hat ein Girl – in seiner Situation macht er so etwas? Dieser schweigsame Bursche, der mit Frauen nicht viel im Sinn hatte, soll sich ausgerechnet eine Mexikanerin genommen haben – Mikel?
David Jericho hielt das Girl fest und wartete auf dessen Antwort. Dabei dachte er an Mikel Shannon und daran, dass jemand zweitausend Dollar Belohnung auf Mikels Kopf ausgesetzt hatte – tot oder lebendig!
Shannon hatte zwei Männer erschossen und war verletzt geflohen. Er musste nach Mexiko geflüchtet sein, aber nun war er hier, beinahe dort, wo er zu Hause war – in Arizona.
Verrückt, dachte David Jericho, das ist alles verrückt. Mike Shannon ist in Arizona mit einer hübschen Mexikanerin, das ist schon irre genug. Dass er eine Kugel in der Seite hat, ist weniger verrückt, das musste mal so kommen. Aber, dass der Kerl herkommt und genau weiß, dass man ihn hängen wird, wenn man ihn erwischt, das ist so verrückt, dass ich es kaum fassen kann. Völlig irre ist es jedoch, dass ich ihn treffe. Ich muss ihm ein paar Armbänder verehren – ich, David Jericho Graves, denn dazu verpflichtet mich das Gesetz. Gesetz?
David Jericho Graves, Undertaker, Sargmacher, Posaunenkünstler und Townmarshal atmete tief durch.
Ich, dachte Jericho, der seltsamste Bursche, den Arizona jemals hervorgebracht hatte, ich werde den Teufel tun. Ehe ich Mike Shannon Armbänder verpasse, geht diese verrückte Welt unter. Zur Hölle mit dem Gesetz und dem Richter. Und wenn man mich dafür einlochen sollte – ich habe einen Mike Miller gefunden. Shannon – wer ist Shannon? Den Mann kenne ich nicht! Ich sch… auf das Gesetz, jawohl, ja!
Manchmal, das wusste niemand besser als David Jericho, taugte das beste Gesetz für keinen Cent. Vor allen Dingen dann nicht, wenn es von einem Richter ausgenutzt werden wollte, um eine persönliche Rache an einem Mann zu vollziehen, der seinen einzigen Sohn erschossen hatte.