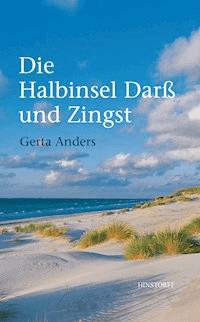
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hinstorff
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicht nur dieser köstliche Strand, auch die Lage Prerows zwischen der Ostsee auf der einen Seite und dem Bodden auf der anderen hat einen besonderen Reiz. Dazu gesellen sich tiefer Wald, weite Heideflächen, die Moore, die Wiesen an den Binnengewässern. Und alles ist eingehüllt in ein weiches insulares Klima. Unsere Winter sind mild, doch oft von starken Stürmen heimgesucht. Der Frühling kommt spät. Der Sommer ist wie überall an der See kurz und kühler als im Binnenland, dafür ist der Herbst herrlich lang und warm. Der große Wald bietet Schutz vor den starken, vorherrschenden Westwinden, mildert das Klima. Gerta Anders 1956
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerta Anders
Die Halbinsel Darß und Zingst
Ein Heimatbuch
Herausgegeben von Käthe MietheIllustriert von H. Holtz-Sommer und E. Th. Holtz
Neu bearbeitete und erweiterte Auflage
MEINEN KINDERN
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Meine Mitarbeiter
Die Maase
Aus der Geschichte
Die Kronheide
Strand und Tang
Bernstein
Strandung und Strandgut
Sturmflut
Schiffahrt
Fischerei
Born
Wieck
Prerow
Zingst
Sundische Wiese und Bock
„Gute alte Zeit“
Unser Heimatmuseum
Vorwort
Als ich vor nunmehr acht Jahren mein Heimatbuch „Das Fischland“ schrieb, zog ich mit vollem Bewußtsein die Grenze meines Gebietes südlich vom Darß, denn die Halbinsel Darß und Zingst führt bei aller Verwandtschaft, die die gesamte Entwicklung der Küste und ihrer Bevölkerung verbindet, ein eigenes Leben und verlangt eine eigene Betrachtung und Bewertung.
Trotz eifrigen Bemühens gelang es nicht, die Lücke in unserer Reihe zu schließen. Das Heimatbuch der Insel Hiddensee war erschienen, in kurzem Abstand folgten ihm die Bücher der Insel Rügen und Usedom. Nur für die „Scheitelhöhe“ des „Darß“ und den langausgestreckten Landarm von Prerow bis zum Bock, der nach Hiddensee und Rügen weist, konnte ich jahrelang keinen Mitarbeiter finden, der die nötige Liebe und die nötige Kenntnis für diese große Aufgabe besaß.
Jetzt sind wir endlich so weit: Die Leiterin des Darßer Heimatmuseums, Biologin und Geologin von Haus aus, tief verwurzelt mit der Natur und der Geschichte der Halbinsel Darß und Zingst, hat für uns, das heißt, für alle, die dort leben, für alle, die dort ihren Urlaub verbringen oder dorthin sich sehnen, das Buch geschrieben, das ihnen das bewegende Schicksal dieses Küstenabschnittes, an dem Wasser und Winde unermüdlich formen, zeigt, sein vielfältiges Leben der Pflanzen und Tiere am Strande, im Walde, am Saum der Boddengewässer, die gesellschaftliche Entwicklung der als Seefahrer weit berühmten Bevölkerung, und die Leser durch Schauen und Wissen zur Heimatliebe führt, auf der jene wahre Vaterlandsliebe gegründet ist, die unser ganzes Denken und Tun bestimmen soll.
Sommer 1954Käthe Miethe
Meine Mitarbeiter
Heimatkunde ist unser vielseitigstes Forschungsgebiet, sie erstreckt sich auf fast alle Wissenszweige: Das große Feld der Geschichte – sei es Vorgeschichte, Frühgeschichte, politische Geschichte –, ferner Geologie, Erdkunde, Pflanzen- und Tierkunde, Kunstgeschichte, Volkstumskunde, Gesellschaftswissenschaft, alles muß einbezogen werden, wenn man sich der Heimatkunde zuwendet. Und wie könnte ein Mensch sich dieses umfassende Wissen zu eigen machen?
Unsere Forschungen sind im Laufe der letzten Jahrzehnte so mannigfaltig geworden und so weit vorgeschritten, dass sich selbst ein Spezialgebiet oft nicht mehr übersehen läßt, viel weniger sämtliche Wissenszweige. Heimatforschung muß also eine Kollektivarbeit im höchsten Sinne sein. Sie ist durchaus kein „Reservat“ des Wissenschaftlers. Jeder kann daran teilnehmen, und es muß unser Ziel sein, daß sich das ganze Volk zum Dienst an der Heimatkunde berufen fühlt, ob es sich um das Sammeln unserer Flurnamen handelt, um Familiengeschichte, die Erkundung der Heimischen Vogelwelt, den Schutz seltener Pflanzen und Tiere, um Bodenfunde oder um Beobachtung des Wandels der Mundart.
Bei der Vorbereitung dieses kleinen Heimatbuches war ich also auf so viele Mitarbeiter von allen Seiten angewiesen, daß ich nur wenige nennen kann, allen aber von Herzen zu danken habe.
Die ersten stummen Helfer waren für mich die Bodenfunde und die Versteinerungen. Sie erzählten mir von den früheren, nun längst verblichenen Pflanzen und Tieren unserer Heimat und lehrten mich die Entstehung unseres Darß’ erkennen. Vorgeschichtliche Funde zeigten mir, wie unsere Vorfahren hier gelebt und gewirkt haben. Alte Bauten, Chroniken und Urkunden berichten über die Geschichte unserer Gegend. Lebende Pflanzen und Tiere sind unsere heimatkundlichen Wegbegleiter und Erzieher.
Bücher aller Art halfen mir, daß sich das Bild der Heimat rundete.
Besonders dankbar bin ich den Urhebern der Schwedischen Matrikel, die in ihren sorgfältigen Karten und Aufzeichnungen die Grundlage für die Erkenntnis der Vergangenheit, was Menschen, Landschaft und Lebensäußerungen betrifft, geben. Die Entstehung dieser Dokumente, die uns für den ganzen Bereich des einst schwedischen Vorpommerns eine geradezu minutiöse Auskunft über die wirtschaftliche Lage am Ausgange des 17. Jahrhunderts schenken, ist so wissenswert, daß sie hier kurz skizziert werden soll:
Um die Mißstände abzustellen, die durch Aufrechterhaltung der sogenannten „Hufensteuer“ entstanden waren und zu einer übermäßigen Belastung der Bauern geführt hatten, entschloß sich die schwedische Regierung in Vorpommern, eine Überprüfung der Verhältnisse vorzunehmen. Die Stände hatten schon lange auf Reform gedrängt. Ende des 17. Jahrhunderts kam es endlich dazu. Da sich in Deutschland damals zu wenige Vermessungsfachleute fanden, wurden schwedische Landmesser und schwedische Studenten aus Upsala mit dieser Aufgabe betraut, obwohl in Schwedisch-Vorpommern Verwaltungssprache und Recht deutsch waren. Diese Schweden schufen von 1692 bis 1698 in sechsjähriger Arbeit ein einzigartiges, vorbildliches Werk, für das wir noch heute nicht dankbar genug sein können, weil es uns über die mannigfaltigen Lebensäußerungen der damals in unserer Heimat lebenden Menschen genau unterrichtet. Sogar die Namen der Einwohner der einzelnen Orte werden genannt. Die Beschaffenheit des Bodens, die Erträge jeglicher Art, auch Schiffahrt, Fischerei, Viehzucht, nichts entgeht ihrer Beschreibung. Weil Ausländer diese Arbeit geleistet haben, ist Sachlichkeit und Parteilosigkeit gegeben, denn ihre Aufzeichnungen konnten ohne Rücksichtnahme auf Verwandtschaft und Nachbarschaft gemacht werden. Wo man sich auf Mitteilungen der Eigentümer, etwa über die Ertragsmöglichkeiten ihres Bodens, verlassen mußte, wird deutlich hervorgehoben, daß den Angaben nicht ganz zu trauen wäre. Den kartographischen Aufnahmen der Dörfer liegt eine sorgsame Dreiecksmessung zu Grunde. Der Maßstab ist umgerechnet 1:8000, genauer 1:8333,3.
Dieses kostbare Dokument ruhte 1½ Jahrhunderte lang unbeachtet bei irgendeiner Behörde und wurde erst 1905 auf dem Boden des Stralsunder Regierungsgebäudes wiederentdeckt. Ein Teil des gewaltigen Werks, glücklicherweise gerade „mein Revier“, die Dorfbeschreibungen der Ämter Franzburg und Barth, sowie der Barther und Stralsunder Distrikte, sind inzwischen, bearbeitet von Fritz Curschmann, ins Deutsche übersetzt, der Forschung durch Drucklegung leicht zugänglich gemacht worden.
Außer der Matrikel halfen mir in erster Linie die drei Altväter der Darßliteratur: August v. Wehrs, Carl Scriba und Friedrich v. Suckow, auf die man immer wieder zurückgreifen muß, wenn man unsere Vergangenheit aufhellen will. Aber vorerst muß ich des Johannes Micrealius gedenken, dessen „Sechs Bücher vom alten Pommernland“, 1723, eine Quelle nicht allein für dynastische Geschichte, sondern auch für das Leben des Volkes bedeuten, auf das er genauestens eingeht. Nicht einmal vergißt er, die Apfelsorten zu nennen, die bevorzugt angebaut wurden, noch die grausigen Zeichen am Himmel zu beschreiben, in denen die Menschen damals kommendes Unheil wie die gewaltige Sturmflut von 1625 angekündigt wähnten.
Die drei ältesten Darßschriftsteller sind Ende des 18. Jahrhunderts geboren.
Der Darß vor dem Ende der Litorina-Transgression
Kurz nach dem Ende der Transgression: an die 3 Landkerne legen sich Dünenhaken an.
Die Inselkerne sind seewärts gradlinig abgeschnitten, die Haken wachsen in der Länge und Breite.
Der Dünenhaken der Wustrower Insel legt sich vor das alte Kliff des Altdarß.
Der Darß um 1650
Der Darß in seinen heutigen Umrissen (Nach Th. Otto)
August von Wehrs war Hannoveraner. Er studierte in Göttingen, wurde schwedischer Offizier, um nicht für Napoleon kämpfen zu müssen. Sein Regiment bestand aus vielen Deutschen. Wehrs gehörte zur schwedischen Besatzung des Darß’. Er geriet in französische Gefangenschaft. Später besuchte er den Darß wieder und heiratete die Tochter des Oberförsters in Born, der ein geborener Darßer war. Wehrs liebte den Darß und hat ihn mit Hilfe seines Schwiegervaters eingehend erforscht. Sein Werk, das man bei aller Einschränkung als Quelle bezeichnen muß, heißt: „Der Darß und der Zingst“, Hannover 1819.
Carl Scriba stammte aus Mölln in Schleswig-Holstein. Er war ebenfalls Offizier. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Kopenhagen. Seine Tochter veröffentlichte später in der „Deutschen Rundschau“ Erinnerungen ihres Vaters an die Kämpfe, die er 1809 mitgemacht hatte. Dabei war er auch nach dem Darß gekommen, wo er gefangen genommen wurde.
Auch Friedrich von Suckow war Offizier, er war in Goldberg bei Neu-Buckow geboren und besuchte eine Barther Pension, kam also in die Nähe des Darß. Er lebte später lange Jahre in Stralsund, wo er die Wochenschrift „Sundine“ herausgab, die damals große Bedeutung besaß. Für uns ist wichtig, was er in den Artikeln: „Winterliche Reisebilder oder acht Novembertage am Nordstrande: auf dem Darß, dem Zingst und Hiddensee“ (Sundine 1831 bis 1832), erzählt.
Diese drei Offiziere, die zufällig und nur vorübergehend auf den Darß gekommen waren, hatten die einsame Gegend an der See so lieb gewonnen, daß sie ihre Eindrücke aufschrieben. Zu ihnen gesellt sich der Seminarlehrer H. Genz aus Franzburg. Er hat zwar nur ein bescheidenes Büchlein „Die Halbinsel Darß-Zingst“ im Jahre 1882 herausgegeben, bringt aber eine Fülle von Beobachtungen, die gerade durch ihre jene Jahre bezeichnende romantische und verschnörkelte Ausdrucksweise ein gutes Zeitbild bedeuten. Übrigens hat er einen klaren Sinn für die Realitäten des Lebens bewiesen, sonst würde er niemals geschrieben haben:
„… Denn die Kuh, dieses nützliche und darum in einigen Fällen fast zum Abgott gewordene Tier, ernährt auch mittelbar (indirekt), indem ihre Milch zur Auffütterung zweier Schweinchen verwendet wird, von denen man eins verkauft, das andere aber im eigenen Haushalte so weislich verwendet, daß es neben allerlei Fischen den Fleischbedarf eines ganzen Jahres deckt.“
Außer diesen Ortsfremden schrieb damals nur ein einziger Einheimischer über den Darß: Johann Segebarth. Er wurde 1833 in Wieck geboren, ging auf die Dorfschule und fuhr nach der Einsegnung zur See. Im Winter besuchte er die Navigationsvorbereitungsschule in Prerow auf der Mühlenstraße und später die Navigationsschule in Stralsund. Er machte früh die Prüfung für Schiffer auf großer Fahrt. Auch sein Vater war Seemann gewesen, hatte zuerst einen Schoner seiner Familie übernommen und führte später rund 25 Jahre lang eine Bark.
Als Johann Segebarth 1870 in Konstantinopel mit anderen deutschen Schiffen durch die Blockade der Franzosen zurückgehalten wurde, las er Reuter und wurde dadurch zum Schreiben angeregt. Sein bekanntestes plattdeutsches Buch ist „De Darßer Smuggler“, sein gelesenstes hochdeutsches „Die Halbinsel Darß-Zingst“. Seit 1882 wohnte er in Prerow, zuerst im „Strandheim“, dem heutigen Besitz der beiden Schwestern Asmus, das er sich in der Strandstraße bauen ließ, nachher im „Trauten Heim“ in der Grünen Straße. Den Adler auf dem Hause in der Strandstraße und auch den Adler auf der Apotheke hat er geschnitzt. Auf seinem Grabstein stehen die Worte:
„Der ist in tiefster Seele treu,Wer die Heimat so liebt wie du.“
Nun sind endlich die Lebenden an der Reihe, die mir für meine Arbeit zur Seite gestanden haben. Vor allem schenkte mir das geschichtliche Büchlein von Gustav Berg „Geschichte des Darßes und des Zingstes“, das jetzt leider vergriffen ist, eine Fülle von Material. Es erschien ebenso wie das „Darßer Heimatbuch“ im Verlage des Wielandhauses von Martin von Wedelstädt, dem verdienstvollen Gründer der „Heimatausstellung“, aus der sich unser „Darßer Heimatmuseum“ entwickelt hat. Auch das „Darßbuch“ von Siegfried Merklinghaus aus dem Jahre 1925 möchte ich nennen.
Viele Menschen haben mir mit Auskünften, Berichten, Erzählungen geholfen: Kantor Schmidt aus Prerow, der seinen Darß in jeder Beziehung gut kennt und im Sommer heimatkundliche Wanderungen durch den Wald leitet, der ehemalige Seemann Pieplow in Born, der alte Schiffszimmermann Köpke in Prerow, Kapitän a. D. Scharnberg-Prerow, Schulstraße, die über 90jährige Frau Nienkirchen aus Prerow, die vier nach ihr kommende Generationen erleben durfte, Förster König, mit dem ich die Fundorte seltener Pflanzen aufgesucht habe, der Lehrer im Ruhestand Treu in Born und der jetzige Schulleiter Neumann, Müllermeister Pahnke in Wieck, der mir selbstlos seine Funde überließ und alle Mitarbeiter des Darßer Heimatmuseums, darunter der immer einsatzbereite Herr Quadfasel – sie alle standen mir bei. Prof. von Bülow, der Rostocker Geologe, Verfasser des „Abriß der Geologie von Mecklenburg“, half mir in großzügiger Weise beim Neuaufbau der geologischen Abteilung unseres Museums, wie seine Schriften neben dem alten geologischen Standardwerk von Otto „Der Darß und Zingst“, Greifwald 1913, die Grundlage für meine geologischen Ausführungen sind. Dazu kam in letzter Zeit die neue Veröffentlichung von Prof. Hurtig über unsere Boddenlandschaft. Der Prähistoriker Herr Schubarth, Prof. Bauch und seine Assistenten von der Biologischen Forschungsanstalt Hiddensee gaben Anregungen. Gedenken möchte ich meines kürzlich gestorbenen Geologielehrers Prof. Hans Cloos, dem ich meine Beziehung und Einstellung zur Natur verdanke. Einen eifrigen Mitarbeiter fand ich außerdem in meiner Tochter, die unermüdlich Pflanzen heranholt, neue Fundorte sucht und entdeckt. – Vor allem aber habe ich meiner Herausgeberin, Käthe Miethe, die mir die Anregung zu diesem Heimatbuch gegeben hat, für ihren Rat bei seiner Anlage und für ihre Mitarbeit besonders auf den Gebieten der Schiffahrt und Fischerei herzlich danken.
Die Maase
Ein Fuhrwerk mit Sommergästen fährt über den Mecklenburger Weg auf die Rehberge zu mit dem Ziel Ahrenshoop. Es holpert über die dicken Baumwurzeln und sinkt immer wieder in tiefe Löcher hinein. Ununterbrochen muß man sich unter die tief hängenden Zweige der Kiefern ducken. An manchen Stellen fächeln sogar die Wedel des Adlerfarn über den Wagen. Bis über 3 Meter Höhe kann dieser Farn erreichen. Kiefernwald, Eichenwald, Lärchenbestand lösen sich in weiten Gebieten ab. Mächtige Kiefern, dann wieder schlanke, die so nebeneinander stehen, daß ihre trockenen Äste trostlos hinuntergesunken sind. Man denkt zunächst, einem Forstmanne müßte das Herz im Leibe bluten, wenn er dies sähe. Aber der „Urwald“ in seiner Naturwüchsigkeit soll sich selbst weiterhelfen, sich entwickeln nach eigenem Gesetz. Die Gäste werden allmählich durch das Schütteln des Wagens müde und dösen. Bäume, immer wieder Bäume! Nur bei den gewaltigen Buchenstämmen, die immer häufiger werden, werden die Augen wieder wach.
Da taucht plötzlich hinter besonders mächtigen Buchen mitten im dichten Walde eine helle Wiese auf. Der Wagen hält. Zur Wiese hinunter fällt der Waldboden mehrere Meter tief steil ab. Die weite, ebene Fläche sieht fast wie ein großer See aus, vor allem, wenn leichter Nebel über ihr liegt. Diese Wiese – die Buchhorster Maase – ist früher tatsächlich einmal Wasser gewesen. Kein großer Waldsee, sondern Meer, ein Teil der Ostsee. Der schroffe Abhang war einstmals die Meeresküste, eine Steilküste. Dort, wo sich jetzt diese Wiese ausbreitet, brandete die See wie heute an unserem Strand, mit spielerischen Wellen an windstillen Tagen leise und harmlos an die Küste tänzelnd, mit Brauen und Wucht bei Nordstürmen und Weststürmen Riesenbrocken von den Steilhängen reißend und forttragend.
Norddeutschland war während der ganzen älteren Erdperioden eine tiefgelegene Senke, in die von den angrenzenden Landgebieten, dem Skandinavischen Massiv im Norden und dem Böhmischen Urgebietsblock im Süden, Kies, Geröll abgelagert wurden.
Doch diese frühen Schichten sind nicht formgebend für unsere Gegend geworden. Wichtiger für uns sind die jüngeren Zeiten, wie die Kreidezeit. Alle tieferen Bohrungen, auch manche flachen, treffen in Rügen und Ostmecklenburg Kreideschichten an. Also scheint die Kreide hier auf großen Strecken zusammenhängend zu liegen. Oft ist sie durch erdinnere Kräfte über ihre Umgebung hervorgehoben worden, wie auf Gebieten von Rügen. Unser Darß war während der Kreidezeit ein Teil dieses Kreidemeeres.
Die folgende Tertiärzeit ist schon ein Übergang zur Gegenwart, der Neuzeit. Die Belemniten – im Volke „Donnerkeile“ genannt, weil Gott Donar sie mit seinem Donner in die Erde geschleudert haben soll und sie daher die Spitzen des Donners sind –, auch die Ammonshörner sterben aus. Die Säugetiere erscheinen. Die Tertiärzeit war eine Zeit größter erdgeschichtlicher Ereignisse. Die hohen Gebirge entstanden, riesige Überschwemmungen überfluteten auch unser Gebiet. Aber gegen Ende der Tertiärzeit kam es zu einer Beruhigung, das Meer zog sich bis auf das Nordseebecken zurück.
Obwohl die nordeutsche Senke in vielen hundert Millionen Jahren immer wieder nachgefüllt wurde, blieb sie eine Mulde. Sie wurde nicht genügend erhöht, um über den Meeresspiegel zu steigen und Land zu werden. Erst der Eiszeit, die der Tertiärzeit mit ihrem subtropischen Klima folgte, gelang es endgültig, sie mit dem mitgebrachten Gesteinsschutt so anzureichern, dass sie zum Festland wurde. Die Gesamtdicke der eiszeitlichen Erdmassen beträgt bis 300 Meter. Diese großen Mengen konnten nur abgerissen und fortgeschafft werden, weil das Urgestein des skandinavischen Blocks durch das warme, feuchte Klima der Tertiärzeit stark verwittert war. Unser Küstengebiet war während der letzten Vereisung völlig vom Eise bedeckt.
Als das Eis abschmolz, blieb der mitgeführte nordische Gesteinsschutt liegen. Wir finden ihn als Grundmoräne, Geschiebemergel, Geschiebe, Findlinge auch bei uns. Für viele dieser Ablagerungen kann man den Weg sagen, den sie genommen haben, oft auch an der Gesteinsart den Herkunftsort genau nach den nordischen Gegenden bestimmen.
Allmählich wurde das Klima nun wieder dem Ende der Tertiärzeit gleich, also dem heutigen ähnlich. Nur der Einfluß der See fehlte noch, weil damals der Darß in einem Landgebiete lag.
Einige tausend Jahre nach der Eiszeit, dem Diluvium, der Sintflut, hob sich der skandinavische Block vom Drucke des Eises befreit; dadurch senkte sich gleichzeitig die norddeutsche Bucht als andere Schale dieser großen Waage. Bei dieser Senkung auch des südlichen Ostseebodens, der Litorinasenkung, stieg der Spiegel der Ostsee, und die südliche Ostseeküste wurde von der See überflutet. Nur die ehemals höher gelegenen Stellen ragten als Inseln aus der Flut hervor. Auf unserem Darß waren es der Alt-Darß (südlicher Teil des Darß’), ein Teil der Sundischen Wiese und ein Stück Bock. Bohrungen haben hier denselben Sand festgestellt, den das Festland zeigt. Es ist auf dem Alt-Darß Heidesand, ein sehr feinkörniger, fast kalkfreier Quarzsand, der nur geringfügige Beimengungen von Feldspatteilchen enthält. Er ist 7 bis 14 Meter mächtig. Darunter liegt Geschiebemergel, der in Born bei 11 Metern Tiefe, in Wieck bei 14 Metern Tiefe beginnt. Segebarth berichtet vom alten Darß: „Hier besteht der Boden aus einem durch Eisenbeimengungen gelb gefärbten Sande, fast durchgehend mit Ortstein-Unterlage, in den Wiesen mit großen Resten von Raseneisenstein, der früher (1848 bis 1849) in dem Königlichen Hüttenwerk Torgelow bei Pasewalk verarbeitet wurde. 1848/49 mußte ich auf einer Yacht fahren, womit wir von Wieck aus Eisenerde nach Torgelow segelten.“
In jener vorgeschichtlichen Zeit, als unser Darß nur aus einigen Inseln bestand, haben schon Menschen an der Küste der Maase gelebt, die mit einfachen Booten und bescheidenen Werkzeugen Fische fingen, in den Wäldern des Hinterlandes Wild erlegten. Es sind Funde bei der Buchhorster Maase gemacht worden, nach denen man annehmen kann, daß in der Jüngeren Steinzeit – also zwischen 5000 und 2000 v.d.Z., während der Litorinazeit – auf den höher gelegenen Stellen des Küstenstreifens Menschen gesiedelt haben.
Auch auf der sogenannten Prerowbank, die sich nördlich von Darßer Ort erstreckt, sind Funde vorgeschichtlicher Art gemacht worden, Feuersteingeräte, bearbeitete Tierknochen und sogar Bronzen. Die Prerowbank war während der Litorinasenkung eine Insel, die dem Festlande vorgelagert lag. Zu diesem Festlande gehörte auch der Darß.
Wer Genaueres darüber nachlesen will, muß versuchen, sich das längst vergriffene Büchlein „Beiträge zur Geschichte des Darß und des Zingstes“ von Gustav Berg, Verlag des Wielandhauses, Prerow, zu verschaffen.
Nach beendeter Litorinasenkung, der eine kleine Schnecke Litorina litorea, die noch heute an unserem Strande zu finden ist, ihren Namen gegeben hat, führte die Küstenversetzung das begonnene Werk fort. Auch hier arbeiten dieselben Kräfte wie in der Gegenwart. Wind und Wellen formen unaufhörlich an unserer Landschaft. Da die Hauptwindrichtung von Westen nach Osten geht, also Westwinde vorherrschen, gibt der Westen unermüdlich an den Osten ab: Der Darß wächst auf Kosten des Fischlandes und des Weststrandes nördlich von Ahrenshoop. Der „Vordarß“ zwischen dem Fischland und dem alten Kern, dem „Alt-Darß“, ist das Ergebnis dieser Landwanderung. Ebenso wächst der Bock auf Kosten des Zingstes.
Auch nördlich vom Alt-Darß bei Darßer Ort und in der Prerowbucht wurde Land angeschwemmt. Die Maase wurde Festland, ja, sie wuchs ständig nach Norden zu weiter. Der „Neu-Darß“ bildete sich. Dünenzug um Dünenzug lagerte sich nördlich vor ihr an. Jede dieser alten Dünenreihen bezeichnet eine alte Strandlinie. Sie verlaufen von Westen nach Osten und werden im Volksmunde „Reffe“ genannt, die dazwischenliegenden Dünentäler jedoch „Riegen“. Diese Dünentäler beherbergen Seen: Sandkrüe-, Teerbrenner-, Brand-, Vorder- und Süderbramhaken-, Tiefe Stück-, Schmalriff-, Heidensee. Zum Teil sind diese heute verlandet, verschilft oder mit Erlenbrüchen bestanden, mit kleinen Hochmoorbildungen gefüllt. Die Dünen sind dort nur 1,5 bis 3 Meter hoch, bei Esper Ort jedoch 7,2 Meter. Die Abstände zwischen ihnen sind verschieden. Sie betragen an manchen Stellen 30 Meter, an anderen 200 Meter und mehr. Eine Altersbestimmung läßt sich an den Dünenwällen nicht mit Sicherheit gewinnen.
Litorina litorea
Die Gerölle des Weststrandes stammen zum Teil von dem Diluvialkliff des Festlandes, der Maasenböschung. Der Sand wird heute noch genauso forttransportiert. Zum kleineren Teil wird er an Darßer Ort, zum größeren Teil hinter die Spitze verfrachtet und in der Prerowbucht abgelagert. Zur Zeit, da die Schwedische Matrikelkarte aufgenommen wurde, Ende des 17. Jahrhunderts, bildete der heutige Leuchtturmweg noch die Strandlinie. Nördlich davon war Meer.
Von 1595 bis 1925 hatte Darßer Ort einen Zuwachs von 2 ½ Kilometer Länge. Nach anderen Berechnungen sind es durchschnittlich 7 Meter in einem Jahr, nach wieder anderen 10 Meter. Das Alter des Neu-Darß’ wird in den verschiedenen wissenschaftlichen Schriften zwischen 4400 und 900 Jahren angegeben. Der Neu-Darß hat also vermutlich mehr als 1 000 Jahre zu seiner Entstehung gebraucht, geologisch gesehen, einen sehr kurzen Zeitraum.
Das deutsche Wort „Ort“ bedeutete früher soviel wie „Ecke, Winkel“. Darßer Ort ist für die Seefahrenden schon immer eine der gefährlichsten „Ecken“ der Ostsee gewesen; die Seekarten müssen laufend nach dem Stand des Landzuwachses verändert werden.
Ebenso bekannt wie Darßer Ort ist auch die Stelle am Weststrand, die den Namen „Esper Ort“ trägt und schon von weitem durch eine Gruppe herrlicher Buchen zu erkennen ist. Nein, – das stimmt für uns heute leider schon nicht mehr! Das Wahrzeichen von Esper Ort ist bis auf zwei Buchen ein Opfer der Winterstürme geworden. Nirgends in der Literatur findet sich übrigens eine Erklärung für den Namen Esper Ort. Vermutlich stammt der Name schon aus sehr früher Zeit, als Esper Ort dieselbe Rolle spielte wie heute Darßer Ort, die nördlichste Spitze des Darß’ zu sein. Espen gibt es dort weit und breit nicht mehr, aber August von Wehrs erzählt von Ahrenshoop: „… woselbst sich auch Espen befinden …“ Vielleicht standen dort also wirklich einmal Espen, die unter dem Namen Zitterpappeln (Populus tremulus) bekannt sind.
Die Prerowbucht wird im Volksmunde „Lang“ genannt. „Dor liggt ’n Schipp in de Lang“, sagt man, anstatt: Dort liegt ein Schiff in der Bucht vor Anker. Der Name „Lang“ rührt von der Sage her, daß in früheren Zeiten in der Bucht ein Ort „Langendorf“ gelegen haben soll.
Etwa in der Mitte der gesamten Halbinsel Darß-Zingst schwemmt das Meer keinen Sand mehr an, sondern trägt ab, so daß Buhnen zum Schutze der Küste gebaut werden müssen. Erst weit im Osten, am Bock, wird wieder Land angesetzt. Hier kann man am besten das zähe Wirken der Naturkräfte studieren, gegen die der Mensch sich unermüdlich zur Wehr setzen muß, wenn sie seine Kreise stören. Wer eine Karte zur Hand nimmt, die unser vielgestaltiges mecklenburgisches Küstengebiet zeigt, etwa von der Wismarer Bucht bis zum Greifswalder Bodden östlich der Insel Rügen, oder besser noch, wer Einblick in eine Seekarte nehmen darf, die die Tiefen unserer Gewässer verzeichnet, wird den rechten Eindruck davon bekommen, was dieser Sandtransport des Windes und der Wellen für unsere Küste und die Schifffahrt bedeutet. Dort wird er erkennen, wie sich die Südspitze Hiddensees, der schmale flache Gellen, gleich einem lang ausgestreckten Zeigefinger zum Festland reckt, wie der Bock ihm entgegenwächst. Hätte der Mensch sich hier nicht „nach den Jahrhunderten der Gedankenlosigkeit“, wie Prof. von Bülow es so treffend nennt, seit Generationen durch Baggern und Baggern und wieder Baggern der Entwicklung entgegengestemmt, hätte die Halbinsel Zingst mit ihrem Vorposten am Bock den Zeigefinger des Gellen gefaßt und festgehalten, wäre Stralsund seit langem von dieser schmalen Durchfahrt zur westlichen Ostsee abgeschnitten worden. Wir sind, wie von einer unsichtbaren Hand geführt, von der lichten Waldwiese der Maase bis zu einem Blick über unsere ganze Küste gekommen. Das geschah folgerichtig, denn wir sahen mit eigenen Augen in der Maase den Anfangspunkt jener lebendigen, eifrig betriebenen Wandlung, die unseren Heimatboden in ständiger Bewegung hält. Was uns die Schriften der Geologen und ihre Karten von den Schicksalen der niederdeutschen Ebene und der ihnen vorgelagerten Wasser berichten, wobei uns die Jahrtausende, mit denen sie rechnen, den Atem verschlagen, weil die Vorstellungskraft versagt, können wir in unserer Heimat „leibhaftig“ miterleben.
Belemniten, Seeigel, Ammonshorn
Aus der Geschichte
Nachdem wir einen Blick in die Geschichte unserer Heimat getan haben, die die Natur für jeden, der sie zu lesen versteht, in deutlichen Zügen sichtbar macht, müssen wir kurz auf diejenige Geschichte eingehen, die die Menschen auf ihr geschrieben haben. Das ist ein Kapitel, das uns beschämen kann, aber für die Zukunft reiche Belehrung bietet. Man fragt sich dabei: Warum herrscht soviel Gewalttätigkeit und Unterdrückung auf unserer Welt? Warum fragte keiner nach den Leiden derer, die gegen ihren Willen einbezogen wurden? Warum wurden unsere bescheidenen Ortschaften mit ihrer friedfertigen Bevölkerung, die Seefahrt, Fischerei und Landwirtschaft betrieb, in die Händel der sogenannten großen Welt ohne ihren Willen hineingerissen? Was allein hat der Darß, dieses unvergleichlich schöne Waldgebiet, dabei opfern müssen? Und für wen? Darauf kommen wir im einzelnen noch zurück, wenn vom Darß die Rede ist.
Die älteste Nachricht über die Gebiete an der südlichen Ostsee stammt von dem Griechen Herodot. Er erzählt: „In Pfahlbauten am Wasser, behängt mit Bernsteinschmuck, fanden Kaufleute der Mittelmeerländer die Küstenbewohner der Ostsee, erhandelten viel von dem goldigen Gebilde und machten die Griechen damit bekannt.“
Spuren solcher Pfahlbauten sind bis jetzt auf dem Darß nur bei Born gefunden worden. Es kann allerdings sein, daß auch der Pfahlrost, der auf der Maase entdeckt worden ist, aus jener Zeit stammt.
Durch ihre Lage an der südlichen Ostseeküste, die lange Zeit ein Zentrum von Wirtschaft und Handel war, haben Neuvorpommern und Rügen ihre eigene Entwicklung innerhalb Deutschlands gehabt. Die Nachbarschaft zu den skandinavischen Ländern Schweden und Dänemark ließ sie mehr nach Norden als nach Süden schauen. Sie stellen das natürliche Eingangstor der nordischen Staaten zum Festlande dar. Zugleich bedingte die Nähe der großen Hansestädte Rostock, Lübeck, Wismar, die während des ganzen Mittelalters der Sammelpunkt des Wirtschaftslebens waren, eine Ausrichtung nach Westen. Beides brachte eine gewisse Loslösung vom übrigen Deutschland.
In frühester Zeit war Pommern vermutlich von Germanen bewohnt. Um 400 wanderten die deutschen Stämme aus der Ostseegegend fort, sie zogen gen Süden, und Wenden siedelten sich an diesen verlassenen Plätzen an.
Die erste geschichtliche Kunde vom Darß stammt aus dem Jahre 1166. Thomas Kantzow erzählt in seiner Chronik: „… so schickte alsbald der König Waldemar von Dänemark seinen Sohn Christopher und den Bischof Absalon von Röskilde mit etlichem Volke auf der Herzöge von Pommern Land, als da ist Barth, Dartz, Cingst und ließ sie überfallen. Aber sie richteten ohne ein wenig Raub nichts aus.“
1179 wurden die Barther Lande den Pommern von den Dänen entrissen. Jaromar von Rügen, der als erster Fürst zum Christentume bekehrt worden war, kämpfte mit den Dänen gegen die Pommern. Die Dänen trennten den westlichen Teil Neuvorpommerns von Pommern und unterstellten ihn den Fürsten von Rügen. So erhielt also Fürst Jaromar sein Land von Dänemark als Lehen. Dazu gehörte auch Barth mit dem Darß und dem Zingst. Nach diesem Siege der Dänen wanderten viele Deutsche ein. Sicher sind auch der Darß und der Zingst in den folgenden Jahrhunderten besiedelt worden.





























