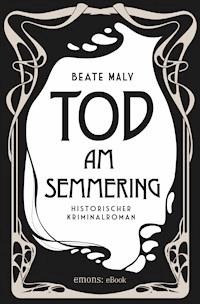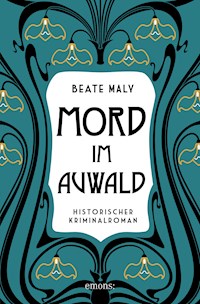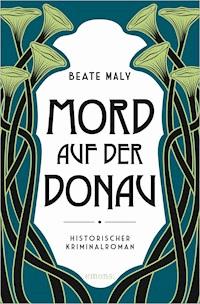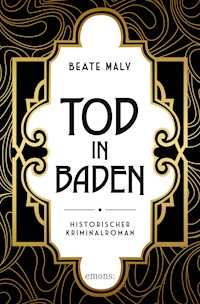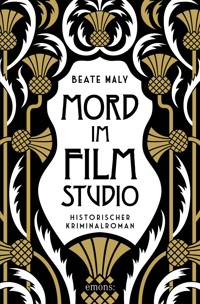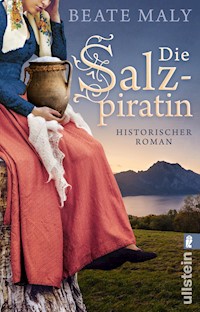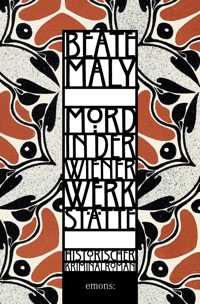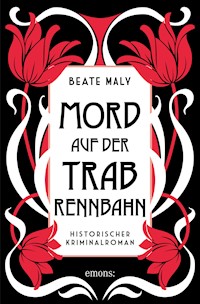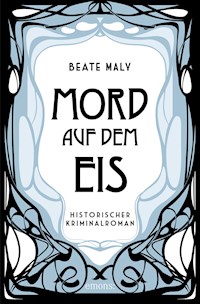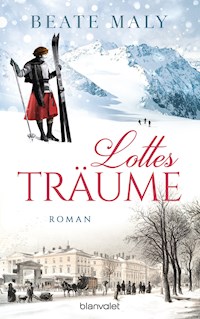8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
1683: Um der gnadenlosen Verfolgung der Kirche zu entkommen, muss die junge Hebamme Anna zusammen mit ihrem geliebten Lorenzo aus Wien fliehen. Auf dem gefährlichen Weg über die Alpen treffen die beiden auf den Gaukler Claudio, der sie bis in die Toskana begleitet. Sie ahnt nicht, welches dunkle Geheimnis der junge Mann vor ihr verbirgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Hebamme und der Gaukler
BEATE MALY, geboren in Wien, ist Bestsellerautorin zahlreicher Kinderbücher, Krimis und historischer Romane. Ihr Herz schlägt neben Büchern für Frauen, die entgegen aller Widerstände um ihr Glück kämpfen.
Von Beate Maly sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Hebamme von WienDie Hebamme und der GauklerDer Fluch des SündenbuchsDie DonauprinzessinDer Raub der StephanskroneDie SalzpiratinDie KräuterhändlerinFräulein Mozart und der Klang der LiebeDie Frauen von SchönbrunnDie Bildweberin
1683: Die Türken belagern Wien, brandschatzen und morden. Die junge Hebamme Anna flieht zusammen mit ihrem Verlobten Lorenzo in die Toskana. Auf dem gefährlichen Weg über die Alpen treffen die beiden auf den geheimnisvollen Gaukler Claudio, der sie bis in Lorenzos Heimat begleitet. Hier fühlt Anna sich wie im Paradies. Doch ihre Welt bricht zusammen, als ein Gesandter der Medici ermordet wird und man ausgerechnet Lorenzo neben der Leiche kniend entdeckt – der Hebamme bleiben nur wenige Tage, um Lorenzos Unschuld zu beweisen. Und welche Rolle wird der Gaukler Claudio dabei spielen?
Beate Maly
Die Hebamme und der Gaukler
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Oktober 2011© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2011Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © gettyimages/Franz Xavier Winterhalter; © ARTOTHEK/Lorrain (Gellée), Claude, 1600–1682, Italienische LandschaftAutorenfoto: © Fabian Kasper E-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-1133-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
NACHWORT
Leseprobe: Die Bildweberin
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
Widmung
Für meine Eltern Monika und Manfred
1
Loibltal, November 1683
DER EISIG KALTE WIND WIRBELTE eine weitere heftige Schneeböe auf und trieb die weißen Flocken in die vermummten Gesichter der Reisenden. Dort, wo die Haut frei lag, schmerzten die Eiskristalle wie winzig kleine Messerspitzen.
Anna presste die Augen fest zusammen, bis sie durch ihre dichten Wimpern die Umgebung nur noch erahnen konnte. Aber auch mit offenen Augen hätte sie nicht mehr von der Landschaft sehen können. Tiefhängende graue Schneewolken hielten die Berggipfel rund um den Loibl seit den frühen Morgenstunden umfangen, die Bäume rechts und links vom Weg schienen seit Stunden verschwunden, verschluckt vom Nebel und dem dichten Schneetreiben.
Alles, was Anna erkennen konnte, war Lorenzos hohe Gestalt direkt vor ihr. Außerdem wusste sie, dass ihre Tante Theresa und der zwölfjährige Hannes hinter ihr gingen. Hannes verfügte über viel Ausdauer und Zähigkeit, das hatte er in den letzten Wochen bewiesen. Aber Theresa war nicht mehr die Jüngste. Auch wenn sie es nicht zugeben wollte und trotz der Kälte und des Schnees aufrecht voranschritt, litt sie am Rheuma, und der beschwerliche Weg durch den Tiefschnee forderte ihr viel Kraft ab.
»Wir hätten gar nicht erst losgehen sollen«, murmelte Anna verärgert vor sich hin, aber niemand hörte sie. Sie hatte es bereits nach dem Frühstück gesagt, hatte versucht, die anderen zurückzuhalten, aber weder Theresa noch Lorenzo hatten auf sie gehört. Sie waren in der letzten Woche bereits zweimal in einen Schneesturm geraten, und beide Male waren sie nur knapp dem Tod durch Erfrieren entkommen.
Bevor sie heute Morgen vom Hospiz St. Leonhard aufgebrochen waren, hatte Lorenzo gemeint: »Das bisschen Schnee kann uns nicht aufhalten.« Ein bisschen Schnee! Anna biss sich auf die Lippen. So viel Weiß wie in den letzten Wochen hatte sie in ihrem ganzen Leben noch nie gesehen. Die Orientierung hatte sie schon vor Stunden verloren.
»Lass uns umkehren!«, rief sie wütend. Ihre Stimme wurde vom Wind verschluckt, deshalb zog sie ihren Verlobten am Wollmantel und hielt ihn auf.
»Lorenzo, es hat keinen Sinn, wir kommen nicht weiter. In dem Tempo erreichen wir den Pass niemals vor Einbruch der Dunkelheit.«
Lorenzo blieb stehen und drehte sich um. Seine dunklen Locken klebten nass in der Stirn, und seine hellblauen Augen blickten müde, doch er hätte niemals zugegeben, dass er erschöpft war.
»Pater Michael hat gesagt, dass es ganz in der Nähe eine Hütte gibt, die bewirtschaftet wird. Es kann nicht mehr weit sein.«
»Das sagst du schon seit Stunden, und wer garantiert uns, dass der Weg hier zu dieser Hütte führt?«
Lorenzo verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen. »Wohin – wenn nicht zum Gipfel – soll ein Weg führen, der steil bergauf geht?«
»Hört auf zu debattieren und geht weiter!«, sagte Theresa, die näher gekommen war.
Anna rührte sich nicht vom Fleck. »Ich gehe keinen Schritt weiter. Ich will zurück zum Hospiz.«
Hannes war ebenfalls zu ihnen aufgerückt. Er legte seine in Lumpen eingewickelte Hand an die Stirn und drehte sich einmal um sich selbst. »Alles sieht gleich aus. Wo geht es denn überhaupt zurück zum Hospiz?« Er zitterte vor Kälte, und seine Zähne klapperten laut. Angestrengt starrte er in alle Richtungen, aber außer einer dichten Nebelsuppe war nichts zu erkennen.
»Wieder zurück?« Die alte Frau schüttelte entsetzt den Kopf. »Auf keinen Fall! Wir müssen weiter!«
Wegen Theresa war die kleine Gruppe vor über einem Monat heimlich nachts aus Wien geflohen. Nachdem Anna und Lorenzo die alte Hebamme aus dem Stadtgefängnis befreit hatten, hatten sie sich Richtung Süden auf den Weg gemacht. Aber schon kurz hinter der Stadtgrenze hatte sich herausgestellt, dass der bequeme Weg über Ödenburg und Laibach nach Aquileia im Moment zu gefährlich war. Die Bernsteinstraße, eine uralte Handelsroute, die bereits von den Römern genutzt worden war und die unwirtlichen Alpen umging, war seit der Belagerung Wiens zu einem der unsichersten Reisewege geworden. Soldaten aus der zerschlagenen türkischen Armee zogen raubend und brandschatzend durch den Südosten des Habsburgerreiches und machten mit allen Lebewesen, die ihren Weg kreuzten, kurzen Prozess.
Anna hatte das vorhergesehen, aber Lorenzo hatte ihr zunächst nicht glauben wollen. Er hatte steif und fest behauptet, der Weg über die Berge sei im Winter nicht zu schaffen. Bereits in Mattersburg war klar gewesen, dass Lorenzo sich geirrt hatte. Der Weg, den vor Monaten die osmanischen Reitertruppen genommen hatten, um Wien zu erobern, war immer noch viel gefährlicher als ein Marsch über die Alpen. Um den Resten der türkischen Armee zu entgehen, hatte die kleine Reisegruppe den Weg nach Westen eingeschlagen und war Richtung Gloggnitz gezogen, um über den Semmering und die Fischbacher Alpen in den Süden zu gelangen. Und nun, nach wochenlanger, beschwerlicher Reise über unwirtliche Berge, war ausgerechnet Lorenzo derjenige, der sowohl der Kälte als auch dem Schnee trotzte und unbedingt rasch weiterziehen wollte, um so schnell wie möglich nach Montepulciano in der Toskana zu gelangen.
Theresa setzte ihren kleinen Leinensack, in dem sie all ihr Hab und Gut mit sich trug, für einen Moment im Schnee ab. »Was, wenn der Prediger Abraham a Santa Clara uns einen Suchtrupp hinterhergeschickt hat?« Die Angst in der Stimme der alten Frau war nicht zu überhören. Zu präsent waren ihr noch die Erinnerungen an die nasskalte Gefängniszelle und an den grausamen Mann, der für ihre Verhaftung verantwortlich gewesen war.
Anna erwiderte: »Theresa, mach dich nicht lächerlich, wir sind doch schon viele Meilen weit von Wien entfernt. So viel Macht und Einfluss hat nicht einmal Santa Clara, um zwei unbedeutenden Hebammen einen Suchtrupp über die Alpen nachzuschicken. Mir ist so kalt … ich … will zurück ins … Warme, sonst … erfriere ich.« Annas Zähneklappern wurde so laut, dass ihre Worte nur schwer zu verstehen waren. Ihre Schultern bebten, und die Knie zitterten. Sie bemerkte nicht, dass Lorenzo ihr einen besorgten Blick zuwarf. Nach einer kurzen Pause sagte er: »Anna hat recht, wir müssen umkehren, bei diesem Wetter schaffen wir es nicht auf die Passhöhe.«
Überrascht sah Anna auf. Hatte sie sich verhört, oder hatte Lorenzo ihr eben zugestimmt? Was jetzt in seinen Augen zu lesen war, galt ihr allein, und sie spürte, wie ihr trotz der Kälte warm ums Herz wurde. Er machte sich Sorgen um sie und wollte nicht, dass sie fror.
»Theresa, lass uns zurückgehen.«
Widerwillig nickte die alte Frau. »Und wo geht’s zurück?«
»Ich glaube, dass wir hier entlang müssen.« Lorenzo deutete auf den Boden, wo ihre Spuren noch erkennbar waren. Aber der Wind fegte mit einer Heftigkeit über die dicke Schneeschicht, dass sie im Nu verschwunden sein würden.
Entschlossen ging Lorenzo voraus, und nur Anna erkannte, dass sich hinter seiner vorgeblichen Entschlossenheit große Unsicherheit und Angst verbargen. Er führte die kleine Gruppe den Hang hinunter und sank bei manchen Schritten bis zu den Knien im Schnee ein. Niemand sprach, denn die Worte wären ohnehin vom Sturm verschluckt worden, und jeder benötigte seine Kraft für den steilen Abstieg. Anna hielt sich dicht hinter Lorenzo, so dass sein Körper ihr Windschutz bot. Ihre Füße schmerzten von der Kälte. Sie versuchte die Zehen in den Lederschuhen zu bewegen, damit sie nicht völlig taub wurden, aber ohne Erfolg. Vielleicht waren sie bereits blau und blutleer.
Plötzlich verlor Anna das Gleichgewicht, als sie auf einer Eisplatte ausrutschte, die sich unter der Schneedecke befand. Gerade noch rechtzeitig bekam sie Lorenzos Jacke zu fassen, was sie vor einem Sturz bewahrte.
»Geht es?«, fragte Lorenzo. Anna nickte tapfer und marschierte weiter.
Trotz Müdigkeit und Erschöpfung kamen die vier zügig voran. Der Schneefall wurde schwächer und hörte auf, doch der Sturm ließ nicht nach und mit ihm blieb die entsetzliche Kälte. Der Nebel lichtete sich ein wenig, und zu ihrer rechten Seite war ein krumm gewachsener Baum zu sehen.
Erleichtert atmete Anna auf. Sie erkannte das eigenwillige Gewächs wieder, es befand sich ganz in der Nähe des Hospizes St. Leonhard. Am liebsten hätte sie Lorenzo auf der Stelle umarmt, er hatte den richtigen Weg genommen. Bald würden sie wieder vor einem warmen Kachelofen sitzen, eine Tasse heiße Milch zwischen den klammen Fingern und die Füße in warme Wolldecken gehüllt. Anna beschwor die behaglichen Bilder von Wärme hervor, in der Hoffnung, dadurch die Kälte zu mildern.
Plötzlich durchdrang ein donnerndes Geräusch das heftige Toben des Windes.
»Ein Gewitter?«
Das Donnern hielt an, wurde lauter und näherte sich mit rasanter Geschwindigkeit.
Lorenzo machte einen Schritt auf Anna zu und fasste ihre Hand, in seinen Augen stand das Entsetzen. Er starrte in die Richtung, aus der das bedrohliche Geräusch kam.
»Anna, wenn es stimmt, was man sich über die Berge erzählt …« Er stockte und sprach nicht weiter.
»Was ist das?«
»Vielleicht eine Lawine.«
»Was ist eine Lawine?«
Das donnernde Geräusch schwoll an, wurde so laut, dass nichts anderes mehr zu hören war. Die Erde bebte, und Anna spürte, wie eine riesige Masse sich rollend auf sie zubewegte. Holz knickte, Bäume brachen und Schneestaub wirbelte auf.
Lorenzo umklammerte Anna mit beiden Armen und hielt sie fest umschlungen. »Was immer passiert, halte beide Arme über deinen Kopf!«, schrie er gegen das krachende Donnern an. Eine Druckwelle nahm Anna die Luft zum Atmen, und auf einmal baute sich eine Schneewand vor ihr auf, die sie wegfegte. Anna merkte, dass Lorenzo sie immer noch umklammert hielt, sie versuchte die Arme schützend über den Kopf zu halten. Fester, harter Schnee brach über ihr zusammen, begrub sie wie eine lebende Tote. Lorenzo wurde von ihr fortgerissen und mit der Schneemasse den Berghang hinuntergeschoben. Anna schrie, aber ihre Stimme ging im Getöse unter. Kaltes Weiß, wohin sie blickte, dazwischen abgebrochene Äste und Geröll. Anna sah einen riesigen Baumstamm auf sich zukommen, er wurde langsam gegen ihren Unterarm gedrückt. Sie hörte, wie ein Knochen brach, einmal, zweimal, aber sie spürte keinen Schmerz und hielt weiterhin beide Arme schützend über den Kopf. Immer weiter wurde sie fortgetragen, bis sie plötzlich feststeckte.
Völlige Dunkelheit umgab sie. Dunkelheit, vor der sie sich mehr fürchtete als vor Kälte und Schmerz. Aber Anna spürte immer noch nichts, selbst das stechende Pochen in ihren Fingern und Zehen hatte nachgelassen. Sie konnte nur noch flach atmen. Mit den Händen versuchte sie die kleine Höhle über oder unter ihrem Kopf zu vergrößern, aber es ging nicht. Sie hatte überhaupt keine Kraft mehr, fühlte sich völlig gelähmt. War diese Taubheit, die von ihr Besitz ergriffen hatte, Folge der Kälte, die sie nicht mehr wahrnahm? Eigentlich hätte sie Angst vor dem Erfrieren haben müssen, aber es war allein die Dunkelheit, die sie beunruhigte.
Eine ungeheure Müdigkeit überkam Anna, sie sehnte sich mit jeder Faser ihres Körpers nach Schlaf. Aber sie wusste, dass sie diesem Gefühl auf keinen Fall nachgeben durfte. Sobald ihr die Augen zufielen, riss sie sie mit aller Kraft wieder auf. Atmen, denken, atmen, denken … Aber die Müdigkeit war stärker. Ihre Augen schlossen sich wie von selbst. Atmen, denken, atmen …
Irgendwann – Anna hatte jedes Gefühl für Zeit verloren – durchdrang ein schabendes, klopfendes Geräusch ihren Dämmerzustand. Ein Traum? Sie sah Holzscheite vor sich, die übereinandergeschichtet wurden, um ein schönes, wärmendes Feuer anzuzünden. Aber wozu Feuer und Wärme? Anna war gar nicht kalt. Sie spürte gar nichts mehr. Oder schwebte sie bereits? War das der Weg in den Himmel? Oder in die Hölle, an die sie nicht glaubte? Halt, da war ein Schmerz. Ihr Körper war doch nicht taub. Etwas pikste sie. Etwas wie ein langer, dünner Stecken, der sich durch die Schneedecke über ihr gebohrt hatte und sie nun am linken Oberschenkel erwischte.
Anna zuckte zusammen. Sie wollte schreien, aber es ging nicht. Der Stecken verschwand wieder, um sich gleich darauf in ihren Rücken zu bohren. Hoffentlich traf er nicht ihr Gesicht. Aber statt ein weiteres Mal gestochen zu werden, hörte Anna wieder das Schaben und Kratzen.
Diesmal lauter.
Es war doch kein Traum. Über ihr trug jemand die Schneedecke Schicht für Schicht ab, und das Gewicht der kaltnassen Masse wurde leichter. Die Dunkelheit verschwand, und plötzlich konnte sie den grauen Himmel sehen. Zwei kräftige Hände schoben die letzte Schicht Schnee über ihr beiseite.
»Anna, amore mio!«, rief Lorenzo und grub immer noch wie wild im Schnee. Er griff nach Annas Händen, und plötzlich durchzuckte sie ein fürchterlicher Schmerz, der sich wie ein Lauffeuer im ganzen Körper ausbreitete.
Sie schrie laut auf.
»Scusa!«, sagte Lorenzo. Behutsam befreite er Anna aus dem Schnee und zog sie zu sich herauf, ohne dabei ihre Hände zu berühren. Er umarmte sie und weinte vor Erleichterung. Anna vergrub ihr Gesicht in seinem schneebedeckten Mantel. Was war passiert? Wo waren Theresa und Hannes?
So als könnte er Annas Gedanken lesen, schüttelte Lorenzo traurig den Kopf.
Sie blickte an ihm vorbei und bemerkte eine kleine breite Gestalt, die auf sie zukam. Es war Pater Michael, der Leiter des Hospizes St. Leonhard im Loibltal, von dem sie heute Morgen aufgebrochen waren. Es war doch heute gewesen?
Der Geistliche kniete sich in den Schnee, legte seine große Hand vorsichtig auf Annas Stirn und sagte sanft: »Gott hat seine schützende Hand über Euch gehalten. Meine Mitbrüder bringen Euch zurück ins Hospiz.«
Das Hospiz? Wo war es, und wie war der Pater hierhergekommen?
»Wir waren nur noch wenige Meter vom Hospiz entfernt«, erklärte ihr Lorenzo. »Ein Wunder hat mich geradewegs hinter dem Haus an die Oberfläche gespült. Du musst ins Warme. Deine Lippen sind blau, und dein Gesicht ist völlig bleich.«
»Ich hatte keine Zeit, mich für dich schön zu machen », murmelte Anna.
Ein Lächeln umspielte Lorenzos Lippen. »Ich meine es ernst. Du hast Glück gehabt, und ich will nicht, dass du auf den letzten Metern erfrierst.«
Zwei kräftige Mönche brachten eine Tragbahre und hoben Anna vorsichtig darauf. Erneut fuhr ein stechender Schmerz durch ihr Handgelenk. In ihren Ohren surrte es, die Bäume um sie herum begannen zu tanzen.
»Werdet ihr Theresa und Hannes noch finden?«, fragte sie tonlos, schloss die Augen und fürchtete sich vor der Antwort.
»Wir werden nach Eurer Tante und dem Jungen suchen«, versicherte Pater Michael, aber seine Worte drangen nur noch von fern zu Anna durch. Das Surren wurde lauter, und dann erlöste eine Ohnmacht sie von weiteren Schmerzen und Sorgen.
Als Anna erwachte, war es draußen völlig dunkel geworden, durch die winzigen Butzenglasscheiben des Krankenzimmers drang nichts als Finsternis. Aber auf einem kleinen Tischchen neben Annas Bett brannte eine Kerze in einem Tonbehälter. Die kleine, warme Flamme warf bizarre Schatten an die dicken, breiten Balken an der Decke. Die Tür zum Gang stand offen, und Anna hörte, wie draußen geschäftig die Mönche über den sauber gekehrten Fliesenboden liefen. Die Geräusche waren so leise, als befänden sich die Mönche in einem anderen Haus, in einer anderen Welt. Aber sie verrieten ihr, dass sie in Sicherheit war.
Jemand rief: »Sie haben sie gefunden!«
Anna hörte das, verstand es aber nicht. Müde fielen ihr erneut die Augen zu, doch sie versank nicht mehr in tiefen Schlaf, immer wieder wachte sie auf. Irgendwann saß Theresa plötzlich an ihrem Bett. Die alte Tante hielt ihr die verletzte Hand, und Anna hatte keine Schmerzen.
»Wie machst du das?«, fragte Anna.
Die Tante lächelte und schüttelte den Kopf. Dann sagte sie mit ihrer tiefen, beruhigenden Stimme: »Alles wird gut. Wir brechen morgen auf und kehren zurück nach Wien. Unser Häuschen in der Tuchlauben wartet auf uns.«
Kurz nach Mitternacht begann Anna zu fiebern. Sie zitterte am ganzen Leib und war schweißnass. Jemand kühlte ihre glühend heiße Stirn mit einem feuchten Tuch.
Es war nicht Theresa.
Warum nicht? Wo war sie?
Jemand musste sie weggeschickt haben, denn freiwillig hätte sie ihre Nichte nicht alleingelassen. Verzweifelt bemühte sich Anna, die Augen aufzuschlagen, brachte aber nur ein Blinzeln zustande. Das schmale Gesicht vor ihr kam ihr bekannt vor, ein Mann mit dunklen Locken und hellblauen Augen. Wie hieß er nur? Anna wollte der Name nicht einfallen. Schickte es sich denn, dass ein Mann an ihrem Krankenbett saß? Sie war doch eine verheiratete Frau!
Anna erschauderte, denn mit einem Mal tauchte das aufgedunsene Gesicht von Kaufmann Stöckl vor ihr auf. Er hatte zu viel getrunken und wollte jetzt seine Rechte als Ehemann einfordern. Nein! Alles in Anna wehrte sich, sie wand sich im Bett hin und her. Sie wurde festgehalten. Aber sowohl der Druck der Hände als auch die Stimme, die auf sie einsprach, waren sanft, das konnte nicht ihr Ehemann sein. Anna entspannte sich wieder.
Sie fror, und gleichzeitig war ihr heiß. Schließlich warf sie die Decke von sich und erstarrte, denn dieser schreckliche Schmerz in ihrer Hand kehrte zurück, breitete sich im ganzen Körper aus und nahm ihr die Luft zum Atmen. Benommen sackte sie zurück aufs Bett. Jemand deckte sie erneut zu, flößte ihr mit einem Löffel heiße Flüssigkeit ein und wischte ihr wieder den Schweiß von der Stirn.
Anna verlor jedes Gefühl für Raum und Zeit. Wenn sie die Augen öffnete, war der Himmel hinter dem winzigen Fenster manchmal hellgrau und dann wieder völlig schwarz. Sie sah merkwürdige Bilder und träumte absonderliche Dinge. Bunte türkische Zelte tauchten vor ihr auf. Eine belagerte Stadt. Dann wieder sah sie eine Frau, die in den Wehen lag, um ihr eigenes Leben und das ihres Kindes kämpfte. Eine schöne Osmanin, Anna kannte die Frau, sie war ihre Freundin. Aber auch ihr Name war Anna entfallen.
Jemand wusch sie mit einem lauwarmen Tuch und wechselte ihr nasses Bettlaken. Anna war dankbar dafür. Endlich fiel sie erschöpft in einen tiefen Schlaf, der diesmal traumlos und erholsam zugleich war.
Als sie das nächste Mal erwachte, hatten das Zittern und die Kopfschmerzen nachgelassen. Annas Magen knurrte, sie hatte großen Hunger. Vom Gang her duftete es nach Suppe und frischem Brot, doch auf dem kleinen Tisch neben ihrem Bett stand bloß ein Tonbehälter mit einer heruntergebrannten Kerze. Draußen, hinter dem kleinen Fenster, war der Himmel schwarz. Wie spät es wohl war? Vorsichtig setzte sich Anna auf und bemerkte, dass ihr rechter Arm geschient und verbunden war. Sie versuchte die Fingerspitzen zu bewegen und bereute es sofort, denn augenblicklich kehrte der Schmerz zurück. Es dauerte eine Weile, bis er wieder nachließ.
»Lorenzo? Pater Michael?«
Vorsichtig spähte Anna zur winzigen Holztür. Der ganze Raum war ungewöhnlich niedrig, die dunklen, rußgeschwärzten Balken lagen so tief, dass ein großgewachsener Mann sich bücken musste. Sie hörte Schritte, und Augenblicke später schob sich ein dunkler Lockenkopf durch den Türspalt.
»Grazie a Dio!«, rief Lorenzo und stürzte ins Zimmer, den Kopf etwas nach vorn gebeugt, um sich nicht zu stoßen. »Endlich! Ich dachte schon, du willst den ganzen Winter verschlafen!«
Er lehnte sich über Anna und küsste sie auf die Stirn.
»Wie lange habe ich geschlafen?«
»Fast eine Woche lang! Ich habe mir solche Sorgen gemacht.« Lorenzo ließ Anna nicht aus den Augen. Zärtlich strich er ihr eine rote Haarsträhne hinters Ohr und streichelte ihr sanft über die eingefallene Wange.
»Wo sind Hannes und Theresa?« Die Bilder des Schneesturms und der Lawine tauchten vor Annas innerem Auge auf.
Noch bevor Lorenzo etwas sagen konnte, las Anna aus seinem traurigen Blick die Antwort.
»Wir haben Theresas Leichnam noch am selben Abend gefunden, und Hannes ist nach wie vor verschwunden … unter den Massen des Schnees verschüttet.«
»Nein!«, flüsterte Anna fassungslos. Ihr Herz setzte einen Moment lang aus. »Aber Theresa war doch hier!« Sie wusste genau, dass ihre Tante an ihrem Bett gesessen hatte.
»Du hast phantasiert«, erklärte Lorenzo. »Du hast nicht nur Theresas Namen, sondern auch den deines verstorbenen Ehemanns gerufen.«
Anna schloss die Augen. Theresa. Sie war ihr Ersatzmutter und weise Lehrherrin zugleich gewesen, sie hatte die Nichte nach dem Tod ihres brutalen Ehemanns bei sich aufgenommen und ihr ein selbständiges Leben ohne Ehe ermöglicht. Nun war sie tot. Von einer Lawine verschüttet.
»Wo ist sie? Ich will sie sehen!«
»Wir haben sie bereits begraben«, sagte Lorenzo.
»Nein, das kann nicht sein!« Mit der gesunden Hand krallte sich Anna in der Decke fest. Tränen traten ihr in die Augen. Wütend ballte sie die Hand zur Faust und schlug sich auf den eigenen Oberschenkel. Sie spürte den Schlag nicht.
»Ich will sie sehen, will mich von ihr verabschieden. Sie kann nicht tot sein!«
Lorenzo umfasste Annas Schultern mit beiden Händen. »Amore mio, ich weiß, dass es ein schrecklicher Verlust für dich ist. Aber sie hat sehr friedlich ausgesehen. So als hätte sie die Welt völlig im Reinen mit sich selbst und Gott verlassen.«
Anna war verzweifelt. »Sie ist erfroren, unter den Schneemassen erstickt.«
»Ja, gerade deshalb hätten ihre Züge schmerzverzerrt sein können. Aber ihr Gesichtsausdruck war beinahe glücklich.«
Anna ergriff Lorenzos Hand und bettelte wie ein Kind: »Bitte, Lorenzo! Ich will sie sehen. Will nur noch einmal ihr Gesicht sehen, will mich von ihr verabschieden. Bitte!«
Aber Lorenzo schüttelte langsam den Kopf: »Wir haben sie schon vor drei Tagen begraben. Pater Michael hat eine Messe für sie gelesen.«
Anna senkte den Kopf und presste die Lippen zusammen. »Wo ist ihr Grab?«, fragte sie tonlos.
»Gleich neben der kleinen Kapelle. Es ist ein schöner Platz. Morgens scheint die Sonne direkt darauf, und abends hat man von dort einen wundervollen Blick auf den Sonnenuntergang. Man überschaut das ganze Tal.«
Warme, salzige Tränen rannen über Annas Wangen, tropften auf ihr Schlüsselbein und versickerten im Nachthemd.
»Das Grab hätte ihr gefallen«, sagte Lorenzo. Er setzte sich auf den Bettrand und zog Anna an sich. Seine Wärme und sein Geruch spendeten ihr Trost.
»Und wo ist Hannes?«, schniefte Anna. Ihre Tränen durchnässten Lorenzos Hemd.
»Pater Michael hat gesagt, dass es in dieser Gegend oft zu Lawinenunglücken kommt. Auch das Hospiz ist immer wieder in Gefahr. Jedes Jahr gibt es Lawinenopfer. Ein paar von ihnen tauchen erst im Frühling mit der ersten Schneeschmelze wieder auf. Manche bleiben sogar für immer verschwunden.«
Anna kniff die Augen zusammen. Das Gesicht des dürren Jungen tauchte vor ihr auf. Sie erinnerte sich an den Tag, als er zerlumpt und fiebrig an ihre Tür in den Tuchlauben in Wien geklopft hatte. Ein Waisenkind, das sich auf den Straßen der Stadt sein Essen erbetteln musste. Es war schier eine Ewigkeit her. Inzwischen war Hannes Teil ihres Lebens geworden. Er hätte die Möglichkeit gehabt, in Wien bei einem freundlichen Kaufmann in die Lehre zu gehen, aber er wollte bei Theresa und Anna bleiben und hatte sich für die Flucht entschieden. Anna wünschte, er hätte es nicht getan. Wünschte, sie selbst hätte diese schreckliche Reise durch Kälte und Schnee nie angetreten.
Nach dem Frühstück setzte Anna sich gegen Pater Michael und Lorenzo durch und stand auf. Sie behauptete hartnäckig, dass sie kräftig genug sei, um zu Theresas Grab zu gehen. Pater Michael schüttelte sorgenvoll den Kopf, aber Lorenzo wusste, dass es sinnlos war, Anna von ihrem Vorhaben abzuhalten. Deshalb packte er sie in eine warme Wolldecke und begleitete sie hinaus.
Seitlich neben der Kapelle standen drei hohe Tannen mit schweren, ausladenden Zweigen. Das dichte Geflecht der Nadeln und der Schutz der Kapelle hatten dafür gesorgt, dass die Erde hier nicht ganz so fest gefroren war und man ein Grab hatte ausheben können. Auf einem frischen Erdhaufen befanden sich zwei schlichte Holzkreuze, auf dem größeren stand »Theresa Zapf«, auf dem kleineren »Hannes«. Sie hatten ihn nie nach seinem Nachnamen gefragt. Jetzt war es zu spät, sie würden ihn nie mehr erfahren.
Anna zitterte und schwankte, langsam sank sie auf die Knie. Sofort ergriff Lorenzo sie an den Schultern und versuchte sie hochzuziehen, aber sie wehrte ihn ab: »Ich will mich verabschieden und vor dem Grab meiner Tante knien.«
»Das verstehe ich. Deshalb bin ich mit dir hierhergekommen. Aber du hattest gestern noch Fieber. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Zwei Tote sind genug!«
Der bittende und zugleich besorgte Ton seiner Stimme war Grund genug, dass Anna sich beim Aufstehen helfen ließ. In ihren Gedanken suchte sie nach einem passenden Abschiedsgebet, aber es fiel ihr keines ein. Es gab keine Worte für den Schmerz, den sie empfand. Die Gebete, die sie kannte, klangen hohl und spendeten nicht den geringsten Trost.
Anna wollte weinen, aber ihre brennenden Augen blieben so leer, wie sie selbst sich fühlte. Sie versuchte daran zu denken, dass Theresas Seele sich nun an einem besseren Ort befand. Aber alles, was sie sah, war der kahle, frische Erdhügel, unter dem sie sich den leblosen, kalten Körper ihrer Tante vorstellte. Traurig und zitternd stand sie da, und Lorenzo wartete hilflos neben ihr.
Dann griff er in seine Manteltasche und holte einen Gegenstand hervor. Es war ein schmaler goldener Armreif, der Theresa gehört hatte. Lorenzo hatte darauf bestanden, dass die Mönche ihn der Toten abnahmen, damit Anna ihn bekam.
»Du sollst entscheiden, was damit geschieht«, sagte er leise und drückte Anna den Armreif in die gesunde Hand.
»Den hat Theresa von ihrer Mutter bekommen, und die hatte ihn von …« Annas Stimme versagte. Sie konnte den Namen des alten Apothekers nicht aussprechen. Meister Konrad hatte bis zu seinem Todestag gewartet, ehe er Theresa verriet, dass er ihr leiblicher Vater war. Das schien alles so lange her zu sein, dabei waren seitdem gerade erst fünf Monate vergangen. Für Anna war es eine Ewigkeit.
»Wenn du willst, können wir ihn aufs Grab legen.«
Aber Anna schüttelte den Kopf: »Sie hätte gewollt, dass ich ihn trage.«
Ungeschickt versuchte sie mit der verbundenen Hand, den Reif auf das gesunde Handgelenk zu streifen. Lorenzo half ihr dabei.
»Danke!«, sagte Anna und begann nun doch zu weinen. Erleichtert fühlte sie, wie die Tränen einen Teil der Traurigkeit aus ihrem Körper schwemmten.
Lorenzo legte seinen Arm um Annas bebende Schultern und drückte sie sanft an sich. »Komm, lass uns wieder hineingehen. Hier ist es zu kalt für dich.«
In der Gästestube wartete Pater Michael auf sie. Er hatte auf einer der schmalen Holzbänke Platz genommen, die rund um den riesigen, quadratisch gemauerten und grün gefliesten Kachelofen angebracht waren. Über dem Ofen befanden sich Stangen, auf denen man nasse Kleidungsstücke zum Trocknen aufhängen konnte. Der Kachelofen bildete das Zentrum des kleinen Raums, es war der behaglichste Ort im ganzen Hospital.
»Setzt Euch!«, sagte der kräftige Pater ernst zu Anna und Lorenzo und wies auf den Platz neben sich auf der Bank. Der Kopf des alten Priesters war völlig kahl, und das lag nicht an einer frischen Tonsur, sondern daran, dass er tatsächlich kein Haar mehr auf dem Kopf hatte.
Lorenzo nahm die Decke von Annas Schultern, half ihr aus dem Mantel und hängte ihn an einen der Haken an der Wand. Dann nahmen er und Anna Platz neben Pater Michael. Der Geistliche wirkte bedrückt, etwas Unangenehmes schien ihn zu belasten. Langsam bückte er sich und holte unter der Bank einen kleinen Leinensack hervor, den sowohl Lorenzo als auch Anna sofort erkannten. Es war Theresas Sack.
»Den haben wir neben dem Leichnam Eurer Tante gefunden«, sagte der Pater.
Lorenzo sog geräuschvoll die Luft ein, Anna hingegen war immer noch zu benommen, um die Gefahr zu erkennen, in der sie sich möglicherweise befand. In dem Sack war die Geburtszange, die ihr ein geschickter osmanischer Waffenschmied während der Belagerung von Wien geschmiedet hatte. Ein vollkommenes Werkzeug, das Frauen- und Kinderleben retten konnte, dessen Gebrauch die Kirche aber mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen bestrafte. Viele Geistliche vertraten die Meinung, es sei Gottes Wille, dass Frauen bei der Geburt litten und manche dabei auch starben. Mit Werkzeug nachzuhelfen und so möglicherweise Frauenleben zu retten, sei Teufelswerk. Schon der Besitz dieses Instruments war verboten und wurde in ganz Europa bestraft. Nur in England, wo der König alle Katholiken aus seinem Land vertrieben und ein Mann namens Chamberlen die Zange vor Jahren erfunden hatte, war ihr Gebrauch erlaubt. Deshalb befanden sich Hebammen, die Geburtszangen verwendeten, ständig in Gefahr, angezeigt und verurteilt zu werden. Auch Theresa war aus diesem Grund im Gefängnis gewesen, ehe Anna und Lorenzo sie auf waghalsige Art befreit hatten.
»Ihr wisst, was sich in dem Sack befindet?«, fragte Lorenzo tonlos.
»Nein!«, sagte Pater Michael scharf. Den beiden war sofort klar, dass er log. Seine besorgten, unruhig hin und her wandernden Augen verrieten ihn. Lorenzo setzte zu einer Erwiderung an, aber der Pater streckte ihm beide Hände abwehrend entgegen.
»Ich will es auch nicht wissen«, sagte er barsch. Pater Michael glaubte weder an Hexen noch an die Existenz des Teufels, und er war nicht nur Priester, sondern auch ein Arzt, der um jedes Menschenleben kämpfte. Er wusste um die Vorzüge dieses Instruments und wollte Anna keine Schwierigkeiten bereiten. Aber er musste sich auch selbst schützen, deshalb tat er so, als hätte er die Zange niemals gesehen.
»Ich muss Euch nur bitten, den Sack gut zu verstecken, damit keiner meiner Mitbrüder zufällig darauf stößt. Das Leben hier in den Bergen kann mitunter sehr eintönig und langweilig sein. Da kann es passieren, dass man der Versuchung erliegt und Dinge untersucht, die einem nicht gehören und einen nichts angehen.«
»Ihr fürchtet, Eure Mitbrüder würden unsere Sachen durchsuchen?«, fragte Lorenzo erschrocken.
»Ich sage, dass es besser ist, den Sack zu verstecken«, antwortete der Pater und machte mit einer Geste klar, dass er nicht weiter über diese Angelegenheit reden wollte.
Rasch nahm Lorenzo den Sack entgegen und steckte ihn unter seine Jacke. »Vielen Dank! Wir stehen tief in Eurer Schuld«, sagte er. »Und wir werden noch tiefer hineinrutschen, denn zurzeit ist es unmöglich, den Pass zu überqueren und weiterzureisen. Wir müssen Eure Gastfreundschaft wohl noch ein paar Tage in Anspruch nehmen.«
Pater Michael fuhr sich mit der Rechten über sein glattrasiertes, breites Kinn: »Ihr solltet besser auf eine Reisegruppe warten oder wenigstens auf einen erfahrenen Reisebegleiter. Es ist zu gefährlich, zu zweit im Winter die Alpen zu überqueren. So etwas könnte Euch das Leben kosten.«
Anna zuckte bei seinen letzten Worten unmerklich zusammen. Diese Reise hatte bereits das Leben von zwei Menschen gefordert, die ihr sehr nahegestanden hatten.
»Kommt denn um diese Jahreszeit jemand vorbei, der in den Süden zieht?«
»Natürlich kommen immer wieder welche vorbei. Händler wandern auch im Winter in den Süden, und es gibt eine Gauklertruppe, die jedes Jahr im Herbst diesen Weg nimmt. Heuer waren sie noch nicht da.«
»Vielleicht gibt es die Truppe gar nicht mehr. Wir befinden uns immer noch im Krieg mit den Türken«, sagte Lorenzo bitter. Die Bilder der belagerten Stadt Wien waren ihm noch sehr präsent. Als Kurier und später als Jurist des Stadtkommandanten und Grafen Starhemberg hatte er so viele Kriegsopfer gesehen, dass es für ein einziges Menschenleben mehr als genug war.
»Das ist schon möglich. Aber wie gesagt, es ziehen auch Händler in den Süden. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben und auf Gott vertrauen.« Der Pater machte eine Pause und fügte hinzu: »Eure Verlobte braucht ohnehin noch etwas Zeit, um sich vollständig zu erholen. Bis dahin kommen ganz sicher Reisende vorüber, denen Ihr Euch anschließen könnt. So lange seid Ihr unsere Gäste.«
2
DIE DICHTEN SCHNEEFÄLLE HIELTEN AN, und das Hospiz versank immer tiefer im frostigen Weiß. Eine Seite des Gebäudes war so tief eingeschneit, dass man die winzigen Fenster nicht mehr öffnen konnte, ohne eine Ladung Schnee in die Kammern zu bekommen. Täglich wurden Körbe voll Brennholz verheizt, Vorräte, die die Mönche den ganzen Sommer über gesammelt hatten.
Nun wurde auch klar, warum das Hospiz über eigene Kühe, Ziegen und Hühner verfügte. Die Tiere sicherten den Mönchen das Überleben. Ohne frische Milch, Eier und den selbstgemachten Käse würde es in den Wintermonaten eng werden.
Anna erholte sich nur langsam. Die Knochen ihrer Hand waren mehrmals gebrochen, bei jeder unvorsichtigen Bewegung fuhr ihr ein heftiger Schmerz in den Arm. Es dauerte, bis sie akzeptieren konnte, dass Theresa wirklich tot war und sie die geliebte Tante nie wiedersehen würde. Die Trauer um den Verlust wollte einfach nicht geringer werden.
Lorenzo gab sich alle Mühe, Annas Stimmung aufzuhellen, hatte aber nur mäßigen Erfolg. Er setzte darauf, dass Anna sich besser fühlen würde, sobald sie die schneebedeckten Berge hinter sich gelassen hatten. Aber das konnte angesichts der unaufhörlichen Schneefälle noch Wochen oder sogar Monate dauern.
Abends vor dem warmen Kachelofen erzählte Lorenzo von seiner Heimat, von den sanften Hügelketten, den Weinbergen, den Steinhäusern und der warmen Sonne. Doch während Lorenzos Vorfreude auf eine Rückkehr in die Toskana immer größer wurde, wuchsen Annas Zweifel. War es richtig, allein mit ihm in den Süden zu ziehen? So weit weg von Wien, ihrer Heimatstadt? In ein Land, wo sie die Sprache der Menschen nicht verstand, zu einer Familie, in der sie nicht willkommen war?
Anna wusste, dass Lorenzo vor Jahren bei Nacht und Nebel geflüchtet war, weil er eine Frau heiraten sollte, die er nicht liebte. Sie behielt ihre Zweifel für sich, denn sie wollte Lorenzo nicht verunsichern, aber sie fühlte sich einsamer und unglücklicher als je zuvor.
Die Tage vergingen, aus den Tagen wurden Wochen, und von einer Reisegruppe, die über die Alpen zog, war immer noch nichts zu sehen. Die wenigen Menschen, die sich ins Hospital verirrten, waren auf dem Weg nach Villach. Offenbar wagte niemand, in diesem strengen Winter den Weg über die Berge zu nehmen.
Gegen Ende der dritten Woche ließen die Schmerzen in Annas Hand allmählich nach. Pater Michael wechselte regelmäßig ihren Verband und kontrollierte den Fortschritt ihrer Genesung. An einem späten Vormittag, der Duft des Mittagessens zog bereits aus der Küche durch die Gänge des Hospizes, saß Anna in dem winzigen Behandlungszimmer, das gleichzeitig das Arbeitszimmer des Paters war. Der Geistliche wechselte gerade ihren Verband, als von draußen ein buntes Stimmengewirr ins Zimmer drang.
Ein junger Mönch steckte seinen runden Kopf mit der frischen Tonsur zur Tür herein und rief: »Der hinkende Gaukler mit seiner Truppe ist wieder da!«
»Ihr habt Glück«, sagte Pater Michael, ohne von Annas Hand aufzublicken. »Es ist sicher der Gaukler, von dem ich Euch bereits erzählt habe. Er zieht jedes Jahr im Herbst in den Süden, um dort den Winter zu verbringen. Diesmal ist er spät unterwegs, daran ist wohl der Krieg schuld. Aber er kennt den Weg und ist in den Bergen erfahren. Mit ihm werdet Ihr sicher in Eure neue Heimat gelangen.«
Neue Heimat? Anna schluckte hart. Würde sie sich jemals in der Toskana zu Hause fühlen? Sie vermisste Theresa mit jeder Faser ihres Körpers. Was sie hier am Loibl zurücklassen musste, war nicht nur ein geliebter Mensch, sondern auch ein weiteres Stück ihrer Heimat.
»Wie viele Leute hat er denn diesmal dabei?«, fragte Pater Michael, an den jungen Mönch gewandt.
»Zwei Männer und die Frau vom letzten Mal.« Der Bursche wurde rot. »Die Frau hat einen riesigen Bauch. Ich glaube, sie erwartet ein Kind.«
Annas Hand war nun fertig geschient, und Pater Michael ließ sie los.
»Eine schwangere Frau. Sie kann sich glücklich schätzen, dass eine Hebamme mit ihr weiterreisen will.«
»Eine Hebamme mit nur einer Hand«, sagte Anna bitter und verzog den Mund.
»Macht Euch keine Sorgen. Der Bruch war zwar kompliziert, aber nun wachsen die Knochen gut zusammen. In ein paar Wochen werdet Ihr nichts mehr davon bemerken.«
Anna warf dem alten Mann einen ungläubigen Blick zu.
»Nun ja, kann sein, dass Ihr Wetterumschwünge spürt. Aber das wird auch schon alles sein. Ihr werdet die Hand bewegen können wie früher. Ihr müsst bloß ein wenig Geduld haben, denn die Muskeln sind nun schwach und werden erst einmal noch schwächer werden. Es wird etwas Zeit brauchen, bis sie wieder so kräftig sind, wie sie einst waren.«
»Wie lange muss ich den Verband noch tragen?«, wollte Anna wissen.
Pater Michael wiegte den Kopf und überlegte: »Zwei Wochen mindestens.«
»So lange werden wir nicht mehr bleiben.«
»Ich weiß. Aber Ihr seid eine vernünftige Frau und werdet ihn nicht früher abnehmen.«
Er machte eine Pause und fuhr dann fort: »So, und jetzt lasst uns den Gaukler und seine Truppe begrüßen. Ich bin sicher, Euer Verlobter spricht schon mit ihnen. Er kann es kaum erwarten, von hier aufzubrechen.«
»Ich weiß«, erwiderte Anna seufzend. Sie wünschte, sie hätte Lorenzos Freude auf die Toskana teilen können.
Pater Michael, dem nichts entging, beugte sich zu Anna.
»Ich war noch nie im Süden. Aber die Menschen, die diesen Teil der Welt schon bereist haben, schwärmen von der Wärme, den Früchten und den Gerüchen. Wilder Rosmarin und Thymian, leuchtende Orangen und blühende Sträucher. Manchmal, wenn die Winter besonders kalt und unfreundlich sind, versuche ich mir das vorzustellen. Aber es gelingt mir leider nicht. Ich bin ein Mensch, der sein Leben lang die Kälte gewöhnt war. Aber ich kann Euch versichern, dass alle, die schon einmal im Süden waren, wieder dorthin wollen.«
Anna nickte. Aber wirklich überzeugt war sie nicht.
Als Anna und Pater Michael die Gästestube betraten, schlug ihnen warmer Dampf entgegen. Es roch nach schneenasser Kleidung, schwitzenden Menschen und dicker Linsensuppe mit Speck. Über dem grünen Kachelofen hingen feuchte Mäntel zum Trocknen, und rund um den großen, schweren Eichentisch saßen vier Reisende, Lorenzo und einer der Mönche. Alle waren über hölzerne Schüsseln gebeugt und aßen schlürfend heiße Suppe.
Das leise Stimmengewirr verstummte, als die Tür sich hinter Pater Michael schloss. Einer der Neuankömmlinge, der mit dem Rücken zu Anna saß, drehte sich langsam um und musterte sie unverhohlen mit großen dunkelbraunen Augen. Der Mann hatte schulterlanges dunkles Haar und einen kurzen Bart wie jemand, der sich seit einigen Tagen nicht rasiert hat.
Anna fand, dass die kurzen Bartstoppeln gut zu dem verwegenen Gesicht des Fremden passten. Die dunkelbraunen Augen ruhten eine Spur zu lang auf Annas Gesicht, so dass sie ihren Blick verlegen auf den Boden richtete. Der Mann grinste und stand auf, er war in etwa so groß wie Lorenzo. Nun ging er auf Pater Michael zu, und obwohl er sich bemühte, es zu verbergen, fiel Anna auf, dass der Mann hinkte. Sein rechtes Bein war steif.
»Pater Michael!«, sagte der Fremde voller Freude und breitete die Arme aus. Seine tiefe, melodiöse Stimme klang, als würde er singen. Er beherrschte Annas Sprache beinahe fehlerfrei, hatte aber den gleichen Akzent wie Lorenzo und betonte Vokale ungewöhnlich lang. Er umarmte den Pater, der ein gutes Stück kleiner war als er, und klopfte ihm begeistert auf den Rücken. Als er ihn wieder losließ, lachte Pater Michael.
»Claudio! Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ob dir etwas zugestoßen ist. Es ist bereits November. So spät bist du noch nie in den Süden gezogen!«
Der Gaukler zog die Schultern hoch und grinste schief: »Wir wurden von einer osmanischen Truppe aufgehalten.«
»Hat man euch gefangen genommen?«, fragte der Pater besorgt.
»Lass es mich so formulieren«, Claudio kratzte seinen Stoppelbart, »wir haben ein paar unfreiwillige Vorstellungen gegeben und durften schließlich weiterziehen.«
»Wie auch immer. Es ist schön, dass du da bist, Claudio! Wen hast du denn diesmal mitgebracht?« Pater Michael schob den Gaukler zurück zum Tisch und sah sich interessiert um.
»Wir sind in derselben Zusammensetzung wie im Vorjahr unterwegs. Alessandro, der Messerwerfer« – Claudio wies auf einen kleinen, untersetzten Mann mit hellblondem, verfilztem Haar –, »Silvio, der Seiltänzer!« Ein hagerer Mann mit einer hässlichen Narbe auf der rechten Wange, die noch nicht sehr alt aussah, erhob sich vom Tisch und deutete eine Verbeugung an. »Und Philippa, die Tänzerin!«
Neben dem Seiltänzer saß eine Frau, die etwa in Annas Alter war. Trotz ihrer langen hellblonden Haare, die sie zu einem dicken Zopf geflochten hatte, und den graublauen Augen war sie keine schöne Frau, sondern eher unscheinbar. Ohne Claudios Vorstellung hätte Anna ihr vermutlich gar keine Beachtung geschenkt. Die Frau nickte kurz und warf Anna einen fast ängstlichen Blick zu.
Nachdem Pater Michael jeden aus der Gauklertruppe einzeln begrüßt hatte, zeigte er auf Lorenzo und fragte Claudio: »Hast du dich schon mit meinen Gästen unterhalten? Die beiden wollen in die Toskana reisen. Leider sind sie vor einigen Wochen in eine Lawine geraten, und zwei ihrer Wegbegleiter sind dabei ums Leben gekommen. Jetzt suchen sie nach einer Gruppe, der sie sich anschließen können.«
»Wir haben nur kurz miteinander gesprochen«, sagte Claudio, ohne Lorenzo anzusehen. Seine gesamte Aufmerksamkeit galt Anna, der er nun galant einen Stuhl hinstellte.
Sie nahm Platz und sah den Gaukler mit der magischen Stimme fasziniert an. Es war wie ein Bann, dem sie sich nicht entziehen konnte. Sie wünschte, der Mann würde immer weitererzählen. Vielleicht eine Geschichte, ein Märchen, ganz egal, sie wollte seine Stimme hören.
»Wir wollen nach Montepulciano«, sagte Lorenzo ungewohnt scharf. Er hatte Annas Bewunderung für den Neuankömmling bemerkt und zog finster die Augenbrauen zusammen.
»Montepulciano«, wiederholte der Gaukler langsam.
Er sprach den Namen so melodiös aus wie Lorenzo und ließ sich neben Anna nieder. Rasch griff er nach seinem Löffel und beugte sich über die Suppenschüssel, so als handele es sich um ein verbotenes Thema, über das er nicht weiter sprechen wolle.
Anna hätte schwören können, dass Claudio mit diesem Ort im Süden irgendwelche Erinnerungen verband. Sie warf ihm einen Seitenblick zu, doch der Gaukler hing über seinem Teller, als befänden sich darin Goldstücke, die es zu entdecken gelte.
Ohne aufzuschauen, richtete der Gaukler eine Frage an Lorenzo: »Wie lautet Euer Name?«
»Lorenzo.«
»Und weiter?«
»Lorenzo Martecelli.«
Jetzt war sich Anna sicher, dass der Mann mit der wundervollen Stimme zusammengezuckt war. Es war nur ein ganz kurzer Moment gewesen, und er überspielte ihn gekonnt. Aber Anna spürte, dass dieser Claudio sowohl den Ort in der Toskana als auch Lorenzos Familiennamen kannte.
»Es tut mir leid, so weit reisen wir nicht«, sagte der Gaukler ernst.
Anna wusste, dass er log. Aber seine Stimme fesselte sie weiterhin. Wie schön musste es klingen, wenn der Mann sang! Bestimmt beherrschte er irgendein Instrument. Vielleicht eine Laute?
»Aber Ihr könnt bis Triest mitkommen.« Die herrliche Stimme riss Anna aus ihren Überlegungen.
»Damit ist uns geholfen. Von dort aus kommen wir gut allein zurecht«, sagte Lorenzo. Dann lehnte er sich zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und warf dem Gaukler misstrauische Blicke zu. Für seinen Geschmack saß Anna eine Spur zu nah bei dem Mann, und sie sah ihn eindeutig zu aufmerksam an.
Claudio war mit seiner Suppe fertig und schob die leere Schüssel von sich weg. »Wir nehmen Euch gerne mit. Aber wir werden irgendwann eine Pause einlegen müssen.«
Mit einer eleganten Bewegung strich er sich eine Haarsträhne aus der Stirn und drehte sich zu der blonden Frau um. »Philippa ist schwanger. Sie wird bald ihr Kind bekommen.«
»Anna Stöckl ist Hebamme«, warf Pater Michael, der das Gespräch aufmerksam verfolgt hatte, rasch ein. Der Geistliche genoss es, wenn Reisende im Hospiz waren. Viel zu oft litt er in den Bergen unter Einsamkeit.
Claudio sah zuerst den alten Priester an, dann drehte er sich zu Anna und blickte ihr direkt in die Augen. Ihr Dunkelbraun hatte etwas ebenso Magisches wie seine Stimme, der man sich nicht entziehen konnte. Vermutlich verzauberte er sein Publikum auf dem Jahrmarkt mit beidem.
»Manche Zufälle sind so merkwürdig, dass man glauben könnte, jemand halte die Fäden in der Hand und spiele mit uns«, sagte er langsam und bedeutungsvoll. Dabei beugte er sich ein Stück zu weit zu Anna, so dass sein Arm sie berührte. Ungeschickt schob sie ihren Holzsessel nach hinten, was ein unangenehmes Geräusch verursachte.
»Claudio!«, sagte Pater Michael ernst. »Deine Worte sind Gotteslästerung. Natürlich lenkt Gott unsere Wege, aber er spielt nicht mit uns.«
So weltoffen der Pater auch war, derart freche Worte mochte er in seinem Hospiz nicht dulden.
Anna verzog den Mund. Sie konnte den Gaukler gut verstehen. Manchmal hatte auch sie den Eindruck, bloß eine Spielfigur zu sein, die willkürlich auf ein bestimmtes Feld gesetzt wurde. So wie in dem Kampfspiel, das ihre osmanische Freundin gespielt hatte. Bauern gegen Springer, Türme gegen Läufer, und zuletzt fallen die Dame und ihr König. Manchmal machte das Spiel mehr Spaß, und manchmal war es eine bloße Zumutung. Derzeit war sie sich nicht sicher.
So als hätten die Gaukler ein besonderes Abkommen mit Gott, schien am nächsten Tag die Sonne. Dennoch zögerte sich die Abreise hinaus.
Nach dem Frühstück, das aus dickem Haferbrei mit Honig bestand, bestand Pater Michael darauf, noch einmal einen Blick auf Annas Hand zu werfen. Er gab ihr genaue Anweisungen, wann sie ihren Verband abnehmen und wie sie ihre Hand danach bewegen sollte. Danach wollte er den Reisenden Brot und Käse als Proviant mitgeben. Das Brot war aber noch im Ofen, und so musste die Gruppe warten, bis einer der Brüder die frischen, nach Anis und Fenchel duftenden Laibe aus der Backstube brachte.
Schließlich war es weit nach Mittag, als Anna, Lorenzo und die Gaukler abreisebereit waren. Pater Michael trat ein letztes Mal zu Anna und sagte: »Vergesst nicht, dass die Muskeln anfangs schwach sein werden. Aber mit gezieltem Üben und etwas Geduld werden sie sich wieder kräftigen. In ein paar Wochen werdet Ihr Eure Hand wieder so bewegen können wie früher.«
Anna nickte und hoffte, dass der alte Priester recht behielt. Sie vertraute ihm. Und sie wusste auch, dass sich der freundliche Geistliche liebevoll um Theresas Grab kümmern würde. Das half ihrer toten Tante zwar auch nicht mehr, aber der Gedanke spendete Anna auf seltsame Weise Trost. Und wenn Hannes’ Leiche im Frühjahr, sobald der Schnee weggetaut war, auftauchte, würde er neben Theresa seine ewige Ruhe finden.
»Ich wünsche Euch, dass Ihr im Süden eine neue Heimat findet«, sagte der alte Mann. Anna umarmte ihn stumm.
Dann trat sie ins Freie und folgte der seltsamen Gruppe, in deren Begleitung sie und Lorenzo die nächsten Wochen reisen würden.
Nach einem kurzen steilen Anstieg verlief der Weg zunächst relativ flach. Annas Freude darüber hielt aber nicht lange an. Kaum war das Hospiz außer Sichtweite, führte der Weg einen steil abfallenden Trampelpfad entlang, der noch dazu tiefverschneit war. Niemand wollte sich ausmalen, was geschehen würde, sollte sich einer der Steine unter der Schneedecke lösen. Ohne in den Abgrund zu schauen, folgte Anna Philippa, die direkt vor ihr stapfte. Sie bemühte sich, ausschließlich auf den schmalen Rücken der hochschwangeren Frau zu starren. Von hinten bemerkte man gar nichts von Philippas Zustand.
Der Pfad endete so abrupt, wie er begonnen hatte, und ging über in ein weites Schneefeld. Für Anna war es ein Rätsel, wie Claudio, der die Gruppe anführte, in der tiefverschneiten Landschaft einen Weg ausmachen konnte. Für sie sah alles gleich aus. Weiße Flächen, wohin sie schaute. Hin und wieder waren Tierspuren im Schnee zu erkennen. Anna tippte auf Schneehasen oder Bergziegen, sicher war sie sich aber nicht. Die Tiere selbst bekamen sie nicht zu sehen.
Die Stille, die herrschte, fand Anna beinahe beängstigend. Außer den stampfenden Geräuschen, die sie selbst verursachten, und ihrem lauten Keuchen war kein Geräusch zu vernehmen. Kein Vogelschrei, kein Surren von Insekten. Nicht einmal das leise Sausen von Wind. Nur eiskalte, klirrende Winterluft.
Claudio führte die Gruppe trotz seines steifen Beins zügig an, hinter ihm marschierten die beiden anderen Gaukler durch den Schnee. Die drei Männer zogen eine Spur durch das hohe, unberührte Weiß und erleichterten auf diese Weise den Frauen, die es mit ihren langen Röcken deutlich schwerer hatten, das Fortkommen. An dem Wollstoff blieben faustgroße Eisbrocken hängen, und innerhalb kurzer Zeit schleppten sowohl Philippa als auch Anna jede Menge unfreiwilligen Ballast mit sich.
Lorenzo bildete den Schluss. Er sorgte dafür, dass niemand zurückblieb. Anna war dankbar für seine Nähe, die ihr ein Gefühl der Sicherheit gab, obwohl sie wusste, dass es trügerisch war. Immer wieder sahen sie Schneebretter, die von Tieren losgetreten worden waren und die eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen hatten. Am liebsten hätte Anna ihre Röcke gerafft und wäre den Berg hinuntergelaufen, ohne anzuhalten. Vielleicht auch gerutscht. Hauptsache weg vom Schnee und zurück nach Wien.
Je weiter sie kamen, umso heftiger wurden ihre Zweifel. Wohin würde dieser beschwerliche Weg durch den Schnee sie führen? Was sollte sie ohne ihre Tante im Süden anfangen? An einem Ort, an dem ein Schwiegervater saß, der sie ablehnte?
Da sie so spät vom Hospiz aufgebrochen waren, endete der Reisetag schon nach wenigen Stunden. Die rasch untergehende Sonne beendete ihren Marsch, und Claudio suchte nach einer Almhütte. Er kannte den Weg genau, denn er war ihn schon zigmal gegangen und wusste, wo man in dieser unwirtlichen Umgebung übernachten konnte.
Die erste gemeinsame Nacht verbrachten sie in einem leerstehenden Schuppen, der im Sommer einem Hirten als Unterschlupf diente. Er war nicht mehr als ein hölzerner Windfang, der im Sommer gegen Regen und im Winter gegen Schnee schützte. Trotz eines kleinen Feuers war es eisig kalt. Anna schmiegte sich ganz eng an Lorenzo, bis er beinahe keine Luft zum Atmen mehr hatte, und dennoch zitterte sie die ganze Nacht über vor Kälte und vor Angst zu erfrieren.
»Bitte erzähl mir von der Sonne in deiner Heimat«, bat Anna mit klappernden Zähnen.
Lorenzo zog sie noch näher an sich und sagte: »Die Toskana wird auch deine Heimat werden, amore mio.«
Nur zu gerne hätte Anna seine Zuversicht geteilt.
Dann beschwor Lorenzo Bilder von orangeroten Sonnenuntergängen, zirpenden Grillen und duftenden Kräutern. Aber auch sie konnten die Kälte kaum mildern. Irgendwann schlief Anna erschöpft ein.
Die zweite Nacht war besser. Claudio fand den Weg zu einem abgelegenen Bauernhof, wo er den Bauern kannte, der ihnen ohne zu zögern den Stall überließ. Auf trockenem Stroh verbrachten sie die Nacht zwischen Kühen und Ziegen. Anna fand den Geruch schrecklich, aber es war deutlich wärmer als auf dem festgefrorenen Boden am Abend zuvor. Auch in dieser Nacht erzählte Lorenzo von seiner Heimat. Diesmal sprach er von Landschaften und Häusern und erwähnte kurz seine Schwester und seine verstorbene Mutter. Seinen Vater jedoch ließ er geflissentlich aus, was bei Anna statt Vorfreude unangenehme Phantasien auslöste.
Als die Sonne aufging, lud der Bauer alle zu einem großzügigen Frühstück ein. Es gab Brot, Eier, Käse und Speck. Anschließend kauften die Reisenden zu einem ehrlichen Preis Proviant für die nächsten Tage und setzten ihren Weg fort. Beim Aufbruch war der Himmel seit Tagen zum ersten Mal wolkenlos und strahlend blau, ein Tag ohne Schneefall kündigte sich an. Der Nebel und die schweren Wolken waren verschwunden, sie hatten freie Sicht auf die scharf gezackten Berge, graue Giganten mit messerscharfen Kanten. Anna erschauderte. War es besser, diese Felsriesen zu sehen oder sie gut versteckt im Nebel zu wissen?
Zunächst beschloss sie, sich erst einmal über die Sonnenstrahlen zu freuen, die den Schnee wie tausend Diamanten glitzern ließ. Doch schon nach einer Stunde wünschte sie sich wieder Wolken herbei, die das gleißende Weiß erträglicher machten. Ihre Augen tränten, sie musste ständig blinzeln und hielt sich die gesunde Hand wie ein schützendes Sonnendach über die Augen. Angeblich gab es Menschen, die vom Weiß des Schnees erblindeten. Wie konnte man sich dagegen schützen? Annas Haut im Gesicht wurde immer heißer. Bestimmt hatten sich ihre Sommersprossen mittlerweile verdreifacht, und spätestens übermorgen würde sich die verbrannte Haut in hässlichen Fetzen von ihrer Nase und den Wangen lösen.
Lorenzo hingegen schien die Sonne gar nichts auszumachen. Seine ohnehin sonnengebräunte Haut wurde noch dunkler, und seine Augen strahlten in kräftigem Hellblau wie immer. Auch Claudio und der Seiltänzer hatten keine Probleme mit der Sonne. Der stämmige Messerwerfer Alessandro und Philippa hingegen hielten sich ebenfalls die Hände schützend vors Gesicht.
Um die Mittagszeit bemerkte Anna, dass Philippa, die vor ihr ging, seit geraumer Zeit deutlich langsamer wurde. Der Abstand zwischen ihr und dem Messerwerfer vergrößerte sich zusehends. Außerdem blieb sie immer häufiger stehen und drückte sich beide Hände ins Kreuz.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Anna.
Die stille Frau nickte und ging rasch weiter, um kurz darauf wieder stehen zu bleiben.
»Habt Ihr Schmerzen?«, fragte Anna.
Philippa schüttelte den Kopf, doch ihr blasses Gesicht sagte etwas anderes.
»Philippa, wenn Ihr Schmerzen habt, müsst Ihr das sagen. Es kann sein, dass Euer Kind bald kommt.«
Philippa schüttelte eigensinnig den Kopf und ging weiter. Es war zwecklos, sie zu fragen. Anna hatte der stillen Frau angeboten, sie zu untersuchen, aber sie hatte davon nichts wissen wollen. Seit sie gemeinsam unterwegs waren, hatte Philippa bloß zweimal kurz gesprochen. Beide Male hatte Anna sie nicht gehört, da sie Claudio etwas zugeflüstert hatte. Auf dieser Reise wurde überhaupt wenig geredet. Claudio und Lorenzo gingen einander aus dem Weg, so gut es ging. Und sowohl Silvio als auch Alessandro waren wortkarge Männer, die nur das Allernötigste sagten.
Wieder blieb Philippa stehen. Diesmal atmete sie laut und schnell.
Anna versuchte gar nicht erst, sie nach ihrem Wohlergehen zu fragen. Sie hielt beide Hände an ihren Mund und rief: »Claudio! Bitte bleibt stehen!«
Der Gaukler hielt an und drehte sich fragend um.
»Philippa braucht eine Pause!«
Die blasse Frau presste die schmalen Lippen zusammen und schüttelte vehement den Kopf. Sie hob erneut ihre Röcke und stapfte weiter. Aber schon nach zwei Schritten blieb sie wieder stehen. Ihr Oberkörper krümmte sich zusammen, und plötzlich kippte sie zur Seite.
»Verdammt!«, fluchte Claudio und lief zurück. Er ließ sich neben der Tänzerin auf die Knie in den Schnee fallen und zog die Frau an den schmalen Schultern hoch.
»Philippa, was ist los?«
»Sie kriegt ein Kind!«, sagte Anna.
»Glaubt Ihr, das weiß ich nicht?« Verärgert drehte sich Claudio zu Anna. Seine dunkelbraunen Augen waren nun beinahe schwarz, hatten deshalb aber nichts von ihrer Anziehungskraft verloren.
Mit der flachen Hand klopfte Claudio auf Philippas blasse Wange. Langsam öffnete sie die Augen und hielt sich mit beiden Händen den Bauch.
»Es geht los«, hauchte sie.
»Maledetto!«, schimpfte Claudio. »Hast du das nicht früher gespürt? Wir haben vor Stunden den Bauernhof verlassen.«
Philippa schloss die Augen, um nicht antworten zu müssen.