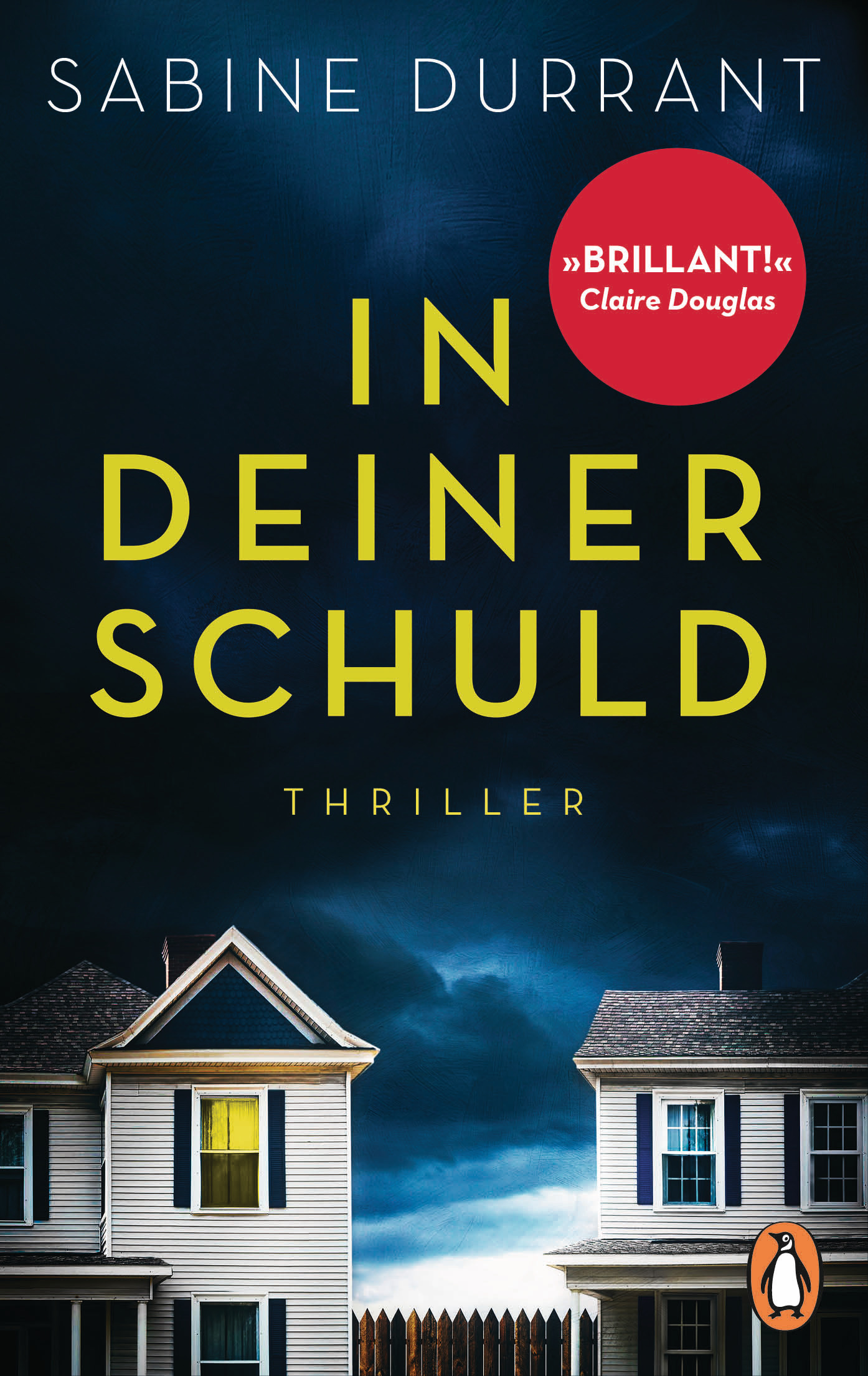12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine griechische Insel, eine Gruppe Freunde und ein nie aufgeklärtes Verbrechen
Seit Paul Morris einen großen Bestseller landete, sind viele Jahre vergangen. Mittlerweile ist das Geld aufgebraucht, und er leidet unter einer Schreibblockade. Doch auf Kosten anderer kommt er ganz angenehm durchs Leben, denn mit einem hatte Paul noch nie Probleme: lügen. Als er seinen alten Schulfreund Andrew Hopkins in dessen Villa besucht, lernt er dort Alice Mackenzie kennen. Die junge Mutter ist verwitwet – und sehr wohlhabend. Alice lädt Paul ein, sie und Andrews Familie in den alljährlichen Urlaub nach Griechenland zu begleiten. Dort, auf Pyros, verschwand vor zehn Jahren ein Mädchen spurlos, und Alice hat nie aufgehört, nach ihr zu suchen. Doch auch Paul war damals auf der Insel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
SABINE DURRANT lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in London, wo sie als Autorin und Journalistin arbeitet. Sie schreibt unter anderem für den Guardian, den Daily Telegraph sowie die Sunday Times und hat bereits mehrere Kinderbücher und Romane veröffentlicht, die in bis zu 15 Sprachen übersetzt wurden.
Sabine Durrant
DIE HOCHSTAPLER
Roman
Aus dem Englischen von Karin Dufner
Die englische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Lie With Me« bei Mulholland Books, an imprint of Hodder & Stoughton, an Hachette UK company, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
1. Auflage 2018
Copyright © 2016 by TPC & G Ltd
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Penguin Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Hafen Werbeagentur gsk
Covermotiv: © RIVA-Edition_Olaf_Tamm
Redaktion: Karin Labhart
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-21876-8V003
www.penguin-verlag.de
Für Francesca
August 2015
In der Nacht fiel mir ein, dass es sogar schon früher angefangen haben könnte. Erschrocken fuhr ich hoch und ritzte mir mit dem Fingernagel das Wort »BUCHLADEN« auf den Unterarm. Inzwischen sind die Buchstaben wieder verschwunden: Meine Haut hat sich wegen eines Insektenstichs entzündet, an dem ich herumgekratzt habe. Dennoch hat das Aufschreiben seine Aufgabe erfüllt. Heute Morgen kann ich mich noch sehr gut an alles erinnern.
Hudson & Co: das Antiquariat in der Charing Cross Road. Ich hatte angenommen, dass es dort begonnen hat – dass das alles nie geschehen wäre, wäre mein Blick nicht auf das rote Haar der albernen kleinen Verkäuferin gefallen. Oder irre ich mich? Hatte sich das Schicksal bereits in den Wochen und Monaten davor in Bewegung gesetzt? Reicht die Giftspur viel weiter zurück, lange bevor dieses dämliche Mädchen verschwand, bis hin zur Universität? Oder vielleicht noch weiter bis in die Schulzeit, die Kindheit, zu dem Moment, im Jahr1973, als ich mich mit rot angelaufenem Gesicht in diese gnadenlose Welt kämpfte?
Vermutlich will ich auf die Frage hinaus, wie viel wir zu unserer eigenen Vernichtung beitragen. Wie viel von diesem Albtraum habe ich mir selbst zuzuschreiben? Man kann vor Wut toben. Sich wehren und um sich treten. Unsinnige Dinge tun. Manchmal jedoch hat man keine andere Wahl, als die Hand zu heben und die Schuld auf sich zu nehmen.
DAVOR
Kapitel eins
Es war ein verregneter Tag, einer dieser grauen Nieselnachmittage in London, an denen Himmel, Gehwege und feuchte Hausfassaden ineinander übergehen. Es ist schon lange her, dass ich ein solches Wetter erlebt habe.
Gerade hatte ich mit Michael Steele, einem meiner ältesten Freunde, im Porter’s in der Unterführung in Charing Cross zu Mittag gegessen. Es war eine Weinbar, in der wir als Stammgäste verkehrten, seit wir im Alter von sechzehn Jahren entdeckt hatten, wie diskret sowohl die Lage als auch der Wirt des Lokals waren. Natürlich hätten wir uns inzwischen lieber in einem weniger muffigen und schummerigen Laden getroffen (zum Beispiel in diesem schicken kleinen Bistro in der St Martin’s Lane, das auf Weine von der Loire spezialisiert war). Doch die Nostalgie kann ein strenger Zuchtmeister sein. Wir hätten beide nicht im Traum daran gedacht, von dieser Gewohnheit abzuweichen.
Wenn ich mich von Michael verabschiedete, marschierte ich meistens mit einem im wahrsten Sinne des Wortes stolzgeschwellten Gefühl der Überlegenheit davon. Sein Leben war durch die Anforderungen einer Ehefrau, Zwillingen und einer Anwaltskanzlei in Bromley eingeschränkt. Er lauschte den Schilderungen meiner Missgeschicke – die alkoholgeschwängerten Abstürze in Soho, die blutjungen Freundinnen – mit Neid im Blick. »Wie alt ist sie diesmal?«, fragte er und machte sich über seine Schottischen Eier her. »Vierundzwanzig? Gütiger Himmel.« Er war kein Bücherwurm, doch eine Mischung aus treuer Freundschaft und Unwissenheit sorgte dafür, dass er mich noch immer für den größten Schriftsteller aller Zeiten hielt. Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, dass ein mittelprächtiger, vor zwanzig Jahren erschiener Bestseller womöglich nicht genug war, um meinen guten Ruf bis in alle Ewigkeiten aufrechtzuerhalten. Für ihn war ich der Star des »literarischen London« (sein Ausdruck), und wenn er die Rechnung übernahm – etwas, worauf man sich immer verlassen konnte –, geschah das weniger aus Mitleid als aus Heldenverehrung. Falls es nötig war, sich gegenseitig etwas vorzumachen, um den Status quo aufrechtzuerhalten, war das ein kleiner Preis. Ich bin sicher, dass viele Freundschaften auf Lügen beruhen.
Doch als ich an jenem Tag wieder hinaus auf die Straße trat, fühlte ich mich niedergeschlagen. Die Wahrheit, die ich natürlich für mich behalten hatte, lautete nämlich, dass es in meinem Leben rapide bergab ging. Mein letzter Roman war gerade abgelehnt worden, und Polly, die besagte Vierundzwanzigjährige, hatte mich wegen irgendeines aufgeblasenen politischen Bloggers verlassen. Aber die schlimmste Nachricht hatte ich erst heute Morgen erhalten, nämlich, dass ich aus meiner mietfreien Wohnung in Bloomsbury, die ich inzwischen seit sechs Jahren als mein Zuhause betrachtete, rausfliegen würde. Kurz gesagt, ich war zweiundvierzig, pleite und in der erniedrigenden Lage, wieder bei meiner Mutter in East Sheen einziehen zu müssen.
Und wie bereits erwähnt, regnete es zu allem Überfluss.
Regenschirmen ausweichend trottete ich die William IV Street entlang in Richtung Trafalgar Square. Vor dem Postamt blockierte eine Gruppe ausländischer Studenten mit Rucksäcken und neonfarbenen Turnschuhen den Gehweg, sodass ich in den Rinnstein geschubst wurde. Einer meiner Schuhe versank in einer Pfütze; ein vorbeibrausendes Taxi bespritzte das Bein meiner Cordhose. Fluchend humpelte ich über die Straße, schlängelte mich zwischen wartenden Autos durch, bog in die St Martin’s Lane ein und nahm die Abkürzung über den Cecil Court in die Charing Cross Road. Die Welt vibrierte – Straßenverkehr, Bauarbeiten, das Scheppern von Gerüststangen und der höllische Lärm der Eisenbahn. Der Regen fiel weiter vom Himmel, aber ich hatte dank meiner Hartnäckigkeit die U-Bahn-Station bereits passiert, als eine herannahende, mit Koffertrolleys bewaffnete Horde Touristen mich erneut abdrängte und an eine Schaufensterscheibe drückte.
Ich stützte mich an dem Glas ab, bis sie sich vorbeigewälzt hatten, und zündete mir dann eine Zigarette an. Ich stand vor Hudson & Co, einem Antiquariat, das auf Fotografie und Film spezialisiert war. Hinten im Laden gab es eine kleine Belletristikabteilung, wo ich, wenn ich mich recht erinnerte, einmal ein altes Exemplar von Glück für Jim geklaut hatte. (Keine Erstausgabe, aber eine orangefarbene von Penguin aus dem Jahr 1961 mit einer Zeichnung von Nicholas Bentley auf dem Einband: hübsch.)
Ich spähte hinein. Es war ein staubiger Laden, der gewiss schon bessere Zeiten gesehen hatte – in den meisten oberen Regalen herrschte gähnende Leere.
Und dann sah ich das Mädchen.
Sie starrte aus dem Fenster und lutschte an einer Strähne ihres langen roten Haars. In ihrem Gesicht spiegelte sich eine Langeweile, die so sinnlich war, dass es mich in den Fingern juckte.
Ich knipste das brennende Ende meiner Zigarette ab, steckte den Stummel in die Jackentasche und öffnete die Tür.
Ich sehe nicht schlecht aus (damals, bevor alles geschah, sogar noch besser) und habe, wie man mir gesagt hat, die Art von Gesicht, die Frauen anspricht – blaue Augen mit Lachfältchen, markante Wangenknochen und volle Lippen. Außerdem achtete ich sehr auf mein Äußeres, aber immer mit der Absicht, es so wirken zu lassen, als sei alles Natur. Beim Rasieren bemerkte ich manchmal die Länge meiner Finger, die auf meinem ebenmäßigen Kiefer lagen, die regelmäßige Anordnung meiner Bartstoppeln und die leicht gebogene, aristokratische Nase. Meiner Ansicht nach ist ein Leben in geistigen Sphären kein Grund, den Körper zu vernachlässigen. Ich habe eine breite Brust; selbst jetzt mühe ich mich damit ab, sie straff zu halten – die Übungen, die ich im Power Pulse, dem Fitness-Studio in Bloomsbury, während des kostenlosen »Schnuppermonats« gelernt habe, erweisen sich noch immer als sehr hilfreich. Außerdem wusste ich, wie ich mein Aussehen einsetzen musste: das verlegene, schüchterne Lächeln, der vorsichtige Augenkontakt, das beiläufige, gedankenverlorene Streichen durch mein zerzaustes blondes Haar.
Das Mädchen blickte kaum auf, als ich eintrat. Sie trug ein langes, geometrisch geschnittenes Oberteil über Leggings und klobige Motorradstiefel, hatte drei winzige Piercings am Rand der einen Ohrmuschel und war stark geschminkt. Ein kleines Tattoo in der Form eines Vogels prangte seitlich an ihrem Hals.
Ich neigte den Kopf und schüttelte rasch mein Haar aus. »Mistwetter«, sagte ich in aufgesetztem Cockney-Akzent. »Das regnet ja in Strömen da draußen.«
Sie wippte ein wenig auf den Absätzen ihrer Stiefel, ließ ihr Hinterteil auf einem Metallhocker ruhen und schaute kurz in meine Richtung. Die rubinrote Haarsträhne, auf der sie herumgekaut hatte, ließ sie los.
»Gewiss, Ruskin sagt, es gibt gar kein schlechtes Wetter«, fuhr ich, ein bisschen lauter, fort. »Nur verschiedene Sorten von gutem Wetter.«
Ihre mürrische Mundhaltung bewegte sich fast unmerklich auf ein Lächeln zu.
Ich hob meinen feuchten Mantelkragen an. »Aber erzählen Sie das mal meinem Schneider!«
Das Lächeln verblasste auf halbem Wege. Schneider? Woher sollte sie ahnen, dass das mit dem Mantel, den ich für einen Spottpreis bei Oxfam in Camden Town gekauft hatte, ironisch gemeint gewesen war?
Ich trat einen Schritt näher. Auf dem Tisch vor ihr stand ein Becher von Starbucks, auf den jemand mit schwarzem Filzstift den Namen »Josie« geschrieben hatte.
»Also Josie, richtig?«, fragte ich.
»Nein«, erwiderte sie mit ausdrucksloser Miene. »Das habe ich nur dem Barista gesagt. Ich gebe denen jedes Mal einen anderen Namen an. Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie etwas Bestimmtes?« Sie musterte mich von oben bis unten – den wasserfesten Tweed, die Cordhose, die klatschnassen Brogues und den kläglichen Mann mittleren Alters, der darin steckte. Auf der Theke vibrierte ein Mobiltelefon, doch obwohl sie nicht ranging, schaute sie immer wieder hin und stupste es mit der freien Hand an, um über den Rand des Bechers hinweg das Display lesen zu können – ich war eindeutig entlassen.
Gekränkt verdrückte ich mich in den hinteren Teil des Ladens, wo ich in die Knie ging und vorgab, in einem unteren Regal zu stöbern (zwei für fünf Pfund). Vielleicht kam sie ja frisch aus der Schule und gehörte nicht unbedingt zu meiner Zielgruppe. Trotzdem. Wie konnte sie es wagen? Mist.
In dieser Ecke stieg mir der Geruch von feuchtem Papier und Schweiß in die Nase; die Flecken und Finger anderer Leute. Außerdem war es hier beißend kalt. Als ich den Blick über die vergilbten Taschenbücher schweifen ließ, drängten sich mir Sätze aus der letzten E-Mail meines Verlegers in meine Gedanken: »Zu experimentell … Derzeit auf dem Markt nicht verkäuflich … Warum schreiben Sie nicht einmal einen Roman, in dem wirklich etwas passiert?« Ich richtete mich auf. Vergiss es. Ich würde so stolz wie möglich hier hinausspazieren und mich auf den Weg in die London Library machen oder – ein rascher Blick auf die Uhr – ins Groucho. Es war fast drei Uhr nachmittags. Vielleicht würde mir da ja jemand einen Drink ausgeben.
Ich habe mir seitdem den Kopf zerbrochen, ob das Türglöckchen gebimmelt hatte; ob diese Tür überhaupt ein Glöckchen hatte. Bei meinem Eintreffen hatte der Laden zwar menschenleer gewirkt, doch die Form des Raums ermöglichte es jedem, sich zu verstecken oder zu lauern – wie ich es selbst ja gerade tat. War er bereits im Laden gewesen? Oder nicht? Erinnere ich mich an den Geruch von West Indian Limes? Das erscheint mir wichtig, obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Vielleicht sucht mein Gehirn nur nach einer Erklärung für etwas, das vielleicht absoluter Zufall gewesen ist.
»Paul! Paul Morris!«
Er stand auf der anderen Seite des Bücherregals, sodass nur sein Kopf zu sehen war. Ich führte eine kurze optische Inventur durch: dicht beieinander stehende Augen, ein zurückweichender Haaransatz, der sein Gesicht auf merkwürdige Weise herzförmig wirken ließ, ein fliehendes Kinn. Die breite Spalte zwischen den Vorderzähnen half meinem Gedächtnis schließlich auf die Sprünge. Anthony Hopkins, ein Mitstudent aus Cambridge. Geschichte, wenn ich mich recht erinnerte. Vor einigen Jahren hatte ich ihn im Urlaub in Griechenland getroffen. Ich hatte das unangenehme Gefühl, dass ich bei dieser letzen Begegnung nicht gut abgeschnitten hatte.
»Anthony?«, sagte ich. »Anthony Hopkins?«
Ein leicht gereizter Ausdruck huschte über sein Gesicht. »Andrew.«
»Natürlich, Andrew. Andrew Hopkins. Entschuldige.« Ich tippte mir an die Stirn. »Wie nett, dich zu sehen.« Ich zermarterte mir das Hirn nach Einzelheiten. Ich hatte mit Saffron, einem Partymädchen, mit dem ich damals zusammen war, und einigen ihrer Freunde eine Rundfahrt um die Insel unternommen. Beim Anlegen hatte ich sie aus den Augen verloren. Der Alkohol war in Strömen geflossen. Hatte Andrew mir Geld geliehen? Jetzt stand er in einem Nadelstreifenanzug vor mir und hielt mir die Hand hin. Ich schüttelte sie. »Es ist … eine Weile her«, druckste ich herum.
Er lachte. »Das letzte Mal auf Pyros.« Von dem Regenmantel über seinem Arm perlten Wassertropfen. Die Verkäuferin schaute zu uns hinüber und belauschte unser Gespräch. »Wie geht es dir? Immer noch unter den Schreiberlingen? Ich habe deinen Namen im Evening Standard gesehen – Buchkritiken, richtig? Dein Roman hat uns sehr gut gefallen – meine Schwester war so begeistert, als du die Rechte an einen Verlag verkauft hast.«
»Äh, danke.« Ich verbeugte mich. Seine Schwester – natürlich. Ich hatte in Cambridge ein kleines Techtelmechtel mit ihr gehabt. »Du meinst Anmerkungen zu einem Leben.« Ich sprach so laut ich konnte, um der kleinen Zicke klarzumachen, welche Chance sie verpasst hatte. »Ja, einige Leute waren so freundlich zu sagen, sie hätten das Buch gemocht. Ich glaube, ich habe damit einen Nerv getroffen. In der New York Times hieß es …«
Er unterbrach mich. »Hast du seither etwas geschrieben?«
Das Mädchen schaltete einen Heizlüfter ein. Als sie sich vorbeugte, klaffte ihr seidenes Oberteil auseinander. Ich machte einen Schritt zur Seite, um sie besser sehen zu können, und erhaschte einen Blick auf ihre sanft gerundeten Brüste und den rosafarbenen BH.
»Dieses und jenes«, erwiderte ich. Ich hatte nicht vor, den lauwarmen Aufguss von einem zweiten Band und die enttäuschenden Verkäufe der beiden darauf folgenden Bücher zu erwähnen.
»Ja, ja, ihr Kreativen heckt ständig etwas Spannendes aus. Ganz anders als wir langweiligen Juristen.«
Das Mädchen war zu ihrem Hocker zurückgekehrt. Der Luftstrom des Heizlüfters bauschte ihr seidenes Oberteil auf und ließ es hochwehen. Unterdessen redete Andrew ohne Punkt und Komma. Er arbeite jetzt bei Linklaters, Schadensersatzklagen, und habe es zum Partner geschafft. »Noch mehr Überstunden. Rund um die Uhr auf Abruf.« Er zuckte die Achseln – Selbstzufriedenheit, getarnt als Resignation. Aber was könne man tun? Kinder in der Privatschule, bla, bla, bla, zwei Autos, eine Hypothek, die ihn »umbrachte«. »Ach ja, wirklich?«, sagte ich ein paarmal, doch er plapperte immer weiter. Er wollte mir zeigen, wie erfolgreich er war, und prahlte mit seiner Frau, während er das Gegenteil zu tun vorgab. Tina habe der Bankenwelt den Rücken gekehrt, »ausgebrannt, die Arme«, und einen kleinen Laden in Dulwich Village eröffnet. Ausgerechnet einen für spezielle Strickgarne. Liefe erstaunlich gut. »Wer hätte gedacht, dass man mit Wolle so viel Geld verdienen kann?« Er lachte kurz und selbstbewusst auf.
Ich langweilte mich und fühlte mich genervt. »Ich nicht«, erwiderte ich tapfer.
Geistesabwesend nahm er ein Buch aus dem Regal – Hitchcock von Francois Truffaut. »Bist du inzwischen verheiratet?«, fragte er und klopfte sich mit dem Buch auf die Handfläche.
Ich schüttelte den Kopf. Inzwischen? Wieder fiel mir seine Schwester ein – sie hatte auch eine Spalte zwischen den Schneidezähnen gehabt. Einen kecken Kurzhaarschnitt. Jünger als er. Wenn ich ihren Namen noch gewusst hätte, hätte ich mich nach ihr erkundigt. Lottie, oder? Lettie? Eindeutig eine Klette. Waren wir eigentlich miteinander im Bett gewesen?
Plötzlich wurde mir heiß. Ich fühlte mich beengt und wollte nichts als raus hier.
Hopkins sagte etwas, das ich nicht ganz mitbekam, obwohl ich die Wörter »Abendessen in der Küche« aufschnappte. Spielerisch klopfte er mir mit dem Hitchcock auf den Oberarm, als ob er sich in den letzten zwanzig Jahren oder vielleicht auch nur in den vergangenen zwei Minuten diese kumpelhafte Vertrautheit verdient hätte. Er hatte sein Telefon gezückt. Entsetzt wurde mir klar, dass er auf meine Telefonnummer wartete.
Ich schaute zur Tür. Draußen regnete es immer noch. Mittlerweile las die rothaarige Verführerin in einem Buch. Ich drehte den Kopf, um den Namen des Autors zu entziffern. Nabokov. Prätentiöses Geschwafel. Ich hatte das dringende Bedürfnis, ihr das Buch aus der Hand zu reißen, sie am Haar zu packen und den Daumen auf das Tattoo an ihrem Hals zu pressen, um ihr eine Lektion zu erteilen.
Ich wandte mich wieder Hopkins zu und erfüllte ihm lächelnd seinen Wunsch. Er versprach mir, mich anzurufen. Ich nahm mir fest vor, in diesem Fall einfach nicht ranzugehen.
Kapitel zwei
Es war zwei Wochen später, an einem Dienstagnachmittag Ende Februar, als er sich wieder bei mir meldete. Ich wohnte – mit knapper Not – noch immer in Bloomsbury. Die Abmachung lautete folgendermaßen: Alex Young, der Wohnungseigentümer und Geiger bei den New Yorker Philharmonikern, überließ mir die Wohnung, wenn ich dafür seine Katze fütterte. Ich musste mich nur dünnemachen, wenn er und sein Freund in der Stadt waren. Die Lamb’s Conduit Street mit ihren alternativen Cafés und den so angesagten »altmodischen« Herrenausstattern war mein geistiges Zuhause. Die Wohnung in der obersten Etage eines georgianischen Gebäudes enthielt nichts von meinen, sondern ausschließlich seine Sachen (Gemälde, weiße Bettwäsche, antike Möbel und eine Espressomaschine) und präsentierte der Welt den Mann, der ich sein wollte. Nun neigte sich dieses Arrangement seinem Ende zu. Ich versuchte, nicht daran zu denken.
Als mein Telefon klingelte, saß ich mit der London Review of Books in einem mit abgewetztem Samt bezogenen Ohrensessel und genoss einen kurzen Moment Wintersonnenschein. Die Strahlen schienen schwach durch das große Fenster. Die Schatten der viereckigen Fensterrahmens malten ein Himmel-und-Hölle-Muster auf den türkischen Teppich. Auf dem Tisch neben mir befanden sich eine Tasse Kaffee und ein Käsesandwich. Ich rationierte gerade den letzten Rest Brot. Persephone, die ich ins Herz geschlossen hatte, rollte sich auf meinem Knie zusammen wie ein kleiner Nerz.
Ich erkannte die Nummer nicht, war jedoch nicht auf der Hut. Gestern Abend im Pub hatte ich eine junge Uniabsolventin namens Kate kennengelernt, die versuchte, im Journalismus Fuß zu fassen. Ich hatte ihr meine Kontaktdaten auf die Handfläche geschrieben und ihr vorgeschlagen, sich bei mir zu melden, falls sie Rat brauchte. Als ich das Gespräch annahm, malte ich mir bereits unser Treffen aus (»bei mir ist es vermutlich am praktischsten«), ihre gehauchte Zustimmung, die Flasche Wein und dann ab ins Bett.
»Paul Morris«, sagte ich in dem knappen, professionellen Ton eines viel beschäftigten Mannes.
»Ach, hab ich dich doch erreicht.«
Nicht Katie. Eine Männerstimme, die ich nicht sofort erkannte. Irgendein Paragraphenreiter von einer der Literaturzeitschriften, die mir gelegentlich einen Auftrag zukommen ließen? Dominic Bellow, ein Saufkumpan aus Soho und Herausgeber der Zeitschrift Stanza, hatte mir letztens den neuen Will Self zur Besprechung zugeschanzt, und ich war mit meinem Artikel zu spät dran. (Das ist das Problem mit der Unterbeschäftigung: Selbst die Dinge, die man erledigen müsste, bleiben liegen.)
»Ja«, erwiderte ich argwöhnisch. Dem Anrufer vorzuschwindeln, dass er sich verwählt hatte, kam nicht mehr infrage. Schließlich hatte ich meinen Namen genannt.
»Hallo. Ich rufe dich an, um dich in die Wildnis von Dulwich zu entführen.« Dulwich? »Tina möchte dich unbedingt kennenlernen.« Tina? »Obwohl ich da besser vorsichtig sein sollte, denn ich weiß ja, wie du die Frauen um den Finger wickelst. Das mit Florrie verzeihe ich dir nie.« Er lachte herzhaft.
Florrie. Aber natürlich. Nicht Lottie. Florrie Hopkins, die Schwester von Anthony Hopkins. Andrew. Egal, wie er hieß. Ich erinnere mich noch daran, wie er im Buchladen das Wort »Schadensersatz« ausgesprochen hatte, mit einem breiten Grinsen und zusammenschnappenden Zähnen.
»Spitze«, sagte ich, obwohl ich »Scheiße« dachte. »Wie schön.«
»Was hältst du von diesem Wochenende? Samstag? Ein dankbarer Mandant hat mir gerade eine Kiste guten Wein geschickt. Wäre doch ein Jammer, den nicht mit Freunden zu teilen. Châteauneuf-du-Pape, 2009. Tina wollte ihr Spezialgericht kochen. Langsam gegartes Lamm. Marokkanisch.«
Ich bin nicht stolz auf mich. Doch wenn man auf sich allein gestellt ist und von der Hand in den Mund lebt, rechnet man mit spitzem Bleistift: die Kosten und Unannehmlichkeiten, die es mit sich bringt, sich in die Pampa südöstlich von London zu schleppen, gegen die sich möglicherweise daraus ergebenden Vorteile. Ein gutes Essen und ein Glas französischer Wein waren nicht zu verachten. Außerdem war es wichtig, Beziehungen zu pflegen. Schließlich würde ich bald obdachlos sein, und man konnte nie wissen, was sich daraus ergeben würde. Außerdem: Wie reich war er? Ich dachte an den Schnitt seines Anzugs, der sich formvollendet an seine Schultern schmiegte. Seine weiche Handfläche, als er mir die Hand geschüttelt hatte. Ich war neugierig darauf, wie er wohnte.
Das Sandwich mit den sich einrollenden Scheiben Billigkäse blickte mich elendiglich an. »Also am Samstag«, sagte ich. »Moment mal. Ja. Nächste Woche bin ich in New York, aber Samstag passt. Am Samstag habe ich Zeit.«
»Fantastisch.« Nachdem er mir den Weg beschrieben hatte, legten wir auf.
Ich blieb noch eine Weile im Sessel sitzen und streichelte die Katze.
Die Adresse führte mich zu einer breiten, von Bäumen gesäumten Straße ganz am Rand von Dulwich, gute zehn Minuten Fußmarsch vom nächsten Bahnhof entfernt: Herne Hill. Der lag auf derselben Linie von Victoria Station aus wie Michaels Bude in Beckenham, wo ich oft am Sonntag zu Mittag aß. Allerdings war das hier eine völlig andere Vorstadt, weniger gedrängt und hektisch. Hier wohnte auch mein Arschloch von einem Agenten, und das passte. Die Straßen waren breit und selbstbewusst. Selbst die Bäume schienen mit sich zufrieden.
Andrews Haus war eine frei stehende Villa aus der späten viktorianischen Ära mit einem Giebeldach und einer geschwungenen Auffahrt, wo drei Autos kreuz und quer parkten. Der Großteil der Fassade war mit Kletterpflanzen bewachsen, und ich entdeckte in einer Ecke der Regenrinne ein aufgegebenes Vogelnest. Die Lamellen der Läden am Erkerfenster waren geöffnet. Durch die Ritzen konnte ich Lichter, bewegliche Schatten und ein flackerndes Kaminfeuer sehen.
Ich versteckte mich hinter einer Hecke und versuchte, mir eine Zigarette anzuzünden. Da ein böiger Wind blies, brauchte ich mehrere Streichhölzer. Unter meinem Arm klemmte eine Flasche Wein, die ich im Laden neben dem Bahnhof gekauft hatte. Ein chilenischer Sauvignon Blanc: 4,99 Pfund. Das blaue, vom Kondenswasser durchfeuchtete Seidenpapier löste sich allmählich auf.
Ein großes Auto fuhr langsam vorbei, sodass die Stoßdämpfer über die Temposchwellen wippten. Auf dem Gehweg gegenüber schlenderten drei Jugendliche dahin, die Musikinstrumente schleppten. Unter einer Straßenlaterne blieben sie stehen und starrten mich an. Einer tuschelte etwas, die anderen lachten. In einem Viertel wie diesem fiel ein einzelner Mann ohne Familie, Hund, Volvo mit Allradantrieb oder einem verdammten Cello unangenehm auf. Ich drehte mich zur Hecke um. Zwischen einigen Zweigen steckte auf Augenhöhe ein verirrtes Lamettafädchen. Die Zigarette im Mundwinkel, zog ich daran und förderte eine Christbaumkugel zutage – rot, verziert mit einer Schneeflocke und weißem Kunstschnee. Ich steckte sie in die Manteltasche. Dann nahm ich noch einen letzten tiefen Zug, warf die Zigarette auf den Boden und trat sie aus.
Es ist ein seltsamer Gedanke, dass ich in diesem Moment noch hätte gehen können. Ich hätte auf dem Absatz kehrtmachen und mit meiner Christbaumkugel zum Bahnhof zurückkehren können – eine Zigarettenkippe wäre der einzige Beweis für meinen Besuch gewesen.
Zunächst dachte ich, ich hätte das falsche Haus erwischt. Die Tür wurde von einer Frau mit haselnussbraunen Augen geöffnet. Sie hatte ein offenes Gesicht und dichte Locken, die sie mit einem grünen Seidenschal zu bändigen versucht hatte: viel zu bohemienhaft, um Andrews Frau zu sein. Die Weinflasche in einer Hand, breitete ich die Arme aus – hier bin ich.
Die Frau musterte mich einen Moment lang. »Sie müssen Paul Morris sein«, sagte sie. »Wir warten schon auf Sie. Kommen Sie doch rein. Ich bin Tina.«
Ich streckte meine freie Hand aus, sie schüttelte sie und zog mich in die Vorhalle, wo ein großer gläserner Kronleuchter das Licht in Stücke zerteilte; kleine rautenförmige Fragmente bedeckten Boden und Wände. Ein dunkles Geländer führte eine geschwungene Treppe hoch. Ich schlüpfte aus meinem Tweedmantel, worauf sie ihn in einen geräumigen französischen Schrank hängte. Ich fühlte mich nackt, und es schnürte mir die Brust zu, als sie die Wohnzimmertür aufmachte. Eine Gruppe Fremder, die sich um ein Klavier geschart hatte, drehte sich um und starrte mich an. Eine brennende Kerze verbreitete einen aufdringlich süßlichen Geruch. Auf jeder freien Fläche drängten sich gerahmte Fotos von Kindern in Badesachen oder gesteppten Skihosen.
Eine Erinnerung regte sich, wie das Sediment auf dem Grunde eines Brunnens. Eine Einladung zum Tee bei einem Mitschüler. Der Anzug, in den meine Mutter mich gesteckt hatte; die Mutter des Jungen hatte nur einen Blick mit ihrem Sohn gewechselt. Ich schluckte heftig.
Andrew kam auf mich zu. »Mein lieber Freund«, verkündete er. »Wie schön, dass du uns vor New York noch einschieben konntest.«
»New York?«, erwiderte ich. »Ach, ja, beruflich. Ein Blitzbesuch. Ich werde wieder zurück sein, ehe ich mich versehe.«
Als ich Andrew die Weinflasche hinhielt, nahm er sie entgegen, ohne den Blick von mir abzuwenden. Der Hals meiner Isla-Negra-Flasche für 4,99 Pfund ruhte in seiner Handfläche und der Flaschenboden in seiner Armbeuge wie bei einem Sommelier. Kleine Pusteln vom Rasieren bedeckten seinen Hals. »Komm und lern die anderen kennen!«
Ich hatte meinen besten Anzug ohne Krawatte an. Die obersten drei Knöpfe meines weißen Hemdes standen offen. Ich war zu formell gekleidet. Alle trugen Jeans, die Männer Polohemden, die Frauen geblümte Tunikas. Ich holte tief Luft, rückte meine Manschetten zurecht und verzog meinen Mund zu einem Lächeln, dem Lächeln, von dem ich wusste, dass Frauen es liebten.
»Das ist Paul, der alte Freund aus der Uni, von dem ich euch schon erzählt habe.« Andrew schob mich zum Klavier und ratterte eine Liste von Namen herunter: Rupert und Tom, Susie und Izzy – ein Meer von Kinnen und spitzen Nasen, mageren Beinen, Kaschmir und baumelnden Ohrringen. »Oh, und Boo«, fügte er den Namen einer kleinen pummeligen Frau hinzu, die er beinahe vergessen hatte.
Man drückte mir eine kalte Champagnerflöte in die Hand, und ich bemerkte, dass ich im Mittelpunkt des allgemeinen Interesse stand. Mein Lampenfieber ließ nach – in solchen Situationen laufe ich oft zur Hochform auf –, und bald lehnte ich am Klavier und schilderte in leuchtenden Farben meine mühselige und abenteuerliche Reise. U-Bahn, Zug und den verdammten Fußmarsch. »Sonst war niemand zu Fuß unterwegs«, wandte ich mich tadelnd an Andrew. »Ich habe mich gefühlt wie in L. A. Ich musste sogar ein Auto anhalten, um nach dem Weg zu fragen. Zweimal.« Andrew lachte laut auf. »Paul ist Schriftsteller«, sagte er.
»Sie sind Schriftsteller?«, hakte Susie nach.
»Ja.«
»Wie alt warst du? Zweiundzwanzig, als du Anmerkungen geschrieben hast?«, fügte Andrew hinzu.
Ich lächelte bescheiden. »Einundzwanzig. In meinem letzten Jahr in Cambridge. Als es veröffentlicht wurde, war ich zweiundzwanzig. Das Buch hat es auf Platz neun der Sunday-Times-Bestsellerliste geschafft.«
Wie rein und unschuldig diese Worte waren. Ich spürte, wie sie auf fruchtbaren Boden fielen und Wurzeln schlugen – Samenkörnchen der Hoffnung, frische Schösslinge.
»Wie aufregend. Haben Sie seitdem noch etwas geschrieben?«, erkundigte sich Susie.
Mein Lächeln erstarrte. »Nur Kleinkram … einige kürzere Romane, von denen Sie vermutlich noch nie gehört haben.«
»Ist es wahr, dass jeder einen Roman in sich trägt?«, sagte eine Stimme hinter mir.
Das ist ein ärgerliches Klischee. Ich drehte mich um, um festzustellen, wer die Frage gestellt hatte. In der Tür stand eine schlanke, zierliche Frau mit schulterlangem blondem Haar. Sie trug eine mit Mehl befleckte Schürze.
Die Frau trat vor und streckte die Hand aus. Silberne Armreifen klimperten. Sie hatte ein kleines spitzes Kinn. Ihr Mund war schief, und der hellrosafarbene Lippenstift stand ihr nicht. Obwohl sie offenbar schon ein wenig älter war, hatte sie etwas Kindliches an sich. Nichts Besonderes, aber wenigstens attraktiver als das übrige Angebot. »Ich bin Alice«, sagte sie. »Wir kennen uns bereits.«
Sie erschien mir vertraut, auch wenn ich sie nicht einordnen konnte. »Wirklich?«
Sie neigte den Kopf zur Seite und streckte mir weiter die Hand hin. »Alice Mackenzie?«
Andrew, der am Klavier gelehnt hatte, trat vor. »Paul, erinnerst du dich nicht an Alice? Ich bin sicher, dass ihr euch schon begegnet seid. Ganz bestimmt in jener berüchtigten Nacht in Griechenland.« Er lachte.
Vor mir tat sich ein Abgrund auf. Ich dachte ganz und gar nicht gern an Griechenland. Also beschloss ich, nicht auf ihre ausgestreckte Hand zu achten, beugte mich stattdessen vor und küsste sie auf die Wange. »Natürlich«, meinte ich.
Sie rührte sich nicht und reckte mir weiter ihr Gesicht entgegen. »Du hast geraucht. Das rieche ich.«
Schicksalsergeben breitete ich die Hände aus.
Sie lehnte sich noch ein Stück vor, berührte mit beiden Händen meinen Hemdkragen und atmete tief ein und lenkte die Luft von meinem Mund zu ihrer Nase. »Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Es riecht wunderbar. So, und jetzt zurück in die Küche. Ich werde gebraucht.«
Sie verschwand durch die Tür. Andrew blickte ihr nach.
»Alice ist ein Wunder.« Boo hatte sich zu uns gesellt. »Eine wahre Naturgewalt.«
»Ach, wirklich?« Auf mich hatte sie nicht weiter ungewöhnlich gewirkt.
»Ja, sie ist einfach unglaublich.« Sie erhob die Stimme. »Wie alt war Alice, als sie ihren Mann verloren hat, Andrew?«
Andrew wirbelte herum. Er schloss die Augen. »Äh, Harrys Tod ist jetzt zehn Jahre her, also Anfang dreißig. Die Kinder waren noch klein.«
»Was für ein Pech«, sagte ich. »Krebs?«
»Nebennieren«, erwiderte Boo. »Der ist ausgesprochen selten. Er hatte Bauchschmerzen, und sie haben auf eine Blinddarmentzündung getippt. Inzwischen hatte der Krebs schon im ganzen Körper gestreut, und drei Monate später war er tot. Aber sie war so stark; sie hat sich wegen der Kinder zusammengenommen.« Ihr Tonfall war gleichzeitig ehrfürchtig und selbstzufrieden, so als könne ein Teil von Alices Heiligkeit auf sie abfärben, indem sie darüber sprach.
»Alice ist eine wundervolle Mutter«, ergänzte Andrew. »Und eine Anwältin, wie es sie nur selten gibt. Sie ist keine geldgeile Rechtsverdreherin wie ich.« Er legte eine Pause für eine Schweigeminute ein. »Alice arbeitet bei Talbot & Co – du kennst doch die berühmte Menschenrechtskanzlei in Stockwell. Sie vertritt hauptsächlich Asylbewerber.«
»Und geschlagene Frauen«, fügte Boo hinzu.
»Sie engagiert sich sehr für ›Frauen gegen sexuelle Gewalt‹, ›Frauen für Gleichberechtigung‹, ›Frauen für weibliche Flüchtlinge‹ … und so weiter.«
»Sie hat auch die Kampagne ›Findet Jasmine‹ ins Leben gerufen«, sprach Boo weiter, als ob ich zum Teufel noch mal gewusst hätte, wovon sie redete.
»Ihr seid euch schon mal begegnet«, sagte Andrew. »In jener Nacht auf Pyros. Wir haben alle am Hafen zu Abend gegessen, als wir dich gesehen haben. Erinnerst du dich?«
Ich krallte meine Hand in eine Sessellehne und hielt mich daran fest. »Wahrscheinlich war ich an diesem Abend nicht gut in Form«, antwortete ich vorsichtig.
»Du warst ziemlich daneben, alter Junge. Ein bisschen durchgedreht.«
Ich kratzte mich am Kopf und versuchte, die Sache ins Lächerliche zu ziehen. »Sonnenstich.«
Andrew schnalzte mit der Zunge. »Retsina.«
Ich warf Boo einen Blick zu. »Seitdem habe ich keinen Retsina mehr angerührt. Aversionstherapie.«
Zwei tiefe Grübchen entstanden auf Boos Wangen. Ich hatte sie als zu dick und zu aufgetakelt für meinen Geschmack abgetan, doch als ich sie mir nun genauer ansah, stellte ich fest, dass sie recht hübsch war: hellhäutig und blauäugig. Auch ihre Körperhaltung war sexy: die Schultern nach hinten, um ihr üppiges Dekolleté zur Geltung zu bringen, kurze pummelige Beine in optimistisch engen Jeans, die Zehen nach außen gerichtet wie eine Balletttänzerin.
Ich lächelte sie an und wich Andrews Blick aus.
»Es ist lange her«, sagte er.
»Das Essen ist fertig!« Tina stand in der Tür und schwenkte einen Holzlöffel. Gekräuselte rotbraune Haarsträhnen hatten sich aus ihrem Kopftuch gelöst, und ihre Wangen waren gerötet.
Ich verließ als Erster das Zimmer und folgte ihr den Flur entlang in eine riesige in Weiß und Cremefarben gehaltene Küche. Eine Kücheninsel mit Spülbecken, wo Alice gerade Salat wusch, teilte den Raum. Von einem Metallgestell an der Decke baumelten Pfannen aus Edelstahl, und am anderen Ende der Küche führten riesige Glastüren in den Garten. Ein kleiner Teil der Terrasse wurde vom Licht aus der Küche erleuchtet, der Rest verschwand in verschiedenen Stufen von Dunkelheit.
Hinter uns strömten die anderen herein. »Das Parken bereitet mir Kopfzerbrechen«, verkündete eine Männerstimme. Der Tisch aus schimmerndem Mahagoni war geschmackvoll gedeckt. Andrew begann, Kerzen anzuzünden, und zwar mit einem langen, eleganten Objekt, auf dessen Seite das Wort »Diptyque« stand. Klick. Klick. Tina hatte einen zerfledderten Zettel in der Hand und wies den Gästen ihre Plätze zu – sie war verlegen und tat so, als könne sie ihre eigene Handschrift nicht richtig lesen.
Ich stand neben dem mir zugeteilten Stuhl mit dem Rücken zur Küche und das Gesicht drei großen Gemälden zugewandt, die die Wand bedeckten. Sie waren schauderhaft: pseudoabstrakte Seestücke in grellen, nicht zueinander passenden Farben – Türkis, Orange und Weiß in großzügigen Mengen. Absolut nicht mein Ding. Ich bevorzuge Aktzeichnungen.
»Die sind von mir«, raunte Tina mir über die Schulter. »Also seien Sie nicht unhöflich.«
»Das war nicht meine Absicht. Sie sind so … lebendig. Es gefällt mir, wie Sie das Licht eingefangen haben.«
»Genau genommen stellen sie Griechenland dar. Pyros, wo … wo Sie auch schon waren. Der Blick von Circes Haus. Wir fahren jedes Jahr hin – dank Alice.«
Wir schauten uns beide nach Alice um, die sich noch immer am Spülbecken zu schaffen machte. Als sie ihren Namen hörte, hob sie den Kopf und lächelte uns geistesabwesend zu.
Tina wandte sich wieder zu mir um. »Leider ist bald Schluss damit.«
»Womit?« Andrew hatte seinen Platz am Kopf der Tafel eingenommen.
»Pyros.«
»Eine Schande ist das.« Er erhob die Stimme. »Arme Alice. Das Ende einer Ära.«
»Was, Griechenland?«, erwiderte sie und brachte eine dampfende Tajine zum Tisch. »Ja. Mein Mietvertrag ist ausgelaufen, und im Januar hat mir dieser Mistkerl von einem Grundbesitzer geschrieben, er werde das Land an Investoren verkaufen. An die Arschlöcher, die auch das Delfinos Resort gebaut haben. Aber wenigstens haben wir, was das Haus, wenn auch nicht das Land, angeht, einen Vollstreckungsaufschub. Ihr kommt diesen Sommer doch wieder zu Circes Haus, Tina und Andrew, oder? Eine große Abschiedssause.«
»Natürlich.« Andrew stand wieder auf, um Tina Platz zu machen. »Sonst würden die Kinder uns umbringen. Wir wären buchstäblich tot.«
»Buchstäblich?«, fragte ich.
»Gut so.« Alice setzte sich ihm gegenüber ans andere Ende des Tisches, wedelte dramatisch mit ihrer Serviette und legte sie dann auf ihren Schoß. »Und jetzt wird gegessen.«
Ich sah erst kurz sie, danach Andrew und schließlich Tina an, die irgendwo in der Mitte des Tisches saß. Man hätte meinen können, dass Alice hier die Gastgeberin war. War das marokkanische Lamm in Wahrheit ihr Spezialgericht, nicht das von Tina? Ich nahm mir einen Löffel voll, bis mir klar wurde, dass ich vermutlich zuerst meine Tischnachbarinnen – Susie auf der einen Seite, Izzy auf der anderen – hätte bedienen sollen. »Verzeihung«, sagte ich und holte mein Versäumnis nach. »Ich habe keine Manieren. Daran merkt man, dass ich auf dem Internat war – die Panik, wenn es Essen gab. Jeder Junge kämpft für sich allein.«
»Internat? Auf welchem denn?«, erkundigte sich der kahlköpfigere der beiden Männer.
Als ich ihm sagte, wo ich meine prägenden Jahre verbracht hatte, merkte ich ihm die Überraschung an. Die Schule genießt in Sachen Bildung einen guten Ruf. Außerdem ließ ich eine Bemerkung über mein Stipendium fallen und erwähnte, dass ich im Haus der Jahrgangsbesten gewohnt hatte. Tina ging darauf ein. »Ein schlauer Junge«, meinte sie. »Nicht nur ein hübsches Gesicht.«
»Oh, kannten Sie Sebastian Potter?«, fragte Izzy. »Er muss etwa in Ihrem Alter sein.«
»Nein«, antwortete ich zu schnell und fügte hinzu: »Der Name kommt mir bekannt vor. Wahrscheinlich war er ein paar Jahre über mir.«
»Oh, okay«, erwiderte sie. »Große Schule.« Als sie die Achseln zuckte, rutschte ihr das Oberteil übers Schlüsselbein, und die Federn an einem ihrer Ohrringe verhedderten sich in ihren Haaren. (Natürlich kannte ich Sebastian Potter. Er hatte zu den Dreckskerlen gehört, die mir das Leben zur Hölle gemacht hatten.)
Ich wandte meine Aufmerksamkeit dem Essen zu. Es war wirklich ausgesprochen lecker – die Sauce schmeckte nach Orangenblütenwasser und Safran, das Fleisch war wundervoll zart. Ganz gleich, ob Tina oder Alice es gekocht hatte, allein diese Mahlzeit war offen gestanden die Reise wert. Andrew hatte inzwischen den Wein eingeschenkt, und zwar aus einer Glaskaraffe. Vermutlich der versprochene 2009er Châteauneuf. Er rann mir angenehm die Kehle hinunter: auch hier keine Beschwerden.
Rings um mich herum schleppte sich das Tischgespräch von Tinas Wollladen namens Ripping Yarns bis hin zu Plänen für das Velodrom. Dann war die Schule an der Reihe, die offenbar einige Kinder der Anwesenden besuchten. Ein neuer Vorstand für die sechsten Klassen war kürzlich ernannt worden, doch sein Vorgänger wurde sehr vermisst. Einer der Lehrer in Naturwissenschaften war eine Niete. Boos Tochter war nicht in das Programm des Herzogs von Edinburgh aufgenommen worden. Offenbar hatte es zu viele Anmeldungen gegeben, weshalb man die Teilnehmer skandalöserweise ausgelost hatte. So ungerecht. Boos Mann, der geschäftlich verreist war, würde sich der Angelegenheit sofort nach seiner Rückkehr annehmen.
»Haben Sie Kinder?«, fragte mich Susie.
»Nein.«
»Dann langweilen Sie sich bestimmt schrecklich.«
»Ganz und gar nicht«, erwiderte ich.
»Wir sollten unsere Zungen hüten«, meinte Alice. »Wahrscheinlich sammelt er schon Material für seinen nächsten Roman.«
Wieder einmal eine Bemerkung, mit der zu rechnen gewesen war. Ich hatte aufgehört mitzuzählen, wie oft ich sie schon zu hören gekriegt hatte. Alice trug noch immer ihre Schürze, die inzwischen nicht nur mit Mehl, sondern auch mit Sauce bekleckert war. Außerdem hatte sie eine neue Schicht ihres grässlichen Lippenstifts aufgetragen. Der Rand ihres Glases war damit beschmiert.
Plötzlich hatte ich das dringende Bedürfnis nach einer Zigarette. Mir zitterten bereits die Knie. Ich entschuldigte mich, schob meinen Stuhl zurück und ging hinüber zur Glasfront, an der ich herumfummelte, bis ich herausfand, wie man sie entriegelte. Ich schlüpfte durch einen Spalt hinaus und machte die Tür leise hinter mir zu.
Der Garten lag im Dunkeln – eine lange, breite, von Büschen gesäumte Rasenfläche. An deren Ende hoben sich skelettartige Bäume vom Himmel und einer finsteren leeren Fläche ab: ein Spielplatz. Ein brauner Geruch nach Erde und Feuchtigkeit.
Nichts versperrte die Sicht auf das erleuchtete Haus hinter mir – die Kerzen auf dem Tisch, das funkelnde Besteck, jede Einzelheit war für alle, die hier draußen lauern mochten, deutlich zu erkennen. Lautes Gelächter, das Scharren eines Stuhls. Boos Stimme, die »Nein!« kreischte.
Ich verdrückte mich außer Sichtweite. Auf dem Rasen lauerte eine schmiedeeiserne Bank, verdeckt von Gebüsch und von der Küche aus nicht zu sehen. Ich hockte mich auf die Kante und versuchte, mir keinen feuchten Hosenboden zu holen. Ein Klettergerüst und ein Trampolin mit hohen schwarzen Seitenwänden ragten auf wie Sträflingsschiffe in den Sümpfen von Kent. Der Mond tauchte auf, malte Lichtpunkte auf den Rasen und war wieder fort. Ein Flugzeug flog über mich hinweg – ein zorniges Grollen im Wind.
Diesmal hatte ich keine Mühe, meine Zigarette anzuzünden. Es war kalt. Ich hätte meinen Mantel mitnehmen sollen. Ich fragte mich, wie bald ich mich wohl würde verabschieden können. Der Abend war nett gewesen – ich hatte mich wacker geschlagen –, doch nun hatte ich gegessen, und sonst gab es hier nichts, was mich interessierte. Keine Frauen. Keine Arbeit. Nicht der Hauch eines Angebots, das Haus zu hüten. Ich inhalierte tief und sog mir das Nikotin ins Blut.
Plötzlich waren da lautes Stimmengewirr und ein Schwall warmer Luft, die schon im nächsten Moment wieder verschwanden. Ich drehte mich um. Alice stand auf der Terrasse. Ich verhielt mich ruhig, in der Hoffnung, dass sie wieder hineingehen würde. Doch sie machte einige Schritt über den Rasen und entdeckte mich.
»Hallo«, sagte sie.
Mit einer raschen Handbewegung ordnete sie einige Haarsträhnen am Hinterkopf – eine Geste, die Frauen so rührend verstohlen beherrschen. Ein leichtes Zusammenzwirbeln, ein bisschen Glätten, so als glaubten sie, ihr Haar sei nur in einer ganz bestimmten Form annehmbar. Seltsamerweise geht mir das immer zu Herzen.
Sie trat noch einen Schritt auf mich zu. »Ich dachte, ich könnte eine Zigarette von dir schnorren – wenn es dich nicht stört.«
Wie jedes Mal war ich leicht verärgert. Warum können Nichtraucher sich nicht selbst Zigaretten kaufen? Oder gleich gar nicht rauchen? »Natürlich«, erwiderte ich galant und griff in die Jackentasche.
Als sie sich, die Ellbogen auf den Knien, neben mich kauerte, reichte ich ihr eine Zigarette. Ich machte eine spöttische Bemerkung darüber, was für eine weibliche Marke ich rauchte – Silk Cut mit einem ganz besonders niedrigen Teergehalt. Sie lachte, obwohl ich nur versucht hatte, von meinem Feuerzeug abzulenken. Es war der lange, dünne Stab, den Andrew auf dem Tisch liegen gelassen hatte. Ich schob das Ding zurück in meine Tasche und fuhr fort, es zu betasten. Es war mattschwarz und fühlte sich glatt an.
Sie nahm einen tiefen Zug. »Wunderbar«, sagte sie. »Eigentlich rauche ich gar nicht. Die typische Gesellschaftsraucherin, obwohl es heutzutage immer schwieriger wird, an dieser Gewohnheit festzuhalten.« Sie setzte zu einem Vortrag an, dass E-Zigaretten ihr den ganzen Spaß verderben würden. Die Gelegenheiten, sich »eine leicht bekiffte Schwummerigkeit« zu gönnen, würden immer seltener.
»Wahrscheinlich kann man jemanden, der an einem elektrischen Verdampfer zieht, nicht bitten, einem ein kleines Dampfwölkchen abzugeben«, meinte ich. »Außer man hat Lust auf einen Mund voller Spucke mit Karamellgeschmack.«
»Genau.« Sie lachte. Ihre mandelförmigen Augen unter den geschwungenen Brauen waren grün wie die einer Katze.
»Wie hast du Andrew eigentlich kennengelernt?«, erkundigte sie sich. »Ich habe ganz vergessen nachzufragen.«
»Ich war mit ihm am Trinity.«
»Aha, Cambridge. Natürlich.« Sie lächelte. »Kanntest du ihn damals gut?«
»Eigentlich nicht.« Ich lehnte mich auf der Bank – feucht oder nicht – zurück und hob das Gesicht zum Himmel. »Ich hatte ein bisschen mit seiner Schwester zu tun.«
»Florrie. Ja, klar.«
»Kennst du sie?«
»Wir waren in der Schule beste Freundinnen. Andrew bin ich durch sie begegnet. Ich habe sie häufig in Cambridge besucht. Vielleicht sind wir beide uns dort auch schon über den Weg gelaufen.« Sie schmunzelte. »Ich habe ihr viel zu verdanken. Andrew und ich sind tolleKumpel.«
Tolle Kumpel. Sie lachte schrill und gekünstelt auf. Offenbar gehörte sie zu den Frauen, die zwar plappern und flirten, aber es ist alles nur gespielt. Alles Wichtige behalten sie für sich. Man erfährt nie, was sich wirklich hinter der Fassade verbirgt. Falls da überhaupt etwas ist. Außerdem sind sie miserabel im Bett.
Sie musterte eingehend ihre Zigarette, blickte dann auf und sagte kokett: »Du erinnerst dich nicht daran, dass du mich schon einmal getroffen hast, richtig? Weder in Cambridge noch in Griechenland?«
»Du kommst mir bekannt vor.« Ich ließ die Zigarette fallen und trat sie mit dem Absatz ins Gras. Dann beschloss ich, den Stier an den Hörnern zu packen. »Pass auf, Alice. Es tut mir wirklich leid. Den ganzen Abend schon war mir die Sache ein wenig peinlich. Keine Ahnung, warum Andrew mich eingeladen hat. Damals in Griechenland war ich total durch den Wind. Wie lange ist es jetzt her, acht Jahre?«
»Zehn.«
»Ich bin nicht stolz auf diese Phase meines Lebens. Wir haben eine von diesen Sauf-Rundfahrten gemacht. Ich habe meine Freunde aus den Augen verloren, und das Boot hat ohne mich abgelegt. Und da bin ich zufällig Andrew über den Weg gelaufen, und er hat mir zum Glück aus der Patsche geholfen. Aber, ehrlich gesagt, sind die Einzelheiten bis heute ziemlich verschwommen.«
»Soll ich dir erzählen, woran ich mich erinnere?«
»Wenn es sein muss.«
Sie lachte. »Du kamst in die Taverne gestürmt, wo wir gerade zu Abend aßen. Du hattest ein violettes T-Shirt mit der Aufschrift ›Zeus Nightclub‹ an, hast rumgebrüllt und dich ziemlich aufgeführt. Dann hast du zu singen angefangen.«
»Wirklich?« Ich wand mich innerlich. Allerdings machte es mir Mut, dass sie das anscheinend komisch fand. »Zeus, ja, das mit dem T-Shirt weiß ich noch. Und … Singen … Singen war noch nie meine Stärke.«
»Andrew hat dich in ein Taxi bugsiert. Dich hineingekippt, ich glaube, so hat er es ausgedrückt.«
»Andrew ist ein Gentleman.«
Ein Ruf aus der Küche. Alice warf einen letzten Blick auf ihre Zigarette und schnippte sie ins Blumenbeet. Sie trug eine kurze violette Strickjacke, wie sie zu einer älteren Dame gepasst hätte. Nun zog sie sie am Hals zusammen. Ihr Gesicht wurde plötzlich ernst. »Diese Nacht hat sich in allen Einzelheiten in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich erinnere mich an alles. Es war eine schreckliche Zeit …«
»Das habe ich gehört. Dein Mann …«
»Ich spreche nicht von Harry.« Sie schüttelte den Kopf und lachte verzweifelt auf. »Er war schon im Jahr davor gestorben. Nein, ich meine jene Nacht, die Nacht, in der Jasmine verschwand.«
Wenn ich gründlich genug in den trüben Tiefen meines Verstandes gekramt hätte, wäre ich auf das gestoßen, wovon sie redete, allerdings nur auf Fetzen, Bruchstücke und Wege, die plötzlich endeten.
»Hilf mir auf die Sprünge«, forderte ich sie auf.
Alice verzog das Gesicht. »Jasmine. Jasmine Hurley. Du warst da. Die arme Yvonne, ihre Mutter. Oh Gott.« Sie ließ ihre Strickjacke los und begann mit steif ausgestreckten Fingern zu gestikulieren. »Es stand in der Zeitung. Du musst am nächsten Tag davon gehört oder gelesen haben. Wo hast du gewohnt? Elconda? Sogar die Polizei auf Pyros, die sich von Anfang an nicht sehr geschickt angestellt hat, muss dort zumindest ermittelt haben … Sicher erinnerst du dich noch daran.«
Ich senkte den Kopf. Noch nie war es mir so peinlich gewesen, dass man mich bei meiner Gefühllosigkeit ertappt hatte. Allerdings hatte sie mein Gedächtnis angeregt, obwohl die Einzelheiten weiterhin verschwommen blieben – ein weggelaufener Teenager, eine alleinerziehende Mutter, ein zwielichtiger Freund? »Ja, ja, natürlich«, sagte ich. »Ich weiß es noch. Tut mir leid.«
Sie legte die Finger einer Hand auf den Nasenrücken. Ich tätschelte ihre Schulter und machte ein trauriges und besorgtes Gesicht, so gut es mir möglich war. Inzwischen wollte ich dringend wieder hinein. Es lag nicht nur an der Kälte. Ich fühlte mich deplaziert und außerdem gereizt – zwei Emotionen, die sich vermischten und einander keinen Gefallen taten.
Durch das Gewirr der Büsche schimmerte Licht aus der Küche nach draußen. Andrew umrundete, die funkelnde Karaffe in der Hand, den Tisch. Tina befand sich auf der anderen Seite des Raums und bückte sich, um eine Schüssel – Fruchtpudding? – aus dem Kühlschrank zu holen. Boo reckte die Arme in die Luft: Sie versuchte, ihre Strickjacke auszuziehen, die sich mit ihrem Oberteil verheddert hatte. Ich erhaschte einen kurzen Blick auf nackte Haut und einen BH-Träger.
Ein hohes Zirpen sorgte dafür, dass ich mich wieder zu Alice umwandte. Sie wischte sich die Augen ab und kramte ein Mobiltelefon aus der vorderen Tasche ihrer Jeans.
»Phoebe, meine Älteste, will von einer Party abgeholt werden«, verkündete sie, nachdem sie das Display betrachtet hatte. »Tja, da wird sie wohl den Nachtbus nehmen müssen. Ich habe viel zu viel getrunken.«
Beim Sprechen tippte sie rasch eine SMS. »Mal ehrlich, sie ist fast achtzehn und wird bald von zu Hause ausziehen. Man möchte doch meinen, dass sie ein bisschen selbständiger geworden wäre.« Sie steckte das Telefon wieder ein, wobei sie die Hüfte nach vorne kippte, damit es besser in die Hosentasche passte. »Obwohl nur der Himmel weiß, was ich anfangen werde, wenn sie weg ist. Ich kann nicht an ihrem Zimmer vorbeigehen, ohne es mir leer vorzustellen.«
Sie erschauderte, zog die Schultern hoch und rieb sich den Unterarm. »Wir gehen wohl am besten wieder rein.«
»Zeig mir noch mal dein Telefon«, forderte ich sie auf.
Sie hielt meinem Blick stand. »Warum?«
»Mach schon.«
Ein verkniffenes Lächeln. »Nein.«
»Es hat Hasenöhrchen, stimmt’s?«
Ich vollführte eine rasche Bewegung, als wollte ich ihr in die Tasche greifen. Kichernd fuhr sie zurück, holte es dann mit einem kindlichen Schmollen heraus und warf es mir zu. »Also gut. Erfreue deine Augen daran. Lach dich ruhig scheckig.«
Ich drehte das Telefon auf meinem Schoß um, wo es gelandet war. »Die Hülle deines iPhones hat die Form eines blauen Häschens«, stellte ich sachlich fest.
»Mein Sohn Frank hat es mir geschenkt!«
»Nimmst du Superanwältin es auch mit zur Arbeit? Zu deinen wichtigen Besprechungen?«
Als sie grinste, bemerkte ich, warum sie einen schiefen Mund hatte. An einem Mundwinkel zeigte ein winziger, etwas hervortretender Pfeil nach oben. Eine kleine Narbe.
Das Gefühl kam aus dem Nichts. Sie hatte nicht geflirtet, und sie war auch nicht mein Typ – unter anderem mindestens zwanzig Jahre zu alt. Also wusste ich nicht, woran es lag, vielleicht an Boos BH oder dem Gedanken an Alices warme Hüfte unter der Tasche ihrer Jeans. Möglicherweise auch an ihren lebhaften Bewegungen. Es konnte auch sein, dass ich im Hinterkopf noch immer mit der Vorstellung eines freien Zimmers in einem gemütlichen Haus spielte. Doch als ich die Narbe sah, hatte ich plötzlich das Bedürfnis, sie abzulecken.
Kapitel drei
Am nächsten Morgen rief ich Andrew an, um ihn nach Alices Nummer zu fragen. Falls er erstaunt war, verbarg er es gut. »Na klar, Moment mal«, sagte er. Darauf begann er herumzuschimpfen. »Entschuldige … ich bin einfach zu blöd … warte eine Sekunde …«, murmelte er. Er bezeichnete sich selbst als »Technikflasche« und konnte während des Telefonierens nicht auf seine Kontaktliste zugreifen. »Tina!«, rief er. Dann endlich: »So, hier hätten wir sie. Alice Mackenzie. Büro, privat oder mobil – oder vielleicht alle drei?«
»Mobil«, erwiderte ich. Ich rollte die Christbaumkugel aus seiner Hecke zwischen den Fingern und spürte, wie der Glitzer sich in körnigen Staub verwandelte.
»Okay.« Er hielt inne. »Rufst du sie jetzt oder erst nach deiner Geschäftsreise an?«
»Was für einer Geschäftsreise?«
»New York.«
»Ach ja.«
Wieder eine Pause. Dann meinte er: »Hör zu, ich weiß, dass ich mich wie ein Idiot benehme. Aber ich kann nicht anders, als den Beschützer zu spielen. Ali hat so schwere Zeiten hinter sich – Harrys Tod hat sie entsetzlich mitgenommen. Sie hat alles wundervoll gemeistert, und ihre Kinder sind toll. Doch sie ist noch immer nicht wieder auf dem Damm. Mir und Tina, uns beiden, bedeutet sie sehr viel. Ich möchte nicht, dass sie verletzt oder gekränkt wird, oder … So, ich habe genug gesagt. Ende des Vortrags.«
Was hätte ein besserer Mann, als ich es bin, wohl geantwortet? »Du hast völlig recht. Meine Absichten sind absolut unehrenhaft. Deine Worte haben mich zur Vernunft gebracht, und ich werde einen respektvollen Rückzieher machen.« Wirklich? Hätte sich irgendjemand seine selbstgerechte kleine Moralpredigt angehört und so reagiert?
»Ich tue und lasse, was mir gefällt, du aufdringlicher kleiner Idiot«, hätte ich am liebsten erwidert. Doch ich sagte genau das, was von mir erwartet wurde. Ich beteuerte meine Aufrichtigkeit so glaubhaft, dass ich es mir beinahe selbst abkaufte.
Und so wurde die Nummer gehorsam herausgerückt. Jede Ziffer langsam diktiert, als müsste Andrew sie sich, wider besseres Wissen, aus dem Herzen reißen.
Ich verabredete mich mit Alice für einen Dienstagabend in zehn Tagen. Ein seltsamer Zeitpunkt, doch ihr Terminkalender war mit Besuchen an der Universität, Einspruchsfristen und Elternabenden vollgepackt und alles »unglaublich kompliziert«. Die Wartezeit war mir zu lang. Im Laufe der Tage verlor die Idee zunehmend an Reiz. Und als der fragliche Abend da war, hatte ich ganz vergessen, was ich eigentlich an ihr gefunden hatte.
Dennoch ist ein Date ein Date, und ich bin schließlich ein Gentleman. Damals war Andrew Edmunds, ein kleines, verschwiegenes Restaurant in Soho, mein Lieblingslokal. Von Kerzen erleuchtet und ein wenig künstlerisch ausgeflippt, eignete es sich ausgezeichnet für derartige Zwecke. Mir gefiel die Vorstellung, es könnte etwas über mich aussagen, dass ich mich dort so zu Hause fühlte. Außerdem bekam ich dreißig Prozent Rabatt, weil ich die Tochter des Geschäftsführers durch die Englischprüfung geboxt hatte: Othello (sie schrieb eine glatte Eins).
Ich kam zu früh und stellte enttäuscht fest, dass Alice bereits vor mir eingetroffen war. Sie trank ein Glas Wein und blätterte einige Papiere durch. Bei meinem Anblick stopfte sie sie, zusammen mit einem dicken in Krokodilleder gebundenen Terminkalender, Format DIN-A-3, in eine riesige Ledertasche, erhob sich rasch und hielt mir die Hand hin. Sie trug einen marineblauen Rock, eine hochgeschlossene weiße Bluse und flache, kniehohe schwarze Stiefel. Ihr Haar war zurückgebunden, und sie war, bis auf den wenig schmeichelhaften rosafarbenen Lippenstift, ungeschminkt.
Sie entschuldigte sich dafür, dass sie so nach Büro aussah. Den ganzen Nachmittag hatte sie bei Gericht verbracht: eine kongolesische Jugendliche, Einserschülerin in Barnet, sollte ausgewiesen werden, wenn sie in einem Monat volljährig wurde. Ja, ich hätte recht, es lauge sie emotional aus. Immerhin sei ihre eigene Tochter fast genauso alt, weshalb es ihr noch mehr an die Nieren ginge.
»Phoebe?«, fragte ich. »Die, die bald auszieht?«
»Ja. Sie hat im September einen Studienplatz in Anglistik in Leeds. Falls sie die Noten schafft.«
»Oh. Erst im September.«
»Der kommt früh genug. Ich kann es kaum ertragen. Sie wird eine solche Lücke hinterlassen.«
»Du könntest dir einen Untermieter suchen.«
»Eigentlich will sie Journalistin werden. Andrew hat mir erzählt, dass du manchmal für Zeitungen schreibst.«
»Stimmt. Und falls sie meinen Rat braucht, helfe ich natürlich gern. Was auch immer sie braucht, um beruflich weiterzukommen.«
»Das wäre nett. Danke.«
Wir bestellten unser Essen – Wildbachforelle und das Perlhuhn spezial. Ich erfuhr mehr über ihre Kinder. Auf Phoebe, die Älteste, seien noch zwei Jungen gefolgt (Louis, sechzehn, und Frank, vierzehn). Außerdem erwähnte sie einige Male ihren verstorbenen Mann. »Frank ist geradeheraus«, teilte sie mir mit. »Genau wie Harry, für jeden Spaß zu haben.« Louis sei eher ein düstererer Charakter und mache gerade eine schwierige Phase durch, »in der er seinen Vater natürlich noch mehr vermisse«. Bei diesen Worten seufzte sie und berührte mit dem Mittelfinger der linken Hand leicht den Tränensack unter dem linken Auge. Da ihre Augen trocken waren, wirkte die Geste gekünstelt oder zumindest routiniert; ein automatischer Test, vielleicht ein Relikt aus den Zeiten, als da noch Tränen geflossen waren. Wie in Andrews Garten hatte ich den Eindruck, dass sie eine Menge verschwieg, auch wenn sie einem scheinbar ihr Herz ausschüttete.
Mein Stuhl befand sich neben dem Eingang zur Küche, und der Kellner rempelte jedes Mal dagegen, wenn er vorbeikam. Tür auf, Tür zu. Allmählich fiel es mir schwer, mich zu konzentrieren. Ich war unruhig, meine Knie zuckten, und ich fühlte mich nicht in Bestform. Sobald die Teller abgeräumt waren, beschloss ich, der Sache ein Ende zu bereiten, indem ich sie auf einen Kaffee zu mir nach Hause einlud. Zu meiner Überraschung nahm sie an. Es regnete, und die Gehwege waren glitschig – vielleicht erfinde ich das ja auch nur: Sämtliche meiner Erinnerungen scheinen etwas mit Regen zu tun zu haben. Sie pfiff ein Taxi herbei, ein richtiger Pfiff auf zwei Fingern, bei dem einem die Haare zu Berge stehen. Mich machte das sofort scharf. Als wir zehn Minuten später in meine Straße einbogen, bestand sie darauf zu bezahlen. Auf dem Weg die Treppe hinauf, während ihre Umhängetasche immer wieder gegen das Geländer stieß, verkündete sie, es sei bezaubernd hier. Auf der Schwelle meiner Wohnung begeisterte sie sich über meinen Geschmack und mein Stilgefühl, um ihre Verlegenheit zu tarnen. »Oh ja. Oh ja. Wirklich reizend.«
Ich zündete mir eine Zigarette an, machte mich in der Küche an der Kaffeemaschine zu schaffen und lauschte, während sie im Wohnzimmer umherging. Jedes Knarren der Dielenbretter verriet mir, vor welchem Bild oder Bücherregal sie gerade stand.
»Ich liebe den ›twiggy bird‹!«, rief sie aus. Sie befand sich vor dem Schwarzweißdruck über dem Kamin.
»Eine Kaltnadelradierung«, erwiderte ich. »Von Kate Boxer.«
»Spielst du Klavier?«, fragte sie kurz darauf. Sie kramte in Alex’ Notenhaufen neben dem Sofa.
»Schrecklich eingerostet«, antwortete ich. »Seit meiner Kindheit nicht mehr.«
Ich genehmigte mir einen Schluck Whisky aus meinem Vorrat für Notfälle und dann noch ein paar mehr. Als Persephone sich um meine Beine schlängelte, gab ich ihr eine Untertasse Milch. Ich war nicht ganz sicher, wie ich weiter vorgehen sollte. War das eine Verführungsszene? Ich wusste nicht, wie das bei älteren Frauen funktionierte. Würde sie eine sensiblere und zurückhaltende Herangehensweise bevorzugen? Aber warum zerbrach ich mir überhaupt den Kopf darüber? Ich kam nicht auf die Idee, ihr die Wahrheit zu sagen, nämlich, dass das Leben, das die Wohnung widerspiegelte, nicht mein eigenes war. Nicht, weil ich mich geniert hätte, obwohl das vielleicht angebracht gewesen wäre: ein Mann von zweiundvierzig Jahren, der nichts vorzuweisen hatte als einige Müllsäcke auf dem Speicher seiner Mutter. Nein, ich sah einfach keinen Sinn darin. Und was, wenn ich in einer Woche auf der Straße landen würde? Ich rechnete ohnehin nicht damit, sie jemals wiederzusehen.
Als ich mit dem Kaffee hereinkam, saß sie auf dem Sofa und betrachtete das gerahmte Photo aus dem Trinity College. Natürlich gehörte es Alex, doch da wir uns dort kennengelernt hatten, hätte es genauso gut meins sein können. »Ich habe es im Klo von der Wand genommen. Hoffentlich stört es dich nicht. Ich suche dich.« Ihr Finger fuhr eine Reihe junger, rundlicher und arroganter Gesichter entlang. »Aha!« Sie lächelte. »Längere Haare … Wo ist Andrew?«
Ich beugte mich vor, um besser sehen zu können. Blasses Gesicht, spitze Nase, selbstgerechte Miene. »In der ersten Reihe, Mitte.«
»Oh ja. Auch längere Haare.«
»Mehr Haare.«
»Sei nicht so gemein.« Sie lachte und musterte das Foto. »Ich kann Florrie nicht finden. Ist sie drauf?«
»Nein. Sie kam erst später. In meinem dritten Jahr.«
Sie legte das Foto neben sich aufs Sofa und betrachtete mich. »Warst du glücklich?«
Einen Moment hielt ich inne und fragte mich, was sie meinte. »Ja, sehr«, sagte ich schließlich.
»Ich weiß noch, dass ich das College bei meinen Besuchen immer sehr grandios fand. Die Leute dort waren entweder auch sehr grandios oder sehr klein. In Bristol, wo ich studiert habe, konnte man alles sein. Aber dort war man entweder das eine oder das andere.«
»Vielleicht hast du recht.«
Sie trank einen Schluck Cappuccino. Als ihr eine Locke nach vorne rutschte, bemerkte ich graue Strähnen zwischen den blonden Haaren.
»Und du?«, fragte ich. »Warst du als Kind glücklich?«
Das war eine meiner üblichen Anmachsprüche. Alice reagierte wie vorausgesehen: ein bescheidenes Achselzucken und dann eine Art Strahlen – sie hatte überhaupt nichts dagegen, stundenlang von sich zu erzählen. Sie war als einziges Kind eines Anwalts und einer Hochschuldozentin im Norden von London aufgewachsen. Privatschule, danach Bristol, wo sie Harry begegnet war. Ein goldenes, vom Glück gesegnetes Leben, sagte sie.
»Es ist hart, mit Privilegien zu leben, nicht wahr?« Sie wies auf die Wohnung, die Bilder, die antiken Möbel und die Bücherregale. »Hast du nie ein schlechtes Gewissen, weil alles so leicht ist für uns und weil Leute wie wir so viel von unseren Eltern auf einem silbernen Tablett überreicht bekommen haben?«
Mir krampfte sich die Brust etwas zusammen. Ich hatte das Bedürfnis, mir alles von der Seele zu reden. Als ob ich ihr hätte schildern können, wie schwierig es gewesen war, nicht so leben zu müssen wie meine Eltern. Wie ich ihren mangelnden Ehrgeiz und ihre Bereitschaft, sich bescheiden mit dem Mittelmaß zufriedenzugeben, gehasst hatte. Ich fragte mich, wie privilegiert sie wohl wirklich war. Wie reich war diese wohlhabende Dame? Wie viel hatte Harry ihr hinterlassen? Wie groß war ihr Haus? Es gelang mir ein weises Nicken. »Ja, wahrscheinlich muss man sich das vor Augen halten und … tja, sein Bestes tun, um etwas zurückzugeben.«
Sie legte mir die Hand auf den Arm. »Ich wusste, dass du das verstehen würdest. Deshalb übe ich meinen Beruf aus. Andrew schilt mich immer, weil ich nicht in einer Kanzlei wie der seinen arbeite und Wirtschaftsrecht praktiziere. Doch das würde mich nicht glücklich machen. Ich habe immer für die Benachteiligten gekämpft, für die Leute, die sich kein Gehör verschaffen können.«
Sie schüttelte den Kopf und trank noch einen Schluck Kaffee. »Du schreibst Bücher«, sagte sie. »Das ist in gewisser Weise auch ein großzügiger Akt. Dazu musst du dich öffnen.«
»Ja. Das muss man wirklich.«
»Hast du momentan etwas in Arbeit?«
Als ich ihr eine Zigarette anbot, schüttelte sie den Kopf. Ich zündete mir selbst eine an. »Ja, in der Tat. Einen Roman über London, über Einwanderung, über die Benachteiligten. Die Lage der Nation und so …«
Alles erlogen.
»Hast du schon einen Verlag? Ich weiß nicht, wie so was funktioniert.«
»Mehr oder weniger.« Ich lehnte mich zurück und wechselte das Thema. »Andrew sagt, du engagierst dich sehr für wohltätige Zwecke.«
»Ich sitze in verschiedenen Gremien. Jasmine wiederzufinden ist mein wichtigstes Anliegen. Dafür empfinde ich am leidenschaftlichsten. Andrew hilft mir dabei. In gewisser Weise fasst es alles zusammen, was ich gerade gesagt habe. Du weißt, dass Jasmine kein niedliches blondes Mittelschicht-Kleinkind war wie Madeleine McCann. Sie war vierzehn. Aber immer noch ein Kind. Sie hat genauso viel Aufmerksamkeit von Polizei und Medien verdient, doch es schien niemanden sonderlich zu interessieren.«
»Das muss hart sein«, sagte ich, bemüht, dabei selbst interessiert zu klingen.