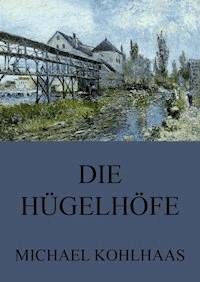
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erwin Schmidhuber war ein deutscher Schriftsteller, der bereits 1937 in Fürstenfeldbruck verstarb. Neben seiner Tätigkeit als Richter verfasste er einige humoristische und heimatnahe Romane. Zu den bekanntesten gehört zweifellos "Die Hügelhöfe".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Hügelhöfe
Michael Kohlhaas (Erwin Schmidhuber)
Inhalt:
Die Hügelhöfe
Wo und wer
Afra
Der Vetter
Vor Gericht
Der Primiziant
Vater und Sohn
Tod und Leben
Im Obstgarten
Die Mariann
Nur deswegen
Beim Floriwirt
Die Schönheitskönigin
Nur im aufsteigenden Jahr
Zwei Reisen
Im Zwergerhof
Die große Nacht
Die Hügelhöfe, M. Kohlhaas
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849645045
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Die Hügelhöfe
Wo und wer
Schauplatz: die oberbayrische Landschaft. Aber nicht die mit Moor und Ried oder goldgelben Getreidefeldern auf ebenem Plan, sondern die südlichere der Vorberge mit See und Hügel, Wieswachs und Waldrevier und den blauen Bergen dahinter.
Die Dörfer liegen darin wie verstreutes Kinderspielzeug, so lieb, und die Kirchen winken mit fröhlichem Spitzturm: »Nur her zu uns! Gebet und Freude vertragen sich gut!« oder verkünden mit breitem Satteldach: »Hier ist gut sein. Da steh ich und bleib ich.«
Wochüber rauschen die Sensen, schwanken die Heufuhren, hallt das Sensengedengel weit in die Abendstille hinein. Sonntags aber krachen die Böller und donnern die Kegelbahnen. Und dazwischen läuten die Mesner wieder ein Gesetzel mit allen Kirchenglocken. Der See leuchtet, die Sonne lacht und die Silberwolken stehen still, als wollten sie über so viel Glanz und Daseinslust nicht so ohne weiteres hinüber.
Ha, das ist euch ein Land! Ein Wichtelmann möchte man sein, schaut man darauf von einer der Waldhöhen hinunter, ein zaubermächtiger Wichtelmann, damit man sich nach Belieben verwandeln könnt' in eine blitzende Welle im schnellen, dem See zueilenden Forellenbach oder in die weißblaue Fahne, die vor dem Dorfwirtshaus so lustig in alle Weite weht, oder in einen der mittagsstillen Obstbäume rings im Dorf, davon zu ihrer Zeit die reifen Äpfel und Birnen ins Gras fallen, nicht wie die Holzbirnen und Holzäpfel in unsern Schriftstellergärtlein mit Rütteln und Schütteln, sondern ganz von selber – plum, plum, plum – in sinnender Vollmondnacht. Und nur der Sommerfrischler, der da zwischen zwei Zwetschgenbäumen in seiner Hängematte flackt und unter Bienensummen und Sommersäuseln, den goldnen Zwicker auf der Nase, den Kursbericht seiner Großstadtzeitung lesen kann, nur der möcht' ich nicht sein, weil er eine Unzier für Hof und Garten ist. Hingegen könnt' ich mir vorstellen, daß sogar ein Kaiser, und ein entthronter schon gleich gar, angesichts dieser ausgebreiteten Heimatanmut bei sich dächte: Meiner Seel! Wär' Ich nicht die Majestät, möcht' Ich Bauer im bayrischen Oberland sein.
Und doch und doch. Mit den Bauern in diesem schönen Land- und Himmelsstrich hat's etwas. Mit den Bauern hat's einen Haken. Einen ganz kolossalen Haken. Denn Dickschädel sind sie, einer wie der andre, es ist nicht zum Sagen. Ist wirklich einmal ein zarteres Gemüt darunter, es kommt nicht auf in diesem Kreis.
Da sind z. B. gleich der Kogler und der Zwerger von Würfling. Ihre Höfe sind die höchsten den Sankt Ulrichshügel hinauf, an den das Kirchdorf Würfling sich anschmiegt, und ihre Feindschaft ist die tiefste um den ganzen Würflinger See herum. Sie liegt auf dem Haus wie eine von den Vorfahren überkommene Hypothek, zu der, anstatt davon abzutragen, jede Generation eine neue Verschuldung hinzugefügt hat und die jetzt regierende die größte.
Nachbarhöfe sind es, weit genug zwar auseinander, um sich gegenseitig nicht im Weg zu sein, aber doch auch wieder einander so nah, daß im See draußen von einem Juchezer, der von der Höhe her laut würde, nicht gut zu sagen wäre: kommt jetzt der vom Kogler- oder vom Zwergerhof. Beiläufig gesprochen und bloß zur Veranschaulichung; denn tatsächlich ist da droben seit Jahr und Tag kein Mensch zu einer solchen Lustbarkeit aufgelegt.
Wer sollte auch juchezen auf dem Zwergerhof? Er, der Zwerger vielleicht? Wer hat aber schon einen stillen, leutscheuen Grantnickel juchezen hören? Oder etwa der Pfannamichl, der Oberknecht und die rechte Hand des Zwerger? Doch ein Bär juchezt nicht, ein Bär brummt nur. Oder die Zwergertochter, die liebe, blonde Mariann, mit dem stillen Mund und dem lauten Blick? So eine könnte überhaupt nur innerlich jubilieren. Und auch dazu hat die Mariann keinen Grund. Auch ist sie ja die meiste Zeit auswärts, bei des Vaters Schwester in Stallau, weiter dem Gebirge zu; denn sie hat längst keine Mutter mehr.
Und auf dem Koglerhof ist es nicht anders: der Kogler selber ein Räsonierer und Polterer, ein Aufbrauser und Überundüber, der von den Dienstboten nur ein ewiges Geracker, aber keine Fröhlichkeit braucht; die alte, treue Afra, die Wirtschafterin – weil nämlich auch dem Koglerhof die Bäuerin fehlt – vom »Absterbens-Amen« nicht mehr gar zu weit weg, und der junge Kogler, der Franz, im Freisinger Klerikalseminar auf die Geistlichkeit hinarbeitend, – da ist natürlich auch auf dem Koglerhof ausgejuchezt. Und die braune Nelly, die Beihilfe der Afra, die »Stütze«, wie die Stadtleut sagen würden, kann's allein auch nicht herausreißen, so ungestüm auch zeitweise das Krattler- oder Zigeunerblut in ihr es zu verlangen scheint.
Das mit der Nelly ist überhaupt eine absonderliche Geschichte. Kommt da vor Jahren eines Tags eine Zigeunersippschaft mit zwei Einspännerkarren auf den Hof, verlangen, weil es unterm Blahendach für die kleinen Würmer gar so unmenschlich kalt sei, Nachtquartier vom Bauern, der gerade wieder einmal schwerbeladen aus dem Wirtshaus eintrifft, werden mit brutalen Redensarten angelassen, schließlich aber doch für eine Nacht im Heuboden geduldet. Am Morgen darauf ist das Nest leer und das Pack fort unter Zurücklassung eines armseligen Spatzen von einem achtjährigen Mädel, dem sie, während es noch in tiefem Schlaf gelegen, auf und davon sind, – eine solche Bande! Der Kogler will das Kind auf der Stell der Gemeinde aufhalsen, die Afra es am nächsten Tag nach Kloster Biberg mit hinübernehmen über den See zu den Barmherzigen Schwestern und der Franz, an den das scheue Ding wie ein verlaufener Hund sich hinmacht, der Franz möchte die kleine Wildnis auf dem Hof behalten. »Vater, laß s' da!« sagt er; »wenn's nix is damit, kannst sie ja alleweil noch weitertun.« Darauf küßt die Kleine dem Buben blitzschnell die Hand, daß alle hellauf lachen und das verlassene Wesen sich schon gleich gar nimmer auskennt. Der Kogler aber sagt unter allgemeiner Verwunderung zu seinem Buben: »No ja,« sagt er, »weil du so a schöns Zeugnis hoambracht hast von der Gstudi, kann s' vorderhand dableiben.«
So also kam die Nelly auf den Koglerhof, der Franz bald darauf, schon im dritten Jahr, zu den Benediktinern nach Schäftlarn und die Afra nicht aus dem Kopfschütteln heraus über des Bauern ungewohnte, ja, unerhörte Nachgiebigkeit: »Dös muaß er scho rein deswegen tan haben, weil 'n der Bua noch gar nia um was angangen hat.« Somit auch nicht ums Studieren. O je, das Studieren! Der Kogler Franzl wär' doch hundertmal lieber in Würfling und auf dem Hof geblieben. Aber man weiß ja: Denken und Wollen ist in diesem Betracht den Eltern vorbehalten und ein Bub persönlich nur zu dereinstigem Rückblick berechtigt, mit Saldovortrag – Soll oder Haben – in privater Herzensbilanz.
Über diesen kleinen menschlichen Dingen verrannen aber so bestimmend die Jahre, daß die Augen der braunen Nelly immer glühender, die der blonden Mariann immer entsagender und die schwarzen Röcke des Kogler Franzl, unbeirrbar, immer länger wurden. Bis es zuletzt eines Tages hieß: am Mittwoch kommt er und in drei Wochen feiert er seine Primiz.
Afra
Als es mit dem Franz ungefähr so weit war, da war's auch mit der Afra so weit, daß sie beim hellichten Tag in ihrer Kammer lag, und es muß nicht gut stehen um ein so tätiges Leut, wenn es sich zur Bettruhe niedertut und nicht mehr aufverlangt. Jetzt! Mitten in der Sommerzeit!
»Wie viel Fuhren Heu hamm s' nachher no draußen?« fragt die Afra aus ihrem Müßiggang heraus, wie sie ihr Kranksein nennt.
»Heut wollen s' noch 's letzte einführen«, sagt die Nelly.
»Und i, i lieg so nixnutzig da herin!« Ihre Stimme ist matt und ihre Augen sind so müd und immer auf das kleine, offene Fenster gerichtet. Zwei Blumentöpfe stehen davor, die grellroten Blüten der Sonne zugewendet, die gerade mit dem schüttern Apfelbaum, ganz nah dem Fenster, ihre Kurzweil treibt. Bald hat sie die Oberhand, bald wieder das schattende Laubwerk. Wer hat des acht in gesunden Tagen? Aber für einen Kranken sind es Lebenssymbole, nicht auszudenken in Wochen und Monden. Und darum kommt auch die Afra mit ihrem müden Blick nicht weg davon. Tick-tack, tick-tack, tick-tack, will die Schwarzwälderuhr an der weißen Wand geschäftig die Zeit dazu vormessen. Aber wer schon an den Saum der Ewigkeit hinstreift, der hat abgeschlossen mit dem Stundenmaß. »Laß 's Uhrwerk stehn!« sagt die Afra; »mi beirrt's nur bloß«, und die Nelly hält den Perpendikel an.
Vor dem kleinen Fenster steht eine Bauernkommode, blau gestrichen mit aufgemalten roten Rosen, und auf dem alten, wurmstichigen Möbel eine Heiligenstatue, holzgeschnitzt und unscheinbar. »Wenn's iatz bald dahingeht mit mir,« sagt die Afra und hebt ein bissel die Hand gegen den Kommodkasten hin, »der Heilige, Nelly, ghört dir.«
»Red nöt alleweil vom Sterben, sag i! Du bist no nöt so weit.«
Die Kranke gibt nichts auf die Red. »Es is a uralts Heiligenbild, Nelly. Und wem's ghört, dem bringt's Glück.«
»Hat's dir oans bracht?«
»Weiters nöt, na. Aber es hat's mir halt scho mei Vater in solchener Meinung geben.«
»Nacher wird's scho mir a koans bringen.«
»Kann man nöt wissen. Glück für an jeden, hat der Vater gsagt, der's mit rechtschaffener Gesinnung in seiner Stuben stehn laßt, und grad dir möcht i 's vererben. Es is der nämliche Heilige, verstehst, der in der Seekapellen drüben steht, – der heilige Pankrazi.«
»Au weh!« sagt da gar die Nelly.
»Warum? Was hast?«
»No, den hat doch unser Bauer ums neue Gwand betrogen.«
»Muaßt iatz du alls dö bösen Leut nachplappern und muaßt du di alleweil an beim Brotherrn reiben!«
»I fürcht ja bloß, es wird dem heiligen Pankrazi für oans vom Koglerhof mit 'm Glück nöt mehr pressieren als wia an Kogler mit 'm neuen Gwand für 'n heiligen Pankrazi. Hast ghört? Nöt um a bissel mehr wird's eahm pressieren.«
Die Afra aber war schon wieder in ihr Grübeln und Sinnieren verfallen, darin sie Stunden und Stunden verbrachte, schier nicht erreichbar für die Dinge um sie herum: vielleicht, daß ich doch zu wenig rechtschaffen war, vielleicht aber auch, daß er mit seinem Glück wirklich nicht hat herein mögen in den Koglerhof; denn, was wahr ist, ist wahr: ein Tropf, ein eiskalter, war er von jeher, der Kogler.
An die zwanzig Jahr mag's wohl her sein, und grad noch hat das Eis getragen über den See. Wegkürzung von Würfling nach Biberg mindestens drei Viertelstunden, und der Kogler muß heut nach Biberg. Muß. Zu einem Tarokrennen. Also probiert er gleich hinter Würfling die Eisdecke mit seinem Körpergewicht und findet: ja, sie hält's aus. Aber inmitten des Sees scheint es auf einmal, als wolle der Auswärts, wie man dortlands den Frühling nennt, unter Ausnützung der Koglerischen Zentnerlast die überlebte Winterhülle sprengen und justament heut den See dem schlichten Kranz einfügen, den er bereits um die Ufer zu spinnen beginnt. Plötzlich nämlich läuft ein unheimliches Rollen unter dem Eis hin, weitmächtig nach allen Seiten ausstrahlend, sich an den Ufern brechend und dröhnend wieder zurückkehrend zu des Koglerbauern Schwergewicht. Klaffende Risse, wie von unwiderstehlichen Hammerschlägen aus der Seetiefe herauf, furchen die Spiegelfläche; ja, manchmal ist es, als schwanke bereits das Eis.
Mit Recht wendet da sich einer an eine höhere Macht als den Gemeinderat oder das Bezirksamt, und so ruft denn auch der Kogler den heiligen Pankratius an, der in seiner einsamen Kapelle, gleich unterhalb Biberg, am Seeufer steht und in seinem fadenscheinigen, mottenzernagten Röcklein voll himmlischer Geduld darauf wartet, bis die Seedörfler in Wassernot sich seiner erinnern, dann aber auch nie seine Hilfe versagt.
»Heiliger Pankrazi,« ruft also der Kogler mitten drinnen im krachenden See, »wenn i no nauskonnn, grad heut wennst mi no lebendig nauskommen laßt, – mir geht's auf a neus Gwand nöt zamm.« Rumbumbumbum dröhnt es, anscheinend, um eine deutlichere, weniger drehbare, unanfechtbare Ausdrucksweise zu erzwingen, unter dem Kogler hin.
»Hast ghört? A neus Gwand kriagst« – rumbum – »a nagelneus Gwand!« Bum, und ein Dutzend Risse und Spalte stieben mit einem einzigen Schlag auseinander. »Heiliger Pankrazi, hörst denn nöt? Von mir, auf meine Kosten a neus Gwand!«
Aber Frühling und Winter ringen weiter miteinander, und der See donnert dazu. »Brauchst denn etwan koans?« Bum, bum! Zwei Kapitalschläge sind es. »Hei–li–ger Pan–« – Dum! – »krazi! An nagelneuen Rock – vom Schneider Ambros« – Hundert Schritte seitwärts schieben sich schon Eisschollen übereinander – »und a funkelnagelneue Hosen!«
Einen Augenblick ist es jetzt still, so daß der Kogler, an alles seinen materialistischen Maßstab anlegend, bei sich denkt: Aha, hätt ich ihm nur gleich die Hosen anboten! Dann aber fegt und heult der Föhnsturm, der von fernen Höhen herabgefallen ist, über die dröhnende Einsamkeit. »Nur grad heut, grad heut no laß mi naus!« Es ist nachmittag drei Uhr; aber das nahe Ufer verschwindet im Halbdunkel, eine solche Finsternis kommt mit den niedrig fliegenden schwarzen Wolken über den See. »Dö selbig Kuah, heiliger Pankrazi, – du woaßt as scho – dö perlsüchtig, dö wo i vorgestern an Gschwendtner von Balsweis verkauft hab, heiliger Pankrazi, i nimm s' zruck. Jawohl, zrucknehma tua i s' und alle Kosten trag i und a nagelneus Gwand, vom Schneider Ambros, is dir gwiß!« Aber wenn der Kogler jetzt nicht bald das Land erreicht, ist trotzdem alles aus. »Hei–li–ger Pan–krazi!« Da steht er am Strand.
»Sooo,« sagt er, wie er wieder festen Boden unter den Füßen spürt, »heraußen waar i und neigehn tua i meiner Lebtag nimmer, aber a Gwand, heiliger Pankrazi, kriagst du für dös Hermartern koans. Du hättst as leichter a machen kinna.« Und der Kogler schlägt den Weg nach Biberg, zum Tarokrennen, ein, und der heilige Pankratius steht da in seinem mottenzerfressenen Röcklein und bedenkt den Undank der Welt. Kann man unter solchen Umständen erwarten, daß er, und wär's auch nur für einen armen Dienstboten, mit seinem Glück noch hineinmag in den Koglerhof?
Die Nelly aber, die diese ablehnende Haltung wohlbegründet fand, erhebt sich jetzt von ihrem Stuhl neben dem Bett und sagt: »Zeit, Afra, für d' Medizin!« und holt von der Kommode Löffel und Medizinflasche herbei: »Afra, geh! Einnehmen! Nacher wird's bald wieder besser.«
»I brauch koa Medizin. Für mi gibt's koa Besserung nimmer.«
»Bild dir nix ein!«
»Durchaus gar koa Besserung nimmer.«
»Woaßt nöt, was der Dokter gsagt hat? Von Gefahr, hat er gsagt, koa Red. Aber Schonung und Ruhe, hat er gsagt.«
»Hätts 'n dahoam lassen! Mein Weg in d' Ewigkeit find i ohne Dokter gradso.«
»Und koane so trüabseligen Gedanken! hat er gsagt. 's Herz is nöt so schwach, hat er gsagt, wia du dir einbildst.«
»Dös sell woaß i besser. Und drum hättst 'n dahoam lassen sollen.«
»I?«
»Du, ja; denn an Bauern waar 's ja sowiaso nöt eingfallen. Schad um dös viel Geld.«
»Wenn aber doch der Franz gschrieben hat, Afra, daß mir unbedingt an Dokter holen müassen.«
»Der Franz?« und die Afra versucht, sich etwas im Bett aufzurichten. »Ja, hat denn der Franz gwußt, daß 's mi hat?«
Da zögert die Nelly mit der Antwort, muß aber dann doch heraus damit: »Aber freilich hat er's gwußt.«
»Der Franz von meim Kranksein gwußt?«
»Versteht sich. Ich hab's eahm ja doch gschrieben.«
»Du? Gschrieben? Ins geistlich Seminar neigschrieben? Du? Als a Madl?«
»Ja mei. Ich hab deswegen in der Eil a koa Bua mehr wern kinna. Und er hat mir's ja selber auftragen, wie er 's letzte Mal fort is. Öfter wia oamal. Sowie der Afra, hat er gsagt, was zustoßt, schreibst mir's augenblicklich! Augenblicklich, hat er gesagt; dich mach ich verantwortlich.«
»Der guate, guate Bua!« Und vor lauter Rührung rinnen der Afra die Tränen übers Gesicht. »So viel Bekümmernis bin ja i gar nöt wert.« Mühselig wischt sie mit der flachen Hand die Tränen ab. »Und so is schon sei Muatter gwesen, – tröst s' der liabe Gott. Akkurat so. Wo sie oan was Guats hat toa kinna, hat sie's not versamt. Auf und auf is er d' Muatter. Alles hat er von ihr und nix vom Vater ...«
»Gott sei Dank!« meint die Nelly.
»... bis auf sei hitzige Art und unnachgiebige Weis.« Und indem sie dazu die Hände faltet, sagt sie: »Was i an Segen ababeten kunnt in meiner letzten Stund, soll alles auf'n Franz kömma!«
»Und dem Franz z'liab«, sagt die Nelly und hält in diesem günstigen Augenblick den mit Medizin gefüllten Löffel der Afra an den Mund, »nimmst du jetzt a den Löffel voll!«
Und willig nimmt die Afra die Medizin. »Nur bloß sei Priminz wenn i no derleb, dann von mir aus kann's dahingehn. Mei Arbet is tan. I hab nix mehr z' suachen auf der Welt.«
»Geh weiter,« beschwichtigt abermals die Junge, »was hast denn wieder für a Gered! Morgen kimmt er ja so scho. Und am Sonntag in drei Wochen is Priminz. Was hast denn nur grad alleweil für a Gejammer! Dös wenn i an Franz sag ...«
»Nelly, paß auf! Wenn iatz der Franz kimmt, als a Ausgweihter, nachher muaßt du fei zu eahm Hochwürden Herr Franz sagen. Gell!«
»Du liaber Himmi, dös a no! – Zerst ›Franz‹: du, Franzl, fang mi – Franzl, gschwind! Heb mir an Millikübl aufs Wagl! – Franzl, was hast denn? Machst mir denn alleweil noch an Kopf an? – Nachher: ›Sie, Franz!‹ Und iatz gar no ›Hochwürden Herr Franz‹ – Afra, dös is a bißl viel, wenn ma mitanander aufgwachsen is.«
»Aufgwachsen? Nelly! Woaßt nimmer, wia du herkömma bist?« Und da die Nelly besinnlich nickt, meint die Afra: »No also. Und der Franzl beim Studieren in Schäftlarn und du z' Würfling da bei der Bauernarbet. Is dös bei dir ›mitanander aufgwachsen‹?«
»In der Vikanz scho. Is doch koa Fuader Grummet nöt eingfahren worn, auf dem nöt i und der Franzl droben ghockt san.«
»In der Vikanz! Ja, Madl, d' Vikanz is nöt 's Leben.«
»Und wer hat mi denn allemal wieder in d' Stuben gholt, wenn mi der Bauer nausgjagt hat wie an Hund? Der Franzl.«
»Trag dös doch an Bauern nöt alleweil no nach! Woaßt ja, wie er is. Es hat 'n halt manchmal wieder aufs neu g'ärgert, daß di deine Leut oafach so dalassen hamm.«
»Kann i was dafür? Und hab i vielleicht nöt auf alle Landstraßen danach gsuacht, daß mi der Gendarm amal glei bis von der Stadt drin wieder zruckbracht hat?«
»Woaß alls, Nelly. Alles woaß i. Und der Bauer hat di a nöt umsunst haben müassen. Mir Hamm di guat brauchen kinna, und du bist der Arbet schon als kloans Madl nöt aus 'm Weg gangen.«
»Und, Afra, wer hat mir denn 's Lesen und 's Schreiben glernt? Der Lehrer vielleicht? Der hat doch nur gsagt, i soll schaun, daß i wieder zu meiner Rasselbande komm. Hundertmal hat er's gsagt. Ein Zigeunerkind, hat er gsagt, gehört in einen Krattlerwagen, aber nicht in eine deutsche Volksschule.«
»Woaß 's. Woaß 's. Der sell Lehrer Moser.«
»Und drum hab i a nix glernt dabei. Mit Fleiß hab i nix glernt, und grad gfreut hat's mi dös Gar-nix-lernen.«
»Nöt recht gwen, Nelly. Heut sag i 's no.«
»Aber beim Franzl hat's mi gfreut.«
»Franzl!« wiederholt die Afra beanstandend.
»No ja. In der selln Zeit is er doch no koa Hochwürden gwen. Und besser und gschwinder hätt mir's überhaupts koa Lehrer glernt.«
»'s selbig Mal bist halt a scho älter und gscheiter gwen, Nelly.«
»A was! Mit seim Guatsein hat er mir's glernt, nöt mit mein Gscheitsein. Und gwußt hat er, was mi freut, und grad dös hat er mi lesen und schreiben lassen. Aber am meisten gfreut hamm mi do dö Sachen, dö er selber gmacht hat. Heut no kann i s' auswendig, allsamt dö Versln, oans wia 's ander. Magst as hörn?«
Mit matter Hand wehrt die Afra ab. »Braucht's nöt. Kenn's scho. Und deswegen is er halt jetzt doch als ein Ausgweihter für dich der Hochwürden Herr Franz.«
»Und für di? Wia sagst nachher du dazua?«
»O mei Dirndl!«
»Sagst du aa Hochwürden?«
Da tastet die Afra an ihren einfachen Bauerngedanken sich durch ihr Leben zurück. Dann sagt sie: »Schau! Wia d' Wimbauern-Stasi von Perlbach Koglerin worden is, da hat ihr Muatter – tröst s' alle zwoa der liabe Gott! – zu mir gsagt: ›Afra‹, hat s' gsagt, ›der Kogler is a bißl a Scharfer; mir is 's liaber, du gehst glei mit der Stasi, daß s' doch auf alle Fäll wen hat, an den sie sich halten ko.‹ Und auf dö Weis bin i vom ersten Tag an mit der Bäurin auf'm Koglerhof gwen und hab's mitansehgn müassen, wie dö jungen Kogler kommen san und wie s' wieder gangen san, bis auf 'n Franzl, und wie mit 'm letzten dö Koglerin selber mit is in d' Ewigkeit umi. ›Afra‹, hat s' noch gsagt, aber nur ganz stad, und hat mi noch amal angschaut mit ihrem guaten Gschau, ›Afra, beim Franzl bleiben!‹ Und i hab ihr d' Hand geben drauf und bin beim Franzl blieben. I moan, – i brauch nöt Hochwürden z' sagen.« Ermattet hält sie inne und der Kopf sinkt ihr zurück und der Atem geht so schwer. Kein Wunder, wenn auf ein gutes Stück der Lebensweg neben dem Koglerbauern hergeht.
»Afra!« ruft die Nelly erschreckt und unterfaßt das Kopfkissen. »Moanst nöt, Afra, i soll dir a bißl a Suppen bringen, daß du wieder mehr Kraft kriagst?«
»Nix! Is scho wieder vorbei. Is mir nur alles dös Schware wieder gar so lebendig worn.« Und die Nelly richtet ihr die Kissen zurecht. »Aber iatz, woaßt, is der Franzl so weit, daß er mi nimmer braucht. Iatz geh i wieder zu der Bäurin.« Und mit einem Mal ist sie wieder ganz für sich allein und nichts mehr für sie vorhanden als die Vergangenheit und, also der Gegenwart entsunken, sagt sie: »Wann i ihr doch grad sagen kunnt, daß dö groß Feindschaft mit 'm Zwergerhof a End hat!«
»Du muaßt nöt alleweil ans Sterben denken!«
Doch die Afra fährt fort in ihrem Selbstgespräch: »I woaß, es waar ihr das Liabste, was i ihr mitbringen kunnt.«
»Geh weiter! Und hör auf mit dem Zeug!«
»Das Allerliabste.«
Da konnte die Nelly sich nicht enthalten beizufügen: »Bei dö zwoa Dickköpf aber a das Allerschwarst.«
»Und wer woaß 's, ob nöt etwa gar unser Primiziant die Aussöhnung stiften kunnt.«
»Was hast denn iatz wieder, Afra!«
»Weil's halt unserm Bauern gar so drum geht, daß der Franz a beim Zwerger drüben an Segen hergibt.« Da hört sie mit dumpfem, entferntem Hall die Haustür zufallen. »Is 'leicht wer kommen, Nelly? Der Bauer kann's no kam sei. Geh, schau nach!« Und wie daraufhin die Afra allein ist, faltet sie ihre schwieligen Hände und betet still, aber mit eifrig bewegten Lippen. Ihr unbewußt werden indes nach einer Weile die drängenden frommen Gedanken laut und sie sagt: »... und nimm dö zwoa abscheulinga Dickköpf eahnern Haß, damit daß dö alt Feindschaft a End nimmt und endlich amal a Ruah und a Frieden zwischen dö zwoa Hügelhöf wird durch Jesum Christum insern Herrn Amen.«
Der Vetter
»Schon wieder eine um Ruhe und Frieden!« mag der liebe Gott bei sich gedacht haben, da er die Afra Holzinger also aus dem Koglerhof zu Würfling rufen hörte. »Ja, meine gute Afra, weißt denn du noch immer nicht, daß Ruhe und Frieden meiner Erde ohnehin zu eigen sind wie Sonnenluft und Waldesschatten, und jeder Mensch sich nehmen kann, so viel davon sein sehnendes Herz begehrt? Ja, daß diese Seelengüter nirgends lieber weilten und blieben als in der Menschenbrust, wenn die sich ihnen nur nicht gar so selten erschlösse? Nun, weil du bei deinen fünfundsechzig Lebensjahren noch nicht zu dieser erlösenden Erkenntnis dich durchgerungen hast, Afra Holzinger, würdest du sie auch mit siebzig nicht erlangen, und so will ich dir wenigstens weiteres Leid ...«
In dem Apfelbaum vor Afras Fenster erscholl jetzt munterer Finkenschlag, und ein Sonnenstrahl erreichte von der Seite her und am Baum vorbei so glücklich das Fenster, daß er sich mit breitem Gold, gehoben durch den unbesonnten, dämmerigen Teil der Kammer zu einer Art von Himmelsgruß, auf Afras Bett und Hände legte.
»Kunnt ja sein« dachte da, unter diesen guten Dingen, die Afra, »daß 's doch wieder recht wird mit mir. Nachher schau i mir aber so gwiß wie was den Platz an, wo der Franz nach der Priminz sei Anstellung kriagt.« Doch sogleich gemahnte sie auch schon heftiges Stechen in der Brust an die Vermessenheit ihrer Hoffnung. »Nix is 's. Aus wird's. In Gottsnam.« Und sie sinnierte wieder vor sich hin.
Da klopft es, und weil niemand zum Eintreten auffordert, klopft es noch einmal. Aber die Afra hört nichts, und so wird leise die Tür geöffnet und ein grauhaariger Mannsbilderkopf hereingestreckt. »Afra!« sagt der Kopf recht freundlich und nachdrücklich zugleich. Darob fährt die Afra aus ihrem halbwachen Hinbrüten auf und schaut nach der Tür: »Du bist da!«
Der Mesner Zistel ist es und einen großen, roten, rechteckigen Pappendeckel, von dem es goldig herglänzt, hat er unterm Arm. »Grüaß Gott, Afra!« sagt er, indem er ans Krankenbett herantritt. »Nur bloß ein bisserl nachschauen, wie 's mit dir steht, damit daß 's nöt etwa hoaßt: iatz is der Zistel Gschwisterkind mit der Afra, bekümmern tuat er si aber nöt drum.«
»A geh, dös sagt doch neamad.«
»D' Leut san oamal z' bös, Afra.«
»Und nachher hätt i mir a denkt, du kaamst wegen meiner und nöt wegen dö Leut.«
»Freili, freili wegen deiner – ma redt nur bloß. Und es freut mi, daß 's nöt so schlecht um di steht, als wia s' sagen.«
»Z' guat nöt, Zistel. Da wern s' scho recht hamm.«
»Hat di scho öfter ghabt. Hast di no alleweil rausgrissen.«
»Dösmal reißt 's mi nei. I woaß 's.«
»Drum möcht i dir zuvor noch gern die Tafel zoagen, dö wo auf'n Franzen sein Triumphbogen naufkimmt. Grad bin i fertig worn damit.« Und schon hält er der Kranken die Vorderseite des mitgebrachten Pappendeckels hin: »Han? Was sagst?« und liest von dem roten Grund die in Goldbuchstaben aufgeklebte Inschrift ab: »›Gottgesandter, kehre ein, – Geisteskraft uns zu verleihn!‹ Und alls aus mir selber ganz alloa – der Spruch aa.«
Indes, die Afra fragt: »Und auf der andern Seiten?«
»Da steht nix drauf«, sagt der Mesner etwas enttäuscht und kehrt die graue, nüchterne und unfestliche Pappdeckelseite nach vorn. »Mögst du da aa was droben haben?«
»Dös is gwiß. Da ghört doch a was drauf.«
Der Mesner jedoch hält diese Meinung für anspruchsvoll und anmaßend und in seinem Ärger läßt er sich zu der Entgegnung hinreißen: »Du moanst, scheint mir, weil dein Franzi Primiziant is, iatz siehgt er auf oamal hinten aa. So weit is 's aber nachher doch noch nöt und es braucht 's a nöt.« Und in seinem Eifer demonstriert er nunmehr die Durchfahrt des Primizianten durch den am Dorfeingang bereits aufgerichteten Triumphbogen. »A so, nöt wahr, von vorn und mei Tafi vor Augen, kimmt er auf'n Triumphbogen zua. Is er durch, hat er s' gsehgn und siehgt s' nimmer a. Und iatz glei werd i s' droben haben.«
»Schad.«
»Was schad? Han?«
»Daß hinten nix drauf steht.«
»Du muaßt doch scho bis zu deiner letzten Stund recht haben! Z' Münzing, beim Semmelbauern-Jackl seiner Priminz, hamm s' überhaupts nöt amal a Tafi droben ghabt, sondern nur bloß an Kranz!«
»Taat mir schier besser gfallen.«
»Du hast in dö langen Jahr von dein Bauern z'viel angnommen, Afra. Dem is a nur bloß wohl, wann er dö Leut was Unguats hinsagen kann.«
»O mei Zistel!«
»Jawohl. A so is er. Und woaßt, was drum iatz d' Leut sagen?«
»Wer so nahet an der Ewigkeit dran is wia i, der hat nimmer Zeit, daß er auf d' Leut aufpaßt.«
»Drum sag i dir 's. Es is a Wunder, sagen s', daß aus an solchen Haus a Herr fürakimmt.«
»Sagen s'?« meint gleichgültig die Afra.
»Aus an Haus, sagen s', wo der Ehbruch dahoam is.«
»Gwesen is, Zistel. Vielleicht. Amal.«
»Vielleicht? Dös wissen mir scho gwiß, warum der Kogler und der Zwerger a so an teuflischen Haß aufanander hamm.«
»No gwisser, Zistel, wird aber inser Herrgott wissen, warum er an Franzen trotzdem hat Geistlich wern lassen. Red eahm nöt so viel drein!«
»I red eahm nix drein. Ma sagt nur bloß, daß 's so





























