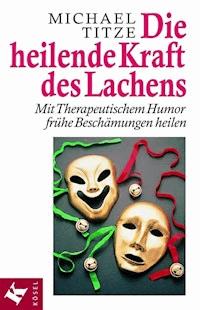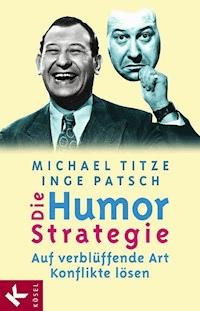
8,99 €
Mehr erfahren.
Mit humorvollen Gesprächstechniken kreative Problemlösungen erzielen
Eine humorvolle Lebenseinstellung zeichnet sich durch heitere Gelassenheit
aus. Dies entspricht der Fähigkeit, Probleme distanzierter und relativierend zu betrachten und dabei originelle Lösungen zu finden. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist die Verknüpfung spielerischer, humorvoller, »kindlicher« Verhaltensmuster mit ernst- und gewissenhaften Herangehensweisen.
Michael Titze und Inge Patsch zeigen, wie beide Strategien flexibel kombiniert und damit verblüffendes Argumentieren und Gewinn bringendes Kommunizieren möglich werden. Mit vielen Beispielen, Tipps, Anekdoten und Witzen verdeutlichen sie ebenso amüsant wie überzeugend, dass derjenige, der sein Alltags- und Berufsleben mit Humor und Gelassenheit meistert, viel besser fährt als der, der seine Ziele verbissen und »bierernst« verfolgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hinweis für das Lesen dieses Buches
Dieses Buch ist in fünf Teile gegliedert: Im ersten Teil finden Sie einige theoretische Voraussetzungen für die lebenspraktischen Schlussfolgerungen im zweiten Teil und dritten Teil. Wen vor allem humoristische Gesprächstechniken interessieren, findet diese im vierten Teil des Buches. Und wer sich durch witzige Sprichwörter, Sprüche, Stilblüten usw. inspirieren lassen will, wird im Anhang fündig,
Zum Geleit
Vor Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, liegt ein außergewöhnliches Buch. Es fasst Erkenntnisse zusammen, die Michael Titze in seiner Arbeit mit therapeutischem Humor über die Jahre gewonnen hat. Ich lernte ihn 1985 kennen, als ich das Handbook of Humor and Psychotherapy1 herausgab. Niemals zuvor hatten sich Psychotherapeuten so ernsthaft und so intensiv mit der heilenden Kraft des Humors befasst. Die bekanntesten Humorexperten berichten in diesem Buch über ihre Arbeit und Michael Titze war der einzige Europäer, der seinen Teil beitrug. Seit dieser Zeit arbeiten wir eng zusammen. Wir haben im Hinblick auf die Humorentstehung einige wichtige Erkenntnisse gewonnen, zum Beispiel diese:
Ein schlagfertiger Mensch, der seine Mitmenschen auf sarkastische oder gar zynische Weise niedermacht, mag vielleicht einen kurzfristigen Lacherfolg verbuchen. Er stellt aber kaum eine positive Beziehung zum Mitmenschen her! Und das aus einem einfachen Grund: Dieser Mensch will glänzen, sich vor den anderen hervortun, will der strahlende Sieger sein. Der therapeutische Humor zielt aber nicht auf diesen schnellen Lacherfolg ab. Er will auch nicht um jeden Preis unterhaltsam sein. Um was es ihm vor allem geht, sind kreative und heilsame Problemlösungen, die die zwischenmenschlichen Beziehungen fördern. Michael Titze wies schon vor 20 Jahren darauf hin, dass ein konstruktiver Humor weder Sieger noch Verlierer, sondern nur Gewinner kennt!
Inzwischen hat der therapeutische Humor seinen festen Platz im weiten Bereich psychosozialer Aktivitäten gefunden. Dazu gehört nicht nur die Psychotherapie, sondern auch die Krankenpflege, Pädagogik, Persönlichkeitsbildung und die Lebensberatung. In diesem Zusammenhang hat Michael Titze in den letzten Jahren innovative Techniken entwickelt. Es sind dies amüsante und lehrreiche Anregungen, wie die alltäglichen Kommunikationsprobleme und Beziehungsfallen auf eine gewinnende Weise – eben humorvoll – bewältigt werden können. Diese Techniken werden im vorliegenden Buch vorgestellt.
Ich bin überzeugt, dass dieses Buch einen großen Leserkreis finden wird. Es wurde für Menschen geschrieben, die in einer zunehmend komplizierten Welt nach Möglichkeiten suchen, erfolgreich ihren eigenen Weg zu gehen und dabei gleichzeitig ihre sozialen Beziehungen zu verbessern.
Bücher über heilsamen Humor gibt es viele. Sie listen vor allem die Segnungen auf, die das Lachen dem menschlichen Geist und Körper angedeihen lässt. Was mir dabei auffällt: In ihnen wird kaum geklärt, wie man den Prozess der Humorentstehung – bei sich selbst und bei den Mitmenschen – in Gang setzt. In diesem Buch wird genau das gezeigt. Ich lade Sie, liebe Leserinnen und Leser, deshalb ein, den spannenden Weg der Humorentstehung zu beschreiten und die vielfältigen Facetten genussvoll auszuloten, die von den Autoren aufgezeigt werden.
Waleed A. Salameh, PhD., MSc2Humor and Health Institute, San Diego
Einleitung
Der Duden definiert den Humor als die Gabe eines Menschen, den Unzulänglichkeiten der Welt und der Menschen sowie den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Der Schauspieler Theo Lingen ging noch weiter. Er sprach von einer »famosen Turnübung, die darin besteht, sich selbst auf den Arm zu nehmen«. Somit dürfte es sich beim Humor um eine beachtliche Strategie der Lebensbewältigung handeln.
Humor entsteht im Spannungsverhältnis kindlicher Affektivität und der Vernunft des Erwachsenen. Ein Kind will Selbstbestätigung, und wenn es diese bekommt (auch auf Kosten anderer!), äußert es diese im Lachen. Ein Erwachsener verfährt »diplomatischer«: Er oder sie ist höflich, sozial einfühlsam oder bedachtsam, indem auf kurzfristige Erfolgserlebnisse verzichtet wird, um langfristig Vorteile im sozialen Leben zu erzielen. Diese im Grunde widersprüchlichen Strategien werden im Humor so miteinander verbunden, dass sie jeweils kurzfristig aktiviert und dann – zu Gunsten der jeweils anderen Strategie – wieder zurückgenommen werden. Wir bezeichnen dies als Reduktion. Sie ermöglicht eine paradoxe Verschmelzung, die den Humoristen unvernünftig und vernünftig denken und handeln lässt. Diese Verschmelzung erweitert einerseits den Horizont, andererseits bewirkt sie eine Relativierung der jeweiligen Geltung beider Strategien: Die spontane Affektivität des Kindes vermengt sich mit dem abwägenden Ernst des Erwachsenen, so dass eine neue Haltung entstehen kann – die heitere Gelassenheit des Humoristen! Der Münchner Kinderpsychologe Kurt Seelmann illustrierte diese Haltung anhand einer Kindheitserinnerung:
»Im Beichtunterricht behandelte der sittenstrenge Geistliche das sechste Gebot. Eindringlich schwor er uns Schüler auf ein keusches Leben ein. Andernfalls kämen wir schnurstracks in die Hölle, sollten wir zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall ums Leben kommen. So standen wir nach Unterrichtsschluss ziemlich verstört an der Straße, wo die damals noch eher seltenen Autos vorbeibrausten. Obwohl die meisten von uns gar nicht so recht wussten, ob – und vor allem, wie! – sie schon gegen das sechste Gebot verstoßen hätten, hatten wir alle Angst vor der Hölle – bis auf eine Ausnahme: Es handelte sich um einen übergewichtigen, rotbackigen Jungen, einen Sitzenbleiber, der den Beichtunterricht ebenfalls wiederholte. Mit einem breiten Grinsen rief er uns anderen zu: ›Jetzt müass ma halt a bissel besser aufpass’n mit’m Verkehr – aber mach’n tun ma’s trotzdem!‹«3
Weil der Humorist in zwei verschiedenen Welten – der des Kindes und der des Erwachsenen – steht, hat er eine gute Standfestigkeit – und nicht selten steht er auch über den Dingen. So vermag er oder sie gerade das zu belächeln, was das Leben eigentlich belastet. Dazu gehören die Missgeschicke des Schicksals ebenso wie die Enttäuschungen, die von anderen Menschen ausgehen, und selbstverständlich auch die eigenen Schwächen. All dies vermag der Humorist mit einer leisen (Selbst-)Ironie auf die Schippe zu nehmen. Seit Sokrates bezieht sich dies auf eine Kommunikationsweise, die das Gegenteil von dem meint, was vordergründig zur Sprache gebracht wird. Der Philosoph Søren Kierkegaard war überzeugt, dass ein humanes Leben ohne die existenzielle Reinigung der Ironie gar nicht möglich sei. Er beschrieb ihre Wirkung so:
»Die Ironie setzt Schranken und gewährt damit Wahrheit, Wirklichkeit, Inhalt. Die Ironie ist ein Zuchtmeister, welcher [...] von dem geliebt wird, der ihn kennt. Wer Ironie schlechterdings nicht versteht, wer für ihr Raunen kein Gehör besitzt, ermangelt eben damit desjenigen, das man als den absoluten Anfang persönlichen Lebens nennen könnte. [...] Die Ironie ist eine Reinigungstaufe; die Erfrischung und Stärkung liegt darin, dass man, wenn die Luft zu drückend wird, sich entkleidet und sich ins Meer der Ironie stürzt, natürlich nicht, um darinnen zu bleiben, sondern um gesund und froh und leicht die Kleidung wieder anzulegen.«4
In den vergangenen 25 Jahren wurden Ratgeber zu Bestsellern, die die »Kunst, ein Egoist zu sein« propagieren oder die dazu aufrufen, sich nichts gefallen zu lassen, sich um jeden Preis durchzusetzen. In manchen Anleitungen zum Manager-Coaching avancieren gar die Kriegskünste des preußischen Generals Carl von Clausewitz5 zum strategischen Vorbild. In der neueren Ratgeberliteratur wurde schließlich der Humor entdeckt – als ein besonders geeignetes Mittel einer Schlagfertigkeit, die den Gegner auf unkonventionelle Weise aufs Glatteis führt. Nicht immer wird dies freilich in einer liebevoll-ironischen Weise praktiziert. Die Grenzlinie zum Sarkasmus, dem bissigen Spott, wird häufig überschritten. So gewinnt man zuweilen den Eindruck, dass Schlagfertigkeit mit einem Schlagabtausch gleichgesetzt wird, bei dem sich der jeweils Wortgewaltigere als Sieger profiliert. Vordergründig macht dies Sinn, denn wer sich als Sieger durchsetzt, stabilisiert (zunächst) sein Selbstwertgefühl. Doch diese Ellenbogenstrategie kann im Arbeitsleben (und nicht nur dort!) auf längere Sicht nur zu nachteiligen Konsequenzen führen. Und das aus gutem Grund: Niemand mag auf Dauer der »zweite Sieger« sein – und so ist ein permanenter Machtkampf vorprogrammiert!
Vor kurzem erlebten wir einen »coolen Macher« bei einem Unternehmerforum zum Thema »Wie nutze ich das Internet?« . Das Auftreten dieses Mannes signalisierte: Ich bin unschlagbar! Der einleitende Satz seines Referates schien höflich zu sein: »Der überaus interessante und rhetorisch gute Vortrag meines Vorredners erschwert meinen Einstieg ...« Doch dies war purer Sarkasmus! Der Vorredner war nämlich das genaue Gegenteil eines guten Rhetorikers, jemand, der kaum einen Satz ohne »äh« herausbrachte und der seinen Text überdies – ohne aufzublicken – vom Blatt ablas. So entlarvte diese Bemerkung die einseitige Strategie des »Machers« schlagartig. – Vielleicht wollte der »coole Macher« seinen Vorredner gar nicht blamieren, sondern das Publikum lediglich mit einer witzigen Bemerkung ködern. Doch dies gelang ihm nicht, weil der eigentliche Humor fehlte!
In diesem Buch beschreiben wir den Weg der Humorentstehung. Das Ziel ist dabei, dass wir uns aus einseitigen Motivationsmustern lösen, um in flexibler Weise sowohl die Strategien des Kindes wie die des Erwachsenen einzusetzen. Wir sollten uns also weder auf einen kindlichen Machtkampf einlassen, der nur den Sieg über den Verlierer kennt, noch sollten wir uns – als die sprichwörtlichen »Klügeren« – einer selbstlosen Nachgiebigkeit hingeben. Der von uns vorgeschlagene Weg ist ein Verbindungsweg, der die Kontrahenten dorthin führt, wo sie miteinander lachen können – nicht über die jeweiligen Schwächen des anderen, sondern über die scheinbaren Probleme des Alltagslebens, die uns alle irgendwie betreffen. Dazu gehören zum Beispiel Rollenzwänge, Statuszuweisungen, Leistungsideale und starre Höflichkeitsregeln. Wenn die logische Beweiskraft diese sozialen Vorurteile unbefangen ironisiert, ergeben sich häufig komische Effekte, die das in Frage stehende Problem aus einem anderen Blickwinkel erscheinen lassen – und es so in seiner Bedeutung relativieren. Dies ist die Voraussetzung für eine Erheiterung, die sich im gemeinsamen Lachen äußert und Kontrahenten zu beidseitigen Gewinnern macht.
An dieser Stelle möchte ich Viktor Frankl danken, dem großen Psychologen und Menschenfreund. Er hat den Humor als Erster für die Psychotherapie genutzt, indem er seine Patienten ermutigte, ihre Angst zu ironisieren. Ich möchte auch den vielen Menschen danken, die mit ihrer Kreativität und ihrem Scharfsinn zum Entstehen dieses Buches beitrugen. Dies sind die Teilnehmer unserer Seminare, die wir im Hospitalhof Stuttgart, dem Haus Gutenberg im Fürstentum Liechtenstein, dem Alfred-Adler-Institut in Zürich, aber auch an vielen anderen Orten in Europa und den USA durchgeführt haben. Danken möchte ich auch den Weggefährten von HumorCare6, insbesondere Alfred Gerhards, Michael Falkenbach, Thomas Holtbernd, Erika Kunz, Ludwig Lambrecht und Erwin Neuwirth. Gerhard Plachta vom Kösel-Verlag verdanke ich viele wertvolle Anregungen. Mein besonderer Dank gilt Dieter Kragl und Brigitte Titze, die das Korrekturlesen besorgten und wichtige Hinweise beisteuerten. Ich schließe auch Heidi-Magdalena Mayer in die Dankesworte ein: Als Humorexpertin verfügt sie über ein enormes Witze-Archiv. Einiges davon haben wir aufgegriffen. Last, but not least darf ich René Schweizer meinen besonderen Dank aussprechen. Er war es, der die Idee hatte, den therapeutischen Humor einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Im Herbst 1996 wurde in Basel auf seine Initiative hin der erste Kongress Humor in der Therapie veranstaltet, dem jedes Jahr ein weiterer folgen sollte. Tausende von Besuchern haben daran teilgenommen. Für die von ihm begründete Homepage www.humor.ch, einem Diskussionsforum über therapeutischen Humor, schrieb Schweizer eine Fülle von lehrreichen und witzigen Texten. Einige finden Sie in diesem Buch.
Michael Titze
Am allervernünftigsten ist es, nicht allzu vernünftig sein zu wollen!
Viktor E. Frankl
Voraussetzungen
Die etwas andere Strategie des Humors
Vor nicht allzu langer Zeit flogen wir mit Southwest Airlines von San Diego nach Sacramento. Die Maschine war ausgebucht. An Bord das Übliche. Begrüßung durch freundliche Flugbegleiter, Erleichterung, dass der eigene Platz noch frei ist – und dann die Überraschung. Statt langweiligen Ansagen Provokation aus dem Lautsprecher: Alkoholische Drinks gibt es für zwei Dollar, Prozac (ein bekanntes Antidepressivum) für fünf Dollar – und Viagra für zehn Dollar! Einige ältere Männer lachten. Der Flugbegleiter fragte, welche Dame ihm dabei helfen würde, die Sicherheitsvorkehrungen zu demonstrieren. Eine freundliche Mittfünfzigerin stellte sich zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe zeigte der Flugbegleiter, wie eine gelbe Schwimmweste aufgeblasen wird. Die Dame bekam diese vor die Brust gesetzt, dann zog der Flugbegleiter an einer roten Leine, er zog und zog – und schließlich hatte er einen ziemlich abgetragenen Büstenhalter in der Hand! Fast alle lachten. Später wurden wir durch weitere Zaubertricks unterhalten. Der Flug verging wie im Fluge.
Auf dem Rückflug wurden wir von einem Flugbegleiter mit einer oszillierenden Scherzbrille und monströsen Plastikzähnen begrüßt. Er machte seine Ansage nuschelnd und lispelnd. Viele Reisende lachten. Als wir die Flughöhe erreicht hatten, gab eine Flugbegleiterin Songs aus bekannten Musicals zum Besten, mit teilweise neuen, lustigen Texten. Es klang professionell, brachte uns alle in Stimmung und so geizten wir auch nicht mit Applaus. Später hatten wir Gelegenheit, uns mit den Flugbegleitern persönlich zu unterhalten. Sie erzählten uns, dass Southwest seit über 20 Jahren nur Mitarbeiter einstellt, die bereit sind, sich mit ihren individuellen Fähigkeiten einzubringen. Ob das etwas mit Humor zu tun habe, fragten wir. Selbstverständlich, bekamen wir zur Antwort: »Humor kann nur dann entstehen, wenn jeder das tun darf, was er gerne macht! Wenn alle das Gleiche tun würden, wäre es doch langweilig!«
Southwest fliegt übrigens als einzige Fluggesellschaft in den USA seit über 20 Jahren kontinuierlich Gewinne ein.
Das Markenzeichen des Humors
Weltweit entdecken Unternehmen den Humor als einen Motivationsfaktor, der den Teamgeist stärkt, Stress abbaut und kreative Ressourcen erschließt. Nicht zuletzt hilft Humor Konflikte auf angenehme, spielerische Weise zu lösen.
Humorvolle Strategien der Konfliktlösung erweisen sich im modernen Arbeitsleben als sinnvoll. Angesichts wachsender fachlicher Anforderungen und eines immensen Konkurrenzdrucks können Spannungen entstehen, die eine harmonische Kooperation und gelassene Kommunikation erschweren. Dabei bilden sich leicht unausgewogene Reaktionsmuster heraus, zum Beispiel das Resignieren und Auf-Distanz-Gehen – was auf die Arbeitskollegen häufig provozierend wirkt! Oder das »Ausrasten«, das aggressive Sich-um-jeden-Preis-durchsetzen-Wollen. Und das wird natürlich ebenfalls als Provokation empfunden. Eine harmonische, entspannte Kommunikation ist in solchen Fällen nicht mehr möglich, was dann auch atmosphärisch spürbar wird.
Auf den folgenden Seiten wollen wir zeigen, wie sich solche Probleme im Privat- und Arbeitsleben auflösen lassen. Voraussetzung sind kommunikative Strategien, die das Markenzeichen des Humors tragen.
Ein Besucher fragt die Chefsekretärin, wer im Nebenzimmer so brülle. Sie erklärt: »Unser Direktor spricht mit Hamburg.« Darauf der Besucher: »Kann er nicht das Telefon benutzen?«7
Ein Mann wird schwer verletzt in die Klinik gebracht. Bei der Aufnahme fragt ihn die Schwester: »Verheiratet?« — »Nein, Autounfall!«
Kursänderung zur heiteren Gelassenheit
B. Redt hat sich bei seinem Referat »verrannt«. Er hat nur die Fakten seines Projekts vor Augen, die Zuhörer sind außerhalb seines Blickfelds. Dieser Monolog kommt nicht gut an. Entsprechend ist die Reaktion der Zuhörer: Einige gähnen, andere unterhalten sich leise und einem Herrn sind bereits die Augen zugefallen. Diese nonverbale Kommunikation wird vom Referenten registriert. Er ist aber flexibel genug, eine schnelle Kursänderung vorzunehmen. Er beendet seinen fachlichen Monolog und geht in einen persönlichen Dialog über. Hier eröffnen sich ihm verschiedene kommunikative Möglichkeiten. Er könnte die Zuhörer vielleicht
rügen, dass sie ihm nicht aufmerksam zuhören,um Verständnis bitten, dass er über ihre Köpfe hinweggeredet hat,darauf einstimmen, dass er sich ab jetzt mehr Mühe geben wird.B. Redt entscheidet sich stattdessen für die Humorstrategie. Er erklärt mit verschmitzter Unschuldsmiene: »Ich freue mich, dass mein Experiment gelungen ist. Ich wollte Ihnen demonstrieren, dass es tatsächlich möglich ist, die Zuhörer bei einem Referat in einen anderen Bewusstseinszustand zu versetzen! Als Nächstes werde ich Ihnen demonstrieren, dass ich Sie in einen längeren Tiefschlaf versetzen kann!« Das kommt an. Die meisten Zuhörer schmunzeln, einige lachen. Die kommunikative Verbindung ist hergestellt. Ein lebendiger Dialog kann sich jetzt anschließen, der die anfängliche Langeweile schnell vergessen lässt.
Ein wichtiges Kennzeichen humorvoller Gesprächsführung ist die Fähigkeit, aus festgefahrenen Kommunikationsmustern »auszusteigen«, um – kurzfristig – etwas ganz anderes zu tun. Ein Kind hat damit noch keine Probleme. Es ist, wie es der Sozialpsychologe George Herbert Mead formuliert, »jetzt das und gleich darauf etwas anderes, und das, was es in diesem Augenblick ist, bestimmt nicht, was es im nächsten Augenblick sein wird. Das ist in gleicher Weise die Anmut wie die Unvollkommenheit der Kindheit.«8
Wer als Erwachsener unbedingt vollkommen sein will, wird freilich Probleme haben, zuweilen »ganz anders« zu sein. Ihm wird es so gehen wie Kurt Tucholsky, der einmal erklärte: »Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu!«
In einem Frauenverein sprach ein Soziologe über die explosive Bevölkerungsvermehrung in der Welt und schilderte die Gefahren, die sich daraus ergeben könnten. »Irgendwo auf der Erde bringt jede Minute, Tag und Nacht, eine Frau ein Kind zur Welt«, sagte er. »Was ist da zu tun?« — Eine Frau in einer der hinteren Reihen hob die Hand. »Das Erste, was meiner Meinung nach getan werden sollte, ist, diese Frau zu finden« erklärte sie, »und dafür zu sorgen, dass sie damit aufhört.«
Zuweilen anders sein
Der Regisseur Max Reinhardt erklärte in seiner »Rede über den Schauspieler«:
»Wir spüren unverkennbar, wie ein herzliches Gelächter uns befreien, ein tiefes Schluchzen uns erleichtern, ein Zornausbruch uns erlösen kann. Unsere Erziehung arbeitet freilich dem entgegen. Ihr erstes Gebot heißt: Du sollst verbergen, was in dir vorgeht. So entstehen die sattsam bekannten Verdrängungen, die Zeitkrankheit der Hysterie und am Ende jene leere Schauspielerei, von der das Leben voll ist.«9
Wenn Sie spüren, dass Sie emotional zu einseitig leben, versuchen Sie es gelegentlich einmal anders. Zum Beispiel:
Manchmal wieder Kind sein
Zwei unterschiedliche Bezugssysteme
Goethe lässt Faust sagen: »Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!« Tatsächlich besitzen wir zwei unterschiedliche Quellen der Motivation, aus denen die zielgerichteten Strategien hervorgehen: das Mögen und das Müssen.
Früher zählte die Pflicht bei Eiskunstläufern 60 Prozent und die Kür 40 Prozent. Bei manchen Menschen wäre es sinnvoll, wenn sie ihrem Pflichtbewusstsein nicht zu 100, sondern ebenfalls nur zu 60 Prozent folgen würden. Pflicht und Kür stehen symbolisch für Müssen und Mögen. Hinter dem Mögen steht das Wollen und das Können oder das noch nicht entwickelte Können. Das Mögen lässt mich erahnen, was mir möglich ist, was ich mag, wofür ich mich gern ins Zeug lege. Im Mögen wie im Müssen eröffnen sich uns Bezugssysteme, die sich grundlegend voneinander unterscheiden.
Diese Differenz lässt sich auch physiologisch feststellen. So schreibt Heiko Ernst in einer Titelgeschichte von Psychologie heute:
»Wir besitzen offenbar zwei weitgehend voneinander unabhängig operierende [Bezugs-] Systeme des Wahrnehmens und Denkens, die in unserem Kopf auch unterschiedlich repräsentiert sind: Das [...] Bewusstsein operiert vor allem in der linken Gehirnhälfte. Es analysiert, schreibt, spricht, rechnet und versteht die Umwelt mithilfe von Logik. Die Arbeitsweise des linken Gehirns erschließt sich uns sofort, weil sie die bevorzugte Methode unseres Problemlösens ist, es ist der Modus Operandi des aufmerksamen, konzentrierten Denkens. Die Arbeitsweise der rechten Gehirnhälfte ist weniger leicht zu beschreiben. Sie wirkt eher ›im Hintergrund‹ und funktioniert komplex, integrativ, ganzheitlich, gefühlsbezogen und assoziativ. Anders ausgedrückt: Sie ist intuitiv.«10
Diese Bezugssysteme können wir psychologisch so beschreiben:
1. Bezugssystem: Es ist emotional geprägt. Seine Strategien laufen auf das Ziel hinaus, auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen – also sich wohl, (selbst)sicher und stark zu fühlen. Dies entspricht der ursprünglichen Motivation eines Kindes, weshalb wir von Kindheits-Strategien oder kurz K-Strategien sprechen. Diese zielen insgesamt darauf ab, unser Selbstwertgefühl stabil zu halten – was mit Selbstbehauptung, Durchsetzungswillen und Ich-Bezogenheit zusammenhängt. K-Strategien werden von einem spontanen »Bauchgefühl« motiviert, das aus dem Unbewussten heraus entsteht, also unreflektiert, impulsiv, intuitiv und – im wahrsten Sinne des Wortes – unberechenbar ist.
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es das Bauchhirn tatsächlich gibt. In einer Titelgeschichte vom November 2000 berichtet das Magazin GEO darüber:
»Verborgen in der Darmwand liegen zwei hauchdünne Schichten eines komplexen Nervensystems. Wie Netzstrümpfe umgeben sie den Verdauungstrakt. Diese zweitgrößte Anhäufung von Neuronen im menschlichen Körper ist mit dem Kopfhirn verbunden [...] Experimente legen nahe, dass außer den bewussten Alarmsignalen – etwa Brechreiz bei Vergiftungen – vor allem unbewusste Botschaften in die Zentrale im Schädel eingespeist werden.«
Das steht in Zusammenhang mit
Begeisterung,Schaffensfreude,Kreativität,Spontaneität,Innovation,Einfallsreichtum,emotionaler Intelligenz.Ein erfolgreicher Verkäufer erklärte das Geheimnis seiner beruflichen Kompetenz damit, dass er nur Produkte verkaufe, die er lieben würde. Ähnlich ergeht es Menschen, die eine Situation auf Anhieb, also gedankenlos und gefühlsmäßig, richtig einschätzen. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Beurteilung von völlig unbekannten Menschen »auf den ersten Blick«. Erfolgreiche Verkäufer wundern sich zuweilen selbst, dass sie oft in Sekundenschnelle vorwegnehmen können, wie sich das Verkaufsgespräch entwickeln wird. Sie werden durch K-Strategien motiviert.
2. Bezugssystem: Es wird von der Vernunft geleitet und ist vom abwägenden oder auch diplomatischen Denken eines rationalen Erwachsenen bestimmt. Es ist
normativ,formal,korrekt,regelhaft,kollektiv,kontrolliert,gewissenhaft.Willensstärke, Pflichterfüllung, Verantwortungsbewusstsein und Anpassung an soziale Erwartungen und Rollenzuweisungen – das sind die tragenden Säulen dieses Bezugssystems. Seine Strategien orientieren sich an sachlichen Zielen, die vom Leistungsprinzip bestimmt sind. Wir sprechen deshalb von Erwachsenen-Strategien oder kurz E-Strategien.
E-Strategien sind rational, logisch, analytisch und gedankenschwer. Wer diesen Strategien überwiegend folgt, funktioniert allerdings auf »emotionaler Sparflamme«. Er oder sie verrichtet seine beziehungsweise ihre Arbeit mechanisch, macht Dienst nach Vorschrift und ist von seiner Aufgabe nicht unbedingt begeistert. Dieser Mensch ist in seiner Lebensgestaltung weniger beweglich. Bildlich gesprochen verharrt er auf seinem Standbein.
Im Bemühen, nur keinen falschen Schritt zu machen, erstarren manche Menschen. Ihnen fehlt das Spielbein. Sie bewegen sich »hölzern« durch den Alltag. Eine lockere Bewegung basiert aber auf dem Zusammenspiel von Stand- und Spielbein – wie beim Tanzen. Tanzt jemand mit zwei Standbeinen, so wirkt er starr. Er oder sie bewegt vielleicht die Arme und den Kopf, kommt aber nicht recht vom Fleck. Viele Menschen tanzen so durchs Leben.
Es gibt auch Menschen, die mit zwei Spielbeinen tanzen. Sie tanzen wie losgelöst von der Schwerkraft und es ist eine Freude, ihnen zuzusehen. Irgendwann ist der Schwung, in den sie geraten, aber so mächtig, dass sie den Stand verlieren und stürzen. Diesen Menschen fehlt das Standbein.
Ob Sie Walzer, Charleston, Tango oder Rock ’n’ Roll tanzen – der Wechsel zwischen Stand- und Spielbein ist notwendig. Das Tanzen ist eine Kunst und erfordert viel Übung. Ebenso ist es im alltäglichen Leben. Der Wechselschritt zwischen Dynamik und Ruhe ist es, der alle Lebenskunst begründet.
Unterschiedliche Perspektiven
Ein großer Gelehrter aus dem Abendland war beim Sultan zu Besuch. Um den Gelehrten zu prüfen, ordnete der Sultan einen Intelligenzwettstreit an. Zum Kontrahenten erwählte er Nasrudin Mullah, den legendären Sufi-Meister.11
Dieser erschien mit einem Esel bei Hof, der stapelweise Bücher mit erfundenen, aber Eindruck schindenden Titeln schleppte, wie zum Beispiel »Die Theorie universaler Bifurkanten«, »Erosion und Zivilisation«, »Eine Kritik der erträglichen Reinheit«, »Gesellschaftliche Ursachen mentaler Deaktivierungen«.
Der abendländische Gelehrte war von der scheinbaren geistigen Potenz des Mullahs völlig übermannt. Und so entschloss er sich – nach langem Überlegen –, das logische Wissen Nasrudins durch eine gänzlich reduzierte Zeichensymbolik zu prüfen:
Er hob den rechten Zeigefinger.