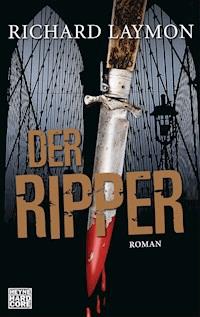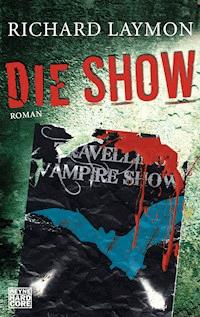9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Nach der Explosion ihrer Jacht finden sich acht junge Urlauber auf einer einsamen Südseeinsel wieder, weitab von jeder Zivilisation. Was als Abenteuer beginnt – früher oder später wird sie ja bestimmt jemand retten, denken sie –, entwickelt sich jedoch zu einem Albtraum, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint: als nämlich einer von ihnen auf bestialische Art und Weise ermordet wird und sich herausstellt, dass die Explosion der Jacht kein Unfall war …
Ein nervenzerreißendes Katz-und-Maus-Spiel von Richard Laymon, einem der meistverkauften Horror- und Thriller-Autoren unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Ähnliche
DAS BUCH
Nach der Explosion ihrer Urlaubsjacht finden sich die Überlebenden am Strand einer einsamen Insel irgendwo in der Südsee wieder: Rupert, seine »Freundin« Connie, deren Schwestern Kimberly und Thelma, Vater Andrew und Mutter Billie sowie Kimberleys Gatte Keith. Auf der Jacht saß Thelmas Ehemann Wesley – und außer Thelma glaubt die ganze Familie, dass die Explosion seiner Idiotie zuzuschreiben ist. Doch kaum hat man sich auf der Insel halbwegs eingerichtet, wird Keith aufgeknüpft im Dschungel gefunden. Wer von den Gestrandeten ist zu so einer Tat fähig? Oder ist es möglich, dass Wesley die Explosion überlebt hat und nun auf der Insel sein Unwesen treibt? Ein atemloses Katz-und-Maus-Spiel beginnt …
Ein furioser Psycho-Thriller von Kultautor Richard Laymon, eine Mischung aus William Goldings »Herr der Fliegen« und Quentin Tarantino, die Ihnen im Sommerurlaub garantiert schlaflose Nächte bereiten wird.
»Einmal mit dem Lesen begonnen, können Sie einfach nicht mehr aufhören!«
The Guardian
DER AUTOR
Richard Laymon wurde 1947 in Chicago geboren und studierte in Kalifornien englische Literatur. Er arbeitete als Lehrer, Bibliothekar und Zeitschriftenredakteur, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete und zu einem der bestverkauften Spannungsautoren aller Zeiten wurde. 2001 gestorben, gilt Laymon in den USA und Großbritannien heute als Horror-Kultautor, der von Schriftstellerkollegen wie Stephen King und Dean Koontz hoch geschätzt wird.
Inhaltsverzeichnis
Dieses Buch ist Frank Coghe gewidmet
Eine Legende zu Lebzeiten
So einen wie dich, Cog, wird es nie wieder geben.
Heute ist die Jacht explodiert.
Zum Glück waren wir gerade an Land und haben ein Picknick gemacht, sonst wären wir wohl alle mit in die Luft geflogen. So hat es nur Prince Wesley erwischt.
Eigentlich war er überhaupt kein Prinz, sondern ein Riesenarschloch. Entschuldigung, ich weiß ja, dass man über Tote nichts Schlechtes sagen soll, aber er ist mir nun mal fürchterlich auf den Sack gegangen. Übrigens bin ich mir ziemlich sicher, dass er die Explosion verursacht hat. Wahrscheinlich hat er sich zur falschen Zeit am falschen Ort eine seiner Zigaretten angezündet.
Kabumm!
Jetzt fressen ihn die Fische.
Natürlich tut es mir Leid, dass er tot ist, aber das ändert nichts daran, dass er ein erbärmlicher, arroganter Widerling war. Wer trägt schon als erwachsener Mensch (ich würde mal sagen, dass er mindestens fünfunddreißig war) noch diese albernen weißen Seglermützen? Und dann hatte er ständig eine Zigarettenspitze aus Elfenbein im Mund, in der er sich alle paar Minuten eine Marlboro anzündete. Ach ja, ein Seidentuch hatte er auch und einen Blazer, und wenn die Sonne schien, setzte er sich eine von diesen extradunklen Fliegersonnenbrillen auf.
Ja, so war Prince Wesley. Jetzt ist er tot, und deshalb werde ich nicht weiter über ihn lästern. Sein wirklicher Name, falls das jemanden interessiert, war übrigens Wesley Duncan Beaverton III. Gestorben am heutigen 1. April 1994, und das ist kein Aprilscherz, zumal wir gleichzeitig Karfreitag haben. Gibt es einen besseren Tag, um zu sterben?
Wesley hinterlässt seine Frau Thelma, die eigentlich froh sein sollte, dass sie ihn los ist, und trotzdem einen auf trauernde Witwe macht.
Kinder hatten die beiden keine, aber schließlich waren sie gerade mal ein Jahr lang verheiratet.
Ich persönlich bin davon überzeugt, dass er sie nur wegen ihres Geldes geheiratet hat.
Jedenfalls nicht wegen ihres guten Aussehens. Was das anbetrifft, ist es in ihrer Familie sehr ungerecht verteilt: Ihre Schwester Kimberly hat alles, und Thelma hat nichts. Kimberly ist ungefähr 25 und sieht einfach umwerfend aus. Mit so einer heißen Braut wollte ich immer schon auf einer einsamen Insel stranden. Wow! Was für ein Glück!
Nützen wird es mir freilich nichts. Nicht nur, dass ich ein paar Jahre jünger bin als sie, Kimberly ist zu allem Überfluss auch noch verheiratet, und ihr Mann, Keith, ist einer von diesen unglaublich gut aussehenden, blitzgescheiten und charakterstarken Typen, die normale Jungs wie einen Irrtum der Evolution aussehen lassen. Eine Frau, die einen solchen Mann hat, gibt sich nicht mit dem Bürschchen ab, das ihre Halbschwester Connie auf diesen Osterausflug mitgenommen hat. Wenn er nicht zu nett dafür wäre, würde ich Keith hassen.
Das dritte männliche Wesen auf der Insel ist Andrew (auf keinen Fall Andy) Collins, der alte Herr der drei Mädchen. Nachdem seine erste Frau, die Mutter von Thelma und Kimberly, bei einem Skiunfall am Lake Tahoe ums Leben gekommen war, hatte er Billie geheiratet, die ihm ein paar Jahre später seine dritte Tochter Connie geboren hat.
Den Bootsausflug auf die Bahamas hatten die Töchter und die Schwiegersöhne Andrew und Billie zum zwanzigsten Hochzeitstag geschenkt. Wesley war extra eine Woche zuvor nach Nassau geflogen, um die Hotels zu buchen und die Motorjacht zu chartern. Andrew, der wohl so um die Mitte fünfzig sein dürfte, ist ein pensionierter Marineoffizier, der mit Beteiligungen an Ölfirmen das große Geld gemacht hat. Er ist eigentlich ganz in Ordnung, und wenn man auf einer einsamen Insel strandet, ist es bestimmt nicht verkehrt, einen wie ihn dabei zu haben. Er ist grundehrlich, intelligent und belastbar. Und dafür, dass er garantiert der Meinung ist, ich würde es seiner jüngsten Tochter »besorgen«, behandelt er mich ziemlich fair.
Connies Mutter Billie ist nur ein paar Jahre älter als Thelma und sieht klasse aus. Nicht so gut wie Kimberly, aber bei weitem besser als Thelma. Eigentlich könnte auch sie eine von Andrews Töchtern sein, und wenn man sie und Connie so ansieht, hält man sie eher für Schwestern als für Mutter und Tochter. Sie tragen beide ihr Haar kurz geschnitten und sind am ganzen Körper tief gebräunt. Connie ist zwar etwas größer als ihre Mutter, aber dafür hat diese eine viel größere Oberweite und rundere Hüften und sieht natürlich im Gesicht ein wenig reifer aus, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ehrlich gesagt finde ich Billie nicht nur in dieser Hinsicht ein ganzes Stück attraktiver als ihre Tochter.
(Mir fällt gerade ein, dass dieses Tagebuch den anderen möglichst nicht in die Hände fallen sollte. Schon mit diesen ersten Seiten hier könnte ich mir eine Menge Ärger einhandeln.)
Ach ja: Ich habe vor, alles, was nach unserem Schiffbruch passiert, genauestens aufzuschreiben und es später als Basis für einen »wahren« Abenteuerroman zu verwenden. So betrachtet wäre es natürlich von Vorteil, wenn wir nicht allzu schnell gerettet würden. Nur wenn wir länger hier auf dieser Insel bleiben, besteht die Hoffnung, dass sich ein paar dramatische Szenen abspielen. Eigentlich habe ich mein Notizbuch ja nur deshalb mit an Land gebracht, um an einer Kurzgeschichte zu arbeiten. Ich will nämlich gerne den Schreibwettbewerb auf dem College gewinnen. Daran sieht man, was für ein Optimist ich doch bin! Wer weiß, ob wir jemals wieder von dieser Insel kommen. Möglicherweise kann ich nicht nur den Schreibwettbewerb vergessen, sondern auch alles andere.
Aber jetzt höre ich mit der Schwarzmalerei auf, sonst werde ich noch depressiv.
Ich mache lieber mit der Vorstellung der Personen weiter.
Connie, die Tochter von Billie und Andrew, ist meine »Freundin«. Ich habe sie an der Belmore Universität kennen gelernt, wo wir beide im ersten Semester studieren. Auf einer Uni ist es unmöglich, den Menschen nicht zu kennen, der unmittelbar vor einem im Alphabet kommt, und Conway wird nun einmal direkt hinter Collins aufgerufen. So sind wir öfter mal ins Gespräch gekommen, und irgendwann gingen wir dann miteinander. Und dann hat sie mich eines Tages für die Osterferien auf einen Bootsausflug mit ihrer Familie zu den Bahamas eingeladen – und zwar gerade, als ich mit ihr Schluss machen wollte.
So eine Einladung schlägt man nicht aus.
Ich zumindest nicht.
Ich schob das Unvermeidliche also auf, bis die Reise vorbei war.
Aber jetzt sieht es so aus, als würde sie möglicherweise nie vorüber sein. Meine Fresse, vielleicht bleibt mir Connie ja bis an mein Lebensende erhalten. Nein, nein, nein. Nie und nimmer. Bestimmt werden wir bald gerettet. Die Zeiten eines Robinson Crusoe sind ein für alle Mal vorbei. Im Höchstfall müssen wir ein paar Tage hier verbringen, wenn überhaupt. Wahrscheinlich holen sie uns schon viel früher, denn es ist gut möglich, dass jemand die Explosion gesehen oder gehört hat.
Es war wirklich eine gewaltige Explosion.
Danach fiel jede Menge Zeug vom Himmel und klatschte in die Bucht. Stücke vom Boot wahrscheinlich und vielleicht auch Stücke von Wesley, auch wenn ich weder Fuß noch Kopf noch Gedärme durch die Luft fliegen gesehen habe. Viele der Trümmer brannten. Zum Glück fielen sie alle ins Meer, wo sie zischend verloschen.
Sekunden nach der Explosion war von unserer schönen Jacht nichts mehr zu sehen bis auf eine kleine Rauchwolke und ein paar auf dem Wasser treibende Trümmer.
Obwohl wir alle, bis auf Thelma, sofort nach Schiffen oder Flugzeugen Ausschau hielten, konnten wir keine erkennen. Thelma hatte das Gesicht in Händen vergraben und schrie die ganze Zeit: »Nein! Nein! Lieber Gott, bitte nicht! Nicht Wesley! Mein armer, armer Wesley!« Und so weiter und so fort.
Kimberly nahm sie in den Arm, klopfte ihr auf den Rücken und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie war ganz nass, weil sie nach dem Picknick noch einmal Schwimmen gegangen und erst kurz vor der Explosion wieder aus dem Wasser gekommen war. Ihre langen, schwarzen Haare klebten ihr noch am Kopf und hingen wie eine dichte Matte über ihren Nacken. Die Haut an ihrem nassen Rücken war braungebrannt und glatt. Kimberly trug einen weißen Bikini, dessen Höschen ein wenig verrutscht war und an einer Hüfte ein Stück weiter herab hing als an der anderen, sodass man rechts mehr von ihrer Gesäßbacke sehen konnte als links, und in der Mitte hatte das Höschen eine Falte, die …
Genug davon!
Sie sah einfach verdammt gut aus, und damit basta. Ich konnte nicht anders, ich musste sie einfach anstarren. Trotzdem habe ich auch nach Schiffen und Flugzeugen Ausschau gehalten, während die Rauchwolke langsam auf das Meer hinaus trieb und sich dort auflöste. Weit entfernt am Horizont konnte ich schemenhaft ein paar Inseln entdecken. Ansonsten gab es ringsum nichts als Wasser und Himmel.
Kimberly führte ihre Schwester ein paar Schritte von uns fort und setzte sich mit ihr auf die Decke, die noch vom Picknick im Sand lag.
»Die Ärmste«, sagte Billie.
»Was musste sie auch einen Versager wie diesen Wesley heiraten?«, fragte ihr Mann. »Sieht ihm ähnlich, unser Boot in die Luft zu jagen.«
»Andrew!«
»Der Trottel wusste genau, dass sich im Maschinenraum Benzindämpfe bilden können«, fuhr Andrew fort. »Wieso muss er sich da eine seiner verdammten Zigaretten anzünden? Aber es war mein Fehler. Ich hätte ihn nicht allein an Bord lassen dürfen. War ja eigentlich klar, dass dieser Volltrottel über kurz oder lang irgendwelchen Mist bauen würde. Er war einfach zu dumm zum Leben.«
»Andrew!«
»Wenigstens hat er nur sich selbst in die Luft gejagt. Das ist der einzige Lichtblick an der Sache.«
»Lass das bloß nicht deine Tochter hören. Sie hat ihn geliebt.«
»Sie ihn vielleicht. Aber er sie nicht. Soviel steht fest. Irgendwie bin ich froh, dass wir ihn los sind. Auch wenn es ihn in sämtliche Einzelteile zerlegt hat.« Er spuckte vor seinen Füßen in den Sand.
Kurz darauf fuhren Andrew und Keith im Dingi hinaus zur Unfallstelle. Ich wollte mitkommen, aber sie sagten, das sei nicht nötig.
Ich hatte nichts anderes erwartet. Keine Ahnung, ob sie mich für völlig nutzlos hielten oder ob sie mich nicht dabei haben wollten, weil ich nicht zur Familie gehöre. Vielleicht gibt es aber auch einen anderen Grund, von dem ich nichts weiß. Obwohl sie eigentlich recht nett zu mir sind, lassen sie mich doch immer wieder spüren, dass ich für sie ein Fremder bin. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, oft ausgeschlossen zu werden, schließlich bin ich ja schon ein paar Tage lang mit ihnen zusammen.
Also blieb ich mit den Frauen am Strand zurück, während sie hinaus zur Ankerstelle tuckerten und das, was von der Jacht noch übrig geblieben war, aus dem Wasser fischten.
Ich stand zwischen Connie und ihrer Mutter und blickte dem Dingi hinterher.
»Ob sie wohl was von Wesley finden?«, fragte Connie und machte dabei ein ähnliches Gesicht wie damals, als sie mir erzählte, dass sie Rote Beete nicht ausstehen kann.
»Wenn ja, dann werden wir ihn begraben«, sagte Billie.
»Vermutlich hat es ihn in tausend Stücke gerissen«, meinte ich.
»Igitt!«, rief Connie aus. »Hoffentlich bringen sie nicht irgendwelche Fetzen von ihm zurück. Das hätte mir gerade noch gefehlt.«
»Wer weiß, vielleicht bist du noch dankbar dafür«, sagte ich. »Niemand kann sagen, wie lange wir auf dieser Insel bleiben müssen, und wenn wir nichts mehr zu essen haben, dann …«
»Rupert! Bitte!«, schnappte Billie entrüstet.
»Wie widerlich!«, fauchte Connie. »Musst du denn immer so geschmacklos sein?«
»Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir ihn besser gut durchbraten sollten, sonst wird er uns bei dieser Hitze noch schlecht.«
Billie sah mich kopfschüttelnd an. »Du hast wirklich verrückte Ideen«, sagte sie mit einem angedeuteten Lächeln. »Sag so etwas bitte niemals zu Thelma.«
»Versprochen.«
Sie trat einen Schritt auf mich zu und stupste mich sanft mit der Schulter an. »Braver Junge. Du bist zwar nicht ganz richtig im Kopf, aber wenigstens hast du ein Gespür für Menschen.«
»Stimmt.«
»Hört endlich auf mit dem Scheiß!«, sagte Connie. Sie mag es nicht, wenn ihre Mutter und ich herumalbern, das ist mir schon ein paarmal aufgefallen. Eigentlich gefiel ihr so gut wie gar nichts, was Billie tat. Vielleicht, weil sie erkannt hat, dass ihre Mutter ihr haushoch überlegen ist, und das in allen Disziplinen: Aussehen, Intelligenz, Sinn für Humor, Mitgefühl und was weiß ich noch alles.
Muss ganz schön hart sein für Connie. Ich sollte in Zukunft wirklich mehr Verständnis für sie haben.
Nachdem sie uns gesagt hatte, wir sollten aufhören, standen wir einfach schweigend da und sahen den »Männern« zu, wie sie die auf dem Meer treibenden Schätze einsammelten.
Das Wasser der Bucht war sehr ruhig, was wohl an dem der Insel vorgelagerten Riff lag. Kurz nachdem das Boot in die Luft geflogen war, hatte es ein paar ziemlich hohe Wellen gegeben, aber inzwischen hatte sich alles wieder beruhigt, und das blassblaue Wasser, das jetzt merkwürdig trüb war, wird bestimmt bald wieder so wunderbar klar werden, wie es vor der Explosion gewesen ist. Eigentlich war es ganz schön, hier im blendend weißen Sand zu stehen. Ein leichter Wind vom Meer her machte die Hitze halbwegs erträglich, und dann waren da noch die Mädels …
Was will man mehr?
Okay, dass es Prince Wesley zerrissen hat, ist wirklich schlimm, und die arme Thelma leidet sicher sehr, aber trotzdem kann ich nicht anders: Ich empfinde die Tatsache, dass wir hier auf dieser Insel gestrandet sind, irgendwie als einen echten Glücksfall.
Zumindest fürs Erste.
Was mich anbelangt, so kann unser Aufenthalt hier ruhig noch etwas länger dauern. Je länger, desto lieber.
Nein, ganz stimmt das nicht. Aber gegen ein paar Wochen hätte ich nichts auszusetzen, vorausgesetzt, dass wir nicht verhungern (Wasser gibt es hier zum Glück genug, denn direkt neben uns fließt ein Bach).
Nach einer Weile kamen Andrew und Keith mit dem Dingi voller Sachen zurück. Darunter waren sogar ein paar Päckchen Proviant und zum Glück keine abgerissenen Körperteile von Wesley. Wer weiß, was Connie sonst gemacht hätte?
»Ob seine Leiche wohl in der Bucht herumschwimmt?«, fragte ich.
»Irgendwo muss sie ja sein«, sagte Keith.
»Wir fahren gleich noch mal raus«, sagte Andrew. »Wir müssen bergen, soviel wir können.«
»Soll ich euch vielleicht diesmal helfen?«, fragte ich.
»Nein, bleib lieber hier, Kleiner«, sagte Andrew. »Einer muss schließlich auf die Damen aufpassen.«
Kleiner. So nennt er mich ständig. Ich werde bald neunzehn, und er nennt mich Kleiner, als wäre ich noch ein Kind.
Vielleicht findet er das witzig.
»Wie Sie wollen, Skipper«, sagte ich.
Er hob eine Augenbraue.
Thelma und Kimberly kamen zurück zu uns. Thelma hatte aufgehört zu weinen, aber sie wirkte noch ziemlich mitgenommen. Trotzdem half sie, wie wir alle, das Dingi auszuladen. Als es leer war, ließen Andrew und Keith den Motor wieder an und fuhren hinaus in die Bucht, um nach neuer Beute zu suchen.
Während die Frauen die Sachen sichteten, die wir an Land gebracht hatten, ging ich zu unserer Picknickdecke, um mir mein Schreibheft zu holen. Ich hatte es in meinem Rucksack, zusammen mit ein paar Taschenbüchern.
»Bin gleich wieder da«, rief ich und ging, bevor jemand auf die Idee kam mir zu folgen, am Bach entlang in den Dschungel hinein.
Während wir anderen am Strand gelegen hatten, hatten Keith und Kimberly sich dort umgesehen und berichtet, dass es etwas weiter drinnen im Dschungel eine Lagune mit einem Wasserfall gab. Vermutlich hatten sie den Erkundungsgang nur unternommen, um eine Weile allein zu sein. Bestimmt hatten sie in der Lagune nackt gebadet und hinterher eine schnelle Nummer geschoben, darauf gehe ich jede Wette ein.
Wenn es mir gelang, die Lagune zu finden, würde ich vielleicht hineinspringen und ein wenig darin herumschwimmen, aber viel wichtiger war mir, mich irgendwo ungestört hinzusetzen und mein Tagebuch zu schreiben.
Irgendwie kam mir der Dschungel ziemlich dicht und unheimlich vor, und ich bekam plötzlich Angst, dass irgendwelche Viecher Jagd auf mich machen könnten. Also kehrte ich um und ging ein Stück am Strand entlang, bis ich zu einem Haufen großer Felsblöcke kam.
Die Bucht, in der der Bach ins Meer mündete, hatte etwa die Form eines großen Us, dessen beide Spitzen von solchen Felshaufen gebildet wurde. Der, auf den ich jetzt zuging, war etwas höher als der andere. Wenn ich ganz hinaufkletterte, war ich nicht nur ungestört, ich würde auch einen guten Ausblick über die ganze Bucht haben.
Oben angelangt war ich ziemlich außer Puste, aber die Anstrengung hatte sich gelohnt. Ich befand mich etwa fünfzehn Meter über dem Meeresspiegel und schaute mich erst einmal gründlich um. Ich sah die Frauen unten am Strand und die »Männer« draußen im Dingi, wie sie immer noch irgendwelches Zeug aus dem Wasser zogen.
An manchen Stellen der Bucht war das Wasser schon wieder so klar, dass ich bis auf den Grund sehen konnte, aber dort, wo die Jacht gelegen hatte, war es immer noch trüb von der Explosion. Zum Glück, dachte ich, dann bestand wenigstens nicht die Gefahr, Leichenteile von Wesley darin herumschwimmen zu sehen.
Hinter dem Felshaufen sah ich nichts außer noch mehr Strand und noch mehr Dschungel. Keinen Steg, kein Haus, keine Straße, keine Telefonmasten – nichts, was darauf hätte schließen lassen, dass die Insel bewohnt war.
Ich ließ den Blick über den Horizont und den Himmel schweifen. Keine Schiffe, keine Flugzeuge.
Nachdem ich mich auch noch vergewissert hatte, dass keine der Frauen mir gefolgt war, suchte ich mir eine Spalte zwischen den Felsblöcken, in der ich es mir bequem machte und zu schreiben begann.
Es ist schön hier oben. Ein großer, überhängender Felsblock schützt mich vor der Sonne, und die sanfte Brise ist einfach wundervoll. Alles, was ich von hier aus sehen kann, ist ein Stück Ozean und ein Stück Himmel.
Ich glaube, ich habe eine gute Stunde lang geschrieben, und jetzt bin ich mit meinen Aufzeichnungen in der Gegenwart angelangt. Vielleicht war es sogar länger. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Mein Hintern tut mir ein wenig weh, deshalb werde ich jetzt aufstehen und nachsehen, was die anderen so treiben.
Vielleicht sollte ich mein Tagebuch hier oben zwischen den Felsen verstecken.
Nein, ich nehme es doch lieber mit. Wenn ich es hier lasse, kann ich es vielleicht nicht mehr rechtzeitig holen, wenn wir überraschend gerettet werden. Außerdem weiß ich nicht, ob das Heft hier sicher ist. Vielleicht findet es irgendein wildes Tier, und ich möchte nicht, dass meine kostbaren Aufzeichnungen von irgendwelchen Vögeln zum Auspolstern ihrer Nester verwendet werden. Lieber lasse ich sie in meinem Rucksack und nehme sie überallhin mit. Auf diese Weise kann sie auch niemand lesen.
So, das wäre es fürs Erste.
Das erste Abendmahl
Bin wieder da.
Es ist früher Abend, und wir sind immer noch hier. Sieht ganz so aus, als ob heute Nacht nichts mehr aus unserer Rettung würde. Andrew und Keith haben fast den ganzen Nachmittag lang Treibgut aufgefischt, und Keith ist sogar ein paarmal auf den Grund der Bucht hinabgetaucht, um versunkene Dinge aus dem Wasser zu holen. Dabei haben sie einige Sachen gerettet, die uns den Aufenthalt auf der Insel erträglicher machen: Nahrungsmittel und Kleidung und sogar ein paar Flaschen Whisky, die wie durch ein Wunder die Explosion überlebt haben. Bei dieser Gelegenheit haben sie auch gleich ein paar Fische eingesammelt, die weniger Glück hatten. Wirklich hilfreiche Dinge, wie Leuchtkugeln oder das Funkgerät, haben sie allerdings nicht gefunden.
Andrew, der anscheinend alles kann, nahm die Fische aus. Bestimmt ist er nicht nur bei der Marine, sondern auch bei den Pfadfindern gewesen. Allzeit bereit. So wie ich immer mein Schreibzeug und etwas zu Lesen bei mir habe, schleppt er ständig ein Schweizer Offiziersmesser mit sich herum sowie ein Gasfeuerzeug, mit dem er seine Pfeife anzündet.
Während Andrew den Fischen die Bäuche aufschlitzte, gingen wir anderen den Stand entlang und sammelten Treibholz für ein Feuer. Holz liegt hier genug herum, und so hatten wir in nicht einmal zehn Minuten einen gut zwei Meter hohen Haufen zusammengetragen.
Nachdem Andrew die Fische ausgenommen hatte, machte er in sicherer Entfernung von dem Haufen Treibholz ein kleines Feuer.
Billie übernahm das Kochen. Sie legte die Fische in einen großen Topf, den Keith aus der Bucht geborgen hatte, und weil wir kein Fett hatten, machte sie eine Whiskyflasche auf und dünstete die Fische in Bourbon. Schmeckte gar nicht schlecht.
Irgendwie komme ich mir hier vor wie auf einem Campingurlaub, bei dem man vor lauter Schusseligkeit die Hälfte seiner Sachen zu Hause vergessen hat und ständig improvisieren muss. Allerdings habe ich noch nie mit so vielen hübschen Frauen gecampt.
Ich muss mir große Mühe geben, um Kimberly, die in ihrem weißen Bikini einfach umwerfend aussieht, nicht die ganze Zeit anzustarren. Und Billie ist auch nicht gerade hässlich. Obwohl ihr schwarzer Bikini sehr viel größer ist als der von Kimberly, kommt er einem trotzdem kleiner vor, weil er einfach besser gefüllt ist. Wie sie so neben dem Feuer hockte und den Topf mit den Fischen schwenkte, war Billie einfach ein toller Anblick. Zumal der Topf nicht das Einzige war, was sie schwenkte. Sie zeigt gerne, was sie hat, und ich muss wirklich aufpassen, dass Connie mich nicht dabei ertappt, wie ich ihre Mutter mit Blicken verschlinge
Ich würde ja auch Connie gerne mit Blicken verschlingen, aber leider zeigt sie mir nicht allzu viel. Fast den ganzen Tag über trägt sie über ihrem Bikini ein weites T-Shirt. Im Gegensatz zu Billie scheint sie nicht den geringsten Hang zum Exhibitionismus zu haben, obwohl sie ihren Körper wirklich nicht zu verstecken braucht. Vielleicht kommt das ja daher, dass sie im Vergleich zu ihrer Mutter richtiggehend abgemagert wirkt.
Was Thelma anbelangt, so ist sie zwar nicht unbedingt hässlich, aber für meinen Geschmack einfach zu dick. Aber ich will nichts Unfreundliches über sie sagen, denn eigentlich ist sie ziemlich nett, und im Großen und Ganzen mag ich sie. Sie trägt ständig weiße Socken und Turnschuhe, einen breitkrempigen Strohhut und eine viel zu weite Bluse, die sie nie in ihre schlabberigen Shorts steckt. Den ganzen Urlaub über habe ich sie noch nie im Badeanzug gesehen.
Vielleicht wäre es besser, wenn ich nicht solche Sachen über die Frauen schriebe. Sollte irgendwann mal jemand meine Aufzeichnungen lesen, wird das vielleicht peinlich. Außerdem könnte man meinen, ich sei oberflächlich und vielleicht sogar ein wenig pervers. Als ob mich nichts anderes interessierte, als Frauen in Bikinis anzuglotzen.
Aber das stimmt nicht.
Wahrscheinlich ist es sehr einfach, unbekümmert über wundervolle, halbnackte Bräute zu plaudern, wenn man selbst ein gut aussehender und selbstsicherer Typ ist, der schon ein paar Dutzend von ihnen flachgelegt hat. Ich aber bin klein, mager und picklig und noch nicht einmal neunzehn Jahre alt. Zu allem Überfluss haben meine Eltern mich auch noch RUPERT genannt, nach Rupert Brooke, einem großen Dichter, dessen Arbeiten ich sehr schätze. Aber wieso haben sie sich nicht für Robert (Frost), Carl (Sandburg) oder Walt (Whitman) entschieden? Wieso ausgerechnet für Rupert? Also wirklich! Aber vielleicht sollte ich froh sein, dass sie mich nicht Wilfred, Ezra oder Sylvia genannt haben.
Wie dem auch sei, ich bin im Grunde genommen nichts anderes als ein schmales Hemd mit einem doofen Namen und einer Menge Flausen im Kopf. Wenn Connie überhaupt auf mich steht, dann nur deshalb, weil ich keine Bedrohung für sie darstelle. Sie findet mich lustig und glaubt, dass sie mich voll in der Hand hat. Vielleicht hat sie auch noch andere Gründe, aber diese kommen mir am einleuchtendsten vor.
Ich glaube ja, dass es immer andere Gründe für alles gibt. Versteckte Gründe. Manchmal so gut versteckt, dass man nicht einmal selbst etwas von ihnen ahnt.
Hoffentlich ist das bei mir auch so. Denn sonst gehe ich nur deshalb mit Connie, weil sie bisher das einzige Mädchen an der Schule ist, das auch nur das leiseste Interesse an mir gezeigt hat. Ihr Aussehen jedenfalls hat mich nicht umgeworfen, und eine gewinnende Persönlichkeit kann man ihr auch nicht bescheinigen.
Und außerdem ist sie echt prüde.
Was wiederum bedeutet, dass wir uns auf der körperlichen Ebene noch nicht besonders nahe gekommen sind.
Das war bei mir eigentlich bisher mit allen Mädchen der Fall, und deshalb bin ich auch so froh, dass ich jetzt in der Nähe von tollen Frauen wie Kimberly und Billie bin, auch wenn ich sie bloß anstarren kann.
Vielleicht gibt es ja auch dafür verborgene Gründe.
Jetzt ist es fast schon zu dunkel, um weiter zu schreiben. Ich höre jetzt auf und gehe zu den anderen ans Lagerfeuer.
Spurlos verschwunden
Keith ist verschwunden.
Es muss während seiner Nachtwache passiert sein.
Als wir am Lagerfeuer saßen, diskutierten wir darüber, ob wir nicht Wachen einteilen sollten. Die meisten waren dagegen. Schließlich waren wir schon seit dem späten Vormittag auf der Insel und hatten bisher keinerlei Anzeichen dafür entdeckt, dass von irgendwoher Gefahr drohte. Andrew aber meinte, Vorsicht sei die Mutter der Porzellankiste, und außerdem sei eine Wache auch deshalb nötig, um das Feuer nicht ausgehen zu lassen.
»Wir sollten es Tag und Nacht brennen lassen, bis wir gerettet werden«, sagte er, während er Tabak in seine Pfeife stopfte. »Ein Feuer wird von Suchflugzeugen gut gesehen, und außerdem haben wir nur ein einziges Feuerzeug. Wenn dem das Gas ausgeht, können wir kein neues Feuer mehr anzünden. Ich zünde mir damit natürlich nicht mehr die Pfeife an.« Mit diesen Worten nahm er einen brennenden Zweig aus dem Feuer und hielt ihn über den Tabak. Als die Pfeife brannte, teilte er ein, wer wann Wache stehen und das Feuer am Brennen halten sollte. Wir waren drei Männer, und weil Andrew meinte, dass es in neun Stunden wieder hell werden würde, dauerte jede Wache drei Stunden. (Wenn es um so etwas ging, zählte ich plötzlich zu den Männern. Muchas gracias, Skipper.)
Kimberly wollte wissen, warum die Frauen denn nicht ebenfalls Wache stehen sollten. »Ist es, weil wir Eierstöcke haben?«, fragte sie.
Ich musste lachen, was mir freundliche Blicke von Kimberly und Billie einbrachte, vom Rest der Gruppe aber nicht so gut aufgenommen wurde.
Es gab eine kurze Diskussion, die mit dem Beschluss endete, die Frauen in der zweiten Nacht Wache schieben zu lassen, falls wir dann noch hier sein sollten. Damit waren alle einverstanden.
Andrew wollte die erste Wache übernehmen, Keith die zweite, und ich war um vier Uhr früh mit der Morgenwache dran.
Nachdem alles soweit geklärt war, legten wir uns schlafen, nur Andrew blieb am Feuer.
Die Luft war angenehm warm, und wir bauten uns Nachtlager aus Picknickdecken, Handtüchern und den von Keith und Andrew aus der Bucht gefischten Kleidungsstücken, die inzwischen getrocknet waren.
Die Paare machten sich Doppelbetten, nur Connie und ich hatten separate Schlafplätze, die zwar nebeneinander lagen, aber doch einen guten Meter Abstand voneinander hatten. Für mich war das okay. Sie gab mir einen spitzen Gute-Nacht-Kuss, dann krochen wir unter unsere improvisierten Decken.
Connie hatte die Lage ihres Schlafplatzes extra so gewählt, dass sie mir die Sicht auf Billie versperrte, die nur drei Meter von mir entfernt schlief.
Auch Kimberly, die auf der anderen Seite lag, konnte ich nicht sehen, weil sie und Keith Thelma gebeten hatten, sich zu ihnen zu legen. Es war zwar nett von ihnen, dass sie Thelma in der ersten Nacht ihrer Witwenschaft Gesellschaft leisteten, aber mussten sie sich denn ausgerechnet so hinlegen, dass ich hinter Thelmas massivem Rücken Kimberly nicht mehr sehen konnte?
Mir blieb also nichts anderes übrig, als meine Augen zu schließen und mich meinen Fantasien hinzugeben.
Darüber musste ich wohl eingeschlafen sein, denn das Nächste, was ich weiß, war, dass mich jemand an der Schulter rüttelte. Ich öffnete die Augen und sah, dass der Himmel nicht mehr dunkel war. Außerdem war es nicht Keith, der mich weckte.
Es war Andrew. Der Skipper. Zuerst erkannte ich ihn nicht, weil ich ihn bisher immer nur mit T-Shirt, Sonnenbrille und Baseballmütze gesehen hatte. Jetzt trug er nichts außer seinen khakifarbenen Shorts, und ich stellte fest, dass er graue Haare auf der Brust und eine Glatze hatte. Als er mich mit seltsam blassen Augen ansah, kam er mir viel älter vor und bei weitem nicht so knallhart wie sonst.
»Was ist denn los?«, fragte ich.
»Das wollte ich gerade dich fragen.« Er klang zwar nicht verärgert, aber besorgt. »Wieso stehst du denn nicht auf deinem Posten?«, fragte er.
Darüber musste ich einen Augenblick lang nachdenken. »Weil mich niemand aufgeweckt hat«, sagte ich dann.
»Keith hat dich nicht geweckt?«
»Nein.«
»Aber wieso denn nicht? Seine Wache war doch um vier zu Ende.«
»Keine Ahnung. Aber es ist nicht meine Schuld. Schließlich habe ich keinen Wecker dabei.«
Ich setzte mich auf und sah mich um. Thelma und Kimberly schliefen friedlich nebeneinander, aber Keith lag nicht bei ihnen.
Auch sonst war er nirgends zu entdecken.
»Wo ist er denn?«, fragte ich.
»Weißt du es denn nicht?«
»Nein, wie denn auch? Ich bin sofort eingeschlafen. Sie saßen drüben am Feuer, und Keith schlief neben Kimberly. Dort habe ich ihn zum letzten Mal gesehen.«
»Es sieht Keith überhaupt nicht ähnlich, dass er seinen Posten verlässt«, sagte Andrew.
»Vielleicht hatte er einen guten Grund dafür.«
»Welchen zum Beispiel?«
»Dünnpfiff?«
»Er hätte dich vor drei Stunden wecken sollen«, sagte Andrew kopfschüttelnd.
Er hatte Recht. Das war eine verdammt lange Zeit, um mit Durchfall im Dschungel zu hocken …
»Vielleicht hat er mich ja absichtlich schlafen lassen«, sagte ich, aber dann sah ich, dass das Feuer nicht mehr rauchte und nur noch aus einem erkalteten Haufen Asche bestand. Offenbar hatte seit Stunden niemand mehr etwas nachgelegt.
Auf einmal machte sich in meiner Magengrube ein seltsames Gefühl breit.
»Was ist denn los?«, fragte eine müde Stimme neben mir. Es war Connie, die ziemlich mitgenommen wirkte. Sie gähnte und stützte sich auf einen Ellenbogen. Irgendwie sah sie süß aus mit ihren kurzen Haaren, die ihr in allen Richtungen vom Kopf abstanden und ihrem T-Shirt, das ihr von einer Schulter gerutscht war. Ich hatte sie noch nie am Morgen aufwachen sehen.
Andrew erklärte ihr die Sache mit Keith. »Ist dir in der Nacht irgendetwas aufgefallen?«, fragte er. Connie gähnte noch einmal und schüttelte den Kopf. »Ich wette, dass er Joggen gegangen ist oder so was. Er ist doch ein totaler Fitnessfreak. Wahrscheinlich rennt er einmal um die Insel rum.«
»Möglich wäre es«, sagte Andrew, aber ich wusste, dass er das nicht glaubte. Um des Familienfriedens willen gab er häufig seiner Frau und den Mädchen Recht, auch wenn er selbst anderer Meinung war.
Er stand auf, ging hinüber zu Billie und rüttelte sie an der Schulter. Offenbar hatte sie einen gesegneten Schlaf, denn sie stöhnte nur kurz auf und drehte sich auf die andere Seite. Dabei verrutschte ihr Bikini so, dass die Hälfte einer Brustwarze zum Vorschein kam. Ich starrte wie gebannt zu ihr hinüber. Wenn ich Glück hatte, sprang vielleicht noch die ganze Brust aus dem Körbchen. Aber dann musste ich schnell wegschauen, weil Andrew aufstand und wieder zurück zu uns kam.
»Liebling, könntest du bitte aufstehen und deine Schwestern wecken?«, wandte er sich an Connie.
Die brummte zwar etwas, befolgte aber dann doch seine Anweisungen. Während sie hinüber zu Thelma und Kimberly ging, stand ich auf. Billie hatte sich mittlerweile aufgesetzt und rieb sich die Augen. Leider versperrte mir einer ihrer Ellenbogen die Sicht auf ihr Bikinioberteil.
Connie stand inzwischen vor Thelma und stieß sie ganz leicht mit dem Fuß an. »Aufwachen, Mädels«, sagte sie.
Thelma, die flach auf dem Rücken lag, öffnete die Augen und schaute Connie finster an.
Kimberly hatte sich eine blaue Decke bis über die Schultern gezogen. Es war nicht die gute Decke, die wir zum Picknick am Strand ausgebreitet hatten, die hatten Andrew und Billie für sich in Anspruch genommen. Kimberlys Decke hatten Andrew und Keith nach der Explosion aus dem Wasser gefischt, und dementsprechend sah sie auch aus. Sie hatte einen langen Riss und ein paar Brandlöcher, durch die ich Kimberlys gebräunte Haut sehen konnte.
Kimberly rührte sich erst, als Connie sagte: »Keith ist verschwunden!« Dann schlug sie die Decke zurück und sprang auf.
Sie trug immer noch ihren weißen Bikini und sah fantastisch aus, obwohl sie ein besorgtes Gesicht machte.
Andrew und Billie gingen hinüber zu ihr.
»Was ist passiert, Dad?«, fragte Kimberly. »Wo ist Keith?«
»Das wissen wir nicht, mein Schatz. Er hätte Rupert um vier aufwecken sollen, hat es aber nicht getan. So, wie es aussieht, ist er schon seit einer ganzen Weile fort.«
Kimberly drehte sich in Richtung Dschungel und rief mit lauter Stimme: »Keith!« Als sie keine Antwort bekam, formte sie mit den Händen ein Sprachrohr und schrie, so laut sie konnte: »KEITH!«
Dann fingen wir alle an, seinen Namen zu rufen.
Wir versuchten es sogar gemeinsam. Das war Billies Idee. Sie zählte bis drei, und wir alle riefen »KEITH!«
Dann warteten wir, aber es kam keine Antwort.
»Hast du vielleicht eine Idee, wo er hingegangen sein könnte?«, fragte Andrew Kimberly.
»Soll das ein Witz sein? Du weißt genau, dass Keith nirgendwo hingeht, wenn er zur Wache eingeteilt ist. Höchstens vielleicht mal fünf Minuten, wenn er auf’s Klo muss. Aber das dauert doch keine vier Stunden.«
Ihre Stimme klang schrill, aber nicht hysterisch. Ich hatte sie noch nie so besorgt gesehen, und es fehlte nicht viel, und sie hätte angefangen zu weinen.
»Es muss ihm etwas zugestoßen sein«, sagte sie. »Ein Unfall oder …« Sie schüttelte den Kopf. »Wir müssen los und ihn suchen.«
Ohne uns Zeit für eine Debatte über ihren Vorschlag zu lassen, nahm Kimberly ihre Schuhe und lief los in Richtung Dschungel.
»Bleib stehen, Kim!«, rief Andrew ihr hinterher. »Warte auf uns!«
Kimberly hielt an, drehte sich um und sah ihren Vater an. Dann ging sie entschlossenen Schrittes weiter auf den Dschungel zu.
»Einer sollte hier bleiben«, schlug ich vor. »Für den Fall, dass Keith zurückkommt …«
»Gute Idee«, sagte Andrew. »Möchtest du hier bleiben?«
»Nein, aber…«
»Ich bleibe hier«, bot Connie an.
»Aber nicht allein«, sagte ihr Vater.
»Rupert kann doch bei mir bleiben.«
»Aber ich will mit nach Keith suchen«, sagte ich.
Der Skipper deutete auf mich. »Nein, du bleibst bei ihr.« Er kramte in seiner Hosentasche, zog das Feuerzeug heraus und warf es mir zu. »Mach ein Feuer, Rupe.«
»Aye, aye, Sir.«
Andrew, Billie und Thelma holten sich Schuhe, Hüte und Sonnenbrillen und eilten Kimberly hinterher. Bald waren sie alle im Dschungel verschwunden, und Connie und ich blieben allein am Strand zurück.
»Der taucht schon wieder auf«, sagte Connie.
»Hoffen wir’s.«
Sie runzelte die Stirn, wie sie es immer tat, wenn sie sich besonders angestrengt konzentrierte. »Was meinst du, was ihm passiert ist?«
»Na was schon? Die Kopfjäger haben ihn geschnappt, als er mal für kleine Jungs musste.«
»Selten so gelacht. Wenn du glaubst, dass das lustig ist, dann hast du was an der Birne.«
»Okay, vielleicht waren es auch keine Kopfjäger.«
»Was du nicht sagst.«
»Es kann ihn ja auch eine Schlange gebissen haben. Oder eine von diesen Riesenspinnen, wie sie hier auf diesen Inseln vorkommen. Sie haben ein spezielles Gift, das einem das Blut in Säure verwandelt. Und dann frisst es einen von innen auf.«
»Wer’s glaubt …«
»Das stimmt.«
»Fick dich ins Knie«, sagte sie und ging zum Wasser.
»Muss es unbedingt mein Knie sein?«, erwiderte ich.
»Was anderes wirst du nicht kriegen«, sagte sie schnippisch, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen.
Dass du dich da mal nicht täuschst, dachte ich mir, sagte es aber nicht. Ich hatte bereits zu viel gesagt.
Während Connie ins Meer ging, entfachte ich auf der Asche ein neues Feuer. Als es groß genug war, schnappte ich mir Schreibheft und Stift und fing an zu arbeiten.
Der Suchtrupp ist immer noch nicht zurückgekehrt.
Connie hat mich allein gelassen.
Sie ist eine Weile in der Bucht herumgeschwommen und dann auf den Felshaufen am Ende der Bucht geklettert (Gut, dass ich dort gestern nicht mein Tagebuch versteckt habe. Wenn sie es gefunden und gelesen hätte, würde ich wohl bald ziemliche Schwierigkeiten kriegen.) Nach einer Weile ist sie wieder heruntergeklettert und noch eine Runde geschwommen. Jetzt liegt sie im Sand und sonnt sich. Sie benimmt sich so, als wäre ich gar nicht da.
Schon vor dieser Reise waren wir nicht gerade ein Traumpaar gewesen, aber sobald die anderen ins Spiel gekommen waren, hatte sich unser Verhältnis noch einmal verschlechtert. Ich glaube, dass Connie es mittlerweile als großen Fehler ansieht, mich auf die Bootsfahrt mitgenommen zu haben.
Ihre Sache.
Ich amüsiere mich auch ohne sie ganz gut.
Irgendwie ist es kein gutes Zeichen, dass die anderen noch immer nicht zurück sind. Langsam befürchte ich, Keith könnte etwas Schlimmes zugestoßen sein.
Und ich hoffe, dass es wenigstens den anderen gut geht.
Was ist denn, wenn sie nicht mehr zurückkommen?
Darüber möchte ich lieber nicht nachdenken. Zum Glück ist es nicht sehr wahrscheinlich.
So, jetzt mache ich für eine Weile Schluss. Ich muss noch rasch etwas erledigen, solange ich den Strand fast für mich allein habe.
Keith wird gefunden
Mann. Mist.
Der Suchtrupp ist immer noch nicht zurück. Kein Wunder, denn er kann Keith gar nicht gefunden haben.
Ich habe ihn gefunden.
Und ich musste nicht lange nach ihm suchen. Nur einmal nach oben schauen.
Und so ist es passiert: Weil ich seit unserer Ankunft auf der Insel meinen Darm nicht entleert hatte, beschloss ich, die Gunst der Stunde zu nutzen und mich ungestört von den anderen zu erleichtern. Ich schnappte mir ein Taschenbuch, aber nicht, um es zu lesen, sondern um die bereits gelesenen Seiten herauszureißen und als Klopapier zu benutzen. (Es ist kein allzu interessantes Buch).
Dann ging ich in den etwas südlich vom Bach gelegenen Teil des Dschungels, den wir seit unserer Ankunft auf der Insel für diese Zwecke verwendet hatten. Deshalb hatten Kimberly und die anderen auch hier zuerst nach Keith gesucht.
Es war nicht weit dorthin, und die Büsche waren so dicht, dass man nach ein paar Schritten nicht mehr zu sehen war. Ich blieb aber nicht gleich an den ersten paar Bäumen stehen, sondern ging noch ein Stück weiter in den Dschungel hinein. Schließlich konnte ich nicht wissen, wann die anderen zurückkommen würden.
Ich suchte mir einen guten Platz und erledigte mein Geschäft.
Um es mir zu erleichtern, hatte ich die Badehose ausgezogen, und als ich fertig war, zog ich sie wieder an. Dabei erwies es sich allerdings als Problem, dass ich meine Schuhe nicht ausgezogen hatte. Als ich so auf einem Fuß balancierend dastand und versuchte, den anderen in die Badehose zu fädeln, blieb ich mit dem Turnschuh hängen und verlor das Gleichgewicht. Wie ein Rumpelstilzchen auf einem Bein herumhüpfend versuchte ich noch, mich zu befreien, aber dann prallte ich mit der Schulter gegen einen Baumstamm und fiel zu Boden, wo ich auf dem Rücken liegen blieb.
Und so entdeckte ich Keith.
Ich war gegen seinen Baum geprallt.
Es war übrigens keine Palme. Hier im Dschungel gibt es auch tausende verschiedene Arten von ganz normalen Bäumen. Keiths Baum sah so aus wie einer bei uns zu Hause, er hatte einen dicken Stamm, kräftige Äste und keine Wedel, sondern ganz normale Blätter.
Keith hing oberhalb der ersten Äste, die in etwa zwei Metern Höhe aus dem Stamm wuchsen.
Zuerst sah ich nur das Hinterteil eines nackten Mannes, der direkt über mir im Geäst baumelte.
So schnell ich konnte, zog ich meine Badehose an, stand auf und trat rasch ein paar Schritte von dem Baum zurück.
Keith hing so weit oben, dass ich sein Gesicht nicht richtig sehen konnte. Trotzdem bezweifelte ich keine Sekunde, dass er es war. Zwar hatte er seine Flipflops verloren, und auch seine Badehose trug er nicht mehr, aber er hatte noch immer sein bunt bedrucktes Hawaiihemd an. Es flatterte im Wind, der auch seinen Körper ganz leicht hin und her bewegte.
Obwohl ich von hier unten aus kein Seil entdecken konnte, war ich mir ziemlich sicher, dass er an einem baumelte.
Ein Selbstmord kam mir höchst unwahrscheinlich vor, was wiederum bedeutete, dass jemand ihn umgebracht haben musste.
Ich rannte wie ein Verrückter zurück zum Strand.
Connie lag nach wie vor im Sand und sonnte sich.
Ich sagte ihr nichts, sondern nahm mein Heft und fing an zu schreiben, und das tue ich jetzt noch.
Ich bin immer noch ziemlich zittrig, und so ist das, was ich hier hinkritzle, kaum lesbar. Schließlich findet man nicht jeden Tag ein Mordopfer. Und Keith war – anders als Prince Wesley – auch noch ein netter Kerl.
Jetzt hatten wir zwei tote Ehemänner. Und zwei Witwen.
Die arme Kimberly. Es wird bestimmt ein schwerer Schlag für sie.
Ich könnte den Fund der Leiche natürlich verschweigen, aber damit wäre nichts gewonnen. Es ist schließlich nicht so, dass Keith sich bloß im Dschungel verlaufen hat und wir nur lange genug warten müssen, bis er wieder zurückfindet. Alles, was er jetzt noch tun wird, ist verwesen.
Außerdem müssen die anderen wissen, dass hier ein Mörder sein Unwesen treibt.
Oder mehrere Mörder.
Wildgewordene Eingeborene?
Wer weiß?
Möglich wäre auch, dass jemand von uns Keith getötet hat. Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Andrew ist wohl der Einzige, der stark genug wäre, ihn den Baum hinauf zu ziehen. Natürlich könnten sich auch zwei der Frauen zusammengetan haben, um die Tat zu begehen. Aber dafür gab es, soviel ich weiß, überhaupt kein Motiv.
So. Jetzt kommen die anderen zurück.
Ich muss aufhören.
Wir tun was
Als sie aus dem Dschungel auf mich zukamen, humpelte Thelma so stark, dass Andrew und Billie sie von beiden Seiten stützen mussten. Sie hatte Andrews schwarzen Ledergürtel um ihren linken Knöchel gebunden und konnte den Fuß praktisch überhaupt nicht belasten.
Kimberly, die am Schluss der Gruppe ging, drehte sich immer wieder um und blickte zurück in den Dschungel.
Alle vier schwitzten stark und hatten vor Anstrengung gerötete Gesichter.
Während sie auf mich zukamen, schüttelte Andrew den Kopf.
»Ihr habt ihn nicht gefunden«, sagte ich.
»Der kann weiß Gott wo sein. Nirgends eine Spur von ihm. Hier bei euch ist er auch nicht aufgetaucht, oder?«
»Nein«, sagte ich. »Was ist denn mit Thelma passiert?«
»Ich bin so ungeschickt«, sagte Thelma. »Ich bin ausgerutscht und habe mir den Knöchel verstaucht.«
»Das hätte jedem passieren können«, meinte Billie.
»Wir gehen gleich noch mal los und suchen weiter«, sagte Andrew. »Wir wollten bloß Thelma zurückbringen, und außerdem müssen wir etwas essen.«
Er und Billie ließen Thelma vorsichtig auf ihr Lager aus Kleidungsstücken und Handtüchern sinken.
Kimberly ging an uns vorbei zum Meer. »Ich muss mich abkühlen«, sagte sie. Sie hatte zahlreiche Kratzer an Armen und Beinen, und an ihrer schweißnassen Haut klebten Blätter und Grashalme.
»Was ist denn mit ihr los?«, fragte ich, als sie außer Hörweite war.
»Sie hat sich ziemlich verausgabt«, antwortete Andrew, während er ihr kopfschüttelnd hinterher sah. »Sie ist auf jeden Felsen gestiegen, in jedes Gebüsch gerannt und in jedes Loch gekrochen. Mir ist schon beim Zuschauen angst und bange geworden. Was für ein tolles Mädchen! Nur mit Mühe konnte ich sie überreden, mit uns zurück zu kommen. Ich hoffe nur, dass Keith einen guten Grund für sein Verschwinden hat, wenn er irgendwann mal wieder hier auftaucht.«
»Das wird nicht passieren«, sagte ich.
Andrew, Billie und Thelma sahen mich verwundert an.
»Was wird nicht passieren?«, fragte Andrew.
»Er wird nicht wieder hier auftauchen. Ich habe ihn gefunden. Erst vor ein paar Minuten. Er ist umgebracht worden. Erhängt, nehme ich an.«
Thelma fiel der Unterkiefer herunter, und sie starrte mich entgeistert an.
»Großer Gott«, murmelte Billie.
Andrew presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. Dann sagte er leise zu mir: »Zeig ihn mir. Und ihr beide bleibt hier.« Dabei deutete er auf die Frauen.
»Was ist mit Kim?«, fragte Billie.
Ich drehte mich um und sah gerade noch, wie Kimberly, die bis zu den Hüften im klaren, blauen Meer vor der Bachmündung stand, die Arme über den Kopf hob und ins Wasser sprang.
»Der sagen wir es erst, wenn wir es ganz genau wissen«, sagte Andrew. »Was, um Himmels willen, geht hier bloß vor? Ist das eine Verschwörung gegen meine Töchter? Wieso will jemand sie zu Witwen machen?«
Beim Wort »Witwen« fing Thelma zu weinen an.
Kimberly tauchte wieder auf und begann zu schwimmen. Ihr Rücken glänzte im Sonnenlicht.
»Gehen wir, Junge.«
Wir beeilten uns. Auf dem Weg fragte mich Andrew, wie ich denn die Leiche entdeckt hätte und ob ich sicher sei, dass es auch wirklich die von Keith war. Ich erzählte ihm, was ich wusste und ließ nur aus, dass ich hingefallen war. Was die Identifizierung des Toten anbelangte, konnte ich ihm nur sagen, dass er Keiths Hawaiihemd anhatte, und ich deshalb davon ausging, dass er es war. »Er kann natürlich auch mit einem Toten das Hemd getauscht haben«, fügte ich hinzu.
»Spar dir deine blöden Witze«, sagte Andrew. »Das ist eine verdammt ernste Sache.«
»Entschuldigung.«
»Du sprichst hier vom Mann meiner Tochter, einem grundanständigen Kerl. Ganz im Gegensatz zu dem Knallkopf, der sich gestern mit unserem Boot in die Luft gesprengt hat.«
Wir erreichten den Dschungel, und ich hatte keine große Mühe, Andrew zu der Leiche zu führen. Schließlich brauchte ich mich nur an den zusammengeknüllten Seiten eines Taschenbuchs zu orientieren.
»Du hast Recht«, sagte Andrew, nachdem ich ihm den Baum gezeigt hatte. »Das ist er.«
»Ich kann mir vorstellen, weshalb er während seiner Wache hierher gekommen ist«, sagte ich. »Wenn alle schlafen, kann man in aller Ruhe sein Geschäft erledigen. Aber offenbar hat ihm jemand aufgelauert.«
»Oder er ist ihm vom Strand aus gefolgt«, fügte Andrew hinzu und sah mich an. Auch wenn ich durch die Sonnenbrille seine Augen nur undeutlich sah, konnte ich erahnen, was das für ein Blick war.
»Sie glauben doch nicht etwa, dass ich es war? Wieso sollte ich so etwas tun?«
»Weil du scharf auf Kimberly bist …«
»Sie sind ja verrückt!«
»Du glotzt sie doch ständig an.«
»Und wenn schon, deshalb muss sie sich mir noch lange nicht in die Arme werfen, bloß weil Keith nicht mehr da ist. Für wie blöd halten Sie mich denn? Und wie soll ich bitteschön Keith hinauf in den Baum gebracht haben? Der ist doch viel zu schwer für mich.«
»Möglich wäre es«, sagte Andrew.
»Ja, mit einem Kran.«
»Mit einem Flaschenzug.«
»Und haben Sie mich vielleicht mit einem Flaschenzug am Strand entlanglaufen sehen?«
»Immer mit der Ruhe, Junge. Ich denke lediglich über alles nach.«
»Über mich brauchen Sie nicht mehr nachzudenken. Und überhaupt, woher soll ich wissen, dass nicht Sie es waren? Sie sind vermutlich stark genug, um jemanden auch ohne Flaschenzug hinauf in den Baum zu kriegen.«
»Und wieso hätte ich meinen eigenen Schwiegersohn umbringen sollen, Sherlock?«
»Keine Ahnung. Sagen Sie es mir.«
»Mein Gott! Der Junge war das Salz der Erde. Verflucht!« Andrew deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger hinauf zu dem Toten. »Du kletterst jetzt da rauf und schneidest ihn ab. Wenn Kimberly sieht, dass wir fort sind, schöpft sie vielleicht Verdacht und sucht uns.«
»Wie bitte? Ich soll da hinaufklettern?«
»Wer denn sonst? Ich vielleicht? Ich bin schließlich sechzig Jahre alt, verdammt noch mal.«
»Echt?«
»Leider.«
»Trotzdem sind Sie viel fitter als ich.«
»Das weiß ich selbst, aber du solltest dich schämen, das zuzugeben.« Er holte sein Schweizer Offiziersmesser aus einer Tasche seiner Shorts und warf es mir zu.
Ich war zu ungeschickt, um es zu fangen, und musste es vom Boden aufheben.
»Und jetzt mach, dass du auf den Baum kommst. Wenn Kimberly ihn hier halb nackt hängen sieht, hat sie für den Rest ihres Lebens Alpträume.«
Damit hatte er wohl Recht.
Weil meine Badehose keine Taschen hatte und ich kein Hemd trug, steckte ich das Taschenmesser in meine rechte Socke und fing an, auf den Baum zu klettern.
Ein Vergnügen war das nicht gerade.
Abgesehen davon, dass ich ständig Angst hatte herunterzufallen, war es mir alles andere als angenehm, zu einem Toten hinaufzuklettern. Mit Verstorbenen hatte ich in etwa so viel Erfahrung wie mit Frauen – sprich: überhaupt keine. Und ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn das auch weiterhin so geblieben wäre (nicht mit den Frauen, natürlich, aber mit den Verstorbenen).
Und als wäre es nicht schon schlimm genug gewesen, dass Keith tot war, er war auch noch so gut wie nackt. Nichts auf der Welt sehe ich weniger gern als einen Mann ohne Hosen. Am allerwenigsten von vorn, und genau so hing Keith im Baum.
So sehr ich mich auch bemühte, beim Hinaufklettern nur auf Stamm und Äste zu sehen, tauchten am Rand meines Gesichtsfeldes immer wieder Keiths nackte Füße und Beine auf.
Ich hob den Kopf und blickte an dem Seil entlang nach oben. Von Keiths Hals lief es zu einem dicken Ast, um den es in mehreren Windungen geschlungen war, bevor es wieder nach unten führte. Etwa einen halben Meter unterhalb der Leiche war es an einem weiteren Ast festgeknotet.
Vielleicht war es ja möglich, das Seil dort unten zu durchtrennen, dann musste ich nicht ganz soweit hinauf klettern. Um aber auch nur in die Nähe des Seils zu kommen, musste ich direkt unterhalb von Keiths Füßen hinaus auf einen Ast krabbeln, und wenn ich dann das Seil durchschnitt, bestand die Gefahr, dass er auf mich herab fiel.
Weil ich das auf keinen Fall riskieren wollte, richtete ich meinen Blick wieder auf den Baumstamm und kletterte weiter.
So sehr ich mich auch bemühte, ich konnte es nicht verhindern, dass ich viel mehr von Keith zu Gesicht bekam, als mir lieb war. Wenn so etwas neben einem hängt, schaut man eben doch immer wieder hin, ob man nun will oder nicht.
Zum Beispiel, weil man sichergehen will, dass man nicht mit der Leiche in Berührung kommt.
Außerdem fragt man sich, ob nicht vielleicht etwas auf dem Toten hockt, das einen beißen oder anspringen könnte. Irgendein Raubtier oder eine Schlange oder weiß Gott, was sonst noch.
Wie dem auch sei, jedenfalls wurde mir von Keiths Anblick ziemlich schlecht. Erst fand ich es am ekligsten, dass er keine Hosen trug, aber als ich hoch genug war, um sein Gesicht zu sehen, war das noch hundertmal schlimmer.
Ich möchte nicht mal ansatzweise beschreiben, wie es aussah.
»Ist er es?«, rief Andrew von unten herauf.
»Ich denke schon.«
»Denkst du es nur, oder weißt du es?«
»Sein Gesicht ist übel zugerichtet. Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass er es ist.«
»Wurde er aufgehängt?«
»Ja«, rief ich nach unten. »Aber es sieht so aus, als hätte ihm jemand vor dem Aufhängen den Schädel eingeschlagen.«
»Dann schneide ihn jetzt ab.«
»Einen Moment noch.«
Ich besah mir den Strick, der nicht viel dicker als eine normale Wäscheleine war. Der Knoten an der rechten Wange des Leichnams war ein echter »Henkersknoten« mit dreizehn Schlingen. Er drückte Keiths Kopf schräg zur Seite und das Seil lief straff gespannt hinauf zu einem dicken Ast etwa einen Meter weiter oben.
»Wieso brauchst du so lange?«, rief Andrew. »Schneid ihn doch endlich ab!«
Ich fragte mich, ob es vielleicht möglich war, Keith langsam herabzulassen.
Wenn man ihn hatte hinaufziehen können, musste man ihn doch eigentlich auch wieder herunterlassen können.
Als ich nach unten sah, bemerkte ich, dass das nicht möglich war. Der Mörder hatte den Strick dicht unterhalb des Knotens abgeschnitten, sodass man den Knoten nicht mehr lösen konnte.
Es widerstrebte mir, das Seil einfach durchzuschneiden und Keith herunterfallen zu lassen.
»Verdammt noch mal, Rupert, nun mach schon!«
»Er wird runterfallen.«
»Na und? Das tut ihm nicht mehr weh.«
»Okay, okay.«
Ich kletterte noch ein Stück höher und hob, während ich den linken Arm um den Baumstamm schlang, meinen rechten Fuß. Ich zog das Messer aus der Socke, klappte die Klinge mit den Zähnen aus und hielt sie weit nach vorne gebeugt etwa zwanzig Zentimeter oberhalb von Keiths Kopf an das straff gespannte Seil.
Andrew musste sein Messer erst kürzlich geschliffen haben.
Ein einziger Schnitt genügte, und das Seil war durch.
Keith sauste nach unten.
Es war noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte.
Der Leichnam krachte auf den Ast unter ihm und blieb den Bruchteil einer Sekunde lang rittlings und mit schlaff herabhängendem Kopf darauf sitzen wie ein Cowboy, der im Sattel eingeschlafen war. Dann kippte er im Zeitlupentempo zur Seite und stürzte kopfüber zu Boden.
Andrew stieß einen brummigen Seufzer aus und brachte sich mit ein paar raschen Schritten rückwärts aus der Gefahrenzone.
Als Keith mit dem Kopf auf dem Urwaldboden auftraf, schien sein Rückgrat in der Mitte einzuknicken, und einen Augenblick lang glotzte er zu mir herauf wie ein Mutant, der halb aus Gesicht und halb aus Hinterteil besteht, bevor er seitlich umkippte und endgültig liegen blieb.
Ich klammerte mich zitternd an den Baumstamm und konnte mich eine ganze Weile lang nicht bewegen.
Es dauerte nicht lange, da rief mir Andrew zu, ich solle mich gefälligst zusammenreißen und herunterklettern – und das Seil mitbringen.
Um das zu tun, musste ich hinaus auf den unteren Ast klettern, an dem es festgebunden war. Meine Hände zitterten so stark, dass ich den Knoten nicht lösen konnte und das Seil durchschneiden musste. Ich ließ es fallen und kletterte nach unten.
Als ich Andrew sein Messer zurückgab, hatte er das Seil schon aufgehoben und zusammengerollt.
»Was machen wir mit ihm?« fragte ich.
»Kimberly will ihn bestimmt sehen«, antwortete er und gab mir das Seil. Dann ging er neben dem Leichnam in die Hocke und löste die Schlinge von seinem Hals. »Das können wir ihr nicht abschlagen, denn wenn sie ihn nicht sieht, glaubt sie uns niemals, dass er tot ist.«
Andrew packte den Toten an den Füßen und zerrte so lange an ihm, bis er ausgestreckt auf dem Boden lag.
»Wo ist bloß seine verdammte Badehose?«
»Die muss der Mörder mitgenommen haben.«
»Sieh nach, ob du sie findest.«
Ich sah mich um, aber ich konnte weder Keiths Badehose noch seine Sandalen noch sonst irgendetwas von ihm finden.
»Willst du ihm nicht deine anziehen?«, fragte Andrew.
»Soll das ein Witz sein? Was soll ich denn ohne Badehose machen? Wieso geben Sie ihm nicht Ihre?«
Er grinste mich schief an. »Dann lauf zurück zum Strand und hol ein Badetuch … eine Decke … irgendwas.«
»Können wir ihn nicht mit Blättern zudecken?«
»Tu, was ich sage.«
Und das tat ich auch, obwohl ich genau wusste, dass es ein Fehler war.
Als ich aus dem Dschungel kam, stieg Kimberly gerade aus dem Wasser. Sie ging den Strand hinauf zu Billie und Thelma, aber als sie mich bemerkte, rannte sie sofort auf mich zu.
Vielleicht hätte ich vor ihr davonlaufen sollen, aber ich konnte es einfach nicht.
»Ihr habt ihn gefunden«, sagte sie. Sie musste es mir am Gesicht angesehen haben. »Oh Gott! Wo ist er?«
»Dein Dad ist bei ihm. Er will nicht …«
»Er ist tot, nicht wahr?«
»Deinem Dad geht es gut.«
»Ich meine Keith.«
Noch bevor ich mir eine gute Antwort überlegen konnte, war sie an mir vorbei in den Dschungel gerannt.
»Kimberly, nicht!«, rief ich hinter ihr her. »Warte auf mich!«
Sie blieb nicht stehen, und sie hatte schon zu viel Vorsprung, als dass ich sie hätte einholen können. Und selbst wenn es mir gelungen wäre, hätte ich sie anspringen und zu Boden reißen sollen?
Andrew hätte mich nicht zum Strand zurückschicken dürfen. Ich hatte es ihm gesagt, aber er hatte darauf bestanden.
Nun gut, ich hatte einen Auftrag zu erledigen. Aber ich ließ mir Zeit damit. Ich ging langsam zu unserem Lager, nahm eine Decke und beantwortete ein paar Fragen von Thelma, Connie und Billie, bevor ich mich wieder auf den Weg in den Dschungel machte.
Als ich bei dem Baum ankam, lag Kimberly weinend in den Armen ihres Vaters.
Er trug nur seine weiße Unterhose.
Offenbar hatte er sie kommen hören, rasch seine Shorts ausgezogen und damit Keiths Blöße bedeckt. Über das Gesicht des Toten hatte er sein weißes Taschentuch gelegt.
Während er tröstend auf Kimberly einsprach, trat ich an den Leichnam heran und breitete die Decke über ihn. Dann griff ich darunter und zog Andrews Shorts und das Taschentuch hervor. Ich trat einen Schritt zurück und sah schweigend zu, wie Kimberly an der Schulter ihres Vaters leise vor sich hinschluchzte.
Das Begräbnis
Nachdem Kimberly sich in Andrews Armen ausgeweint hatte, bestand sie darauf, sich Keiths Leiche näher anzusehen. (Was all unsere Bemühungen, die Leiche zu bedecken, ad absurdum führte). Andrew versuchte, sie davon abzuhalten, aber Kimberly hörte nicht auf ihn und zog die Decke weg, bevor sie neben der Leiche in die Hocke ging.
Sie sah den Toten lange an, bevor sie seinen Kopf in beide Hände nahm und ihn von einer Seite auf die andere drehte und mit den Fingern die Kopfhaut abtastete. Vermutlich wollte sie feststellen, was ihn getötet hatte. Dabei sagte sie kein einziges Wort. Sie weinte nicht mehr, aber die Verbitterung war ihr ins Gesicht geschrieben. Schließlich knöpfte sie Keith das Hemd auf und bat uns, ihn in eine sitzende Position zu bringen. Nachdem sie ihm das Hemd ausgezogen hatte, schlüpfte sie selbst hinein, ließ die Knöpfe aber offen.
Dann wickelten wir alle drei zusammen Keith in die Decke. Andrew band das Seil darum, bis wir ein ordentlich zugeschnürtes Bündel vor uns hatten, aus dem am Ende ein paar Füße herausschauten.
Andrew wuchtete es sich auf die Schulter und ging voraus in Richtung Strand.
Im Lager warteten Billie, Connie und Thelma auf uns. Alle drei weinten. Als wir kamen, scharten sie sich kopfschüttelnd und schluchzend um Kimberly und schlossen sie in ihre Arme. Kimberly selbst schien relativ gefasst zu sein. Sie machte ein grimmiges Gesicht, brach aber nicht zusammen. Als ich sie in Keiths buntem Hemd so vor mir stehen sah, voller Schmerz und unglaublich tapfer zugleich, schnürte mir irgendetwas die Kehle zu.