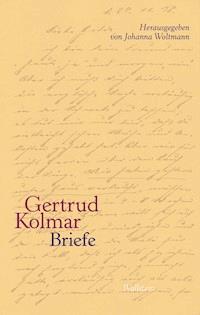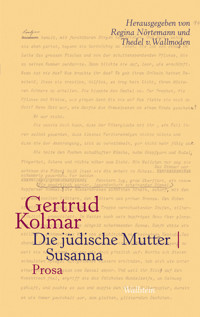
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Prosa von Gertrud Kolmar erstmals in einer kritisch kommentierten Ausgabe. Gertrud Kolmar (1894-1943), die neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit als Lehrerin, Erzieherin und Sekretärin arbeitete, ist hauptsächlich als Lyrikerin bekannt geworden. Sowohl ihre Prosa als auch ihre Theaterstücke wurden zu Lebzeiten nicht veröffentlicht. Gertrud Chodziesner wurde 1943 im Verlauf der "Fabrikaktion" deportiert und in Auschwitz oder auf dem Weg dorthin ermordet. Nach den Editionen ihrer Gedichte (2003, 2. Aufl. 2010), Dramen (2005) und Briefe (1997 und 2014) findet durch die Herausgabe ihrer eindrucksvollen Prosa die Veröffentlichung von Gertrud Kolmars Gesamtwerk im Wallstein Verlag ihren Abschluss. Im Roman "Die jüdische Mutter" geht es um ein kleines Mädchen, das einem Sittlichkeitsverbrechen zum Opfer fällt, um seinen Tod und die Konsequenzen für dessen alleinerziehende Mutter. In "Susanna" schildert Gertrud Kolmar eine psychisch gefährdete, faszinierende junge Frau, auf deren Leben eine Erzieherin zurückblickt. Im Nachwort werden Roman und Erzählung vor dem Hintergrund zeitgenössischer Diskurse über ledige Mütter, den Paragraph 218 und weibliche Sexualität reflektiert. In der vorliegenden kritischen Edition werden beide Prosaarbeiten der Dichterin erstmals in zuverlässiger Textgestalt abgedruckt und kommentiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gertrud Kolmar
Die jüdische MutterSusanna
Prosa
herausgegeben vonRegina Nörtemann und Thedel v. Wallmoden
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2023
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf,
unter Verwendung von Seite 74 des Typoskripts (Durchschrift)
von »Die jüdische Mutter«, Deutsches Literaturarchiv
Marbach/Neckar, A: Kolmar Prosa, Zugangsnummer 93.18.52
© SG-Illustration
ISBN (Print) 978-3-8353-3388-8
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4311-5
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4312-2
Inhalt
Impressum
Die jüdische Mutter
Susanna. Eine Erzählung
Anhang
Kommentar
Nachwort
Zeittafel
Bibliographie
Dank
Anmerkungen
Die jüdische Mutter
Erstes Buch
1
Der neunzehnte August abends. Es herbstete schon. Die dürftigen Straßenbäume gilbten und fröstelten. Der Sturm lief als großer, langstelziger Vogel dahin mit schwarzgrau mächtigen Flügeln und trieb den Regen in Schauern hinein zwischen die Reihen verschmuddelter ältlicher Häuser. Das Pflaster glänzte. Die Straßenbahn surrte rieselnd und spritzend bergauf. Am dunkelrot rußigen Backsteingebäude des Bahnhofs vorbei. Über die Brücke, von deren Geländer der Blick hinabsprang tief in den Schacht, mit seinem enteilenden, nicht zu fern sich verwirrenden Gleisgezücht wie eine Schlangengrube. Die muffligen Häuser fielen zurück. Nun schob zur Rechten des Wagens sich die Krankenhausfestung breit an den Damm mit rötlichen Mauern und eisernen Toren, mit Türmchen und wildweingepanzerten Wänden und einem Uhrblatt vergoldeter Ziffern über dem Hauptportal. Zur Linken schlossen die letzten Gärten des Villenortes sich ab, altfränkische Gärten mit wilden Büschen und Bäumen, mit Bauten, flachdächig, säulengeschmückt, lächerlich südlich, italienisch, und solchen im schottischen Burgenstil mit Stufengiebeln und Zinnen. Über pfleglosem Rasen glomm ein Hochstamm tief safrangelber Rosen, viele tropfenschwer hängend. Und wo jetzt die Bahn das Krankenhaus ließ, erstand eine Welt der Laubengelände, der Schrebergärten, die Vorstadtwelt mit den Namensschildern: »Kolonie Sonntagsfreud«, »Grünfelde«. Zwischen den einzelnen Siedlungen aber öffneten öde Strecken sich, spärlich mit Feldwuchs bedeckt und spärlich von niedren, dichtwipfligen Kiefern behütet, die unter blauem Himmel wohl Pinien einer Campagna vortäuschen mochten, doch im Wolkendüster nur, windgefegt, vom Nordwesten Charlottenburgs sprachen. Über die offene Drahtzauntür lief eine Inschrift: »Zum Roßkaempfer«. Da führte ein ausgetretener Pfad durch schütteres Gras unter splintrigen Birken zur Kneipe, die ganz am Ende des Grundstücks weißschmutzig, bröckelnd und ärmlich lag.
Die Straßenbahnhaltestelle. Ein einziger Fahrgast stieg aus. Eine Frau, großgewachsen, im schlanken schwarzblauen Mantel; sie zückte prüfend den Schirm. Es stürmte noch, regnete nicht. Sie ging ein paar Schritt auf der Straße zurück, die sie eben gekommen, und bog in den ungepflasterten Weg, der zwischen das Kolonistenland und die Roßkaempfer-Wirtschaft rückte. Nun folgten sich rechterhand enge Gevierte mit ihren Gemüse- und Erdbeerbeeten und, um die Lauben, zerrauften Büschen lila und roter Dahlien. Links war an der Gasse dem Roßkaempferbau ein wustiger Garten benachbart, ein Holzhäuschen, morsch, mit verschwemmten Lettern unter dem schrägen Dach: Villa Grazietta. Die Siedler wußten, daß die Grazietta einem Fräulein in Riga gehörte, daß nur jener alte, unwirsche Mann jetzt einsiedlerisch darin hauste. Nun aber stellte sich wie zum Hohn neben das brüchige, schiefe Staket eine hohe, starke gelbliche Mauer, deren Pfeiler das eiserne Gittertor hielten; der eine Flügel war festgerammt, der andere stand weit offen. Die dunkle Frau stutzte eine Sekunde und schaute umher; dann trat sie rasch in den Hof.
Der Hof war auch nur Sand ohne Pflaster und jetzt von Pfützen verschlämmt. Zwei Ahornbäume beschatteten ihn, verfinsterten wohl auch die Fenster des schmucklos grauen, mehrstöckigen Hauses, das dem Eingange gegenüberlag. Das einen Ellbogen bildete und mit seinem kürzeren Arm den Raum zum Grazietta-Garten hin abschloß. Nach der anderen Schmalseite rannte im Winkel die vordere Mauer herum, überspäht von den grünen Blätteraugen eines verwunschenen Parks. Denn es war eine große Besitzung, »Schloß Binnwald«, aus der einst – und niemand wußte den Grund – dies Rechteck herausgeschnitten worden; da hatte der Erwerber vielleicht ein früheres Kutscher- und Gärtnerheim zum Mietshause umgestaltet. Die dunkelgekleidete Frau wohnte hier in dem rückwärtigen breitern Gebäude. –
Sie zögerte. Sie stand, ihre Schlüssel schon zwischen den Fingern, stand wie in Staunen und blickte empor zur Regenrinne unter dem Dach und in das erfrischte, gesättigte Laub der Kronen. Jahre-jahrelang kam sie nun heim, stets wieder hingenommen von Diesem, was sie zum ersten Male betroffen, als sie die Gasse und hinter der Mauer das schweigsame Haus entdeckt, und was sie vermocht, über alle Mängel der Wohnung hinwegzugleiten. Dies war ein Klösterliches, der Friede, die Abgewandtheit, Abseitigkeit eines Stifts, etwas Träumendes, etwas Vergangnes, wiewohl das Bauwerk sein letztes Gesicht kaum vor der Jahrhundertwende erhalten. Solche Häuser liegen immer im Abend, und leise spiegeln die blassen Scheiben verschwelendes Untergangsrot. Nun aber waren sie düster. Die Frau ging hinein.
Die Frau stieg zwei Treppen hinauf und klingelte an einer Wohnungstür. Eine kleine freundliche Alte steckte den Kopf hervor, die weißen Haare sauber gescheitelt, die knochigen Backen wie Apfelwangen mit rotem Tupfen bemalt. »Ach, Frau Wolg!«
»Guten Abend, Frau Beucker. Ist meine Ursa da?«
Die Alte faßte nach einer dünnen silbernen Brosche am Kragen. »Die Ursel, nein, die ist nach der Laube. Mit meiner Anna und Elschen. Die haben den Guß wohl noch abgewartet, sonst wären sie schon zurück. Ich schick’ sie Ihnen gleich, wenn sie kommt.«
»Ja, bitte. Und hier, Frau Beucker, sind dreißig Pfennig, von neulich noch, für die Milch.«
»Das hätt’ auch noch Zeit gehabt.« Sie schob das Groschengeld in die Tasche der blau-weiß gestreiften Schürze. »Guten Abend.«
Das muntere Hutzelweibchen verschwand, die dunkle Frau kehrte sich, schloß gegenüber die eigene Wohnungstür auf.
Ein stockfinstrer Flur. Aber die Stube war hoch, war räumig, trug ohne jede Bedrücktheit und Enge das kräftige Mahagonibett in ihrer Mitte wie einen großen gebeizten Kasten, drin das Brot des Schlafes aufbewahrt wird. Ein gelblicher, in sich gemusterter Fransenwurf deckte es zu. Und seine Fülle lag hoch gewölbt, bis an die Kante der Fußwand fast, an die Kugelknäufe der Pfosten. Mehr noch vielleicht als das plüschgrüne Sofa, mehr als der Aufsatz am Spiegelschrank oder der Kachelofen gab dies Bett dem Zimmer sein altväterisches, etwas spießiges Ansehn. Es fehlte nur das perlengestickte fromme Grußwort über der Tür und ein gipsener Schillerkopf auf der Konsole. Dafür hingen zwei rötliche Photographien über der matten geblümten Tapete; das gerahmte Bild eines Mannes stand auf dem Nachttisch neben der Kerze. Und ein kleines nickelnes Kaffeegeschirr auf dem weißen Strickdeckchen glänzte.
Da war alles säuberlich eingerichtet, schön abgestäubt und ordentlich hingestellt, doch schaute dies kleinbürgerlich Geputzte so fremd auf die Frau, die hinging, Mantel und Hut an den Riegel hängte, die nassen Schuh streifte und wechselte. Denn sie war einfach, ganz unbewimpelt, wie sie vorm Schrank, vor dem Spiegel stand, den schweren, dumpfen Haarknoten löste in Nacht, ihn ballte und wieder im Nacken steckte. Dann blieb sie noch, blickte sich selbstvergessen in das große Gesicht mit den strengen Zügen, schlich den Querfältchen nach von der Nasenwurzel zur Stirn und anderen, die zu den Mundwinkeln krochen. Und plötzlich, von dieser Eigenbetrachtung wie von einer Unziemlichkeit überrascht und verletzt, wendete sie sich scharf, riß das nächste der beiden Fenster auf und jagte die eingeschlossene grämliche Luft zu den Winden. Und sah ihr nach. Der heimliche Park des Schlosses Binnwald langte mit seinen Ulmen empor, die schon dicht wurden, silhouettenhaft flächig und finster am schwächlich grauen gebückten Himmel. Fern irgendwo schwebte ein leiser Streif, ein zartes, verblichenes Rötlichgelbes, wie flüchtig, ganz absichtslos hingewischt. Das Laubgeäst rauschte zuweilen auf, und einzelne Tropfen schütterten, rasselten nieder: Gepladder, kleine Trommelmusik. Und aus einem Röhrchen floß unaufhaltsam sickriges Spieldosenklingen. Goldschnäblige Amseln huschten umher, doch sangen sie nicht in den Abend mehr die Lieder aus schwarzem Sammet. Sie waren lange verstummt.
Die Frau im Dämmer hatte sich schon vom Fenster gewandt; sie hob den Fransenbehang vom Bette und faltete ihn, sie raffte Kissen und Decken und legte sie auf das Plüschsofa hin und machte ein Nest, ein kleines Lager. Dann ging sie über den Flur in die schmälere Küche, verquirlte, weil es nicht lohnte im kalten Herd noch ein Feuerchen anzufachen, auf dem Spirituskocher Milch und Grieß, strich ein paar Butterstullen zurecht und lauschte hinaus in den Hof, als Stimmen und Schritte aufflackern wollten.
Ein dünnes, schüchternes Klingeln. Sie öffnete. Zwei junge Ärmchen wuchsen im Dunkeln um ein rundes Gesicht, das feucht und kühl und süß wie die Erdbeere war. Sie beugte sich hin und küßte es, undeutliche Worte murmelnd; ihr ernster, fast harter Blick verfiel und lächelte, nur eine Sekunde. Die Kleine trippelte mit ihr herein, kroch auf den Stuhl am Küchentisch, ließ sich den Pichel binden, lag mit dem Löffel hungrig im Brei und erzählte.
»Du, Mutter. Wir haben Rüben gezogen. Elschen hatte eine, die kriegte sie gar nicht ’raus. Und ich hatte eine, die war doppelt, mit zwei Beinen, so wie ein Mann. Frau Lange sagt, ich kann sie behalten. Aber wir haben alles in ihren Korb getan, und nachher haben wir dran vergessen. –
Mutter?«
»Ja?«
»Hast du Hunde pho-to-graphiert?«
»Heut nicht.«
»Und gestern?«
»Auch nicht.«
»Und vorgestern?«
»Ja.«
»Was für Hunde?«
»Nur einen. Einen deutschen Schäferhund.«
»Ist der hübsch? Wie heißt der?«
»Vera.«
»Wehrer? So heißt er wohl, weil er sich wehrt?«
»Nein, Ve-ra. Das ist ein Mädchenname. Wie deiner. Wie Ursula.«
Das Kind sah besinnlich aus, die Zunge spielte zwischen den Lippen wie oft, wenn es etwas auf einmal nicht schluckte, erst Zug um Zug in sich sog.
»Sag’ mal, Mutter. Mäuse, das sind doch ganz kleine Hunde. Bei Frau Lange war eine Maus in der Laube.« – »Ein scheußliches Biest,« setzte sie plötzlich in tiefem Brustton hinzu, vermutlich so wie Frau Lange das sagte. »Elschen sagt aber, sie ist nicht scheußlich.«
»Und du?«
»Ich sag’ auch, sie ist gar nicht scheußlich. Tote Katzen sind scheußlich. Wir haben mal eine gefunden. Erich dachte, die hat einer ersäuft. Sie war noch ganz naß und angeklatscht …puh!«
Die Mutter schob ihren Stuhl zurück. Sie war nicht zimperlich, scheute sich nicht, auch nach dem Essen die Schildrung zu hören, ihr würgte kein Ekel die Kehle; aber die Teller standen nun leer, sie hitzte den Kessel, wusch das Geschirr und räumte und stökerte noch eine Weile in Küche und Stube herum. Und das Kind umhüpfte sie wie ein Flämmchen, das bald doch erlöschen soll. Dann nahm es sein bißchen bescheidenes Spielzeug, die Tiere, die Klötze, das Schiff aus Zeitungspapier und streute das alles über den mürben Teppich vorm Schrank und packte gleich wieder ein, weil es schlafengehn mußte. Denn hier gab es kein Betteln und Maulen, kein Trödeln wie anderswo, da die Kleinen durchaus noch aufbleiben wollen; wenn Mutter zur Ruhe ging, konnte das Kind nicht in die Nacht hinein spielen. Ab und zu war es freilich auch ungehorsam, dann pflegte die Mutter sich zu entkleiden, schweigend, ohne Geschelte, und es kam der gefürchtete Augenblick, da sie sagte: »Jetzt mach’ ich dunkel.« Und immer bat zuletzt, schuldbewußt, der zarte, ängstliche Mund: »Mutter …?« – »Ja?« – »Zieh’ mich doch aus.« Nun äugte es schon vom Nest auf dem Sofa wie ein winziges Blumenmädchen aus weißer Rose im grünen Laub, hinüber zu ihr, die neben dem sanften, runden Licht der Petroleumlampe noch saß, seine Strümpfe stopfte. Es blinzelte, als sie ihr Kleid auf den Bügel hängte, nach Lappen und Seife griff, es schläferte schon; doch wie ein Gesättigter mit der Gabel die letzte Krume noch spießt, um ja nur den Bissen nicht zu vergeuden, so wollte es auch von der Helligkeit kein Tittelchen übriglassen und hielt die sperrigen Augenritzchen noch immer gewaltsam auf. Und sah, wie die Mutter nackt durch das Zimmer schritt, das Nachthemd entfaltete und über den Kopf warf; sie hockte auf dem Bettrande nieder und flocht ihren dicken Zopf. Und plötzlich fragte es mit seiner langsamen, träumenden Stimme:
»Mutter. Sag’ mal. Bist du eigentlich schön?«
»Warum …?«
»Weil Elschen …« Es ermunterte sich. »Elschen hat mal gesagt, du bist nicht hübsch, und Erich hat auch gesagt, du bist häßlich. Aber Otto, der ist älter wie wir, der lernt schwimmen, weißt du, der hat gesagt: ihr seid dumme Affen, deine Mutter ist sehr schön.«
»So.« Die Mutter stand auf und reckte sich, sie schien sehr groß in dem langen, bleichen Gewande. »Das kommt darauf an, Ursa, wie du mich findest.«
»Ich finde, du bist schön.« Ein wenig müde, doch überzeugt klang es.
»Dann ist es ja gut, dann bin ich’s. Komm beten.«
Sie falteten beide die Hände.
»Lieber Gott, ich bitte Dich,
Gut und fromm laß bleiben mich;
Schenk’ mir nachts ein Sternelein,
Tags Deinen hellen Sonnenschein.
Amen.«
Noch einmal strich ihm die Mutter leicht über das Haar und die Kissen. Sie trug die Lampe fort, löschte sie draußen und tappte im Finstern zurück.
»Mutter, bist du da?«
»Ja, Ursa.«
»Bist du auch schon in deinem Bett?«
»Ja.«
»Gute Nacht, meine liebe Mutter.«
»Schlaf wohl, liebes Kind.«
Sie lag aber, schlummerlos noch, die Hände unter dem Nacken, sie fühlte Schwärze aus Stubendecke und -wand in ihre Augen rinnen und schloß die Lider erst, als von drüben ein tiefer, klarer, gleichmäßiger Atem zog.
2
Martha Jadassohn kam mit den Eltern aus einer kleinen westposenschen Stadt, mochte sie Bomst oder Meseritz heißen, nach Berlin, wo des Vaters einzige Schwester verwitwet hauste. Sie war das jüngste und letztüberlebende Kind der Alten und führte ihnen seit Schulabgang den bescheidenen Haushalt: die tuntlige Mutter schaffte wohl auch noch, kochte; ein Dienstmädchen hatten sie nicht. Sie lebten still; außer der Tante kam selten Besuch, und sonst ging man nirgendwo hin. Denn das Ehepaar, das sein Lebtag Friedsamkeit und Beschränkung gewohnt, fand in der weiteren, wilderen Stadt sich immer ein wenig verschüchtert. Sie waren nicht mißtrauisch, beide, und dachten nicht ihr Kind vor dem Umgang mit jungem Volk zu behüten; aber wo sollte die Tochter junge Leute auch kennen lernen? Sie traf nicht wie andre mit ihnen auf Festen oder beruflich zusammen und hatte dies starr geschlossene, abweisende Gesicht nicht bloß dann, wenn einer im Hausflur, vorm Laden mit ihr ins Gespräch kommen wollte. Ob sie mit ihrem Lose, mit ihrer Arbeit zufrieden sei, fragte und wußte niemand; sie fegte wortkarg die Stuben, saß an der Nähmaschine, vertrieb ihre freie Zeit mit einem Buch oder ging ein, zwei Stunden ganz allein durch entferntere Straßen spazieren. Bei Sommerwetter mochte sie auch mit den Eltern in einer Anlage hocken, dann schritt sie wohl zum Bahnhof hinüber und schaute ein Weilchen mit seltsamen Augen zu den ein- und ausfahrenden Stadtbahnzügen empor. So fand sie die letzten der zwanziger Jahre und kannte noch jämmerlich wenig von dem, was die Menschen Erlebnis nennen.
Es hatte hier wie in anderen Häusern nach dem Kriege ein Mieterrat sich gebildet. Nun ward eine Sitzung anberaumt, um vor allem die Frage der Kohlenbeschaffung und des abendlichen Torschlusses zu regeln. Marthas Vater, schon damals von einer Krankheit gepackt, die ihn später erwürgen sollte, lag zu Bett und verzichtete ungern darauf, in der Sache mitzubestimmen. Und da die Mutter sich selbst im Herzen zu ungewandt, zu tüterig war, sich fürchtete, vor einem Dutzend Menschen eine Rede halten, ihnen gar widersprechen zu müssen, so wurde ihre erwachsene Tochter als Abgesandte geschickt.
Die Versammlung tagte im Heim des Großhändlers Wolg, eines gebildeten und offenbar wohlhabenden Mannes. Des Großhändlers Sohn, Ingenieur Friedrich Wolg, sah Martha Jadassohn, die er zuweilen flüchtig gegrüßt und kaum angeblickt, heute so recht zum ersten Mal und hörte sie ruhig und knapp, mit Entschiedenheit, mit gesichertem Willen reden. Sie zeigte sich vorteilhaft vor ein paar Damen, die sehr erregt durcheinanderschwätzten, vom Hundertsten ins Tausendste kamen und deren Meinungsbegründung sich immer in kleine Anekdoten verlor. Er trat sogar mit ihr ins Gefecht, da er als Schildknappe seines Vaters vorsprang, und benützte das, sie am nächsten Tag vor dem Hauseingang anzusprechen. Dies war der erste Griff, und nun rollte das Weitere sich ab wie ein Knäuel, von dem eine Hand den Fadenanfang gefunden.
Der alte Wolg stellte sich feindlich. Ihm, seiner jovialen, behaglichen Art, mißfiel das herbe, schweigsame Mädchen; er nannte sie einen Trauerlappen und kalt. Sie paßte ihm auch als Jüdin schlecht und als unbemittelte Jüdin schon gar nicht. Dem Sohne hielt er besonders vor, daß sich seine Frische und Lebhaftigkeit an solcher Frau auf die Dauer stoßen, sich abstumpfen müßte. Daß diese Strenge, die dem Verliebten als Jungfrauenscheu, Unberührtheit erschien, mit der Hochzeit nicht absterben würde und nur das Weib hinderte, dem Manne Kameradin und Freundin zu sein. Er könnte fast ebenso gut ein antikes Steinbild ehelichen. Wir leben im zwanzigsten Jahrhundert, nicht in Jakobs Zeit. »Alttestamentarisch sieht sie schon aus; sie müßte Lea, nicht Martha heißen. Sekt auf Eis, meinst du? Glaub’ ich nicht. Eis schon: ein ganzer Klumpen. Jerusalem am Nordpol. Sie ist stärker als du, das spür’ ich, bloß wenn ich sie sehe. Und wenn du mal anders willst als sie: die duckst du nicht. Entweder du reißt aus, oder sie bricht dich in Stücke. Ohne Gnade.« Die Warnungen halfen nicht viel.
Martha nun liebte Friedrich Wolg eigentlich wider Willen; es dünkte ihr erst Verworfenheit, überhaupt an einen Christen zu denken. Die Eltern fragten nicht, wußten genug, seit sie der Ingenieur ein paarmal unter dem nichtigsten Vorwand besucht und stundenlang mit Mutter und Tochter zusammengesessen. Und eines Morgens winkte der Vater das Mädchen mit kraftlosem Flüstern her; die Mutter horchte bekümmert im Winkel. Er hätte nichts dagegen. Ein Glaubensgenosse wäre ihm lieber gewesen, ja. Doch er hätte auf seinem Krankenbett sich die Dinge so durch den Kopf gehn lassen und sähe manches nun anders ein als bisher. Sonst ließe sich ja an dem jungen Manne nichts tadeln. Und die Wolgs wären reich und die Zeiten hart, und er wüßte gern sein Kind gut versorgt vor dem Scheiden. Eine Woche drauf starb er.
Hans Wolg betrachtete diesen Todesfall als besonderes Unglück für seinen Sohn, der, wie er vor seiner Gattin schalt, »alle Augenblicke« nach drüben schlich, »um die weinenden Hinterbliebnen zu trösten.« Er änderte seinen Kriegsplan jetzt, um, was ihm der offene Kampf versagt, mit Listen und hinterrücks zu gewinnen. Er wußte, daß Friedrich wie er selbst zu den Sanguinikern zählte, deren Gefühl große Stärke hat, aber geringe Dauer. So nützte er gute Beziehungen aus und schickte den Toren vorerst nach England, auf ein paar Jahr, wie er hoffte. Dort würde er andere Weiber genug zu sehn und zu schmecken bekommen, und dies Funkelfeuerchen für die eine würde aus Mangel an Nahrung zuletzt sehr sicher und sänftlich sterben. Die Rechnung wäre wohl richtig gewesen. Zu früh nur, schon nach einem halben Jahre, kehrte Friedrich zurück und schien nun vernarrter denn je. Er hatte, obschon er seiner Braut im Abschiedsschmerz die Treue versprochen, durchaus nicht den Mönch gespielt, pflegte sich aber vor dem Alten sehr abfällig über die britische Schönheit zu äußern, über die Fadheit, dieses Gelabber, Milchbrei mit Himbeersaft. »Wenn ich Blauaugen will und blondes Haar, brauch’ ich bloß in den Spiegel zu gucken.«
Es glückte ihm schließlich auch, die Mutter um günstigen Wind zu bitten, und sein Vater, der eben so eisern war, wie Wetterhähne es sind, drehte sich widerwillig und knarrend nach der erwünschten Seite. Aus Martha Jadassohn ward Martha Wolg; sie wirkte still und gefaßt; Friedrich war heftig verliebt und glücklich.
Die Enttäuschung kam bald. Wenn auch der junge Ehemann, um seinen Warner Lügen zu strafen, den Irrtum nicht zugeben mochte. Doch meinte er schon in der ersten Zeit einmal zu Martha, spottend: »Ich habe eigentlich gar keine Frau, nur eine Geliebte.« Er sprach wahr. Denn sie lebte mit ihm nur in einer Gemeinschaft der Nächte; er nannte sie lächelnd Vesuv oder Ätna und Krakatau, weil ihre Umarmung den Ausbrüchen scheinbar ruhigen, heimlich glimmenden Kraters glich. Später freilich ermüdete, plagte ihn fast der jähe Wechsel von Kälte und Hitze. Und das Wesen, das er bei Tage kannte, bedrückte und langweilte ihn. Daß sie von seiner Arbeit wenig verstand, obwohl sie aufhorchen und ja sagen mochte, konnte er schon verzeihn; ärgerlicher war, daß sie kaum eine seiner Neigungen teilte. Sie wollte nicht paddeln mit ihm, nicht auf dem Motorrad sitzen, und an dem Rundfunkgerät im Eck blieb meist er der einzige Hörer. Ging er ins Kino, ins Kaffeehaus oder auch nur zu Bekannten, so fand sie stets einen kurzen Grund, einsam daheim zu bleiben. »Das ist doch alles ganz angenehm,« überredete er sich selbst, »ein bequemeres Eheweib könnt’ ich mir gar nicht wünschen.« Er empfand es nicht so. Es war ein Seltsames da, ein Fremdes, etwas … er suchte um den Namen dafür.
Dies vielleicht, daß sie aus anderem Blut, daß sie Jüdin war. Sie hatte aber die Sitten und Bräuche ihrer Ahnen nicht mitgebracht, feierte keinen Freitagabend und dachte niemals daran, in den Tempel zu gehn. Sie ließ ihren Glauben doch nicht. Denn er war ihr nicht angezogen so wie ein Kleid, das man auswachsen oder verschleißen und leichthin abwerfen kann, sondern war mit ihr geworden wie eine Haut, verwundbar, doch unverlierbar, unlöslich. Friedrich empfing ein Zeichen davon; so kam es zu ihrem ersten knappen Zerwürfnis.
Sie machten zusammen Einkäufe in der Stadt. Und die schwangere Frau stand still vor einem Wäschegeschäft, betrachtete einen Augenblick die zierlichen Kinderröcke und -jäckchen. Er nickte zum Schaufenster hin: »Das da, das wäre ein nettes Kleidchen, wenn unsers ein Mädel wird – ein Taufkleidchen …«
Sie drehte sich, wendete schwerfällig sich nach ihm um und sprach wie in ungemeßnem Erstaunen:
»Taufkleidchen? Unsere Kinder werden doch nicht getauft?«
Er murmelte: »Ich dachte …«
Sie entgegnete ruhig: »Du hattest mir etwas versprochen, das weißt du.«
Er zuckte die Achseln. »Es fragt sich, ob solch ein Versprechen mich binden würde. Ich hab’ mal darüber gelesen –«
Ihre Stimme war kalt. »Es ist ganz gleich, was du drüber gelesen hast. Wenn du dein Versprechen nicht halten willst und den Pfarrer aufhetzt –« sie unterbrach sich: »Es ist unnütz zu drohn, wenn man noch nicht weiß, was man tut. Aber bedenke,« sagte sie leise, »daß unser Kind noch in mir ist, in meinem Schoß und daß du es, wenn es geboren ist, nicht mitschleppen kannst in deine Fabrik und daß ich es, wenn du es mir auch nimmst, überall finden werde.«
Sie schritt einsilbig neben ihm her. Er plänkelte noch vor dem Rückzug ein wenig, in die Luft hinein; denn sie wehrte ihm nicht. Sie siegte.
Seine Eltern waren empört; besonders der Vater gebrauchte kräftige Worte. »Eine Jüdin … Sie sollte froh sein, wenn ihr Balg christlich erzogen wird.« Friedrich schien ganz verstört. »Ich bitt’ euch um eins, zankt bloß nicht mit ihr, laßt sie in Frieden. Ihr kennt sie nicht. Sie ist imstande und tötet das Kind; das ist eine Medea!« »Megäre,« brummte der Vater. Die Mutter aber schaute den Sohn nur mitleidig an und seufzte.
Martha brachte das Kind zur Welt und stürzte sich drauf, einer hungrigen Wölfin gleich, wie die Schwiegereltern das nannten. Es war ja ihr Kind, nur das ihre. Als hätte bei seinem Entstehen des Vaters Helle mit dem Dunkel der Mutter gekämpft und ihr Finsteres hätte sein Lichtes zuletzt erschlagen und aufgefressen. Ursulas Auge und Haar waren nächtig, die Haut war gelblich, fast braun, klang tiefer noch als der Elfenbeinton im mütterlichen Gesicht. Und auch ihre Züge verrieten von Friedrich Wolg nichts. Ihn freute natürlich das kleine Geschöpf, doch wurde sein Vaterstolz bald gedämpft, da es ihn gleichsam mit winzigen Fäusten aus Marthas Leben verstieß. Sie dünkte ihm oft eine Wilde jetzt, die er gewaltsam im Käfig hielt, die nur trachtete auszubrechen. Trat er zu ihr, sie hatte das Kind an der Brust, so sah sie ihn wortlos an mit fremdem unheimlich flackernden Blick wie eine Tiermutter, die um ihr Junges zittert. Nie stritt sie mit ihm, sie quengelte nicht; meist schob sie ihn ohne viel Wesens beiseite wie ein Ding, das man gerade nicht braucht. Und wollte er trotzen, doch vor ihr gelten, so baute sie sich eine Zauberwand, in die seine Hacke sauste. Die Wand wich zurück, der Schlag fiel ins Leere, sein Arm schmerzte nur, und sie stand unversehrt, wo sie sich vorher getürmt.
Einmal traf Martha ihn unterwegs mit einem hübschen Mädchen, einer jungen Angestellten des Werkes, das ihn beschäftigte. Da schwieg sie. Er wollte sich rechtfertigen. »Es ist nichts, du kannst mir glauben.« Es war wirklich noch nichts. Martha sagte gelangweilt, träge:
»Laß. Ich hab’ mich ja nicht beklagt.« Er haspelte weiter; sie fegte die Krümel vom Tisch. Gleichgültig: »Gut.« Er ertrug diese Art nicht mehr. Er tat, was sein Vater ihm prophezeit, und entfloh. Nach Amerika rückte er aus. Fast ein Jahr blieb er fort, kehrte heim als Schwerkranker und starb. Seine Eltern zürnten der Schwiegertochter, die ihren Sohn vertrieben; in der Heimat hätte er, meinten sie, noch ein langes Leben geführt. Und sie gaben ihr insgeheim die Schuld an seinem frühen Tode.
Martha stand unsicher auf der Welt. Von dem Manne hatte sie nichts geerbt, von ihrer verstorbenen Mutter sehr wenig. Die alten Wolgs liebten sie nicht. Aber es sollte sie niemand verschrein, daß sie die kleine Enkelin hungern ließen. Und fremde Augen, die Friedrichs Ehe nur immer als glücklich gekannt, brauchten auch jetzt noch nicht zu sehn, daß sie anders beschaffen gewesen. So schanzte Hans Wolg die berufslose Witwe der Frau Hoffmann als Lehrling zu. Und Martha zeigte, fast wider Erwarten, sich so gewillt, so begabt, daß, als die Gesellenzeit auch vorbei, die feine alte Dame sie sich zur Mitarbeiterin wählte. Ihre besondere Meisterschaft erwies sie als Tierabbildnerin, ja, sie führte die Tieraufnahmen bei Lydia Hoffmann erst ein. Ein junger Neufundländer, den sein Herr nur zufällig mitgebracht, gab den Anfang; bald ward es Sitte im reichen Westen, die Schoßhunde und Angorakatzen, die Äffchen und Papageien von ihr photographieren zu lassen. Gelegentlich ging sie den kurzen Weg von der Werkstatt zum Zoologischen Garten, um dort für eine Zeitschrift vielleicht die heiligen Rinder zu knipsen. Zwischen ihr und der Wolgfamilie indes schliß das mürbe Band immer mehr, so daß es ohne hörbares Knacken eines Tags vollends zerriß. Und Ursa bewahrte kaum ein Erinnern an ihre Großeltern auf; was die Mutter ihr bot, waren schmuddlig-blasse, unansehnliche Bildchen nur, und sie fragte selten nach ihnen. –
Martha, damals noch ungewiß, wie das Schicksal sie ducken würde, hatte die teurere Neubauwohnung mit einer billigen, kleinern vertauscht, fand Stube, Kammer und Küche genug, auch als ihr der Mut und der Beutel sich strafften. Eine eigene Wohnung, Altwohnung, schien hoher Besitz, selbst wenn sie ganz ohne Bequemlichkeit war, ohne Dampfheizung, Gasherd, elektrisches Licht und »halb aus der Welt«, wie Frau Hoffmann meinte. Flurnachbarn waren Herr Otto Lange, Magistratssekretär, Anna, die Frau, Elschen, die Tochter, ein auffällig hinkendes kleines Mädchen, und Frau Beucker, die Schwiegermutter. Und eines Morgens, als Martha ihr Kind, wie sie’s gewohnt, in den Hort bringen wollte und eben die Tür von draußen verschloß, guckte Frau Beucker aus ihrer Höhle und trug ein Anliegen vor. Die Ursel hätte sich doch schon so gut mit ihrer kleinen Else befreundet, und ob sie nicht dableiben könnte. Sie hätte, Frau Beucker, Zeit genug, sich um die beiden zu kümmern, und auf einen Löffel Suppe zu Mittag käme es auch nicht an. Und das Wetter sei heute doch schauderhaft, richtig zum Schnupfenholen. In der Folge ward Ursula Tag für Tag bei Frau Beucker in Kost und Pflege gegeben, die räumte auch Zimmer und Küche klar und empfing von Frau Wolg für das Liebeswerk allwöchentlich ihre Vergütung.
3
Sie stand auf dem Damm, auf der steinernen Insel, erwartete ihre Bahn.
Das Pflaster bleichte ein glühender, wolkenlos blauer Himmel. Unendlich sausende Automobile wirbelten goldenen Staub. Die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche schien mit ihren Türmen Silvesterbleiguß, der bald in der Hitze schmolz. Und all diese flirrenden Kinder und Frauen hatten nach häßlichen Regentagen das schönste lichteste, zarteste Kleid noch einmal hervorgeholt und wehten und schimmerten. Ein junges Weib steuerte durchs Gedräng den grasgrünen Kinderwagen; hoch über seinem Verdeck tanzte ein seliger Luftballon, rosa mit silberner Mühle. Dort in den pelargonienbehängten niedern Veranden der großen Cafés tranken die Gäste ihr Schälchen Mokka, ihren Becher Eisschokolade. In das Löwentor des Zoologischen Gartens rann unerschöpflicher Menschenstrom, und mancher, dem Geld oder Muße fehlte, hing doch für Sekunden am Gitter fest, um, vor seinem indischen Tempel wandelnd, den Elefanten zu schauen. Ach ja, dachte sie, ich wollte mit Ursa doch wieder einmal zu den Tieren gehn, ich hatte es ihr versprochen. Ich hätte mich mit Frau Beucker verabreden sollen. Sie hätte das Kind in die Bahn gesetzt, und ich hätt’ es hier abgefangen. Nun, morgen vielleicht, wenn das Wetter nicht umschlägt. Ihr Wagen kam, sie stieg auf. –
Als sie bei Langes klingelte, öffnete ihr der Beamte selber, ein schmaler, kleiner, milchiger Herr mit dünnem fahlblonden Haar. Er wunderte sich ein wenig. Spielten nicht Ursel und Elschen im Hof, vorm Tor mit den anderen Kindern? Sie hatten ihn doch erst eben begrüßt beim Kommen. Martha dankte, betrat ihre Wohnung, leerte das Einkaufsnetz, tat den Hut vom Kopfe, richtete dies und das, entschloß sich, da draußen die Bläue lockte, noch einmal hinunterzugehn und ihre Ursa zu suchen. Weit konnte sie ja nicht sein. So, zwischen der Mauer des Schlosses Binnwald und Laubenfleckchen, stieg sie ins Spreetal hinab.
Sie blickte über die Gärten. Im Osten tief schwamm ein falber taubenfarbiger Streif. Und in diesen späten Nachmittag, in diesen frühen Abend leuchteten Blumen wie überspült von der reinen, durchsichtigen Luft. Schwarzpurpurne Dahlienbüschel, orangene Tupfen Studentenblumen, honiggelbe, rahmweiße Gladiolen, Naschkelche für Hummeln und Bienen, die auch der Goldraute Sprühwedel noch vereinzelt umsummten, die prallen, steifgetragenen Köpfe des Goldballs Rudbeckia. Selbst das wüste Nesselgestrüpp an den Zäunen wies freundlicheres, sauberes Grün. Und überall vor den Lauben, den Buden mühten sich Leute, stützten die schweren Tomatenpflanzen, nahmen die faulen, die reifen Früchte, gruben das Bohnenbeet um und sammelten unter den kleinen Bäumen spärliches Fallobst auf. Bisweilen noch, aus dem Traum gescheucht, irrte ein weißer Falter fort, liebend zitternde Seele.
Martha hatte durch Maschengeflechte immer nach ihrem Kinde gespäht, aber das Grauröcklein nirgends entdeckt, noch sein warmes, schon dunkelndes Stimmchen vernommen. Nun war sie im Grunde, vom flachen Ufer nur durch den Schienenstrang getrennt, der die träg ihre Zillen schleppende Spree ein Wegstück begleitete. Sie stand und schaute umher in der Landschaft, die Frau Hoffmann nach einem Sonntagsbesuch »Deutsch-Nordwestafrika« und »Neu-Kamerun« taufte. Denn wirklich war dies eine Welt des Werdenden, des Unfertigen, der Gegensätze: auf unwirschem Wüsten- und Steppengebiet ungeregeltes Bauen. Weit droben guckten jetzt ängstlich und klein die Lauben von ihrem hohen Berge, des Abhang als eine riesig kahle, steile Sandlehne fiel; auch hatte, wer irgend Sand gebraucht, ihn stellenweis ausgeschachtet. Und dort wieder fraß sich als ekles Geschwür der Schutthaufen ein, der Müll: Porzellanscherben, löchriges Kochgeschirr, Pappe, verschimmelte Lumpen. Aus baumloser Einöde jenseits des Flusses stieg eine große rote Fabrik jäh in vergehenden Himmel; weiter vorn aber ruhte, dörfliches Bild, ein Alter im üppigen Ufergras und weidete seine Ziegen.
Martha überquerte das Gleis neben Stellwerk und Schranke, erblickte ein kleines blondzöpfiges Mädchen, das mutterseelenallein am Strand auf dem schmalen Wiesenstreif hinkte; es trug ein kindliches Fischfanggerät, aus Stock und Schnur und verrostetem Marmeladeneimer gefertigt. Nun stand es still, schrie über die Flut in der Richtung des lagernden Ziegenhirten, doch ohne Erwiderung wohl. Ach Gott, dachte Martha Wolg. Ich hab’ ihnen nun schon so und so oft und Frau Lange hat ihnen auch verboten, ans Wasser zu gehn. Es nützt aber nichts. Und wenn eins abrutscht, kommt keiner zu Hilfe, hier ist es so menschenleer. Wenn Ursa ertrinken müßte … Sie schloß die Augen. Dann rief sie. Die Kleine stutzte, schleifte sich her, gab die Hand und knickste.
»Hör’ mal, Elschen. Also erstens: ihr wißt doch und könnt es euch endlich merken, daß ihr jenseits der Schienen nicht spielen sollt. Wenn ihr ins Wasser fallt, zieht euch niemand ’raus. Der Hirt da drüben springt dir gewiß nicht nach. Und zweitens: wo ist denn Ursa?«
»Ursa?« das Kind sah verdutzt sich um, als ob es in diesem Augenblick erst die kleine Freundin vermißte. Dann fiel ihm ein:
»Die ist doch mit Max und Erich gegangen.«
»Wohin denn?«
»Dahin.« Es streckte den Arm. In geringer Entfernung zeterte Jungensgeschrei, sehr gell im abendlichen Verklingen. Martha schritt rasch darauf los; Elschen folgte langsam und neugierig, ungewiß, ob sie mitkommen sollte.
»Welcher von euch ist nun Erich und welcher ist Max?«
Ein Knirps trat vor.
»Du bist Erich?«
»Ja.«
»Und wo ist Max?«
»Der … der ist weg … nach Hause.«
»Sag’ mal, ihr habt mit der Ursula Wolg gespielt, wo habt ihr die denn gelassen?«
»… mit der Ursula Wolg …?«
»Der Ursa, ja. Ich rede doch deutsch? Wo ist die?«
»Die … die wird wohl zu Hause sein, der Mann hat sie doch gerufen.«
Der Mann? In der Herzuhr knackte ein kreisendes Rädchen, setzte aus, eine Sekunde nur. »Was für ein Mann?«
»Ich weiß nicht, ich kenn’ ihn nicht.«
Er entgegnete lümmelhaft patzig jetzt, über die grobe Störung verdrossen. Sein Kamerad hielt den braunen Fußball schon steif in erhobenen Händen, ihn zu schleudern, wenn dieses lästige Weib sich endlich davonmachen wollte. Sie drehte sich nicht.
»Nun komm mal – komm hierher und erzähle, ordentlich hintereinander. Das ist sehr wichtig.«
Kinder fühlen sich gerne wichtig und wesentlich, Hauptpersonen, und so fand Erich gleich selbst Gefallen an seinem Vortrag, der Schilderung, da nun auch die Gefährten sich aufmerksam zuhörend um ihn scharten. Er wäre mit Max und Ursa vorhin auf dem Sandberg herumgeklettert, da sei von oben, er zeigte den Weg, plötzlich ein Mann gekommen, der hätte immer gerufen: Ursel! Ursel! und dann: Komm her, komm gleich, du sollst mal zu deiner Mutter! Ursa hätte gezögert; sie meinte: Das ist ja ein fremder Mann. Aber Max ermahnte: So lauf doch schon, du hörst, deine Mutter sucht dich. Da wäre sie schließlich hingestapft und mit dem Mann mitgegangen.
Er stand, seine ganze Gesellschaft stand und starrte die Frau an, was sie nun sagen würde, was da so wichtig hieß. Und keins vernahm, weil sie Kinder waren, daß sie schon sprach, als ihr großes Gesicht einen Schein blasser wurde, als ihre Hand sich krampfhaft schloß, daß die Nägel sich in die Handfläche bohrten, sich der Mund wortlos öffnete, Atem zog und wieder zusammentat, schnappend fast wie ein Fisch auf dem Sand mit den meerfernen, unverstehenden Augen. Und die Frau sagte:
»Wie sah der Mann aus?«
»Ich weiß nicht, ich hab’ ihn nicht angeguckt; er hatte ’ne Mütze auf, glaub’ ich. Vielleicht hat Max –«
»Wo wohnt Max?«
»Max Hinnes? Der wohnt in der Villa bei Fellenbachs … dem sein Vater ist Gärtner.«
»Und wo ist die Villa?«
Ein Junge, der älteste wohl von allen, bot sich gönnerisch an: »Ich werd’ mitgehn. Ich zeig’ sie Ihnen.«
Sie nickte. »Gut.« Die andern beratschlagten in Hast, ob sie sich anschließen sollten, erklärten sich aber nach kurzem Getuschel für Bleiben und Weiterspielen.
Es war jener Garten. Mit dem ergrauten römischen Hause, dem Rasen voll wilder Blüte, mit dem mächtigen Hochstamme glimmender tief safrangelber Rosen. Das schmale Gittertor schien versperrt; aber der Bursche kannte den Pfiff, es auch von draußen zu öffnen. Durch einen Hintereingang stiegen sie ein, zwei Stufen zur Gärtnerwohnung hinab.
Sie klopften. »Herein.«
Eine Küchenstube, niedrig und vollgepfercht, von vergitterten Fenstern düster. Der Gärtner, ein großer sehniger Alter in Hemdsärmeln, mit nackter struppiger Brust, erwiderte den Gruß und fuhr auf; er schien hier die meiste Lebensart zu besitzen. Die Frau und zwei erwachsene Töchter saßen weiter so flätzig, so plump und breit und brotkauend da und stierten die Eindringlingin an, böse, fast knurrig, wie Hunde, die man beim Fressen stört. Eine grüne Gurke lag im Papier, und ein Paar leerer Bierflaschen stand auf dem Tische. Max, der Spätling, kroch aus dem Eck und wurde von seinem Vater selbst einem knappen Verhör unterworfen. Es brachte nichts Neues zutag. »Na, wollen wir hoffen, daß sie sich doch noch anfindet,« brummte der Alte, der Meinung wohl, daß er ihr wie einer Leidtragenden etwas Tröstliches sagen müßte. In den rohen Zügen der Weiber jedoch stand unklar zu lesen: Macht die ein Gewese um ihre Göre! Sie soll schon gehn. Sie ging.
Martha ging und der Gärtner begleitete sie, da, wie er die unnütze Höflichkeit vor seinem Weibe bemäntelte, er vorn sowieso zuschließen wollte. Sie schwieg. Und fragte plötzlich, als gäb’ es für sie nichts Näheres auf der Welt und so von sich selber überrascht, als ob eine Fremde spräche:
»Die Rose … wissen Sie, wie die heißt?«
»Die gelbe da? ›Melodie.‹ Es schreibt sich aber mit einem Ypsilon am Ende.«
»Melody,« wiederholte sie leise. Und fühlte: Meine Ursa war eine dunkelgelbe Rose. »War?« dachte sie zitternd, »war …? Mein Gott, sie ist ja, sie lebt ja doch! Ich weiß es – ich will es wissen!«
Sie stürzte über den Damm. Und diese scheue, strenge Frau rief Menschen zur Tür und an den Zaun ihrer kleinen Laubengelände; sie lehnten den Spaten, die Hacke hin, setzten den Eimer nieder, dienstbereit oder widerwillig, neugierig oder gelangweilt. Nein, sie hatten gar nichts gesehn, sie waren erst eben gekommen. Nein, sie hatten Erdbeern gepflanzt und sich um sonst nichts gekümmert. Ja, ein Mann war vorbeigegangen mit einem kleinen Mädchen. Mit einem blonden im blauen Kleidchen, nicht wahr? Martha sank das Herz. Wie eine blinde Bettlerin war sie. Sie tastete, streckte die Hand: hier nichts und dort nichts, und was man ihr bot, erwies sich als wertloser Knopf, mit dem sie nichts anfangen konnte. Und ab und zu noch die grausamen, entsetzlichen Mitleidsworte: »Ach ja, man hört so viel Schreckliches jetzt; es gibt zuviel schlechte Menschen. Solch ein harmloses Kind …« Doch dann wieder – Gott vergelt’s: »Na, wissen Sie, regen Sie sich nicht auf, das wird sich noch ganz friedlich erklären. Unsre Hertha hat auch mal einer geholt, der hatte ein Kleines im Kinderwagen, und sie sollte bloß aufpassen, daß es nicht ’rausfiel, solange er in der Budike war.« Solche nährenden Reden schlang die Verschmachtende dankbar und gierig ein.
Frau Beucker rumpelte ihr entgegen; sie wußte von Elschen genug. »Ich hab’ auch schon überall ’rumgefragt,« berichtete sie, »aber leider …« Und diese alte verhutzelte Mutter streichelte der jüngeren starken mitfühlend den Arm. »So, und jetzt kommen Sie mal nach Hause und essen erst was, Frau Wolg. Sie müssen doch abgespannt sein. Und morgen früh – wenn bis dahin nicht schon jemand das Kind zurückbringt; denn nun wissen’s ja alle hier – dann gehn Sie zur Polizei. Heut haben die sicher schon Schluß gemacht, und über Nacht tun sie doch nichts mehr, wenn man’s ihnen auch meldet. Mein Schwiegersohn ist auch wieder fort … zum Kursus …«
Die Polizei. Warum hatte nicht Martha selbst schon daran gedacht? Sie hatte daran gedacht. Aber das nächste Revier lag weit, eine ganze Strecke stadteinwärts, und dann mußte sie stehn, dann mußte sie warten, sich hin und her ausfragen lassen, Minuten sprangen, und hier schrie ihr Kind, und sie hätte den Schrei gehört, wenn sie dagewesen! Denn hier mußte es sein, in der Nähe sein, sie wollte das immer noch glauben. Und es war auch ein Anderes, der Gedanke, nur so fein wie ein Haar: Trag’ ich mein Kind auf die Polizei, so heißt das: ich geb’ es verloren. So heißt das: ich hoffe nicht mehr. Bislang war es wohl ein betrübliches Ding, Ereignis, aufgeregte Geschichte, nun wurde ein Kriminalfall daraus. Und dann konnte nichts mehr kommen als Unglück, Verbrechen, Mord. Sie folgerte nicht. Sie erkannte selbst nicht, daß sie das dachte.
Frau Beucker hielt ihre Hand. »Waren Sie schon bei Roßkaempfers drüben, ja?«
Sie murmelte kaum ein trauriges Nein, sie riß sich selbst fort wie eine, die sich im letzten Augenblick auf vergessene Pflicht besinnt. Und eilte unter den schmächtigen Birken in das kleine verschmuddelte Haus.
Der und jener ruckte verwundert von seinem Glase hoch. Ein Halbwüchsiger, der mit pappenen Bieruntersätzen Fangball spielte, hielt inne, drehte sich um. Denn sie war sehr bleich mit den finster glostenden Augen. Die Wirtin las hinter der Theke unter dem grünlich käsigen Deckenlicht; sie legte die Zeitung hin. Sie kannte Frau Wolg, die gelegentlich kam, bei ihr zu telephonieren. Nun hörte sie zu und machte ein töricht erschrocknes Gesicht. »Ach Gott,« seufzte sie, »wie bloß einer Kindern was antun kann …« Martha stach es ins Herz. Dann wurde der Mann herbeigerufen – so wie sie deftig und derb und breit, war er ein spillriger Wicht – sie berieten erst eine gute Zeit, wer heut gegen Abend schon dagewesen und blieben an einem unbekannten jüngeren Menschen hängen, der eine steife Mütze gehabt, den, während er seine Molle trank, ein Motorrad draußen erwartete. Mit einem Beiwagen, meinte der Wirt, darin jedoch niemand gesessen. Frau Roßkaempfer hatte das Motorrad zwar, indes den Beiwagen nicht bemerkt, und sie stritten.
Sie aber hatte die Hände verkrampft, ineinandergefaltet wie zu inbrünstigem Gebet und schaute die beiden an, so unverstehend, als redeten sie in einer fremden Sprache Worte, deren Sinn sie aus ihren Gebärden selten erriet. Sie horchte doch kaum mehr hin. Darauf war sie noch nicht verfallen. Daß jemand ihr Kind weit fortnehmen könnte, verschleppen mit seinem Gefährt. Zuerst, da hatte es sich gefreut an dem kleinen Wagen, in dem es saß, über den Mann, der mit ihm sauste; aber er brachte es nicht wieder heim, wie er ihm doch versprochen, sondern raste davon in die kalte Nacht, und es weinte bittere Tränen und rief, und der Motorlärm überfuhr sein Weinen!
Sie versteinte. Ihr Herz nur schlug, an dem Hals hinauf, und ihr war, als müßte sie sich erbrechen, es ausspeien mit ihrem Munde. Drüben an der verräucherten Wand zwischen entfärbten, staubigen Bildern hing ein glänzendes neues. Ein kleines Mädchen, pausbäckig gesund, schwarzlockig, in knallrotem Sammetkleidchen, hob schelmisch lächelnd mit beiden Händen ein Seidel Malzbier empor. Es ähnelte Ursa nicht. Doch die Mutter senkte sich ganz hinein in dieses glückliche, frische Gesicht, und jäh, sie wollte den Abschied sagen, stieß aus ihrer Kehle ein Laut. Nur kurz: ein Stöhnen, ein Schluchzen. Sie zuckte, sie faßte sich, nickte nur und schritt aus der Stube.
Sie stand allein auf der häuserarmen, breiten, verdämmerten Straße. Ein Mann kam des Weges, Arbeiter wohl, einen Werkzeugsack auf dem Rücken. Sie lief ihm entgegen und hielt ihn an und schwatzte verworrenes Zeug, von einem Motorrad, von dem Beiwagen und ihrem Kinde. Er schüttelte sacht den Kopf. Nein, ihm war keiner begegnet. Er erwiderte leise, ängstlich fast, wie einer Tollen, Tobsüchtigen, die man nicht reizen durfte. Sie ließ ihn los. Doch späte Heimkehrer, die noch folgten, im kargen Laternenschein, fürchteten sich vor dem zitternden Weibe, das aus dem Dunkel sich auf sie warf: eine stammelnde Irre.
4
Sie erwachte. Sie lag, halb gekleidet, im Morgenrock fröstelnd auf ihrem Bette. Sie lag wie im Freien. Die kühle Nachtluft schlich um sie her und streichelte sie mit Fingern. Sie hatte die Fenster weit aufgemacht, im Zimmer eins und das in der Küche und beider Türen geöffnet. Ihre nackten Füße froren. Ihr Antlitz war heiß. Sie schudderte, wälzte und räkelte sich. Sie gähnte. In der unteren Wohnung dröhnte die Uhr, zwölf Mal; sie zählte die Schläge. Sie seufzte. Sie stützte sich schwerfällig auf den Arm, ganz unerquickt noch, so müde. Sie hatte ja doch geschlafen. Nicht lange, aber sie hatte geschlafen, eine Stunde vielleicht. Plötzlich saß sie hoch: Warum ist mir kalt, warum bin ich wach und warum nicht ausgezogen? Sie sah auf dem Sofa das Kissennest fahl durch die Düsternis schimmern. Schlangenschnell glitt sie hin und betastete es mit bebenden, fliegenden Händen. Nichts, nichts. Sie warf sich darüber und wühlte den Kopf hinein. Sie umschlang dies Weiche, Nachgiebige, preßte es in ihre Arme. Du. Du. O Gott, und ich habe geschlafen. Ich konnte schlafen. Ich konnte … Sie strich die Kissen glatt, sorgsam und zärtlich, als hätte das noch einen Zweck. Dann stand sie und lauschte.
Es war nichts, nein. Aber wie, wenn sie eben im Traume den Schrei überhört? Das konnte nicht sein, sie mußte ihn hören, bei offenem Fenster hier und dort mußte sie alles hören. Und es schreit nicht mehr, dachte sie träge. Es ist ja tot. »Es ist tot,« wiederholte sie laut und stumpf, »Ursa ist tot.« Sie schüttelte wild den Kopf; ihre schwarzen Haarsträhnen zuckten wie Nattern einer Meduse. Nein. Nein. »Ich werde wahnsinnig,« murmelte sie, »ich bin eine Verrückte.« Mich freut nichts mehr. Mich schmerzt nichts mehr. Ich selbst bin gestorben.
Sie setzte sich auf das Sofa nieder, in des Kindes Bettchen mittenhinein, und legte das fiebrig heiße Gesicht in ihre beiden Hände. So saß sie lange. Sie sann nicht mehr.
Sie machte eine Bewegung. Ihr Fuß trat auf etwas, ein Eckiges, Hartes; sie bückte sich, hob es auf und fühlte, ohne es noch zu sehn, daß es eines der bunten Teilchen war, vom Mosaikbaukasten, den Frau Hoffmann der Kleinen geschenkt. Sie hatte gestern damit gespielt und das Steinchen verloren. Die Mutter dachte: »Morgen werd’ ich ihr sagen –« Und wußte auf einmal: Ich hatte ein Kind, das kehrt nie zurück … mein Kind … Sie schluchzte würgend auf. Sie wühlte das glühende Haupt in den Schoß, und jählings, hilflos und fassungslos, begann sie zu weinen.