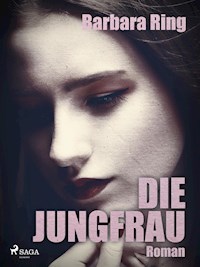
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Es ist Sankta-Lucie-Nacht, und der Tod kommt zu Bilde Bengtsons Hof. Über die Berge kommt er auf einem weißen Hengst unterm schimmernden Mondlicht." Und er kommt, um die alte Frau Gunilla zu holen. Jungfrau Gylicke steht am Fenster und fragt sich, warum ihre nun verstorbene Großmutter sie wohl so sehr gehasst und verflucht hat. Hat es etwas mit ihrer Mutter zu tun? Die aus einem Land im fernen Süden gekommen und bei Gylickes Geburt gestorben ist? Jene geheimnisvolle Frau, nach der sie niemanden fragen darf? Jungfrau Gylicke macht sich auf die Suche nach jener Vergangenheit, der sie selbst entstammt und die ihr heute zugleich Last und Leben ist. Das mit temperamentvoller Kraft und jugendlichem Schwung geschriebene Buch ist Barbra Rings erster reiner Erwachsenenroman und begründete ihren Ruhm mit.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbra Ring
Die Jungfrau
Eingeleitet von
Franz Karl Gingkey
Lust
Die Jungfrau Übersetzt vonJulia Koppel OriginaltitelJomfruenCopyright © 1917, 2019 Barbra Ring und LUST All rights reserved ISBN: 9788711503942
1. Ebook-Auflage, 2019 Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von LUST gestattet.
Ein angesehener Kritiker in ihrer Heimat hat Barbra Ring die Repräsentantin des Seelenadels im demokratischen Norwegen genannt. Die Formel ist gut, wenn sie auch nur einen Teil ihres Wesens umreisst, denn es geht in der Kunst nicht allein um den Charakter oder die Gesinnung, so nötig sie auch sein mögen. Man müsste hinzusetzen: sie ist auch ein ganzer Mensch, ein leidenschaftlicher Künstler und ein unverdrossener Kämpfer.
Um zuerst das Äussere vorwegzunehmen: sie ist in der kleinen Stadt Drammen in Norwegen geboren. Herangewachsen ist sie auf dem Gute Stabbäkk in Bärum, wo ihre Väter schon seit Generationen erbsässig waren, Offiziere, Juristen, Geistliche, die sich alle, was in Norwegen nichts Seltenes ist, nebstbei auch der Landwirtschaft, der Pflege der eigenen Scholle, widmeten. Auch Barbra Ring besass durch einige Jahre einen kleinen Hof, den sie bewirtschaftete. Das erklärt das Urwüchsige, das heimatlich Wissende ihrer Naturbetrachtung, ihre Gestalten schweben nicht aus blauer Dichterluft zu uns herab, sie steigen aus der Erde hervor und klammern sich daran fest, der Sturm des Schicksals kann sie wohl beugen, aber nicht entwurzeln.
Ihr Vater, Jurist von Beruf, war ziveifellos ein Original. Sein Steckenpferd waren Weltgeschichte und die Klassiker der Alten. Der Unterricht in der Töchterschule genügte ihm nicht für sein Kind. Mit zehn Jahren schon kannte Barbra Homer und Ovid, auch dessen für junge Mädchen etwas schwierige ,Metamorphosen‘, und das erste ,Märchenbuch‘, worin sie las, war, wie sie selbst berichtet, die Geschichte von Norwegen, Schweden und Dänemark in fünf grossen Bändert. So wurde, nebst der Heimatliebe, ein weiterer Anker für die Seele gelegt, über das Ich hinaus in das Glück und Leid der Völker und Zeiten, ins Ausserpersönliche.
Hin und wieder dichtete Barbra ein wenig, nämlich zu Vaters Geburtstag, weil er es so wünschte. Dann malte sie auch oder tanzte, wie es bei jungen Damen eben üblich ist und dann tanzte sie sich plötzlich, erst achtzehnjährig, in die Ehe mit einem älteren achtbaren Herrn hinein. Das tat aber auf die Dauer nicht gut, die Ehe wurde geschieden und die junge Frau, tun Mutter eines kleinen Mädchens (sie ist jetzt eine beliebte und gefeierte Schauspielerin im Nationaltheater in Oslo), nahm nun ihr Schicksal selbst in die Hand. Der dritte Anker wurde geworfen, der einer tapferen Lebenszuversicht und er hielt so gut wie die übrigen. Barbra Ring wurde Archivar und Bibliothekar eines öffentlichen Intstitutes. Und dann begann sie plötzlich zu schreiben. Sie schrieb zuerst für ihre Tochter ihre Kindheitserinnerungen nieder, ohne vorerst an eine Veröffentlichung zu denken. Man letzte ihr aber nahe, es doch zu tun. Es ist vergnüglich an sich und überaus bezeichnend für die Dichterin, dass der würdige Verleger, dem sie das Buch, ,Babbens Tagebuch‘ hiess es, in Demut vorlegte, nicht recht wusste, ob das nun eine Kindergeschichte sei oder ein Buch für Erwachsene. Die Wahrheit lag wohl in der Mitte, wie bei jedem guten Kinderbuch. Der Erfolg war sehr gross und da schrieb sie nun vorerst Jugendbuch auf Jugendbuch, und warf damit einen neuen Anker für die Seele aus, den ins geistig Mütterliche. Wir verspüren ihn auch in all den schönen und starken Werken, die sie später für die Erwachsenen schrieb. So wurde sie allmählig die beliebteste Jugendschriftstellerin Norwegens, aber das konnte sie auf die Dauer nicht ganz erfüllen, ihre durchaus künstlerische Natur verlangte ein Weiteres, das rückhaltlose Bekenntnis zu sich selbst im Spiegel eines Weltbildes.
Und so entstand ihr erster Roman ,Die Jungfrau‘, der 1914 zuerst im Buchhandel erschien, ein leidenschaftliches, von allen Morgenröten und frischen Brisen eines hochbegabten Erstlings umwehtes Buch, ein Werk soll jugendlicher Kraft und Freude der Selbfterfüllung. Ein massgebender Kritiker Norwegens hat, als das Buch erschien, mit guter Berechtigung auf die Ähnlichkeit dieser Schilderungen mit dem Wesen der modernen Malerei hingewiesen; grelle Farben flammen auf, Übergänge werden oft gewaltsam übersprungen, Schattentiefen aufgerissen, Temperament scheint wichtiger als Ausgeglichenheit. Wer junge Kraft liebt und ihre Berauschtheit ansich selbst, muss auch dieses Buch lieben. Scheinbar wird im Flackern der Liebesflammen nur das Erotische aufgezeigt. Es erweist sich aber, dass, wie überall, eben dieses Erotische die schaffende Kraft des Lebens überhaupt ist, und das alte Norwegen, sein Boden, seine Gebräuche, seine innerste Wesenheit steigen langsam als Hintergrund dieser wabernden Lohe höchst lebendig auf und vollenden das Seelenbild zu einem Kulturbild.
Barbra Ring mag noch bessere oder für die Forderungen ihres Landes wichtigere Bücher geschrieben haben, als ihre ,Jungfrau‘, aber keines mit stärkerem Temperament. Sie hat dann, nebst ihrer journalistischen Tätigkeit, Roman auf Roman veröffentlicht und jeder behandelte eine Schicksals- oder Gewissensfrage der heutigen Gesellschaft. Ihr zweiter Roman zum Beispiel ,Ehe die Kälte kommt‘, behandelt die moderne Tragödie einer geistig hochstehenden Frau, die die Geliebte eines verheirateten Mannes ist. Das Buch erregte grosses Aufsehen, es fand viel Beifall und viel Widerspruch, wie immer, wenn eine Wunde der Gesellschaft blossgelegt wird, für die es kein Universalheilmittel gibt. Das nächste Werk wieder, ,Unter Segel‘, beleuchtet anderseits die Rechte der Gattin, der Geliebten gegenüber. Hier zeigt sich ein wesentlicher Zug der Barbra Ring, sie kämpft für Freiheit, aber auch für Gerechtigkeit, was ja ein hervorragender Grundzug ihres ganzen Volkes ist. Sie erblickt bei jeder Seite des Lebens auch die Kehrseite, das lässt sie wissend und gütig zugleich sein. Zu ihrer Eigenheit gehört auch, dass sie in manchem ihrer Romane den Mut hat, im Auftakt bereits den Inhalt vorauszusagen, oder ihn wenigstens, ahnen zu lassen, eine Kraftprobe, die sich nur der Berufene leisten kann. Sie holt weit aus, sie baut auch im kleinen fest, eine gute Hausfrau der Gedanken. Der Reiz ihrer Dichtungen gipfelt überhaupt in der Tatsache, dass sie als Schriftstellerin nichts als Weib sein will, hier aber auch über alle Waffen und gottgewollten Listen eines echten, gesunden Weibtums verfügt. Ausflüge ins geistige Männerland liegen ihr nicht, sie empfindet sie als unorganisch und wesensfremd. Der Aufbau ihrer Erzählungen ist mit grosser Kunst gefügt, es formt sich alles aus der Sicherheit ihres Wesens heraus. Sie hat es niemals eilig, auch wenn es um Spannung geht, es stellt sich alles schon im rechten Augenblick ein, weil eben alles organisch in ihr selbst entsteht, als Deutung des Lebens, als des Daseins weiserer Bruder.
Sie hat auch Bücher geschrieben, in denen das Kulturgeschichtliche vorwiegt, wie in ,Der Kreis‘ oder ,Die Schwestern‘. Dann sind es wieder gewagte Gesellschaftsprobleme, und ihre kritische Betrachtung, um die es geht. Nicht selten taucht auch ein stiller wissender Humor auf; es ist kein gewaltsam gerufener, es ist jener, der in der Welt gebunden ruht und nur gehoben zu werden braucht, als ein Teil des Weltbildes, seiner Harmonie und tieferen Begründung. Als den besten Sieg ihres Schaffens verspüren wir aber immer jene letzte Weisheit des Herzens: dass das Glück des Lebens nicht im Nehmen liegt, sondern im Geben.
In der Literatur ihrer Heimat nimmt Barbra Ring eine Sonderstellung ein. Sie ist kein ruhiges Licht an der Küste des Daseins, das unverrückbar leuchtet. Ihr Element ist funkelnde Beweglichkeit, die Vielfältigkeit eines europäisch eingestellten Geistes, dem der Widerspruch gegen alles in Formeln Versteinte tief im Blute liegt. Vielleicht ist es nicht ohne prickelnde Beziehung, dass alle ihre Urgrossmütter im Jahre der französischen Revolution zur Welt kamen. Aber umstürzlerische Naturen wie diese kann man sich wohl gefallen lassen, denn der Urgrund ihres Wesens ist immer, im Rahmen einer allseitigen Bildung, eine reiche mütterliche Güte, die im letzten doch immer erfreuen und beschenken will. Auf ihrem Lebensschilde steht längst die Formel der im Herzen Ausgereiften eingeprägt: sich selbst zu geben und möglichst wenig für sich zu verlangen.
Als ältere Frau bereits vermählte sie sich nochmals, mit einem Jugendfreunde, dem norwegischen Obersten der Artillerie, Generalfeldzeugmeister Ragnar Rosenquist. Ihr Glück war nicht von langer Dauer, nach drei Jahren bereits raubte ihr der Tod den Gatten. Sie lebt seither viel auf Reisen, am häufigsten in Österreich und hier wieder am liebsten im schönen Salzburg.
Wir Österreicher besitzen einen guten Freund in Barbra Ring. Sie liebt unser Land, seine seelische und landschaftliche Vielfalt, seine alte Kultur und tritt dafür immer wieder in ihren Tagesveröffentlichungen ein.
Unvergessen bleiben uns die Wohltaten Skandinaviens in der Nachkriegszeit, da Tausende unserer unterernährten Kinder die liebevollste gastliche Aufnahme in den Familien dieser uns wohlgesinnten Völker des Nordens fanden. Barbra Ring setzt diese Freundschaft fort und stellt mit weltmännischem Klarblick das Unverlierbare unserer inneren Werte in warmen werbenden Worten wieder hin, wohin es gehört: in die Achtung der Welt, in die Schätzung der kultivierten Menschheit. Einen kleinen Dank dafür mag auch die Veröffentlichung dieses Romans in der Berglandbücherei bedeuten. Ein Stück der Seele Norwegens spricht daraus zu uns in kunstvoller Form, durch eine seiner besten und tapfersten Frauen, so dass wir auch hier doch wieder die Beschenkten sind.
Es ist Sankta-Lucie-Nacht, und der Tod kommt zu Bilde Bengtsons Hof. Über die Berge kommt er auf einem weissen Hengst unterm schimmernden Mondlicht. Der Hengst hebt sich gelb von dem Leuchtenden Schnee ab, die lange Mähne und der Schweif erscheinen noch dunkler. Seine Augen sind ohne Farbe, wenn sich aber der Mond in ihnen spiegelt, leuchten sie rot auf.
Die Augen des Reiters sind dunkel wie der Nachthimmel, sein Gesicht ist jung und bleich unter dem breitrandigen Hut. Seine Reiterstiefel tragen lange Sternensporen, sein schwarzer Mantel ist zerfetzt, und blanker Stahl blitzt darunter hervor. Denn es ist eine gefährliche Zeit, und der Tod reitet allein.
Der Tod reitet im Schritt. Sein Pferd schreitet mühsam, denn der Weg ist abschüssig und der Schnee tief und locker.
Wo er reitet, folgt ihm sein Schatten, lang, blauschwarz und unruhig gleitend über weisse Flächen, über die langen Schatten blätterloser Bäume, unter dem Dunkel sammetschwarzer Tannen.
Der weisse Hengst mit den roten Augen schreitet bergab. Durch Wälder und Strauchwerk und über weisswogende Felder; auf den schmalen, dunkeln Streifen fern am Horizont, auf den Arm des Meeres schreitet er zu, denn dort liegt die Stadt, und zwischen der Stadt und dem Binnensee, der unter schneeschwerem Eis und gefährlichen Waken einen unruhigen Winterschlaf hält, liegt Bilde Bengtsons Hof.
Der weisse Hengst geht den geraden Weg, denn er trägt den Tod.
Der Tod hat einen Auftrag auszurichten.
Über ihm zittern Milliarden kleiner kühler Himmelslichter, und während er Schritt für Schritt über verborgene Abgründe des Sees reitet, leuchten vor ihm rote Lichter aus einer dunkeln Steinmasse auf, — die Lucie-Lichter in Bilde Bengtsons Hof. Und auf sie zu reitet mit seinem Auftrag der Tod.
Rund und blank steht der Vollmond über dem grünen Dach des Broholter Schlosses und giesst Silber über den Bären, der sich an die Spitze des Turmes krallt. Denn Bilde Bengtson ist aus dem Geschlecht der Lehm, und der Bär ist ihr Wahrzeichen.
In der grauweissen Mauer sitzen die stummen, schwarzen Fenster Seite an Seite und übereinander. Wenn die Mondlanzen das Glas treffen, ist es, als ob sie zersplitterten und ihr Silber über die blanke Fläche spritzten.
In einigen Fenstern stossen die Sendboten des Mondes auf ein dumpfes, rötliches Licht von innen und erlöschen davor, denn es ist Lucie-Nacht, die längste und gefährlichste aller Nächte, und der Broholter Hof wacht.
Gegen ein Fenster im zweiten Stockwerk presst sich ein junges schmales, elfenbeinweisses Gesicht mit Augen wie alter Bernstein und mit schwarzem Seidenhaar, das in der Mitte gescheitelt ist.
In der Kammer der verstorbenen Gnädigen brennt kein Licht. Der Mond giesst sein Licht über schwere, braune Eichentruhen mit grossen kunstvollen Eisenschlössern, über Bänke, Stühle und Schränke, entzündet Feuer in dem Silberschrein auf dem grossen viereckigen Tisch und macht den Schatten des Spinnrades zu einem riesigen, blauschwarzen Spinngewebe.
Die Mondflut, die sich der Bernsteinaugen, des schwarzen aufgelösten Haares, des weissen Nachthemdes und der schmalen, nackten Füsse ganz bemächtigt hat, überschwemmt auch die dunklen Paneele der Wände, gleitet über Frau Gunillas Porträt, über die schwarze Witwentracht, die langen Hände, die auf dem purpurroten Einband des Gebetbuchs gekreuzt sind, über die schwere goldene Kette auf ihrer Brust und die weisse Halskrause. Bis über den sehr roten Mund und die lange, gerade Nase gleitet das Mondlicht hinauf, die Augen aber erreicht es nicht mehr.
Die zartschlanke Jungfrauengestalt am Fenster starrt in die stille, grünlichweisse Welt hinaus, über leuchtende Felder und schwarze Waldungen, zu der dunkeln, zackigen Masse in der Ferne hinüber. Ein schwerer Turm hebt sich daraus hervor und noch einer, kleiner und schlanker; das sind die Erlöserund die Marienkirche. Wenn die Jungfrau aber durch das Seitenfenster im Erker blickt, kann sie die St. Nicolaikirche ganz in der Nähe sehen, einsam und klein, weiss und turmlos, mit rotem Ziegeldach, umgeben von ihren toten Gemeindekindern hinter der Kirchhofsmauer.
Halb neugierig, halb furchtsam blicken die goldbraunen Augen unter den geraden Brauen, die über der Nasenwurzel fast zusammentreffen. Denn gefährlich ist es, zu erblicken, was sich heute draussen in der Nacht rührt, wo Koboldspuk Macht über Menschen hat, wenn auch der Mond in diesem Jahr den tollsten Spuk vertreibt.
Ein Kälteschauer geht durch den schlanken, zarten Körper der Jungfrau. Sie atmet tief auf und umspannt mit den langen, schmalen Fingern die kleine Brust, die sich nur schwach unterm Nachthemd rundet. Sie fühlt sich so erwachsen dabei, und das macht sie stolz. Sie löst den Silberknopf des Hemdes und streicht mit der Hand über den Hals. Noch treten die Knochen so stark hervor. ,,Hervorstehende Knochen sind hässlich“, hat Frau Mette Aucke vorigen Sommer gesagt, als sie zusammen im Tiefsee badeten, worüber Vater so böse geworden war. „Aber wenn du zur Jungfrau heranreifst, Gylicke, Kind, und später noch mehr, wird dein Hals so voll und weiss wie meiner“, hatte Frau Mette weiter gesagt. Und jetzt ist sie zur Jungfrau geworden. Schon über ein Vierteljahr weiss sie es.
Das offene Hemd und der Gedanke an Frau Mettes vollen Hals aber veranlassen Jungfer Gylicke, sich hastig nach Frau Gunillas Bild umzudrehen. Einem seltenen, kostbaren Stein gleich leuchtet im Mondenschein das kleine rote Buch auf dem schwarzen Sammet. Der rote Mund erscheint noch roter.
Unwillkürlich hebt Jungfer Gylicke ihren spitzen, weissen Ellbogen, als wolle sie sich vor Grossmutters Gesicht verstecken, aber sie lässt ihn wieder sinken und lächelt flüchtig. Es ist ja nicht mehr nötig, sich gegen Grossmutters züchtigende Hand zu wehren.
Sie erinnert sich des Sommerabends, als sie im Rosengarten in ihrem Hemdchen vor den Mägden und Knechten des Hofes getanzt und Grossmutter plötzlich im Fenster gestanden und gerufen hatte:
„Bringt mir das Kind in meine Kammer!“
Sie erinnert sich, wie sie über Grossmutters Sammetknie gelegt wurde, im Lehnstuhl dort am Tisch, und wie sie mit Wohlbehagen mitten in ihrer Angst den Sammet an ihrem Körper gefühlt hatte, bevor die Rute auf sie herabsauste. Und wie ihr der Gedanke gekommen war, dass es Grossmutter freuen würde, wenn sie schriee, und wie sie sich, um das Schreien zu unterdrücken, so fest in die Lippen gebiffen hatte, dass die kleinen, spitzen Zähne ins Fleisch drangen und Blut kam. Schliesslich hatte Grossmutter sie freigegeben, vielleicht weil das Blut von ihrem Mund auf den Fussboden tropfte. Wie hatte sie die ganze Nacht in Ann Maggrets mageren Armen geschluchzt und gebebt!
Da war sie acht Jahre alt gewesen.
Und sie erinnert sich eines anderen Auftritts: Grossmutter zeigt mit ihrer langen Hand, an deren Zeigefinger der veilchenfarbige Stein blitzt, auf Frau Mette Auckes volle Schultern, die sich lockend aus der lavendelfarbenen Seide heben wie ein runder, weisser Schlangenkörper. Sie hört Grossmutters Stimme sagen, dass züchtige Frauen der neumodischen Sitte nicht folgten, die Dirnen aus verdorbenen Städten hergebracht hätten. Sie wüsste wohl, was sie täte, wenn eine der Ihren sich so schamlos kleiden und für jedermann entblössen würde.
Da aber hatte Frau Mette listig mit ihrem grossen, hellroten Mund über den spitzen Raubtierzähnen gelächelt und gemeint, bei Gylicke habe es keine Not, denn sie habe ja ehrbare Anverwandte, — väterlicher- wie mütterlicherseits.
Und dieses Lächeln und diese Worte schienen etwas zu verbergen, denn Frau Gunillas Gesicht war heiss geworden vor Wut, und ihre Hand hatte sich erhoben und war auf Frau Mettes Backe gesaust; die war ganz rot und geschwollen gewesen, Gylicke hatte das vom Fenster aus gesehen, als Frau Mette, kurz darauf mit Vater im Hof erschien und in toller Eile nach Herreby fuhr.
Kurz darauf aber war Vater in Grossmutters Kammer gekommen, blutrot im Gesicht und mit schwimmenden, hellen Augen, wie er sonst aussah, wenn er berauscht war, und die Narbe auf seiner Stirn war tief gewesen und weiss wie Knochen. Vor Frau Gunilla hatte er sich aufgestellt und gesagt, Frau Mutter möge gefälligst nicht vergessen, dass er jetzt Herr auf dem Hof sei, er wolle nicht dulden, dass Weibernücken Zwietracht zwischen ihn und seine Freunde säten.
Da hatte Frau Gunilla ihrem Sohn gerade in die Augen gesehen, denn sie war ebenso gross wie er, und hatte die Worte gesagt:
„Hätte ich gemusst, dass sie zu deinen Freunden zählt, — beim lebendigen Gott, ich hätte noch härter geschlagen.“ Da hatte er die Hand gegen seine eigene Mutter erhoben.
Frau Gunilla aber hatte ruhig seinen Arm gefasst und ihn festgehalten. Und Vater hatte seinen schwarzen Bart auf die Brust gesenkt und war gegangen. Gylicke erinnerte sich noch seines Nackens, als er hinausging. Er war ganz lang und rot geworden, denn die dicken Ringe, die sonst über der Jacke lagen, glätteten sich, als er den Kopf beugte. Vater trug nämlich sein Haar kurz nach der Sitte seiner Jugend.
Da war Gylicke zwölf Jahre alt gewesen.
Alles was Grossmutter und Vater und Frau Mette gesagt hatten, erzählte sie abends Ann Maggret, als die wie gewöhnlich auf ihrem Bettrand sass, um das Abendgebet für sie zu sprechen, zum Schutz gegen die dunkeln Mächte der Nacht, bevor sie selbst in die Bettbank an der anderen Wand kroch.
Da war Ann Maggret so böse, so böse geworden. Ihre kleinen schwarzen Augen hatten zornig gefunkelt, und sie hatte so wunderliche Worte in ihrer eigenen Sprache gemurmelt, dass Gylicke den Kopf vor Angst unter die Decke steckte. Da aber war Ann Maggret verstummt, und ihre knochige Hand hatte die Decke weggezogen und sanft ihre Wange gestreichelt. Der Böse würde eines Tages Frau Gunilla und die anderen holen, wenn sie das gesegnete Kind so schlimme Dinge hören liessen, hatte sie gesagt. Und sie wüsste eine, die dem Bösen gern dabei helfen würde, wenn es nottäte.
Und nun hatte Gylicke ihre Arme um Ann Maggrets dünnen Hals gelegt und geweint und sich in Angst an sie gedrückt. Ann Maggret war ihr bester Freund und ihr treuer Beschützer. Ann Maggret lebte viele hundert Meilen von ihrem eigenen Volk getrennt, das über die ganze Welt verstreut war und nirgends wirklich wohnte, das aber ein Land weit im Süden seine Heimat nannte; so hatte Ann Maggret selbst erzählt. Wie sie aber nach Broholt gekommen war und warum sie dort blieb, darüber sprach sie nie.
Auf dem Hof hatte man eine geheimnisvolle, ängstliche Schen vor Ann Maggret, denn sie kannte viele heilsame Kräuter und konnte Blut stillen und verlorene Dinge wiederfinden. Und es geschah, dass Dinge eintrafen, die Ann Maggret vorausgesagt hatte.
Darum kam keiner auf dem Hof Ann Maggret zu nah, und darum fühlte Gylicke sich in ihrer Nähe geborgen. Aber selbst sie fühlte sich beklommen, als Frau Gunilla kaum eine Woche nach Ann Maggrets Ausspruch, dass der Böse sie holen würde, eines Tages vor ihrem Spinnroden sitzend gefunden wurde, blau und starr im Gesicht. Man letzte sie in ihr Bett, und sie gab vier Tage und Nächte keinen Laut von sich, bis die Stunde kam, wo sie sterben musste. Da hatte sie sich kerzengerade im Bett aufgerichtet und so laut, dass man es in Gylickes Kammer hören konnte, gerufen:
„Gylicke, deine Mutter —“
Als Gylicke sich aber bebend durch die Tür gedrückt hatte und hinter Ann Maggrets Kleid stand, in der Angst, dass etwas Schreckliches geschehen würde, da war Grossmutter hintüber gefallen; sie war tot, ihre Augen blickten gross und starr.
Da sagte Ann Maggret:
„Nun hat sie ihre erste Rache genommen.“
Und das klang so feierlich und unumstösslich wie Worte aus der Heiligen Schrift.
Seit jenem Tage hatte Gylicke Ann Maggret geplagt, ihr von ihrer Mutter zu erzählen. Gylicke musste nur, dass ihre Mutter aus einem Lande im fernen Süden gekommen und sehr schön gewesen sei, und dass sie starb, als sie ihr das Leben gegeben hatte. Ihren Stein jedoch hatte Gylicke nie zwischen den anderen des Geschlechts hinter der Kirchhofmauer von Sankt Nicolai gefunden, und Ann Maggret hatte gesagt, dass sie Vater nie Fragen dürfe, denn er trauere ihr so sehr nach. Auch Grossmutter dürfe sie nicht fragen, denn die sei keinem Menschen gut.
Und Gylicke hatte nicht gefragt. Ann Maggret aber hatte gesagt, wenn die Zeit gekommen wäre, die vom Schicksal bestimmt sei, dann würde Gylicke alles erfahren, denn, was sich im Schnee verberge, das käme bei Tauwetter zutage.
Der breite Silbergürtel des Mondes liegt über Frau Gunillas Bild; als Gylicke sich von neuem, von ihren Gedanken getrieben, zu ihm umdreht, hat das Mondlicht die Augen erreicht, die strengen, blauen Augen. Es ist, als ob sie Gylicke suchten, und als ob der volle, rote Mund, das einzige an ihr, was verrät, dass auch Frau Gunilla einst jung war und die heisse Lust des Lebens kannte, sich öffne, um zu reden.
Ein lähmendes Entsetzen Kriecht über Gylickes Körper. Ihr wird eisigkalt, das Herz scheint ihr in die Kehle zu steigen und hart gegen die Haut zu Klopfen. Sie faltet die Hände, aber beten kann sie nicht; die Angst hält Gedanken und Zunge gefangen, denn es ist Lucie-Nacht, und alles Böse hat Freiheit.
Da erscheint ein weisser Fleck im Dunkel der Kammer, eine Stimme kriecht daraus hervor und flüstert:
„Gylicke!“
Ein Entsetzensschrei bebt durch den Raum. Aber da kommt Ann Maggrets kleine schwarzgekleidete Gestalt mit der weissen Haube in Hast herbeigetrippelt und fängt den weichen Mädchenkörper in ihren Armen auf. Sie zieht Gylicke mit sich in die Schlafkammer, legt sie aufs Bett, schliesst die Tür und schiebt den schweren Riegel vor.
Gylickes Gesicht ist weiss wie das Linnen, ihre Augen sind geschlossen. Ihr dünner Arm hängt über den Rand des Bettes.
Ann Maggret geht an der Schrank und reckt sich auf den Zehen nach einer Flasche, deren Inhalt sie in ein Glas schüttet. Einen Augenblick verweilt sie und legt die Hand auf den Rücken, der sie von dem Recken heftig schmerzt. Ihren heilenden Säften und Pulvern zum Trotz bleibt ihr Rücken gekrümmt, so dass sie mit vorgestrecktem Kopf gehen muss, wie ein Huhn, das Korn pickt.
Ann Maggret presst das Glas an Gylickes Lippen, während sie mit dem anderen Arm ihren Kopf hebt. Gylicke trinkt, feufzt tief auf und öffnet die Augen. Einen Augenblick liegt sie still da, dann schüttelt ein heftiges Erbrechen den jungen Körper, der gegen das Unnatürliche kämpft.
Nach einer Weile ist alles überstanden, nur ein wenig Beklemmung ist zurückgeblieben. —
„Mir wurde so bang, Ann Maggret, ich dachte, Grossmutter riefe mich.“
„Wenn auch, Kind. Sie kann dir nichts tun, solange Ann Maggret Macht hat.“
Die tiefe Stimme, fast zu tief und stark für den kleinen, gebrechlichen Körper, ist beruhigend und beschützend wie eine Liebkosung auf Kinderwangen.
„Und solange du selbst nichts Unrechtes tust, darf dir nichts geschehen“, fügt sie hinzu. Ann Maggret muss ja für die Zeit sorgen, wo sie nicht mehr in dieser Welt und der noch gefährlicheren, die dahinter ist, Wache halten kann. „Zur Nachtzeit darfst du nicht durch die Stuben gehen,“ ermahnt sie, „nicht in solcher Nacht wie heute.“
„Ich konnte nicht schlafen, Ann Maggret. Es ist ja Lucie-Nacht, und alle sind wach. Warum muss ich denn schlafen? Bin jetzt doch eine erwachsene Jungfrau, Ann Maggret. Bald ist’s Mitternacht, und es wird gemeinsam gegessen. Merkst du nicht, wie es schon nach Gebratenem riecht? In diesem Jahr fürcht’ ich mich nicht, Ann Maggret, der Mond scheint ja und macht alles taghell. Aber im vorigen Jahr und noch ein Jahr vorher, erinnerst du dich, da war pechschwarze Nacht, und der Schneesturm pfiff im Schornstein und rüttelte an den Scheiben, und der Bär auf dem Dach heulte. Zweimal gingen Didrich Drengsen im letzten Jahr die Lucie-Lichter aus, als er Pferde- und Kuhstall weihte. Weisst du noch? Und weisst du, wie Stärneros Blut statt Milch gab und wie die San gleich darauf eins von ihren Jungen totdrückte?
Aber in diesem Jahr ist’s nicht gefährlich. Heute würde ich mich nicht fürchten, draussen allein zu gehen.“ Die goldenen Augen leuchten, während sie in die Mondnacht hinausblicken. Plötzlich kommt ihr ein Gedanke.
„Darf ich Didrich heute nacht begleiten?“
Ann Maggret antwortet nicht gleich, sieht sie nur prüfend an. Dann sagt sie:
„Du fürchtest dich nicht? Hast keine Angst, hinauszugehen, du allein?“
„Was meinst du damit, Ann Maggret?“
Das schmale weisse Gesicht wendet sich gespannt Ann Maggret zu.
Ann Maggret nickt langsam.
,,Erinnerst du dich, wie Frau Gunilla erzählt hat, dass sie in dem Jahr, wo sie zur Jungfrau heranreifte, als Lucie-Engel um den Hof von Broholt die Runde machte, im weissen Kleid und mit der LichterKrone auf dem Kopf? Wenn Frau Gunilla hier auf der Welt etwas geliebt hat, so war es Broholt. Sie war selbst aus dem Geschlecht der Lehm, wie du weisst, und die Leute im Ort sagen, dass sie zweiundfünfzig Jahre, trotz manchem ansehnlichen Freier, Witwe blieb, weil sie eine Lehm sein wollte und nichts anderes bis an ihr Ende. Und all ihr Geld Verwandte sie, um den Hof wieder gross und schön zu machen, nachdem der Blitz darin eingeschlagen hatte, lange bevor du geboren warst, — das hab’ ich dir schon erzählt.“
„Aber was ist’s mit dem Lucie-Engel, Ann Maggret? Was ist’s damit?“
Funkelnde Erwartung und Eifer sprechen aus Gylickes Bernsteinaugen.
„In diesem Jahr soll Jungfrau Gylicke als Lucie-Engel durch den Hof gehen, hat Herr Bilde gesagt“, berichtet Ann Maggret.
„Ich!“
Gylicke steht feierlich benommen da; das Mondlicht liegt auf ihrem weissen Gesicht.
„Ich, Ann Maggret!“
„Schaut her, Kind.“
Ann Maggret hat eine Truhe geöffret. Sie nimmt ein Kleid. Heraus, dass im Mondlicht glitzert. Es ist ein Silberbrokatgemand aus Frau Gunillas Hochzeitsschatz. Das blanke Silberfadenmuster ist stumpf und rötlich geworden, aber der Mond lockt von neuem Glanz daraus hervor. Gylicke empfängt es bebend mit ausgestreckten Händen.
Ann Maggret taucht abermals in die Truhe hinunter. Eine Holzkrone mit Löchern für die Lichter kommt zum Vorschein und wird auf den Tisch gestellt. Wieder verschwindet die weisse Haube in der Kiste. Diesmal werden die Lichter herausgeholt.
Ann Maggret streift Gylicke das Kleid über. Es reicht ihr bis an die Fusssohlen, und ihre junge Brust vermag es nicht auszufüllen, wie sehr sie ihre Lungen auch spannt.
„Bück’ dich“, befiehlt Ann Maggret und presst die Holzkrone auf das schwarze Haar. Gylicke bleibt mit gebeugtem Kopf stehen. Unwillkürlich falten sich ihre Hände, — sie fühlt sich beinah wie der gute Herr Jesus, dem die Dornenkrone aufgesetzt wurde, damit er die Welt von Sünde und Teufelsmacht erlöse.
Ann Maggrets Worte aber rufen sie zur Wirklichkeit und in die Jungfernkammer auf Broholt zurück.
„Und glaube nur nicht, dass es gewöhnliche Gemeindelichter sind, die du in der Krone tragen souft. Nein, richtige Herrenlichter sollst du haben, hat Herr Bilde gesagt. Und schau her, was ich hier noch habe.“
Unter den anderen Lichtern zieht Ann Maggret zwei schwere Leuchterkerzen hervor.
„Geweihte Lichter von Frau Gunillas Hochzeitsfest.“
„Die geweihten Lichter!“
Gylicke verneigt sich beim Anblick von Frau Gunillas kostbaren Schätzen aus einer entschwundenen Zeit; aber sie richtet sich gleich wieder auf und steht steif und gerade da, obgleich es weh tut, wie Ann Maggret die sechs Lichter in die Krone drückt.
„Kannst du die heiligen Worte?“
Gylicke nickt. Dann gibt Ann Maggret ihr die schweren Lichter, eines in jede Hand, und macht das Zeichen des Kreuzes vor ihrer Brust. Sie tritt einige Schritte zurück und betrachtet ihr Werk. Nickt dann.
„So ist’s recht. So soll dein Vater dich heute nacht sehen. Komm, aber geh vorsichtig.“
Ann Maggret schraubt die Zinnplatte des Leuchters in die Höhe, so dass der kleine Talglichtstummel, ihr Wegweiser auf Treppen und in Kammern, sich in seiner ganzen Länge erhebt, zündet ihn an der kleinen Flamme der Lampe an und hält ihn hoch über ihrem Kopf, damit Gylicke, die vor ihr die Wendeltreppe hinuntersteigt, die Stufen sieht und nicht stolpert. Ein rauhkalter Windhauch schlägt ihnen aus dem engen Schacht der Treppe entgegen. Vor der schweren Eichentür zur Winterstube machen sie halt.
Gelächter und Weindunst schlägt ihnen entgegen, als sie die Tür öffnen. Der Zug drückt die Flammen der beiden Lichter nieder, die auf dem Tisch brennen, so dass sie zucken und fast verlöschen, obgleich es heute, in der Lucie-Nacht, Wachskerzen sind. Der Mond liegt in einem schmalen, schrägen Streifen auf den Fliesen des Fussbodens. Sonst ist es halbdunkel im Raum.
In ihrer steifen, raschelnden Pracht schreitet Gyalicke erhobenen Kopfes über die schwarzen und weissen Felder des Fussbodens, den Blick starr auf den Tisch geheftet, wo zwei geleerte Silberbecher gleichzeitig niedergelegt werden und vier glasige Augen sie wie eine Erscheinung anblicken.
Es ist Bilde Bengtson selbst mit seinem Gastfreund, dem Ratsherrn Jens Eggert, die zusammen die Lucie-Nacht durchwachen.
Bilde Bengtsons helle Augen, die vom vielen Rheinwein schwer sind, öffnen sich weit. Er hebt die Hand, streicht sich damit über die Augen, die Stirn und den schwarzen Bart, sinkt dann mit einem unsicheren Ausruf der Angst in den Stuhl zurück, als suche er etwas zu durchdringen und könne es nicht.
Jens Eggerts runde, bleiblaue Augen aber treten ganz hervor in dem braunroten Gesicht mit der kurzen Nase und dem dicken Mund. Sie heften sich auf Gylickes Elfenbeinhaut, saugend, begehrlich und aufdringlich wie Fliegen im Herbst. Die Lippen öffnen sich gierig und bleiben offen.
Ann Maggret hat hinter Gylicke gestanden und Bilde Bengtson fest angesehen. Jetzt geht sie auf ihn zu und sagt:
„Seid Ihr bereit, die Lichter anzuzünden und den Lucie-Engel zu Weihen, Bilde Bengtson?“
Bilde Bengtson erwacht aus Rausch und Traum.
Es ist ja Gylicke, seine eigene Tochter, die heute nacht als Lucie-Engel die Runde machen soll, zu seinem und des Hofes Schutz. Sein unsicherer Blick scheint in sich selbst zurückzukehren, er versucht seine Gesichtszüge zu einem festen Ausdruck zu sammeln. Aber es ist, als ob sein Gehirn in Wein verschwimme, er gibt es auf und starrt von neuem auf Gylickes Gesicht. Aber nach und nach blitzt ein Licht in seinen Augen auf, und ein höhnisches Lächeln legt sich um seine geschwungenen Lippen, die frei inmitten des Bartes liegen. Der Gedanke fährt ihm durch den Kopf, dass er Herr auf Broholt ist und stärker als alle Weiber, stärker als die verfluchte Hexe Ann Maggret; denn heute nacht geht seine eigene Tochter die Wachtrunde, zum Schutze für den Hof und ihn selbst. Wieder lächelt er, nur ist das Lächeln jetzt von neuem schlaff und sinnlos geworden.
Er steht auf, stützt sich unsicher mit der einen Hand gegen die Tischplatte, während er mit der anderen das bereitliegende Streichholz ergreift und versucht, es an einem der Lichter zu entzünden, trifft aber immer in die Luft. Schliesslich bekommt er Feuer und streckt den Arm nach den Lichtern in Gylickes Krone aus.
Ann Maggret steht dicht dabei, bereit, zuzuspringen, wenn der unsichere Arm statt des Dochtes das Haar treffen sollte.
Stück für Stück werden die Flammen über Gylickes Kopf entzündet. Sie steht wie festgemauert da, mit grossen, verzauberten Augen. Nur die zarte Brust hebt und senkt sich unterm Kleid. Schliesslich bekommen auch die Lichter in ihren Händen Feuerzungen, grösser als die anderen.
Geh, Lucie-Engel hold und rein,
Lass in den Hof nichts Böses ein.
Die Worte kommen dick und undeutlich, in Gylickes Ohren aber klingen sie wie eine kirchliche Beschwörung. Sie steht unbeweglich, bis Ann Maggret ihren Arm nimmt und sie hinausgeleitet.
„Vergiss nicht, Kind, dass du ausser den heiligen Sätzen kein Wort sagen darfst, bevor du wieder im Hause bist. Und wenn du Angst hast, so sieh nur zu der Kammer der Gnädigen hinauf. Ich werde am Fenster stehen und dich stärken.“
Bevor die Tür aber noch hinter Gylicke geschlossen ist, hat Jens Eggert sich zu seinem Wirt hinüber gebeugt. Der lüsterne Ausdruck herrscht noch in seinem kräftigen Gesicht. Ann Maggret hört seine ersten Worte und bleibt stehen.
„Tod und Teufel, Eure Tochter ist eine erwachsene Jungfrau geworden, Bilde Lehm.“ Und nach einer Weile: „Wenn Ihr gesonnen seid, kann sie vor Sankt Johannistag eine Hausfrau sein.“
Bilde Bengtson dreht sich heftig zu ihm um.
„Meint Ihr Euren Schwestersohn Eirek Raffn auf Skogum?“
Jens Eggert lacht breit und wohlgefällig.
„Ich meine Jens Eggert auf Baastad, Bilde Lehm; Ihr wisst, dass ich eine neue Hausfrau gebrauchen und sie besser als irgend einer in der Stadt und im Kirchspiel aussteuern kann. Und dass ich noch ein frischer und junger Mann für eine Frau bin, das fühle ich selbst, wenn ich junges Blut sehe. Überlegt’s Euch, Bilde Lehm. Ich bin nun reichlich dreiviertel Jahr, wenn ich ihre Krankheit mitrechne, Witwer gewesen, und habe kein Weib in der Zeit angerührt, ausser einzelne Male, wenn ich sehr berauscht war und die Natur ihr Recht forderte, schier ohne dass ich selbst davon wusste.
Überlegt’s Euch, Bilde Bengtson, ich bin der beste Freier hier in der Gegend und jünger als Ihr. Und nachdem ich vierzehn lange Jahre mit meiner sehr gottesfürchtigen und mageren Juliane gelebt habe, für die der Baastader Hof nur eine geringe Entschädigung war, habe ich für den Rest meiner Mannesjahre, weiss Gott, etwas jüngeres Blut verdient. Überlegt’s Euch, Bilde Lehm.“
Bilde Lehm sitzt in seinem Lehnstuhl, die Hand um den Silberbecher auf dem Tisch. Er sitzt und starrt vor sich hin auf die Wand, als höre er nicht. Plötzlich blickt er auf die Tür und wird die weisse Haube im Halbdunkel gewahr.
„Hinaus, Zigeunerweib! Was stehst du da und Horchst? Hinaus!“
Seine Stimme ist grob und wild. Er richtet sich halb auf, sinkt aber wieder zurück.
Da huscht etwas über den Fussboden auf Bilde Bengtson zu, etwas Kleines, Gebücktes. Ganz dicht an seinen Stuhl kommt es heran. Und es beugt sich vor, fasst seinen Arm, der über der Stuhllehne hängt, und ein dunkles Gesicht mit zwei bösen, schwarzen Augen kommt ganz nah an sein Ohr heran und flüstert:
„Ich horche auf Euer Gewissen, Bilde. Hört!“
Sie hält die Hand warnend gegen das Fenster ausgestreckt.
„Hört Ihr nicht, dass heute nacht viele auf Euer Gewissen horchen? Tote wie Lebende.“
Und Ann Maggret dreht sich zum Tisch um und flüstert:
„Und auf Eures auch, Jens Eggert.“
Bilde Bengtsons Gesicht ist leer und ausdruckslos geworden, als ob Ann Maggrets Worte alles Licht daraus verjagt hätten. Jens Eggert aber beugt sich wütend vor:
„Verfluchte Hexe! Verbietet Ihr ihr schmutziges Maul, dass sie uns den Abend nicht verdirbt“, brüllt er, blutrot von Wein und Wut. Er hebt seinen Becher, um ihn ihr ins Gesicht zu werfen. Aber es ist niemand mehr da. Ann Maggret ist hinausgehuscht, klein, zusammengekrümmt, auf Füssen, die lautlos wie die einer Katze schleichen.
Eine Weile ist es still.
„Nun, was sagt Ihr zu meinem Vorschlag?“
Jens Eggerts runde Augen treten vor Erwartung fast aus dem Kopf.
Bilde Bengtson starrt einen Augenblick in die begehrlichen Augen. Dann hebt er seinen schweren Körper aus dem Stuhl und schlägt mit der Faust auf die Tischplatte, dass die Becher hüpfen.
„Nein“, brüllt er.
Wieder sinkt er in den Stuhl zurück und lacht einfältig. Er tastet nach dein Becher und hebt ihn gegen seinen Gast.
„Ein alter Schürzenjäger und das junge, unschuldige Blut. Nein, Jens Eggert, seht Euch nach anderem Jungwild um, das Ihr in Eurem Bett jagen könnt.“
Jens Eggert spricht die Worte: „fegt vor Eurer eigenen Tür“, die er auf der Zunge hat, nicht aus. Er betrachtet lächelnd und ein wenig spöttisch seinen Wirt, der plötzlich fromm geworden ist. Er weiss aus Erfahrung, dass zwei Dinge immer zum Ziel führen, wenn man sie hat und richtig zu gebrauchen versteht: Zeit und Geld.
Über Bilde Bengtson aber ist eine seltsame Unruhe gekommen. Er geht in der Stube auf und ab, mit unsicheren Schritten, die er nicht zu steuern vermag, geht um den Tisch herum und aus dem Bereich der Lichter bis zu den Fenstern, zu denen er verstohlen hinaufblickt; aber vor ihrer Erhöhung macht er jedesmal, kehrt. Plötzlich geht er hastig auf die grosse Tür zu, reisst sie auf und brüllt hinaus:
„Mehr Wein! Von dem letzten Rheinwein!“
Jungfer Gylicke ist auf den Hof hinaus gekommen. Sie geht ganz steif, damit die Lichter nicht zu stark rauchen oder ausgeweht werden. Tross ihres vorsichtigen Ganges aber werden die Flammen nach rückwärts gezogen und hinterlassen einen leichten Schleier von Rauch. Sie geht um das Haus herum, den schmalen Weg im Rosengarten entlang, der für ihre Wanderung im Schnee abgezeichnet ist. Sie sieht, wie die Schatten der gespreizten Bäume und Büsche sich, blauschwarzem, lebendigem Gemürm gleich, über die weisse Schneedecke breiten.
Gylicke hebt ihr kleines schmales Jungfrauengesicht zu den Sternen des Nachthimmels empor, der Mond wirft sein Silberlicht darauf, und die schlanken Finger greifen fest um die langen Lichter mit den flackernden Flammen. Bei jeder Ecke des Hauses bleibt sie stehen:
Lucie-Nacht ist lang,
Keiner sei drum bang.
Gott beschütze Hof und Hain,
Fische, Vögel, Kuh und Schwein.
Keiner sei drum bang,
Lucie-Nacht ist lang.
Die Stimme bebt jung und furchtsam benommen.
Jetzt ist sie wieder beim Portal, wo der Bär in Stein gehauen steht; sie hat sich dicht an die Mauer des Hauses gehalten, als ob sie ihr Schutz gewähren könne. Nun geht sie quer über den Hof, an der grossen Espe in der Mitte vorbei, welche die niedrigsten ihrer knorrigen Äste weit zur Seite breitet und die mittleren hoch zum Nachthimmel emporhebt. Ihr Schatten liegt wie ein verworrenes Knäuel auf der Erde, über die Gylickes Fuss schreiten muss.
Sie tritt jetzt ins volle Mondlicht hinaus. Vorsichtig wendet sie den Kopf und sieht zur Kammer der Gnädigen hinauf. Etwas Weisses bewegt sich nickend, und beruhigt geht sie weiter auf die langen, weissen Ställe zu, wo das gewölbte Mauerportal die Grenze zwischen Pferde- und Kuhstall bildet.
Sie nimmt beide Lichter in eine Hand und öffnet die Stalltür, erst die obere Hälfte, dann die untere. Geschwind kriecht der Mond hindurch. In der geheimnisvollen Dunkelheit unterscheidet sie längs der weissgekalkten Wand die Hörner, die einem rinnenden Bach gleichen. Hier und dort wird die Reihe von einem Tier unterbrochen, das sich von dem ungewohnten Lärm auf dem Hof nicht hat stören lassen und sich ruhig niedergelegt hat. Eine Kuh erhebt sich mit rasselnder Eisenkette; die Luft drinnen ist schwer von schwülem Tieratem.
Gylicke tritt in die Tür:
Lucie-Nacht ist lang,
Keiner sei drum bang.
Kuh und Pferd und Schaf und Schwein
Mögen frisch und stark gedeihn.
Heil’ge Mutter, guter Christ





























