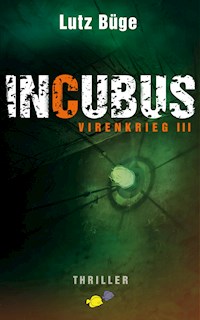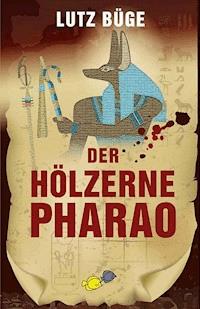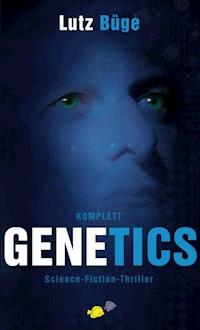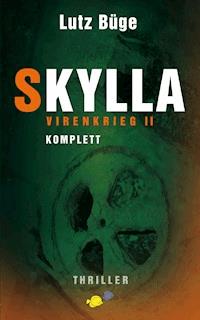5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sparkys Edition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der letzte Arbeitstag. Achim Plibischonka, Journalistenlegende, denkt nicht daran, den Stift abzugeben und in Frührente zu gehen. Er hat Pläne. Da wird in einem öffentlichen Mülleimer eine abgesägte, tiefgefrorene Frauenhand gefunden. Sofort ist Achim, der alte Profi, wieder eingespannt und berichtet für die Zeitung, die ihn soeben erst ausgemustert hat. Zum letzten Mal, wenn es nach ihm geht. Für Kommissar Mesut Yıldırım hingegen ist dies der erste Fall seiner Laufbahn. Und das in Offenbach, der angeblich härtesten Stadt Hessens! Mesut bekommt viel zu tun: Weitere Körperteile tauchen auf. Achim und Mesut ermitteln auf jeweils eigenen Wegen und ahnen nicht, dass sie in derselben Sache unterwegs sind. Lange tappen die grundverschiedenen Spürnasen im Dunkeln, bis sie auf eine scheinbar verlassene Scheune im Wald stoßen. Darin steht eine Tiefkühltruhe. Doch die ist nicht leer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Epilog
Sparkys Edition
Zum Buch
Der letzte Arbeitstag. Achim Plibischonka, Journalistenlegende, denkt nicht daran, den Stift abzugeben und in Frührente zu gehen. Er hat Pläne. Da wird in einem öffentlichen Mülleimer eine abgesägte, tiefgefrorene Frauenhand gefunden. Sofort ist Achim, der alte Profi, wieder eingespannt und berichtet für die Zeitung, die ihn soeben erst ausgemustert hat. Zum letzten Mal, wenn es nach ihm geht. Für Kommissar Mesut Yıldırım hingegen ist dies der erste Fall seiner Laufbahn. Und das in Offenbach, der angeblich härtesten Stadt Hessens! Mesut bekommt viel zu tun: Weitere Körperteile tauchen auf. Achim und Mesut ermitteln auf jeweils eigenen Wegen und ahnen nicht, dass sie in derselben Sache unterwegs sind. Lange tappen die grundverschiedenen Spürnasen im Dunkeln, bis sie auf eine scheinbar verlassene Scheune im Wald stoßen. Darin steht eine Tiefkühltruhe. Doch die ist nicht leer.
Lutz Büge
Die kalte Erika
Achim Plibischonka recherchiert
Fenris-Zyklus Teil 1
Kriminalroman
Impressum
Alle Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Institutionen sind reiner Zufall.
Alle Rechte unterliegen dem Urheberrecht.
Verwendung und Vervielfältigung von Text und Bild nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages.
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Thomas Vögele und Ulrike Spitz
Korrektorat: Thomas Vögele und Ulrike Spitz
Umschlaggestaltung: Fred Münzmaier
© 2024 Sparkys Edition
Herstellung und Verlag: Sparkys Edition,
Zu den Schafhofäckern 134, 73230 Kirchheim/Teck
Druck: Stückle Druck Ettenheim
ISBN: 978-3-949768-28-6
Prolog
Es musste geschneit haben. Nass. Die Zweige der Kiefer draußen hinter dem fast blinden Fenster scheinen tief zu hängen unter schweren, weißen Kissen. Hin und wieder sieht man ein Glitzern auf den Zweigen, vielleicht weil ein bisschen Licht von der Laterne oben an der Straße auf Schnee trifft.
Früher, als junges Mädchen, ist sie im Garten herumgelaufen und hat nach taumelnden Schneeflocken geschlagen. Sie weiß noch, wie es sich angefühlt hat, wenn eine Flocke ihr Gesicht berührt hat, kalt und weich. Aber das ist lange her. Heute kann sie nicht mehr im Garten herumtollen. Sie erinnert sich daran wie an ein fernes Echo, aber sie kann sich vorstellen, wie Schneeflocken über ihrem Bett tanzen und wirbeln und fröhlich funkeln. Das ist schön.
Sie hört, wie die Tür geöffnet wird, und schlägt die Augen wieder auf. Vor dem matten Licht aus dem Flur sieht sie seine untersetzte Gestalt. In einer Hand hält er eine Kerze in einem der Messingständer aus der Vitrine. Er schützt die Flamme mit der Hand gegen den Luftzug. Ihr gelblicher Schein fällt auf sein großes, flaches Gesicht.
„Ich bin wieder da“, sagt er. Es klingt müde, angestrengt, als habe er sich verausgabt.
Sie zieht die Decke bis an die Nasenspitze. Wenn er müde ist, redet er nicht viel, das weiß sie längst. Sie mag es nicht, wenn er redet, aber noch weniger mag sie, wenn er nicht redet. Dann fängt er sie in seinem Schweigen und zwingt sie dazu, sich zu fragen, was er denkt.
Er stellt die Kerze auf den Tisch, legt die Säge daneben, die er mitgebracht hat, und setzt sich auf die Bettkante.
„Wir sollten es jetzt tun“, sagt er monoton. „Worüber wir geredet haben. Wir alle müssen Opfer bringen. So sind die Zeiten. Hart sind die Zeiten. Jetzt ist die Zeit.“
Sie zittert, als sie in seine großen, dunklen Augen blickt. Sein Atem riecht wie immer nach Schnaps, der strenge Geruch hüllt sie ein wie eine Wolke. Doch sie wagt keinen Widerspruch.
„Ich hatte einen harten Tag“, sagt er, „aber ich war effizient.“
Sie hasst dieses Wort.
Er greift nach ihrer schmerzenden Hand, zieht sie zu sich heran, legt sie auf sein Knie und streichelt sie.
„Sind wir effizient, mein Schatz?“, fragt er mit einem Lauern in der Stimme. Sie darf jetzt nichts Falsches sagen. Sie versucht, ihre Hand wegzuziehen, aber er hält sie fest.
„Da ist ein Ring an dem Finger“, sagt sie schnell, bevor er böse werden kann. Er mag es nicht, wenn sie sich ihm zu entziehen versucht. „Ich schenke ihn dir.“
„Was soll ich mit deinem Ring? Wir werden ihn an die andere Hand stecken, dann kannst du ihn weiter tragen. Wir alle müssen Opfer bringen. Das hast du selbst immer gesagt.“
Mit der freien Hand zieht sie die Decke noch etwas höher. Sie traut sich kaum, in sein Gesicht zu sehen. Er streichelt ihre Hand und starrt vor sich hin, vergisst die Zeit. Da ist ein Zucken in seinem flachen Gesicht, während er streichelt.
Dann nimmt er die Säge.
Sie schreit, doch es hilft nichts. Es ist niemand da, um ihr zu Hilfe zu kommen.
Erstes Kapitel
Montag, am späten Abend
„Plibi, du musst fertig werden!“
Gerda Nusswitzky nennt ihn immerzu Plibi, obwohl er ihr zu verstehen gegeben hat, dass nur seine Freunde ihn so nennen dürfen. Die paar, die er hat. Aber das ist der Leiterin der Regionalredaktion Offenbach egal, darüber setzt sie sich leichtfüßig hinweg. Sind sie etwa keine Freunde?
„Du bist fünf Minuten über Redaktionsschluss“, sagt sie. Gerade hat sie den Hörer aufgelegt. Anruf aus der Zentralredaktion. Achim weiß, wer da versucht, ihn auf Trab zu bringen. Ist ihm egal. Die können ihn mal. Er hat wieder den Redaktionsschluss gerissen – na und? Macht er immer! 22:30 Uhr für die Offenbacher Regionalausgabe der Frankfurter Neuesten Nachrichten. Er ist sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Endabnahme und der Technischen Redaktion damit rechnen, dass er sich verspätet:
„Achtung, Plibi hat heute Spätdienst, es wird später!“
So in der Art. Das hat Tradition. Also wozu die Aufregung? Planungssicherheit? Egal, ist heute sowieso zum letzten Mal, denn obwohl Achim auf Gerdas Ansprache hin den Unwilligen spielt und gereizt die Stirn runzelt, ist eines klar: Ab morgen haben sie Ruhe vor ihm. Achim hört nämlich auf. Der Stress mit dieser Tradition findet heute sein Ende.
Achim hat schon vor acht Jahren gewusst, dass es an seinem letzten Arbeitstag nichts wird mit dem pünktlichen Redaktionsschluss. Als Niels Rohregger, der damals neue Chefredakteur, der versammelten Belegschaft dargelegt hat, wie er sich die „journalistische Exzellenzinitiative” vorstellt, mit der er die Zeitung aus den roten Zahlen bringen will, da hat Achim gleich gewusst: An seinem letzten Tag wird er patzen. Er ist gut in solchen Vorhersagen. Er hat auch gewusst, was den schönen Worten des Neuen folgt: Einsparungen beim Personal. Bei „Einsparungen“ ist es noch nie wirklich ums Sparen gegangen, sondern immer nur ums Kürzen. Das wurde auch mit Achim versucht, mit dem Lockangebot einer Abfindung, damit er von sich aus geht. Denn journalistische Exzellenz hat natürlich zuallererst damit zu tun, dass die Kosten runter müssen. Erst kommen die Zahlen, dann die Inhalte. Überall dasselbe. Dass man sich damit der Abwärtsspirale beugt, statt ihr etwas entgegenzusetzen, schert die Entscheider anscheinend nicht. Das Ganze läuft dann als „Unsere Antwort auf den Strukturwandel“.
Achim hat die Abfindung damals nicht genommen. Rausschmeißen konnten sie ihn nicht, er war unkündbar. Ein paar Monate später wurde er nach Offenbach versetzt. Er, der „Hanno-Schreck“, mehrfach ausgezeichnet für seine Arbeit, mit der er einen Frankfurter Oberbürgermeister gestürzt hat. Es war eine Strafversetzung, auch wenn sie niemand so genannt hat. Seitdem schreibt Achim über Einkaufspassagen und schmeißt regelmäßig den Redaktionsschluss. Er ist selbst schuld. Er hätte gehen können. Es hat Angebote und Anfragen gegeben. Aber seine Zeitung ist nun mal die FNN.
Gerda Nusswitzky kommt zu ihm, blickt über seine Schulter auf den Monitor und stellt fest:
„Du bist längst fertig! Warum hast du den Text nicht abgegeben? Damit ich wieder einen auf den Deckel kriege?“
„Geht nicht gegen dich.“
Achim saugt unwillkürlich die Luft tief ein. Ja, das ist Gerda. Eine markante Mischung aus Vanille und Sandelholz – als ob sie ihre Kleider nicht im Kleiderschrank, sondern im Gewürzfach aufbewahrt. Daher ist Achim ihr nie näher gekommen als bis auf eine halbe Armlänge, so wie jetzt. Allerdings wundert er sich, dass sie sich so nahe an ihn rantraut, denn er duftet mit Sicherheit viel ungünstiger. Seit vorgestern ist er nicht mehr unter der Dusche gewesen. Keine Zeit. Keine Lust. So viel Wasser!
„Schick bitte den Text endlich weg“, drängelt Gerda. „Die Kollegen wollen andrucken! Du bist fertig. Mach schon!“
Achim blickt auf, direkt in das runde, sanfte Gesicht seiner Chefin, und ohne hinzusehen gibt er den letzten noch fehlenden Punkt ein und drückt anschließend die Maustaste. Seine letzte Diensthandlung für die FNN. Sieben Minuten nach Redaktionsschluss. Nun müssen die Kollegen wohl schneller drucken. Ihn kümmert es nicht mehr. Er ist durch.
Eine lange Entwicklung, die jetzt ihren Abschluss findet.
„Du bist so durchschaubar, Plibi“, sagt Gerda nachsichtig. „Ein letzter Zickenalarm? Der einstige Star zeigt den Jungs noch mal, wo der Hammer hängt? Du bist und bleibst eine Diva.“
Achim hasst es, wenn sie von oben herab mit ihm spricht. Er sieht sie wortlos an und denkt:
Meine Güte, was bist du hässlich!
Die ganze Welt ist hässlich. Achim kann in Gerdas Augen sehen, dass er selbst keine Ausnahme darstellt. Er trägt wenig Haar und zwei Ringe – unter den Augen wegen zu viel Arbeit am Monitor.
Ich bin so hässlich, so grässlich hässlich, ich bin der Hass!
Wieso fällt ihm diese Textzeile aus einem Hit der 80er Jahre ausgerechnet jetzt ein? Zumal er den Song grauenhaft findet. Vielleicht deswegen?
Aber Gerda ist lieb zu Achim, auf ihre Weise, denn „Zickenalarm“ und „Diva“ mag nach herber Kritik klingen, aber sie sagt das mit ihrer sanften Gerda-Stimme, so dass Achim weiß: Auch dies ist eine Tradition, die heute endet.
Er lässt sich nichts anmerken, sondern steht auf, nimmt seinen Rucksack und sagt leise, aber bestimmt:
„Wie der Dichter schon sagt: Ick bims, wie ick bims.“
Dabei versucht er, ihren traurigen Blick zu ignorieren, während er Sachen vom Schreibtisch in den Rucksack packt.
„Das war dein letzter Arbeitstag hier“, stellt sie fest.
Achim seufzt leise, kneift die Lippen zusammen und macht eine innere Woge von Traurigkeit platt. Offenbar ist Gerda entschlossen, ihm den Abschied zu erschweren, doch er wird ihr den Gefallen nicht tun, er wird nicht flennen.
„Du hast keinen Ausstand gegeben“, fügt sie hinzu.
„Dazu gab es wirklich keinen Grund.“
„Wir haben jahrelang zusammengearbeitet. Ich verstehe, dass du zornig bist, aber doch nicht auf die Kollegen oder mich, will ich hoffen. Von uns hat dir keiner was getan.“
Das stimmt zwar, aber Achim ist kein Mann für Abschiedsfeiern und pathetisch-verlogene Reden. Gerda weiß das. Sie spricht eher zu sich selbst, indem sie so was sagt.
Jetzt noch das Telefonbuch aus dem Jahr 2003, das ihm so viele gute Dienste geleistet hat und in dem so viel Wichtiges steht, lauter Namen und Adressen und Telefonnummern, und dann ist der Rucksack gepackt. Achim richtet sich auf.
„Offenbach ist überschaubar“, sagt er zu Gerda. „Wir werden uns nicht aus den Augen verlieren.“ Dann grinst er auf jene freche Art, die sie stets verunsichert hat. „Um die Wahrheit zu sagen: Ihr werdet noch von mir hören.“
Das klingt eher wie eine Drohung und damit auch für seine eigenen Ohren unangemessen, aber er lässt die Worte im Raum stehen, und Gerda hakt nicht nach.
„Wenn du mal Hilfe brauchst …“, sagt sie.
„Danke“, sagt Achim und zuckt mit den Schultern. Dabei denkt er an seine neue Aufgabe und spürt wieder diese wilde Kraft. Er will es der Welt noch mal zeigen. Er weiß, dass er das kann. Er hat einen Namen, er hat die Journalistenpreise, und wenn die FNN damit nichts mehr vorhat – er kann noch. Fürs erste will er ein Blog aufmachen. Online-Journalismus ist die Zukunft. Das hat nicht zuletzt eben jener neue Chefredakteur als Devise ausgegeben. Aber Achim wird das so machen, wie er es sich vorstellt. Nicht nach irgendwelchen Vorgaben.
„Übernimm dich nicht“, sagt Gerda. „Du bist 55. Warum setzt du dich nicht einfach zur Ruhe? Genieße das Leben! Das Geld dafür hast du, immerhin hast du die Abfindung genommen.“
„Den ‚Fluktuationsanreiz‘“, korrigiert er. „Von wegen ausruhen. Du müsstest mich besser kennen.“
Einen Moment lang sieht sie so aus, als dränge es sie danach, ihn in die Arme zu schließen. Vorsichtshalber tritt er einen Schritt zurück. Keine Sentimentalität bitte! Sonst muss er doch noch flennen. Achim will raus hier! Rasch streckt er ihr die Hand hin.
„Tschüss, Gerda.“
„Plibi …“
Sie ergreift seine Hand nicht. Also geht er einfach. Hinaus aus der Offenbacher Lokalredaktion der Frankfurter Neuesten Nachrichten, hinaus in diese hässliche Welt. Die Tür der Redaktion schließt sich hinter ihm. Er durchquert das Foyer, und dann steht er auf der Kaiserstraße, sieht den Wölkchen hinterher, die in der eisigen Luft aus seinem offenen Mund quellen, und wischt sich verstohlen ein Tränchen aus dem Augenwinkel.
Also doch. Es macht ihm zu schaffen.
***
Mesut hat gehofft, dass er nach dem Training müde genug sein wird, um früh schlafen zu können. Dann wäre er ausnahmsweise morgen ausgeruht. Aber als er den Fernseher nach den Spätnachrichten ausschaltet, weiß er schon, dass es wieder nicht funktioniert. Das liegt nicht daran, dass sich nun das Handy meldet. Die bekannte Festnetznummer.
„Guten Abend, Mama“, sagt er zur Begrüßung.
„Wie geht es meinem Augenstern?“
Seine Mutter nennt ihn immer noch so. Beim letzten Mal, als er mit ihr darüber hat reden wollen, hat sie ihm klargemacht, dass sie nicht daran denkt, sich das abzugewöhnen. Vermutlich wird sie sich niemals mehr etwas abgewöhnen. Das fällt Menschen über 50 bekanntlich schwer. Mesut muss das hinnehmen.
„Du bist mein Jüngster”, hat sie beim letzten Mal erwidert, als sie darüber geredet haben, „und ich denke nicht daran, dich anders zu nennen, als es mir gefällt. Du solltest dich darüber freuen, so wie ich mich darüber freue, dass aus dir etwas geworden ist. Kriminalkommissar! Hättest du das gedacht?“
„Ja, hab ich. Sonst hätte ich diese Ausbildung nicht gemacht. Natürlich wollte ich es schaffen.“
„Das hast du“, hat sie gesagt.
„Es geht mir gut“, antwortet er jetzt, auf der Couch sitzend, in T-Shirt und Boxershorts, bereit für die Nacht. Das Bett ist allerdings bisher nur eine Matratze auf dem Boden des Zimmers und lockt ihn kaum. Er ist gerade erst eingezogen.
„Papa schläft schon?“, fragt er routiniert.
„Dein Vater ist wie immer vor dem Fernseher eingeschlafen. Ich lasse ihn liegen. Du weißt ja, wie bockig er werden kann, wenn man ihn weckt, auch wenn er es im Bett viel bequemer hätte.“
Darum auch ruft sie Mesut regelmäßig erst um diese Zeit an. Sein Vater mag diese Telefonate nicht und soll so wenig wie möglich davon mitbekommen. Mit ihm kann man sich am Telefon kaum unterhalten. Er fragt immer als erstes nach dem Wetter, und wenn er erfahren hat, dass in Offenbach praktisch dasselbe Wetter herrscht wie in Rüsselsheim, dann ist er zufrieden. Von da an muss man ihm alles Weitere aus der Nase ziehen. Vielleicht ist das seine Methode, Mesut zu verstehen zu geben, dass er nicht mit der Entscheidung seines Sohnes einverstanden ist, den Job in Offenbach anzunehmen.
„Das ist keine gute Stadt“, hat er Mesut zu bearbeiten versucht. „Viel zu viele Türken!“
„Das sagt einer, der es wissen muss“, hat Mesut zurückgegeben. „Du bist selbst Türke.“
„Aber ich lebe in Rüsselsheim.“
Das ist die Logik seines Vaters. Was haben sie sich über dieses Thema gestritten! Besonders hoch ist es hergegangen, als Mesut darauf gepocht hat, dass er kein Türke ist, sondern Deutscher mit türkischer Abstammung. Tatsächlich besitzt er nur die deutsche Staatsbürgerschaft, während sein Vater beide hat, die deutsche und die türkische. Der Gedanke, dass er daher Deutscher ist, der wäre seinem Vater allerdings niemals von allein gekommen. Es ist nicht einfach, mit ihm zu reden.
„Die Stelle in Offenbach ist völlig in Ordnung“, hat Mesut ihm beizubringen versucht. „Ich habe nicht vor, dort zu versauern. Ich arbeite mich hoch, irgendwann gibt es ein anderes Angebot, vielleicht in Wiesbaden oder in Mainz. Dann sehen wir weiter.“
Das hat seinen Vater zwar nicht überzeugt, aber der Patriarch hat darauf nichts zu erwidern gewusst, denn er kennt sich nicht damit aus, wie die deutsche Polizei funktioniert.
Darum ruft Mesuts Mutter immer erst an, wenn sie sicher ist, dass Papa schläft. Und weil sie weiß, dass ihr Sohn regelmäßig die Spätnachrichten im Fernsehen sieht. Aber sie will ihn ins Bett bringen, wenn auch nur telefonisch. Sie in Rüsselsheim, er jetzt in Offenbach. Die Umzugskartons sind noch lange nicht alle ausgepackt. Mesut muss sich als erstes einen ordentlichen Kleiderschrank anschaffen. Seine Mutter hätte ihm liebend gern Möbel aus ihrer weitläufigen Verwandtschaft besorgt, aber Mesut will von nun an auf eigenen Beinen stehen, und dazu gehören eigene Möbel nach seinem Geschmack und nicht der ausgediente Kram aus den Speichern der Familie Yıldırım. Das Abnabeln kommt bei ihm sowieso ziemlich spät. Er ist jetzt 29 Jahre alt. Es könnte sein, dass die Distanz zwischen Rüsselsheim und Offenbach nicht groß genug ist, um seine Mutter ernsthaft von ihm fernzuhalten. Mit der S-Bahn bräuchte sie nur eine knappe Stunde. Sie könnte also jederzeit vor seiner Tür auf ihn warten, wenn er nach Hause kommt.
Außerdem hat er Angst, für ein Muttersöhnchen gehalten zu werden. Aus den Psychologiekursen, die er während seiner Ausbildung absolviert hat, weiß er, was manche Menschen anzustellen imstande sind, um etwas zu kompensieren, damit nichts Negatives an ihnen hängenbleibt. Manchmal fragt er sich, ob er vielleicht nur deswegen ein guter Boxer ist, weil großgewachsene Kerle mit breiten Schultern und einem ordentlichen Bizeps, die außerdem diverse Kämpfe gewonnen haben, tendenziell seltener in den Verdacht geraten, von einer starken Mutterfigur gegängelt zu werden. Aber dieser Gedanke tut ihm gleich wieder leid. Seine Mutter gängelt ihn nicht, sondern sie liebt ihn. Wobei das vielleicht mehr miteinander zu tun hat, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Aber wie soll er ihr so was sagen, ohne sie zu verletzen?
Mesut kann mit sich zufrieden sein. Er hat eine Menge erreicht. Er ist Hessischer Box-Vize-Landesmeister im oberen Halbschwergewicht! Leider ist eine der Aufgaben, denen er sich jetzt ausgesetzt sieht, nicht mit Hieben zu bewältigen: Er muss seine Mutter auf Distanz halten. Es gibt da etwas, was seine Eltern nicht von ihm wissen, und er weiß nicht, wie er es ihnen beibringen soll. Vielleicht sollte er sich psychologisch beraten lassen? Die Polizei bietet ihren Leuten Beratungen an. Aber auch das bedeutet einen Sprung über einen Schatten für ihn.
Solche Gedanken kommen ihm unweigerlich, wenn er mit seiner Mutter telefoniert. Heute Abend scheint sie allerdings nicht auf allzu große Ernsthaftigkeit aus zu sein, denn sie kichert, nachdem sie erzählt hat, wie sein Vater mal wieder auf der Couch eingeschlafen ist, und dann fragt sie Mesut:
„Und – hast du schon viele Türken gesehen? In Offenbach?“
„Oh ja“, gibt er zurück, „die Stadt ist voll von denen. Es gibt hier mehr Türken als Einwohner. Offenbach ist die härteste Stadt Hessens, wusstest du das?“
„Das muss ich morgen deinem Vater erzählen“, sagt sie. „Wetten dass er gleich seine Nachbarschaftsbrigade mobilisiert und nach Offenbach fährt, um dich da rauszuhauen?“
Natürlich wird sie Papa nichts dergleichen erzählen.
„Mama, mach nicht solche Witze!“
„Ich möchte nur, dass es dir gut geht.“
„Es geht mir gut, wirklich.“
„Und jetzt machst du also Karriere beim deutschen Staat?“
„Das ist auch dein Staat. Du lebst hier!“
„Gibt es denn schon einen Mord? Du bist doch jetzt bei der Mordkommission!“
„Ja, aber nein, es gibt bisher keinen Mord. Offenbach ist wider Erwarten eine relativ friedliche Stadt.“
„Relativ? Das klingt gefährlich.“
„Mach dir keine Sorgen. Es gibt hier nur das, was es überall gibt. Diebstahl, Schlägereien, häusliche Gewalt ...“
„... Messerstechereien ...“
„Bisher nicht.“
„Du bist erst ein paar Tage dort.“
„Vier Wochen, Mama.“
„Und noch kein Mord? Da ist ja hier bei uns in Rüsselsheim mehr los!“
„Da gibt’s ebenfalls keine Morde. Das sind relativ seltene Verbrechen.“
„Relativ selten – das klingt gefährlich. Aber warum braucht es eine Mordkommission, wenn Morde angeblich so selten sind?“
„Weil sie leider trotzdem vorkommen, dann und wann.“
„Es klingt so klug, wenn du so was sagst, mein Augenstern. Versprichst du mir, dass du trotzdem immer deine kugelsichere Weste trägst?“
Er verspricht es ihr, und dann ist sie endlich zufrieden und müde genug, um das Gespräch zu beenden. Zum Schluss gibt sie ihm einen Kuss auf die Nase, wie immer, und dann hat Mesut es hinter sich.
Leider ist er immer noch nicht müde.
Also schaltet er den Fernseher wieder ein, ruft seinen bevorzugten Streamingdienst auf und lässt sich die nächste Folge von „The Walking Dead“ vorspielen. Die hat er zwar schon mal gesehen, aber er will einschlafen. Als er danach trotzdem noch wach ist, lässt er den Stream laufen und guckt noch eine Folge.
Er muss wohl eingenickt sein. Jedenfalls kriegt er plötzlich einen Schreck, weil sein Handy ihn weckt, und sein erster Gedanke ist: Hoffentlich ist das nicht Mama!
Nein, es ist Kriminalhauptkommissarin Regine Courtax.
„Wenn du noch nicht wach bist, wirst du es am besten jetzt gleich ganz schnell. Wir haben einen Fall!“
Da ist er natürlich auf der Stelle hellwach. Genau darauf hat er gewartet.
„Was für einen Fall? Was ist passiert?“
„Eine abgetrennte Menschenhand in einem Mülleimer. Alles Weitere ist unklar. Die KTU ist angefordert, aber es wird ein bisschen dauern, bis die aus den Federn kommt, um diese Uhrzeit. Wenn du schnell bist, können wir den Fundort vor denen begehen. Odenwaldring, gegenüber Schumannstraße.“
„Bin in zehn Minuten da“, sagt Mesut.
„Sagen wir 15. Es ist spiegelglatt. Fahr vorsichtig.“
Es werden dann sogar 16 Minuten. Mesut ist ein gewandter Radfahrer, aber es ist wirklich sehr glatt.
***
Um diese Uhrzeit ist selbst auf der Kaiserstraße nichts los, abgesehen von zwei Betrunkenen, die bedrückt in entgegengesetzte Richtungen torkeln, und einem SUV, dessen Fahrer seinen Adrenalinpegel nicht im Griff hat und mit aufdröhnendem Motor und bestimmt 80 Sachen auf der einspurigen Straße Richtung Hauptbahnhof prescht, dicht vorbei an den parkenden Autos und immer mitten durch die vielen Offenbacher Schlaglöcher.
Eben rutscht einer der Betrunkenen auf dem spiegelglatten Weg aus. Achim selbst hat die Warnung des Wetterdienstes vor dem überfrierenden Regen gestern noch in die Ausgabe der FNN für heute gesetzt, aber Betrunkene haben anderes zu tun als Zeitung lesen. Jetzt ist der Himmel sternenklar, die Regenwolken haben sich verzogen, und es ist kalt, fünf Grad minus. Ebenso fluchend wie mühevoll kommt der Betrunkene wieder auf die Beine. Er hat was in der Hand und starrt es an.
„Kacke!“, brüllt er und wirft das Etwas weg.
Davon gibt es auch auf Achims Seite der Straße genug. Hundehaufen noch und nöcher! Zum Glück sind sie derzeit alle hartgefroren. Achim hat ein Talent, in solche Haufen zu treten. Er kann nicht alles gleichzeitig. Wenn er durch die Stadt geht, soll er sich Schaufenster ansehen, anderen Leuten, Smombies und Radfahrern auf dem Gehweg ausweichen, Ampelzeichen richtig deuten, nicht über Unebenheiten des Weges stolpern und außerdem noch auf Hundehaufen achten, auch auf die, die verschmiert sind, weil vor ihm bereits jemand reingetreten ist. Das ist ungefähr eine Aufgabe zu viel für ihn.
Wüst und verlassen liegt die Kaiserstraße da, eine von Offenbachs Verkehrsadern in der Innenstadt. Achim wird nicht zulassen, dass es in seinem Leben mal ähnlich wüst aussieht. Andere Menschen würden sich für den Einstieg in den Ruhestand vielleicht einen Hund anschaffen, damit sie beim beliebtesten Volkssport dieser Stadt mitmachen können: Kackhaufen hinterlassen und gegen Haustüren pinkeln. Aber Achim und Hund, das ist undenkbar. Um den müsste er sich kümmern. Darin ist er nicht gut. Außerdem, von wegen Volkssport: Es gibt in Offenbach kein Volk, sondern es gibt etwa ein Dutzend Gruppen von Menschen verschiedener Herkünfte, die mehr oder weniger zufällig in derselben Stadt leben, aber darüber hinaus kaum was miteinander zu tun haben. Die sogenannten „Biodeutschen“ stellen nur ungefähr ein Viertel der Bevölkerung und sind nicht mal die größte Gruppe, sondern das sind die Türken. Von so was wie einem Volk ist weit und breit nichts zu sehen.
Achim ist weit davon entfernt, das zu bedauern. Volk ist ihm egal. Er kann „Volk“ nicht denken, ohne dass ihm gleichzeitig „Vaterland“ und „Führer“ einfallen. Vielleicht wäre die Welt besser dran, wenn es überall so gemischt zugehen würde wie in Offenbach. Aber diese Art zu leben hat ihre Schattenseiten. Zoff gibt es überdies trotzdem. Egal welcher Ethnie die Menschen angehören – sie sind und bleiben Menschen und müssen sich anscheinend zoffen, um ihre Interessen durchzusetzen. Vor allem die Männer. So wie kleine Kinder schreien und Hunde scheißen.
Achim hat mal einen Test gemacht, nur so zum Spaß, ist mit der Stoppuhr aus dem Haus gegangen und hat gemessen, wie lange es dauert, bis er auf der Straße die ersten deutschen Wörter hört. Preisfrage: Hat es a) sechs Minuten gedauert, b) acht Minuten, c) zehn Minuten oder d) eine Viertelstunde? Achim ist nicht sicher, ob man so was als Zusammenleben bezeichnen kann, wenn alle ihre eigenen Sprachen sprechen. Trotzdem funktioniert diese Stadt jedoch. Irgendwie.
Nicht dass Achim sich deswegen Sorgen machen würde. Die Dinge gehen ihren Gang, ohne dass sie aufgehalten werden könnten. Alles entwickelt sich weiter. Das hört nie auf und ist nie anders gewesen. Die Menschheitsgeschichte ist voll von Wanderungs- und Fluchtbewegungen. Achim kann mitreden. Er ist zwar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, aber er ist Sprössling von Menschen, die aus dem Osten des damaligen Deutschen Reichs vor der Roten Armee nach Westen geflohen sind. Hier haben die eigenen Landsleute sie damals wie Fremde behandelt, wie Eindringlinge und Schmarotzer. Das sind zwar andere Zeiten gewesen, es hat Mangel an allen Dingen des Lebens geherrscht, angefangen bei der Nahrung, und alle haben versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Aber trotzdem bleiben Erfahrungen zurück, die sich in Achims Familie als Geschichten festgesetzt haben. Darum gibt es kaum ein Wort, das Achim hässlicher findet als „biodeutsch“.
Auch Achim geht Richtung Hauptbahnhof. Er hat unwillkürlich den Weg zu seiner Wohnung eingeschlagen, aber da will er eigentlich nicht hin. Er hat andere Optionen. Sogar vier davon. Das ist ein gutes Gefühl, weil es bedeutet, dass er das künftige Leben, das nun beginnt, strukturiert angeht. Er macht nicht einfach irgendwas, sondern er hat die Wahl. Wer kann das schon von sich sagen?
Erstens könnte er nach Hause gehen. Diese Option kommt aber am wenigsten in Betracht, denn was soll er da? Dort ist nichts außer Tristesse. Er würde höchstens daran erinnert, dass er aufräumen und Wäsche waschen müsste. Zu Hause warten Pflichten auf ihn. Dafür ist er nicht in Stimmung. Vermutlich wird er zwar auch morgen nicht in Stimmung dafür sein, aber morgen ist morgen und jetzt ist jetzt, und jetzt ist es ihm egal, was morgen ist und wie seine Stimmung morgen sein wird. Die Wäsche kann warten.
Zweitens könnte er die Liste von Telefonnummern durchsehen. Eventuell käme eine der Frauen, die er gespeichert hat, infrage für ein freudvolles Beisammensein zur Feier des Anlasses? Das Problem dabei ist: Damit würde er eine ungeschriebene Regel brechen. Diese Frauen sind nämlich alle verheiratet und haben Männer zu Hause. Bis auf Christina, die hat eine Frau. Die Regel besagt, dass die Frauen von sich aus Kontakt zu Achim aufnehmen, wenn sie Lust haben. Nicht umgekehrt. Außerdem ist es schon spät am Abend. Achim konsultiert sein Handy trotzdem, aber nur, um nachzusehen, ob ihm vielleicht ein Anruf entgangen ist. Nein, ist ihm nicht. Er kann verstehen, dass heute keine was von ihm will. Wer will schon wissen, was dieser Tag für ihn bedeutet, und wer will schon einen Trauerkloß? Erst soll er sich wieder gefangen haben, dann darf er vorbeikommen und das tun, was er am besten kann.
Also die dritte Option? Achim könnte zum Belgier gehen, einer Bierwirtschaft am Wilhelmsplatz, und zwei oder drei Korsendonk zischen. Dann wäre er nicht allein, sondern würde mit ein paar Menschen rumsitzen, die ihm unbekannt sind, während sich die Welt gnädig vernebelt. Das ist zwar nicht das, was er unter Geselligkeit versteht, aber es ginge wenigstens in die richtige Richtung, vor allem was das Vernebeln betrifft. Außerdem bekäme er mit Sicherheit Gelegenheit, ein paar blöde Sprüche abzusondern. Das ist etwas, was er ziemlich gut kann, besonders in vernebeltem Zustand. Aber wenn Achim ehrlich ist: Danach steht ihm heute nicht der Sinn. Heute ist er introvertiert.
Und viertens kann er sein neues Büro aufsuchen, das er der Steuer wegen angemietet hat, und das freudige Ereignis allein begehen, einschließlich Vernebeln. Dann könnte er gleich in aller Ruhe seine ersten Gedanken zum neuen Lebensabschnitt aufschreiben, mit denen er demnächst sein Blog Streichholzkarlche.de starten wird.
Das ist wohl die beste Idee. Er hat noch einiges vor. Die Leute von den FNN und vor allem der Chefredakteur, der ihn nach Offenbach aufs Abstellgleis geschoben hat, die werden sich alle noch umgucken.
Jetzt kommt Achim!
… und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt …
Ob er dieses Lied wohl jemals wieder aus seinem dusseligen Kopf rauskriegt? Achim weiß, dass er nicht einfach ist, aber das hat er trotzdem nicht verdient.
Große Güte, was für ein bescheuerter Ohrwurm!
Also schlägt er den Weg Richtung Büro ein. Das hat was. Vom einen Büro ohne Umweg direkt ins neue. Auch wenn er sich zunächst in seiner Freiberuflichkeit noch zurückhalten muss. Das Anstellungsverhältnis bei den FNN läuft noch bis zum 31. Januar, also noch fast zwei Monate. Aber es gibt für ihn keine festen Arbeitszeiten mehr, keine Redaktionsdienste, er kann schon mal loslegen und ein paar Sachen vorbereiten, mit denen er ab Anfang Februar rausgehen wird. Kann recherchieren, Ideen skizzieren, Leute beobachten. Seine Zukunft.
Achim hat sich in einer Bürogemeinschaft in der Waldstraße eingemietet. Dort steht bereits ein Schreibtisch, und den wird er nun einweihen. Es ist nicht weit. Schnaufend steigt Achim die Stufen zum zweiten Obergeschoss hinauf, schließt die Tür auf und schaltet das Licht ein. Wie beim ersten Besuch erschrickt er, als ihn von der Wand des Flures gegenüber der Eingangstür düstere Gestalten anstarren: Dort hängt das gerahmte Filmplakat von „Der Herr der Ringe – Die Gefährten“.
Um diese Uhrzeit ist natürlich niemand da.
Achims Mitmieter sind ihm zwar vorgestellt worden, als er sich die Räume angesehen hat, aber er weiß nur noch, dass es sich um zwei junge Männer und eine junge Frau handelt, die alle ständig rumgeflitzt sind, so dass er sich kaum mal vernünftig mit denen hat unterhalten können.
Jede Wette – die zugemüllten Arbeitsplätze, an denen er auf dem Weg zu seinem Schreibtisch vorbeikommt, gehören den beiden Jungs. Der dritte ist relativ ordentlich. Der vierte ist leer. Das ist Achims neue Wirkstätte! Kein Monitor, kein Computer, keine Schreibunterlage, das wird alles noch geliefert – aber da steht der nagelneue Chefsessel, die erste Anschaffung. Und mitten auf dem Tisch steht ein mit Wasser gefülltes Senfglas mit einer gelbroten Rose darin, an der mit einer Büroklammer ein Zettel von einem Abrissblock festgemacht ist:
„Willkommen in Mordor! Eowyn, Legolas und Samweis.“
Achim runzelt die Stirn, schiebt das Glas beiseite, schließt den Rollcontainer auf, der rechts unter dem Schreibtisch steht, und nimmt eine Flasche Cognac heraus, die er vorgestern dort deponiert hat. Jetzt steht sie vor ihm mitten auf dem Tisch.
„So, meine Süße, da wären wir.“
Das Vernebeln kann beginnen!
Prompt kommen Erinnerungen auf. Mit Julia in Frankreich! La Rochelle, die Charente – und Cognac, die Stadt des edelsten aller Tropfen. Der Cognac vor ihm auf dem Tisch ist ein Otard!
Wie heißt noch gleich Julias Neuer?
Neuer! Inzwischen wohnen die beiden seit fast zehn Jahren zusammen, drüben in Frankfurt. Achim kommt trotzdem nicht auf den Namen. Egal – sein Gedächtnis hat Unwichtiges schon immer zuverlässig aussortiert. Er entkorkt die Flasche, schnuppert und beginnt dann, in seinem Rucksack nach dem Schwenker zu suchen.
Verflixt! Er hat das Glas nicht etwa in der Redaktion vergessen?
Sein Rucksack enthält eine Menge Zeug: gebrauchte Papiertaschentücher, Kassenbons aus zwei Jahrzehnten, leere Bonbon-Packungen, ausgediente Kugelschreiber, vollgeschriebene Notizblöcke, einen voluminösen Zettelkasten mit Kontaktdaten, das alte Telefonbuch aus dem Jahr 2003, die Ausgaben der FNN der letzten zehn Tage und seine altgediente Digitalkamera. Die gesamte Ausstattung von Achims Schreibtisch in der Redaktion. Nur der Cognacschwenker fehlt. Den hat er wohl so gut versteckt, dass er ihn vorhin beim Einpacken selbst nicht mehr wiedergefunden hat.
Wütend schleudert er den Rucksack beiseite und starrt die Flasche auf dem Schreibtisch an. Er will feiern! Große Güte, es gibt heute wahrlich mehr als einen Grund, ordentlich auf den Putz zu hauen! Kein Gerede mehr über Einsparungen beim Personal und journalistische Qualitätsoffensiven! Achim hat die Zeitungskrise hinter sich, den ganzen bescheuerten Strukturwandel. Das muss gefeiert werden!
Achim wuchtet sich aus dem Chefsessel, um sich auf den anderen Schreibtischen nach einem Trinkgefäß umzusehen, das dem Otard halbwegs angemessen wäre. Unwillkürlich fühlt er sich angesichts der Hamburger-Kartons und Coffee-to-go-Behälter an Gerda Nusswitzky erinnert, aber das hiesige Ensemble hat einen anderen Gout. Zettelsammlungen, Kekspackungen und -krümel, Herpescreme, Zahnpastatuben, Dutzende leerer Cola- und Limoflaschen, ausgedrückte Blister von Magensäureblockern sowie Massen von CDs und DVDs – alles da, was Schreibtische kreativer Menschen kennzeichnet. Und auf dem aufgeräumten Schreibtisch, der am weitesten vom Fenster entfernt steht, klammert sich eine winzige Zimmerpalme vom Discounter an ihr karges Leben. Das alles wirkt im kühlen LED-Deckenlicht wenig hoffnungsvoll.
Doch Achim sucht nichts weiter als einen Cognac-Schwenker oder etwas, was einem Schwenker ähnlich genug ist, um denselben Zweck zu erfüllen. Seufzend gibt er auf, nachdem er alle Rollcontainer unter den Schreibtischen durchsucht und dabei nichts Interessantes gefunden hat außer einem abgegriffenen Porno-Magazin, in dem Männer penetriert werden. Die älteste Geschichte der Welt, immer wieder neu fotografiert. Sonderbar, dass sich mit dergleichen immer noch Geld verdienen lässt. Einer der Jungs ist also schwul.
Er geht nach nebenan. Dies muss mal eine dieser Wohnungen gewesen sein, wie sie früher typischerweise von fünf- bis achtköpfigen Arbeiterfamilien bewohnt wurden: zwei Zimmer, Küche, Bad, Toilette ein halbes Stockwerk tiefer draußen im Treppenhaus. Die Toilette findet Achim am drolligsten. Das erinnert ihn an die Mietwohnung seiner Kindheit. Vermutlich ist das Zimmer, in dem jetzt die Schreibtische stehen, früher mal das Schlafzimmer der Familie gewesen und das andere die Wohnstube. Eine durchgesessene Couch, die auf den Sperrmüll gehört, davor ein Tisch mit leeren Bierflaschen und Resten einer Chips- und Erdnussflips-Orgie, eine Hängematte quer im Raum – und keine Gläser. Hat Achim es hier etwa mit Leuten zu tun, die ausschließlich aus der Flasche trinken?
Er geht in die Küche, macht aber auf dem Absatz kehrt, als er die Spüle sieht. Ja, da gibt es unter anderem Gläser, aber die wird er nicht anrühren. Schimmel ist was für Käse.
Letzte Chance: das Bad. Das einzig Brauchbare, was er dort findet, ist ein leerer Zahnputzbecher, der total sauber ist. Das macht Achim erst recht misstrauisch. Alles hier ist schmutzig, nur der Zahnputzbecher nicht? Dann stimmt damit vermutlich etwas nicht. Er stellt den Becher wieder weg. Also muss nun doch das Senfglas ran. Er kehrt an seinen Schreibtisch zurück, nimmt die Rose heraus, spült das Glas im Bad aus und schenkt dann endlich ein. Den guten Tropfen in seinen Händen wärmend, legt er die Füße auf den Schreibtisch, ehe er den ersten Schluck genießt. Warm und aromatisch rinnt der Cognac seine Kehle hinab.
So hat Achim sich das vorgestellt, so hat er den neuen Lebensabschnitt einläuten wollen. Jetzt kann er Offenbach aufmischen.
Sein Handy klingelt. Umständlich fischt er das Gerät aus der Hosentasche. Kathrin! Was will die um diese Uhrzeit? Viertel nach elf! Eigentlich müsste sie längst selig an der Seite ihres Manns schlafen.
„Was treibst du?“, fragt sie.
Wenn sie so fragt, ist was im Busch. Wird sie ihn rufen? Achim stellt das Glas weg und setzt sich aufrecht hin. Er würde springen. Sofort! Das wäre genau das, was ihm jetzt guttäte. Zwei Schenkel, weit gespreizt, dazwischen die Lippen, schön feucht, und er mit seiner Zunge …
„Was ich treibe? Nichts Weltbewegendes. Ich weihe mein Büro ein.“
„Hast du Lust vorbeizukommen?“
Sie ist allein, sonst würde sie nicht fragen. Aber warum ist sie allein?
„Jörg ist zu einem Einsatz“, sagt Kathrin. „Du kennst das ja. Irgendein Notfall. Offenbar ist die ganze Bereitschaft unterwegs. Er hat was von mehreren Schwerverletzten auf dem Odenwaldring gesagt. Das kann also dauern.“
„Verkehrsunfall?“
„Jedenfalls Großeinsatz. Jörg hat was von einer abgetrennten Hand gesagt. Kommst du? Dann können wir den Start in deinen neuen Lebensabschnitt feiern. Du weißt schon wie.“
„Ich komme gern. Aber ehrlich gesagt will ich mir zuerst ansehen, was da oben am Ring los ist.“
„Wirklich? Ist das so viel spannender?“
„Berufskrankheit.“
Das ist wirklich so und wird nie anders sein. Abgetrennte Hand? Das klingt nicht nach einem Routine-Einsatz der Polizei.
„Lass es nicht zu spät werden“, sagt Kathrin. „Du musst wieder weg sein, bevor Jörg nach Hause kommt.”
„Das weiß ich doch. Bis gleich!“
Achim stürzt den Rest des Cognacs und steht auf, im ersten Moment erstaunt darüber, dass er nicht schwankt. Er ist nicht weit gekommen mit dem Vernebeln. Damit kann er aber später noch weitermachen, zusammen mit Kathrin. Jetzt muss er als erstes am Odenwaldring nach dem Rechten sehen. Das riecht nach einer Geschichte, über die er schreiben könnte.
***
Mesut Yıldırım zieht den Reißverschluss seiner Winterjacke ein wenig auf. Ihm ist auf dem Fahrrad warm geworden, obwohl er nicht schnell hat fahren können. Jetzt hat er das Rad abgestellt und blickt sich um. Überall stößt er auf die neugierigen Blicke der Einsatzkräfte. Er ist allen bereits begegnet, aber jetzt ist der Moment zum Kennenlernen. Mesuts erster Einsatz als Kriminalkommissar bei einem echten Fall. Jetzt wird man sehen, was dieser Türke kann, der als Musterschüler gilt.
Jetzt kommt Mesut!
Er lässt sich nicht anmerken, dass er nervös ist. In seiner Ausbildung hat er viele Krisensituationen geprobt, aber das hier ist die Realität. Er ist jetzt weisungsbefugt. Vielleicht muss er Entscheidungen treffen, die er später zu verantworten hat. Das Szenario ist beeindruckend: zwei Rettungswagen mit Blaulicht quer auf der Kreuzung, zwei Notärzte, Blut auf der Fahrbahn, ein Lkw aus Tschechien, der einen alten Mercedes gerammt und dabei einen Mann zerquetscht hat, ein Pkw, der sich fast um einen Laternenmast gewickelt hat, ein Dutzend Polizistinnen und Polizisten, die für Ordnung sorgen, Personalien feststellen und Aussagen aufnehmen, eine voll gesperrte doppelspurige Bundesstraße, auf der sich trotz der Tageszeit – es ist fast Mitternacht – der Verkehr staut, Dutzende Menschen, die jenseits der Absperrung stehen und gaffen, sowie ein Haufen gefrorenen Mülls unter den Resten eines Mülleimers auf dem Grünstreifen, der die Fahrbahnen der Bundesstraße trennt, des Odenwaldrings, neben einem Fußgängerüberweg mit Ampel. Zur Autobahn hin fließt der Verkehr ungestört, stadteinwärts überhaupt nicht. Und das alles mitten in der Nacht bei Eisglätte. Mesuts erster Einsatz ist ein riesiges Durcheinander. Zum Glück hat die Polizei routinierte Leute. Der Einsatz wird koordiniert von Polizeihauptmeister Jörg Hartmann. Der sieht Mesut, grüßt knapp und berichtet im Steno-Stil:
„Schwierige Unfallsituation, genauer Hergang noch unklar. Zwei Tote. Ein Mercedesfahrer, eine Frau im Wagen an der Laterne. Genickbruch. Ungünstige Kopfposition beim Aufprall. Zwei Verletzte, die gerade erstversorgt werden: einer mit gebrochenen Beinen und einer mit fast abgetrenntem Penis, halb verblutet. Daher das gefrorene Blut auf der Fahrbahn. Zwei weitere Menschen unter Schock: der Fahrer des Lkw und die Frau, die mit dem Mülleimer zusammengestoßen ist und dabei die Hand gefunden hat.“ Er weist mit einem Nicken hinüber zu einem der Rettungswagen: Dort werden die Geschockten versorgt. „Umleitung für den Durchgangsverkehr ist eingerichtet. Es wird dauern, bis sich der Stau auflöst. Courtax ist da vorn am Fundort.“
„Danke. Die KTU ist auf dem Weg?“
„Ja, und wie immer braucht sie ein bisschen.“
Das ist so eine Art Slang unter den Einsatzkräften. Natürlich sind sie die schnellsten, immerhin haben sie Bereitschaft. Aber sie können sich nicht selbst loben, da es nun mal selbstverständlich ist, dass sie schnell sind. Also weisen sie gern darauf hin, dass andere langsamer sind. Dass es für diese Langsamkeit Gründe geben könnte, zum Beispiel weil die Leute von der KTU erst aus dem Bett geholt werden müssen, das ist nicht so wichtig. Auch nicht, dass sie erst noch ihre Ausrüstung holen müssen. Hauptsache sie glänzen momentan durch Abwesenheit. Diese kleine Boshaftigkeit wird aber mehr als wettgemacht durch die Aufmerksamkeit, die den Leuten von der KTU zuteilwird, wenn sie anwesend sind.
„Ich schau mir den Fundort an“, sagt Mesut.
Schon vorhin am Telefon ist Mesut aufgefallen, dass Kriminalhauptkommissarin Regine Courtax nicht von Tatort gesprochen hat, sondern von Fundort. Da es um eine abgetrennte Menschenhand geht, ist wohl ein Verbrechen geschehen, doch das ist nicht hier begangen worden, auf diesem Grünstreifen inmitten des Verkehrs.
Mesut kann die Hand sehen, als er zu Regine geht. Sie steckt in einem durchsichtigen Plastikbeutel, der auf den Gehwegplatten des Fußgängerüberwegs liegt, während Regine Courtax vor den Resten des Mülleimers hockt und sich im Licht der Taschenlampe ansieht, was der Welt zuvor verborgen gewesen ist. Natürlich rührt sie nichts an. Das überlässt sie der KTU.
„Hi Regine, da bin ich“, sagt Mesut und blickt ihr über die Schulter. „Was ist hier passiert?“
„Merde!“, flucht Regine wie zur Begrüßung, aber in Wirklichkeit kommentiert sie damit nur, was sie sieht, und Mesut ist einfach nur der erste, der in ihre Nähe kommt und dem sie sich mitteilen kann.
Mesut ist froh, dass er in Regine eine resolute, erfahrene Kollegin und Hauptkommissarin hat, auch wenn er sie nicht leiden kann. Sie hat etwas Überdrehtes, Hochfahrendes. Ihre weit auseinanderstehenden Augen vermitteln den Eindruck, dass sie an allem vorbeisieht. Dieses Gegenteil von Silberblick lässt sie desinteressiert, ja arrogant wirken. Aber sie kann einen durchaus direkt ansehen, und zwar so, dass keine Zweifel daran bleiben: Jetzt will sie was wissen. Und dann lässt sie nicht mehr locker.
„Was ist los? Stimmt was nicht mit dem Müll?“, fragt Mesut.
„Das Zeug liegt garantiert schon lange in diesem Ex-Mülleimer“, antwortet sie. „Der ist seit Wochen nicht geleert worden, könnte ich wetten. Lauter vergammeltes Zeug!“
„Offenbach ist eine arme Stadt und spart, wo es nur geht.“
„Hast du noch mehr Plattitüden auf Lager? Das sind verfaulte Lebensmittel! Schon vor der jetzigen Kälteperiode haben die da drin gelegen. Das ist unhygienisch und zieht Ungeziefer an. Die Stadt ist verpflichtet, regelmäßig zu leeren.“
„Sei doch froh, so haben wir Spuren!“
„Spuren wovon? Diese Knochen sind von einem Grillhuhn, das nicht vollständig aufgegessen wurde, vor ungefähr sechs Wochen!“
„Stimmt, da hängt noch was dran. Müssen die Reste vom Brustfleisch sein. Kapier ich nicht.“
„Was kapierst du nicht? Dass Fleisch verfault?“
„Dass jemand ausgerechnet das Brustfleisch übriglässt“, präzisiert Mesut. „Das ist angeblich das Beste am Hühnchen.“
„Wer sagt das?“
Mesut hebt abwehrend die Hände und antwortet:
„Ich nicht. Ich bin Vegetarier. Aber man sagt so, oder nicht?“
„Das Brustfleisch ist gut, wenn es entsprechend zubereitet wird“, gibt Regine zurück.
Mesut hat natürlich schon gehört, dass Regine eine großartige Köchin sein soll. So heißt es im Präsidium. Andererseits gibt es Stimmen, die behaupten, der Nimbus der exzellenten Köchin sei ihr angeheftet worden, weil sie nun mal mit einem Franzosen verheiratet ist, in Wahrheit könne sie nichts kochen, was über ein Frühstücksei hinausgehe. Solches Gerede.
„Bei einem ordinären Grillhahn von der Stange ist das Brustfleisch das trockenste Stück Fleisch überhaupt“, fährt Regine fort. „Das blanc de poulet muss sanft gegart werden, und man isst es am besten in einer Sauce à la crème mit einem Hauch Estragon und einem Spritzer citron.“ Regine spricht das Wort nasal auslautend. „Oder mit kräftig gewürzten Morcheln. So wird das Huhn in der Bresse gereicht. Dort gibt es die besten Hühner der Welt, geschmacklich gesehen.“
„Sieht eklig aus“, sagt Mesut und deutet auf die Fleischreste im Müll. Er hat keine Ahnung, was die Bresse ist, er will sich auf seine Arbeit konzentrieren.
So schnell, wie Regines Gedanken auf Abwege geraten sind, kehren sie zum Mülleimer zurück.
„Wie dumm, dass dieses Grillhuhn zur Fundsituation einer abgetrennten Menschenhand gehört. Wenn es schlecht läuft, werden wir herausfinden müssen, wo und wann hier in der Umgebung Grillhähnchen verkauft worden sind ...“
„Da hinten ist ein Supermarkt, die haben eine ‚Heiße Theke‘, wo sie so was verkaufen“, unterbricht Mesut.
„... und dass wir herausfinden müssen“, fährt Regine fort, als habe er nichts gesagt, „wer dieses Hühnchen gekauft und im Gehen gegessen hat, denn wir müssen vermutlich allen Spuren nachgehen. Auch dieser hier. Siehst du?“
Sie leuchtet auf eine bestimmte Stelle im Müll. Mesut braucht nicht lange, um zu erkennen, was sie entdeckt hat.
„Ein Kondom“, sagt er.
„Falsch, Herr Kollege. Ein gebrauchtes Kondom!“
„Wer entsorgt ein gebrauchtes Kondom in einem öffentlichen Mülleimer?“, fragt Mesut entgeistert.
„Gute Frage. Finden wir es heraus! Die DNA haben wir schon mal. Die steckt da drin. Guter Anfang, nicht wahr?“
„Ich verstehe nicht, was hier genau passiert ist“, sagt Mesut.
„Ich auch nicht“, gesteht Regine. „Sieht nach einer Verkettung von Zufällen mit Todesfolge aus, und am Schluss dieser fatalen Kette ist eine Frau mit dem Kopf gegen diesen Mülleimer gestoßen, der daraufhin geborsten ist. Dabei hat die Frau die abgetrennte Hand gefunden. Sie hat einen Schock und wird gerade da hinten verarztet.“
„Ich glaube nicht, dass es was bringt, all diesen Spuren nachzugehen. Die abgetrennte Hand war in dem Mülleimer?“
„So stellt sich die Situation dar, aber die Frau, die sie gefunden hat, kann noch nicht befragt werden.“
„Nehmen wir mal an, es war so. Dann können wir wohl davon ausgehen, dass die Hand ebenso beiläufig dort reingeworfen worden ist wie der ganze andere Müll, oder nicht? Jemand ist vorbeigekommen und hat die Hand entsorgt. Dann ist er weitergegangen und verschwunden. Ist diese Person dabei einem Plan gefolgt? Sie muss nicht mal hier in der Nähe wohnen. Das bedeutet, dass wir überhaupt nichts über die Geschichte dieser Hand erfahren, wenn wir den anderen Spuren aus dem Mülleimer nachgehen. Das wäre höchstens für einen Soziologen interessant, der die Wegwerfpraktiken der Menschen in dieser Stadt erforscht.“
Regine Courtax erhebt sich. Sie ist merklich angefressen. Mesut kann nicht erkennen, ob das daher kommt, dass er ihr einen Gedankengang voraus ist, oder weil er aus eigener Kraft auf etwas gekommen ist, was sie noch nicht hat sagen können, so dass sie dasteht wie eine, die sich von ihrem Co belehren lassen muss. Doch dafür fällt ihre Reaktion erstaunlich lahm aus:
„C’est ça. Hast du dir die Hand schon genauer angesehen?“
Sie bückt sich, hebt die Plastiktasche auf und reicht sie Mesut.
„Nur am Saum der Tüte anfassen“, sagt sie. „Die Hand ist tiefgefroren. Wir dürfen sie nicht berühren. Durch unsere Körperwärme könnte sie sonst stellenweise auftauen, ehe Hedenström sich das angesehen hat.“
„Tiefgefroren?“, wiederholt Mesut. „Wir haben seit drei Tagen Temperaturen unter null Grad, aber reicht das aus, um eine Hand einzufrieren?“
„Ich glaube nicht, dass sie hier gefroren ist, in diesem Mülleimer. Was siehst du, wenn du sie dir anguckst?“
Mesut ist bei seiner Begutachtung auf das gelbstichige Licht der Straßenlaterne angewiesen, unter der er mit Regine steht und an der der Mülleimer befestigt ist. Oder seine Reste. Er runzelt die Stirn.
„Sieht aus wie abgesägt. Unterhalb des Handgelenks. Und zwar dilettantisch. Überall hängen Fleischfasern raus, der Knochen ist gesplittert, die Haut ist an den Einschnittstellen zerfasert. Wo sie intakt ist, da wirkt sie faltig und sieht fleckig aus, wie von einem alten Menschen. Die Gelenke der Finger wirken knotig, als wären Wucherungen unter der Haut. Es ist eine kleine, schlanke Hand. Ich vermute, von einer Frau.“
„Und welche Schlussfolgerungen ziehst du daraus?“
„Diese knotigen Gelenke – ist das wegen Gicht?“
„Könnte sein, oder?“
„Aber Gicht kann gut behandelt werden. Niemand braucht deswegen heutzutage mehr solche Knoten zu bekommen. Ah, ich weiß, worauf du hinauswillst. Die Hand ist tiefgefroren. Wie lange schon? Vielleicht wurde sie zu einer Zeit eingefroren, als man Gicht noch nicht so gut behandeln konnte?“
„Könnte sein, nicht wahr? Und weiter?“
„Oder die Frau ist einfach nie zum Arzt gegangen.“
Regine starrt ihn fassungslos an. Offenbar hat er sie mit diesem simplen, ja banalen Gedanken auf dem falschen Fuß erwischt.
„Weißt du, wie schmerzhaft Gicht sein kann?“, fragt sie. „Sei sicher: Diese Schmerzen treiben dich auf jeden Fall zum Arzt.“
„Und wenn sie bettlägerig war und nicht mehr aus eigener Kraft zum Arzt gehen konnte?“
Regine macht eine wegwerfende Handbewegung. Offenbar gehen ihre Gedanken in eine andere Richtung.
„Nicht ausgeschlossen, aber warum ist diese Hand dann tiefgefroren? Ich sag’s dir: Sie wurde vor langer Zeit abgetrennt. Vielleicht sogar aus einer Art von gutem Willen heraus, um die Betroffene von ihren Schmerzen zu befreien.“
„Wer auch immer das gemacht hat – warum hat er die Hand dann tiefgefroren?“
„Vielleicht wusste er nicht, wohin er damit soll?“
„Haben wir es überhaupt mit einem Verbrechen zu tun?“
„Wenn ich den Gedanken zu Ende denke“, sagte Regine, „fällt mir ein, dass die meisten Menschen zwei Hände haben ...“
„... und dass die Gicht vermutlich nicht auf eine Hand begrenzt war“, fährt Mesut fort. Er spürt, wie ihn ein Frösteln packen will, und vermutlich wird er in diesem Moment blass, als er begreift, was Regines Gedanke bedeutet.
Sie blickt hinüber zu den Häusern längs der Ringstraße. Einige Fenster sind trotz der fortgeschrittenen Zeit noch erleuchtet. Dort wohnen und leben Menschen. Ist es hier passiert, in der Nähe, in einem dieser Häuser?
„Ich vermute, irgendwo in dieser Stadt oder in der Umgebung steht eine Tiefkühltruhe, vielleicht in einem Keller“, sagt Regine, „und darin liegen die Überreste eines Menschen. Und zwar seit langem. Aber jetzt versucht jemand, sie loszuwerden, und dazu verwendet er öffentliche Mülleimer.“
„Das ist bescheuert. Er muss doch davon ausgehen, dass so was nicht unbemerkt bleiben kann.“
„Müsste er wohl, aber vielleicht will er bemerkt werden? Will auf etwas aufmerksam machen. Oder er folgt einem Impuls: Hauptsache weg mit dem Zeug.“
„Du spekulierst ganz schön wild in der Gegend rum“, sagt Mesut.
Das ist frech, aber er hat eine Ahnung, wie er mit ihr reden muss, damit sie ihn respektiert. Sie wird natürlich kontern.
„Das heißt, wir müssen alle Mülleimer in Offenbach durchsuchen lassen“, sagt Mesut. „Sie dürfen nicht mehr geleert werden. Aber das können weder du noch ich anordnen, das übersteigt unsere Kompetenzen. Das muss über den Polizeipräsidenten laufen, vermutlich sogar über das Regierungspräsidium.“
„Für so was gibt es den kleinen Dienstweg“, gibt Regine zurück. „Das ist einer der Vorteile, wenn man es nicht mit einer allzu aufgeblähten Bürokratie zu tun hat. Und jetzt werde ich mich um unsere Zeugin kümmern, die die Hand gefunden hat.“
„Die mit dem Schock? Die kann befragt werden?“
„Hast du mich mal gefragt, wie viele Schocks ich heute schon hatte? Ich kann dir sagen ...“
***
Kurz nach Mitternacht kommt Achim an der Kreuzung Odenwaldring/Schumannstraße an. Er ist zügig marschiert, die eisige Nachtluft belebt ihn. Es ist spiegelglatt auf den Gehwegen. Trotzdem, Achim fühlt sich gut. Er ist ein Mann mit Plänen. Er dampft jetzt runter vom Abstellgleis.
Eine abgetrennte Hand! Viel besser, als sich in einem Büro einsam zu besaufen.
Auf der Ringstraße fließt der Verkehr in Richtung Osten noch immer nicht. Nach Westen hingegen, zur Autobahn-Anschlussstelle Offenbach-Taunusring, ist die Straße frei. Auf der Kreuzung stehen zwei Rettungswagen mit Blaulicht. Einer wird gerade beladen, die Sanitäter schieben eine Liege hinein, auf der ein junger Mann mit entrücktem Gesichtsausdruck liegt. Ein dritter Rettungswagen fährt eben weg. An einem Pkw, der gegen einen Laternenmast geprallt ist, wird geschweißt, um die verzogene Beifahrertür zu öffnen. Neben dem Wagen steht einer dieser unschönen Behelfssärge. Es hat also nicht nur Schwerverletzte gegeben, sondern auch Tote. Jetzt werden die Türen des Rettungswagens mit dem Entrückten geschlossen, die Mannschaft steigt ein, der Wagen setzt sich in dieselbe Richtung in Bewegung, in die zuvor auch schon der andere Rettungswagen verschwunden ist, Richtung Krankenhaus. Achim macht Fotos mit seiner alten Taschenkamera.
Ein Rettungswagen steht noch da, umgeben von einer Menschentraube aus Sanitätern und Polizisten. Regine Courtax ist unter ihnen. Sie spricht mit einer Frau, die auf der Stoßstange des Wagens sitzt, eingewickelt in eine Decke. Das interessiert Achim nur am Rande. Er hat keine Lust auf Regine. Von der erfährt er nichts, die kann unglaublich stur sein. Sie erzählt ihm nur dann etwas, wenn sie sich was davon verspricht, zum Beispiel wenn er Informationen hat, die sie interessieren.
Rehschien Courtax.
Sie besteht tatsächlich darauf, dass man ihren Vornamen französisch ausspricht, wobei das „sch“ ganz weich klingen muss. Dabei ist sie gebürtig aus Castrop-Rauxel. Aber Rehschiens Wille ist Gesetz.
Achim hat die Absperrung erreicht. Auf dieser Seite ist er fast der einzige, der hier nachguckt, was los ist. Drüben, hinter der Absperrung auf der anderen Seite, stehen Dutzende von Menschen, und hinter ihnen sind ihre Autos zu sehen, mit denen sie zurzeit nicht durchkommen, weil die Ringstraße gesperrt ist. Niemand mosert. Achim macht weitere Fotos mit seiner Kleinkamera. Er könnte auch sein Handy benutzen, aber er hängt an dieser niedlichen Kamera, die ihm jahrelang gute Dienste geleistet hat. Er weiß noch, wie die Pressefotografen gefrotzelt haben, als die Digitalfotografie aufkam. Von wegen Zukunft der Fotografie! Es geht nichts über eine schöne optische Spiegelreflexkamera! Damals waren die Digitalkameras noch Schwergewichte. Inzwischen sind sie Standard und so klein, dass sie in Achims Hosentasche passen und trotzdem zeitungstaugliche Fotos liefern.
Wann hat das mit dem Strukturwandel eigentlich angefangen? Oder hat es nie aufgehört? Als Achim zur Zeitung gekommen ist, gab es dort Leute, die noch mit Bleisatz großgeworden waren und sich mit Lichtsatz schwertaten. Inzwischen wird überhaupt nicht mehr gesetzt, sondern alles wird am Rechner gemacht, und zwar nicht mehr durch Setzer oder Metteure, sondern durch Redakteurinnen und Redakteure. Ganze Berufsfelder sind weggefallen. Früher war keineswegs alles besser, aber schlechter war es ebenso wenig. Vielleicht umständlicher. Zeitungen sind trotzdem erschienen. Seitdem hat sich die Zahl der Menschen auf diesem Planeten ungefähr vervierfacht. Das liegt gewiss nicht allein daran, dass irgendwer die Digitalfotografie erfunden hat oder den Computer.
Achim hatte im Volontariat einen Ausbilder, der alle Leute mit Spott überzog, die behauptet haben, in nicht allzu ferner Zukunft werde man am Computer Zeitung lesen. Er war der Meinung, dass niemand einen Computer mit auf die Toilette nimmt, um Zeitung zu lesen; dazu seien die Dinger viel zu klobig. Also werde es immer gedruckte Zeitungen geben. Der Mann hat die damals üblichen Röhrenmonitore im Sinn gehabt. Klar, die nimmt niemand mit auf die Toilette. Heute kann dennoch jedermensch Zeitung lesen, egal wo, auch auf der Toilette. Ein Handy ist nichts anderes als ein Computer. Was Achims Ausbilder wohl sagen würde, wenn er sehen könnte, wie sich die Dinge entwickelt haben? Aber der Mann lebt nicht mehr. Der Strukturwandel hat ihn kalt erwischt.
Achim macht ein paar Fotos von einem Mann, der inmitten der Absperrung in Winterklamotten vor einem Haufen Müll am Boden kniet. Achim hat ihn noch nie gesehen, aber er vermutet, dass es sich um Rehschiens neuen Co handelt. Bis vor wenigen Wochen noch hat KHK Henner Nebentritt als Rehschiens Sidekick gewirkt, bis er endgültig nicht mehr hat können. Achim hat Henners Verfall beobachtet, hat gesehen, wie Henner vor seinem Burnout zunehmend zerbrechlich gewirkt hat und dass ihm viele Dinge viel zu nahe gegangen sind. Die professionelle Distanz, die man bei der Kripo braucht, ist ihm nicht mehr gelungen.
Der Neue soll Türke sein; das hat Achim aufgefangen. Das könnte noch interessant werden, denn normalerweise stehen die Türken auf der anderen Seite: Sie verhaften nicht, sondern werden verhaftet und füllen die Lücken in der Kriminalstatistik, die von den weggezogenen „Biodeutschen“ hinterlassen wurden. Dennoch werden in Offenbach nicht mehr Straftaten begangen als woanders. Bei der Offenbacher Polizei gibt es viele Deutschtürken. Man versucht, die Bevölkerungsstruktur der Stadt abzubilden, und dazu gehört, dass möglichst alle Ethnien in der Polizei vertreten sein sollen. Das ist eines der Themen, über die Achim regelmäßig geschrieben hat. Aber in letzter Zeit hat sein Engagement nachgelassen. Wozu noch rudern, wenn er die Galeere verlassen wird?
Leider wendet der neue Kommissar Achim den Rücken zu und zeigt sein Gesicht nicht. Mit den Fotos, die er macht, wird Achim daher nicht viel anfangen können.
Also hat Achim nur eine Anlaufstelle: Polizeihauptmeister Jörg Hartmann, der den Einsatz leitet. Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass Achim gerade jetzt in Jörgs Ehebett liegen könnte mit dem Kopf zwischen Kathrins Beinen, um sie hochzujubeln. Aber deswegen macht er sich keinen Kopf, als er nun rübergeht zu Jörg. Im Gegenteil, er ist überzeugt davon, dass er einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung von Jörgs Ehe geleistet hat. Manchmal hat er sogar den Eindruck, dass Jörg etwas ahnt. Aber selbst wenn: Achim kann die Dinge auseinanderhalten. Bett und Beruf.
„Hi, Jörg“, grüßt Achim. „Was ist hier los?“
Der Polizeihauptmeister staunt nicht schlecht.
„Um diese Zeit noch im Einsatz für die Nachrichten? Habt ihr nicht längst Redaktionsschluss?“
„Bin als Freier hier, nicht für die FNN.“
„Stimmt, du bist ja jetzt im Ruhestand, du Glückskind. Und das auch noch mit einer ordentlichen Abfindung!“
„Fluktuationsanreiz“, korrigiert Achim.
„Wie auch immer.“ Jörg Hartmann lässt den Blick schweifen. Er hat sich inzwischen entspannt, da die Dinge rund um den Fundort und im abgesperrten Bereich so laufen, wie sie sollen, aber hin und wieder muss er kontrollieren. Alles läuft rund. Daher ist er offen für ein kleines Schwätzchen.
„Offenbar hältst du nichts von Ruhestand – oder warum bist du hier?“
„Weil ich Bock drauf habe”, antwortete Achim schlicht und ehrlich, vielleicht einen Tick zu aggressiv. „Bock auf meine eigene, ganz persönliche journalistische Qualitätsoffensive.“
„Du könntest die ganze Scheiße hinter dir lassen. Willst du dich wirklich noch mal reinhängen?“
„Ich bin zu jung fürs Altenteil. Sag mal, was ist das, was da vorn neben dem jungen Kommissar am Boden liegt? In der Plastiktüte? Ist das eine Hand?“
„Achim, du weißt, wie das Spiel läuft: Warten auf Podot!“
Podot steht für „Pressemitteilung, Polizeibericht“. Wer eine tiefere Wahrheit vermutet, kann lange suchen.
„Eben, ich weiß, wie das Spiel läuft.“ Achim grinst. „Ich starte ein Blog namens Streichholzkarlche.de. Da schreibe ich als freier Autor über Themen aus der Stadt. Wohin wollen wir also gehen, damit ich dich zu einem Bier einlade und du mir was erzählst?“
„Ich kann hier noch nicht weg.“
„Dann schlage ich vor, du erzählst mir einfach gleich hier was, und das mit dem Bier holen wir gelegentlich nach.“ Achim zwinkert ihm zu. „Dein Name wird natürlich nicht in meiner Berichterstattung auftauchen, alter Freund.“
„Du willst die Stadt aufmischen? Könnte lustig werden.“ Jörg grinst. „Wer könnte das besser als Plibi, der Hanno-Schreck!“
Achim grinst ebenfalls, obwohl Jörg ihn Plibi genannt hat, ohne dass er es ihm erlaubt hätte. Aber bei Jörg macht Achim eine Ausnahme. Auch wegen Kathrin und weil er nie um Erlaubnis gefragt hat.
Unter dem Spitznamen „Hanno-Schreck“ ist Achim seinerzeit zur Legende geworden. Das ist ein paar Jahre her, aber in Frankfurt erinnert man sich immer noch gut, auch in der Redaktion der FNN. Oder in dem, was von dieser Redaktion noch übrig ist. Solche Recherchen, die mit viel Buddelei im Schmutz verbunden sind, kriegt diese Redaktion heutzutage nicht mehr hin. Sie hat dafür nicht mehr das Personal, nicht die Zeit und den langen Atem, den man für solche Grabungen braucht. Von wegen vierte Gewalt!
„Von mir hast du es nicht, okay?“, sagt Jörg Hartmann. „Es wurde eine Menschenhand gefunden. Sie ist gefroren und nicht einfach abgetrennt worden, sondern anscheinend mit primitiven Mitteln abgesägt, vermutlich vom Arm einer Frau.“
Achim verzieht das Gesicht. Hört er richtig? Abgesägt? Eine Menschenhand? So was hat es seines Wissens in Offenbach bisher nicht gegeben. Klingt irgendwie nach dem Kannibalen von Fulda, der seinen Freund gegessen hat. Doch Achim will Jörg Hartmann jetzt nicht unterbrechen.
„Wir wissen noch nichts darüber, wie die Hand hierher gelangt ist und von wem sie stammt. Sie lag in dem Mülleimer, und es ist ein riesiger Zufall, dass sie überhaupt entdeckt worden ist. Sonst wäre sie vermutlich bei der nächsten Leerung schlicht auf die Deponie gewandert.“
In diesem Moment taucht Rehschien Courtax neben ihnen auf.
„Wen haben wir denn hier“, sagt sie, „wenn nicht den Aufklärer, dessen Licht schon lange nicht mehr strahlt, den Clown, der nicht merkt, wann sich Fragen geziemen und wann nicht, die Klette, die man nicht los wird, selbst wenn man mit einer Fliegenklatsche nach ihr schlägt!“
„Zu viel der Ehre“, sagt Achim, „aber eine Fliegenklatsche hat noch nie gegen Kletten getaugt.“
„Du meinst, ich bin selbst schuld, wenn ich dich nicht los werde?“
„Falsche Wahl der Waffen!“
„Achim, lass meinen Polizeihauptmeister in Ruhe! Du weißt, wie die Dinge zu laufen haben.“
„Wir wissen beide, wie das läuft, herzigste aller Rehschiens“, wendet Achim ein. „Ich stelle Fragen, kriege keine Antworten und muss daher selbst den Spaten ansetzen. Wir könnten das abkürzen, wenn ich die Antworten gleich bekäme.“
„Wir haben selbst viele Fragen“, lautet der Bescheid von Regine Courtax, „und das bedeutet, dass du dich hinten anstellen darfst. Die Aufklärung dieses Falls hat Vorrang vor dem Interesse der Öffentlichkeit auf Berichterstattung.“
„Interessant“, sagt Achim, „es gibt also einen Fall?“