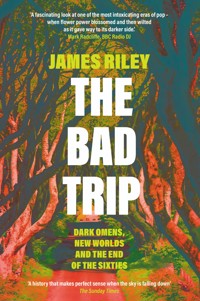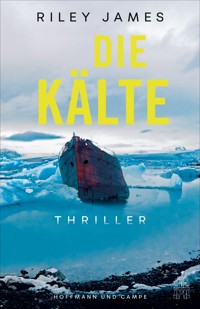
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Um dem Scherbenhaufen ihrer Ehe zu entkommen, tritt Kit Bitterfeld eine Forschungsstelle in der Antarktis an. Doch schon die Anreise wird zum Albtraum, als die Crew einen Notruf der verunglückten Snow Petrel erhält. Das Schiff steht in Flammen, die Besatzung ist spurlos verschwunden, an Bord ist nur ein einziger Mann, dem jede Erinnerung fehlt. Was ist geschehen? Und können sie dem Fremden trauen? Als ein Schneesturm aufzieht, spitzt sich die Lage auf der Forschungsstation zu. Mit dem Wintereinbruch beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Kit muss die Wahrheit aufdecken, bevor sie monatelang von der Zivilisation abgeschnitten werden. Doch wo lauert die größte Gefahr – draußen auf dem Eis oder mitten unter ihnen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Riley James
Die Kälte
Thriller
Thriller
Alexander Weber
Eine Schlange, die von Kälte tief betäubt ist,
birgt gleichwohl Gift in sich, obschon sie es nicht einsetzt;
ebenso verhält es sich bei uns,
denn einzig Schwäche bewahret unsere Unschuld,
und eine Art von Winter unser aller Schicksal.
– Justus Lipsius
Prolog
Es war ein Aasfresser – ein Vogel, der totes Fleisch aß.
Arindam hörte die Skua, bevor er sie sah, bevor er das Bewusstsein ganz wiedererlangt hatte. Er war immer noch in seinen Flugzeugsitz geschnallt und hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war. Der Aufprall bei der Landung musste ihn ausgeknockt haben. Als er wieder zu sich kam, hallte das andauernde Gurren des Vogels durch das leere weiße Tal.
Normalerweise gab es an diesem gottverlassenen Ort kein Leben, nichts, was essen oder atmen oder auch nur ein Geräusch erzeugen konnte – keine Bäume, keine Hunde, keine zirpenden Insekten. Jetzt aber war da dieser eine Vogel irgendwo vor seinem Fenster. Es musste eine Skua sein, eine Raubmöwe, bekannt dafür, dass sie die Kadaver von Robben und Pinguinen fraß. Sie jagte und raubte auch die Nahrung anderer Vögel und tötete und fraß deren Jungtiere. Aber vor allem fraß sie totes Fleisch.
Na großartig, dachte Arindam verzweifelt.
Er wusste, dass seine Verletzungen nicht gravierend waren: nur dieses schmerzhafte Pochen im Kopf und ein furchtbar steifer Nacken – seine ausgekugelte Schulter letzten Sommer hatte ihm schlimmere Schmerzen bereitet. Und doch ließen sich der übelerregende Schwindel und das rasende Herzklopfen nicht ignorieren. Er litt unter einem schweren Schock und war nicht für minus acht Grad Celsius angezogen. Ein Such- und Rettungsteam würde es nicht rechtzeitig schaffen. Als Spezialist für Eisbohrungen hatte er zu viele Geländeübungen absolviert, um sich etwas vorzumachen: Bald würde auch er nur totes Fleisch sein.
Vor dem Absturz hatte ihre zweimotorige Maschine jedwede Orientierung verloren. An jedem anderen Tag hätte der Kapitän die Witterungsbedingungen mit Leichtigkeit gemeistert. Noah, ein erfahrener Pilot und ebenfalls Brite, kannte sich mit Flügen über schneebedecktem Gelände aus. Er war diese Inlandsroute in die Ostantarktis schon dutzendmal geflogen – schließlich hatte er Arindams Forschungstrupp in dieser Saison schon zweimal transportiert –, und er wusste, was bei einem Whiteout zu tun war. Heute jedoch, als der Pilot wieder nach Instrumenten geflogen war, hatte irgendetwas nicht gestimmt. Der Höhenmesser könnte defekt sein, vermutete Noah.
»Wir sind nicht da, wo wir sein sollten«, fügte er mit einem Anflug von Besorgnis in der Stimme hinzu. »Ich glaube nicht, dass wir an der richtigen Position sind. Ich werd mal unter diese Wolkenbank abtauchen und nachschauen.« Er sprach dabei zwar mit seinem Co-Piloten Roger, doch von seinem Platz in der ersten Reihe aus konnte Arindam jedes Wort verstehen. Sie waren schon zu lange in der Luft und hätten längst im Anflug auf die Landebahn sein müssen.
»Wenn ich nur den Horizont finden könnte«, murmelte Noah, »dann hätte ich einen sichtbaren Anhaltspunkt.«
In einem antarktischen Whiteout ließ sich kein Unterschied ausmachen zwischen Himmel und festem Untergrund. Es gab keinen Kontrast mehr zwischen den Wolken, der riesigen Eisdecke auf dem Wasser und dem Schnee, der die Oberfläche einhüllte – alles war ein endloses, einheitliches Weiß. Für gewöhnlich konnte der Pilot zumindest einen Schatten oder eine zerklüftete Bergspitze erhaschen. Aber unter den jetzigen Bedingungen hatte er sogar Mühe, seine Anflughilfen auszumachen.
»Das gefällt mir nicht«, sagte Noah und drehte sich zu seinen drei Passagieren um. »Das kommt mir seltsam vor.«
Seine Stimme hatte ruhig geklungen, doch als Arindam die Miene des Piloten sah, wurde ihm flau im Magen. Es war dieses Flackern in Noahs Augen, ein Aufblitzen von Panik.
Danach konnte sich Arindam an kaum etwas erinnern. Da war das dumpfe Dröhnen der Motoren, als Noah versuchte, das Flugzeug noch herumzureißen, und Rogers fieberhafter Notruf an die Zentrale. Arindam hatte sich an seinen Sitz geklammert, während das Flugzeug wie wild hin und her geschaukelt war, und seine Muskeln hatten vor Anstrengung gebrannt. Vor dem Fenster waren weiße Schemen vorübergerast, bevor sich ein grauer Bergrücken abgezeichnet hatte.
Jetzt lag das Flugzeug still und reglos da. Wo eben noch das Cockpit gewesen war, war jetzt ein großer Haufen Schnee. Oben ragte steif ein bleicher Arm hervor, in einem merkwürdigen Winkel abgeknickt. Arindam bemerkte noch, dass der Arm Noahs Pilotenuhr trug, bevor ihn eine Woge der Übelkeit übermannte und ihn in die Tiefe zog.
Als er wieder zu sich kam, fegte ein eisiger Wind durch den Rumpf. Sein Kopf fühlte sich noch schlimmer an als zuvor. Langsam drehte er sich um und sah, dass das Heckteil abgerissen war. Nun klaffte hinter ihm ein Loch, durch das Schnee ins Innere des Wracks wehte. Es war noch hell, doch der Himmel hatte sich zu einem dreckig-trüben Grau verfärbt.
»Hallo?«, krächzte er in die Leere. Seine Kehle fühlte sich so trocken an, als hätte er geschrien.
Niemand antwortete. Niemand sonst war noch an Bord. Ihm wurde klar, dass er allein sterben würde. Es sei denn, da war noch jemand im Heckteil der Maschine? Jemand, der noch in seinem Sitz festgeschnallt war? Draußen?
Als er den Gurt lösen wollte, schoss ihm ein jäher Schmerz durch die Hand, ein brennendes, kribbelndes Gefühl. Arindam stöhnte auf, blickte hinab und sah, dass sich auf der freiliegenden Haut an seinem Unterarm eine feine kristalline Eisschicht gebildet hatte. Sie reichte vom Ellbogen bis zum Handgelenk und bedeckte auch das Freundschaftsband, das seine Tochter Aisha ihm geflochten hatte. Mit Entsetzen fiel ihm auf, dass seine Haut aussah wie tiefgekühltes Fleisch. Die Kälte verschlang allmählich seinen Körper. Bald würde selbst das Blut in seinen Adern gefroren sein. Er stellte sich vor, wie sich Ranken aus Eis seinen Hals empor und hoch in seine Kopfhaut wanden.
Draußen vor dem Fenster schrillte wieder der Warnruf der Skua. Arindam beugte sich vor, um besser sehen zu können. Der mächtige braungraue Vogel hockte auf einem Flugzeugsitz, nur wenige Meter vom abgetrennten Rumpf entfernt. Er wippte ständig auf und ab, die spitzen Flügel nach hinten gestreckt. Mit seinem furchterregenden Schnabel riss er ruckartig an irgendetwas herum.
Der Anblick des Vogels erfüllte Arindam mit nackter Angst. Er stöhnte in die Stille, sein Herz raste noch immer. Keine gute Art zu sterben, dachte er, wenn dieses Ungetüm da draußen auf ihn wartete.
Er musste daran denken, wie die achtjährige Aisha ihm das Armband überreicht und ihn angefleht hatte, sie ja nicht zu vergessen. Seiner Tochter zuliebe sollte er aufstehen und mit den Füßen stampfen; er könnte seine Durchblutung in Gang bringen, um etwas Wärme zu erzeugen. Vielleicht würde dann ja das Gefühl in seine Finger zurückkehren, und er könnte eine Nachricht schreiben. Anschließend würde er vielleicht einen seiner Kollegen finden – Pete oder Barry –, um gemeinsam Schutz zu suchen und einen Plan zu schmieden.
Mit klammen, ungelenken Fingern löste er den Sicherheitsgurt. Er ließ sich aus dem Sitz hinab auf die Knie gleiten. Der Sitz war gebrochen und verbogen, beinahe aus seiner Verankerung gerissen. Arindams gelbe Jacke raschelte, als er sich langsam in den Gang schob und ächzend und stöhnend in den hinteren Teil des Flugzeugs kroch. Ohne Gespür in Händen und Füßen blieb er immer wieder in dem Chaos aus Taschen und Ausrüstungsgegenständen hängen. Als er endlich an der Öffnung ankam, ließ er sich nach unten auf den Boden plumpsen. Mit einem leisen Knirschen und einer wie Rauch aufstiebenden Schneewolke landete er auf dem Rücken. Irgendwo in seinem trägen Hirn nahm er noch wahr, wie seine Polartec-Hose kalt wurde und nass.
Schwer atmend hievte er sich auf die Knie und warf einen Blick über die Absturzstelle. Vor ihm verlief ein dreckig-dunkler Streifen, der sich wie eine Einfahrt in den Boden gefräst hatte, und er sah mehrere Trümmerhaufen in einem von Eisspalten zerfurchten Schneefeld. Der größte Teil des Wracks war im Schnee versunken. Zu seiner Linken konnte er die Umrisse einer Tragfläche erkennen und weiter hinten etwas, das womöglich das Heck gewesen war. Ihm sank der Mut, als er bemerkte, dass nirgends andere Menschen zu sehen waren, weder tot noch lebendig. Einem Teil von ihm wäre sogar ein Blutbad lieber gewesen als diese menschenleere Ödnis.
Dann entdeckte er die Skua, die noch immer auf der Rückenlehne des Flugzeugsitzes hockte.
Er stürzte auf den Vogel zu, mühte sich auf Knien durch den hohen Schnee. »Schsch!«, zischte er heiser, während er vorwärts taumelte. »Schsch!«
Seine Stimme kam ihm kraftlos vor, doch sie schreckte den Vogel so weit auf, dass dieser zu Boden hüpfte, wo er ungeduldig mit den Flügeln schlug.
Als sich Arindam hinter dem Sitz aufrichtete, sah er, dass ein Arm über die Seitenlehne hing. »Hallo?«, rief er und spähte auf die Vorderseite.
Ihm blieb beinahe das Herz stehen.
Der zerschmetterte, verdrehte Leichnam war tief in die Sitzpolster gepresst. Sein Kopf war in einem grauenhaften Winkel verdreht, der Hals unnatürlich lang gestreckt, und eine Wange ruhte auf der Schulter. Das Gesicht war fahlweiß, und statt Augäpfeln klafften nur zwei blutige Löcher.
Bevor er den Blick abwenden konnte, sah er, dass die Augenhöhlen von Hautfetzen und freiliegenden Schädelknochen umgeben waren, wo sich die Raubmöwe bereits an ihm gütlich getan hatte. Auf der einen Seite gab der aufgesperrte Mund der Leiche eine Reihe von verfärbten Zähnen frei, auf der anderen zog sich eine Spur gefrorener Spucke an einem weißen Bart hinab.
Er hatte Pete gefunden.
Auf dem Flug hatte der wissenschaftliche Leiter zunächst hinter Arindam gesessen. Der langbeinige Mann hatte so lange immer wieder von hinten gegen die Sitzlehne gepresst, bis sich Arindam umgedreht und ihn böse angefunkelt hatte. »Tut mir leid, Kumpel«, hatte Pete erwidert, der nur versucht hatte, seine Sitzposition zu verändern. Es schien ihm aufrichtig leidzutun, und Arindam hatte ein schlechtes Gewissen bekommen, weil er so gereizt war. Es war ein langer Tag gewesen: Seit dem frühen Morgen hatten sie Gräben in das Eis gefräst. Aus Höflichkeit hatte Pete sich daraufhin in eine der leeren Reihen im Heck gesetzt.
Arindam sackte neben Petes Sitz zusammen, sein Atem nur noch stoßartige Schluchzer. Als der Vogel sich erneut über sein Festmahl hermachte, wandte Arindam jäh den Blick ab und taumelte nach hinten. Er war erst ein paar Schritte gegangen, als seine Stiefel durch die pulverige Oberfläche einer Schneebrücke brachen. Wie durch eine Falltür stürzte er hinunter in die Gletscherspalte.
Mit einem harten Aufprall landete er stehend auf einer Eisfläche, kaum breiter als ein Fenstersims. Die Wände der Spalte schimmerten blassblau, und die Höhlengänge schienen wie von innen her unheimlich beleuchtet. Der abrupte Temperatursturz traf ihn wie ein Schock. Seine Lungen japsten nach Luft, und er spürte keine einzige Faser seines Körpers mehr. Ein Zustand jenseits von Kälte, Atem oder Schmerz.
Kaum mehr bei Bewusstsein hörte er weit entfernt ein leises Grollen. Überrascht wurde ihm klar, dass es ein Motor war: ein Hägglunds.
Das Fahrzeug hielt an, und knarrend öffnete sich eine Tür. Arindam vernahm das Rascheln menschlicher Bewegungen, das Knirschen von Schritten auf dem Schnee. Es schien eine ganze Zeit weiterzugehen.
Dann hörte er nur wenige Meter entfernt die Stimme eines Mannes, sein sanfter australischer Singsang hob und senkte sich im Wind. »Hier gibt’s keine Überlebenden«, sagte er. »Es sind alle tot.«
1
»Er ist ein Arschloch«, murmelte Daphne.
Kit Bitterfeld sah misstrauisch von ihrer Sonntagszeitung auf. Sie hatte ihre Mutter noch nie fluchen hören. Selbst jetzt, trotz ihrer Demenz, klang das Wort nicht so, als sollte es zu ihrem Wortschatz gehören.
Zögerlich blickte Kit in das Gesicht ihrer Mutter, studierte dessen wirren, triefäugigen Ausdruck. Die alte Frau saß in einem schmalen Einzelbett, aufrecht in die Kissen gelehnt. Obwohl es ein heißer Sommertag war, hatte sie ihre Heizdecke eingeschaltet, und ihre Wangen glühten rosig von der Hitze. Ihre alten Augen blickten sich suchend um.
»Wie bitte?«, sagte Kit mit müder, ausdrucksloser Stimme.
»Dieser Mann«, sagte Daphne, als ihr Blick schließlich auf Kits Gesicht zur Ruhe kam, »dein Mann.«
»Mein Ex-Mann«, verbesserte Kit sie.
»Ja, dieser Mann. Er ist ein Schloss.«
»Ein Schloss?«, erwiderte Kit leicht verwundert.
Daphne nickte, und Kit nickte ermutigend zurück. Sie hoffte, dass es sich nur um ein Nonsenswort handelte, ein wahlloses Feuern der Neuronen im Hirn ihrer Mutter. Kit hatte nicht die Energie, einen weiteren Ausraster zu verkraften, jedenfalls nicht heute.
»Ich habe es dir gesagt«, fuhr Daphne fort, »als du ihn mir vorgestellt hast. Ich habe dich vor ihm gewarnt. Ich sagte ›Er ist ein bemerkenswert gutaussehender Mann‹, nicht wahr? Wir standen in der Küche unseres alten Hauses, und du sagtest: ›Wir werden heiraten.‹ Und da habe ich dich gewarnt. Ich sagte: ›Weißt du, Kitty, es gibt Menschen, die einfach zu gut aussehen.‹ Und dieser Mann sieht zugut aus.«
Kit runzelte die Stirn und rutschte unbehaglich auf dem Stuhl herum. Sie war verdutzt, dass Daphne sich noch daran erinnerte.
An jenem Tag hatten sie beide allein in der Küche gestanden. Elliot war gerade auf die Toilette gegangen, und sie warteten darauf, dass er zurückkam. Sie unterhielten sich über Kits neue Frisur, einen selbst gestylten Pixie-Cut. Ihre Mutter machte ihr ein Kompliment, obwohl Kit den Pony zu kurz und zu gerade geschnitten hatte. Daphne sagte, der Schnitt gefalle ihr, sie sehe aus wie eine hübsche Jeanne d’Arc. Kit hatte sich gefreut.
Genau deshalb hatte sie der verkappte Tadel auch so überrascht.
»Du solltest vorsichtig sein, Kitty«, hatte Daphne plötzlich gesagt. »Ein gutaussehender Mann ist wie ein Schloss.«
Die heiße Kanne stand gluckernd auf dem Küchentisch, und die Teetassen schepperten bedrohlich. Kit fühlte eine jähe Schwere tief im Magen. Jetzt kommt’s, dachte sie. Ganz sicher würde ihre Mutter ihr gleich ein Er-kann-was-Besseres-als-dich-kriegen reinwürgen, und das ausgerechnet jetzt, wo sich Kit wegen ihrer Frisur ohnehin dämlich vorkam – und wo sie längst wusste, dass Elliot eine Nummer zu groß – und hübsch – für ihresgleichen war.
»Du kennst das alte Sprichwort«, sagte Daphne. »Ein gutaussehender Mann ist wie ein Schloss, und ein Schloss, das oft bestürmt wird, wird irgendwann auch fallen. Die Frauen werden ihn auf der Straße anhimmeln, werden sich ihm an den Hals werfen.« Ihre Augen verengten sich zu Schlitzen. »Und weil er ein Mann ist, wird ihm das gefallen. Er wird die Aufmerksamkeit genießen und auch ihre Avancen, und wart’s nur ab – er wird ihnen nachgeben.«
Just in diesem Augenblick war ihr ein Bild vom Vorabend in den Sinn gekommen: Elliot stand am Picknicktisch im Garten und unterhielt sich mit der langweiligen Lucia vom Buschwanderverein. Er lächelte höflich, warf hier und da einen Kommentar ein, um das Gespräch am Laufen zu halten, und sein markantes Kinn bewegte sich, seine Augen strahlten und funkelten wie immer. Selbst Lucia wirkte ausnahmsweise lebhaft.
Doch vom Haus aus, wo sie saß, konnte Kit auch sehen, wie Elliot den Kopf kaum merklich nach rechts neigte, dorthin, wo Melody nur ein paar Meter entfernt stand.
Melody trug einen kurzen, einteiligen Jumpsuit, die Art Hosenanzug, die man ganz ausziehen musste, um auf die Toilette zu gehen. Er ließ sie noch kindlicher wirken, als es ihre zierliche Figur ohnehin tat, ungeachtet all ihrer Tattoos. Sie balancierte wacklig auf lächerlich hochhackigen High Heels. Früher am Abend, als Kit einen bissigen Kommentar darüber hatte fallen lassen, hatte Melody beschwipst erklärt, dass sie in ihren Schuhen die ganze Nacht durchtanzen könne, selbst rückwärts, wenn es sein musste. Zum Beweis war sie auf Kit zugestakst und hatte dabei ihre Hüften kreisen lassen. Neben Melody war sich Kit furchtbar groß und unbeholfen vorgekommen. Sie hatte Melody einfach stehen lassen und war ins Haus verschwunden.
Durch das Wohnzimmerfenster beobachtete Kit anschließend, wie Melody lässig zu Elliot hinüberschlenderte und ihn am Arm berührte. Er begrüßte sie, als habe er längst gewusst, dass sie da war, und nur darauf gewartet, dass sie zu ihm rüberkam. Jetzt wirkte sein Lächeln endlich echt.
Und so hatte Daphne am Ende recht behalten: Elliot war bestürmt worden. Und er hatte nachgegeben. Aber es hatte einige Zeit gedauert, bis Kit den Betrug entdeckte. Zehn Jahre, um genau zu sein. Das Problem, wie ihr jetzt klar wurde, war, dass seine Liebe einem Kühlschranklicht glich – wann immer sie ihn sah, war das Licht an. Seine Liebe war ein strahlendes, honiggelbes Leuchten. Und wie ein Kleinkind hatte sie angenommen, dass dieses Licht auch dann leuchtete, wenn sie nicht da war.
»Ja, Mum«, sagte sie. »Es gibt Leute, die zu gut aussehen.« Sie versetzte ihrer Zeitung einen befriedigenden Klaps. »Zum Glück werde ich dieses Problem nie haben.«
»Ja, ich weiß, ich weiß«, sagte Daphne gedankenlos, und Kit musste kurz schmunzeln. Doch gleich die nächste Frage ihrer Mutter traf sie wie ein Faustschlag in den Magen. »Hat diese Frau ihr Baby schon bekommen?«
Kit holte scharf Luft und starrte auf ihre Zeitung. Die Worte verschwammen, doch ihr Tonfall verriet keinerlei Regung. »Nein, hat sie nicht, Mum. Melodys Geburtstermin ist erst im August.«
Kits Gedanken katapultierten sie eine Woche zurück, zum am ersten Jahrestag der Trennung, als Elliots bester Freund Grey in ihr Büro an der Universität gekommen war, wo sie in der Forschungsabteilung der zahnmedizinischen Fakultät arbeitete. »Komm rein«, hatte sie gesagt, während ihr der Kopf schwirrte. Sie hatte Grey seit mindestens sechs Monaten weder gesehen noch gesprochen, und sein Besuch kam völlig unerwartet. »Was führt dich her?«
»Tut mir leid, dass ich so unangemeldet reinschneie.« Grey mied ihren Blick. »Hast du einen Augenblick? Können wir uns kurz unterhalten?« Ohne eine Antwort abzuwarten, marschierte er herein und pflanzte sich auf den Hocker neben ihrem Schreibtisch. Als er auf sie herabsah, konnte sie seine Nasenhaare und den feinen Schweißfilm an der Oberlippe ausmachen. Er stemmte die Hände auf die Knie und holte tief Luft. »Ich wollte …«
Kit sprang auf und zeigte auf ein kleines Landschaftsgemälde hinter ihm. Das Bild gehörte zur Ausstattung der Universität. Ein Kollege hatte es ihr am Vortag ins Büro gebracht. Das Aquarell war langweilig und seelenlos, nichts, was Kit sich ausgesucht hätte. Aber sie mochte ihren Kollegen, und sie wollte ihn nicht kränken. »Weißt du«, sagte sie zu Grey, den Blick starr auf das Bild gerichtet. »Ich glaube, dieses Bild hängt schief. Könntest du es vielleicht …?«
Grey stand bereitwillig auf. Er hob die Hand und neigte den Rahmen mit einem Finger leicht nach links. Dann musterte er das Gemälde und setzte sich wieder. Anschließend nahm er sich die Zeit, ein Taschentuch hervorzuholen und sich die Nase zu putzen.
Doch sie konnte der Gelegenheit, Grey zu piesacken, schlicht nicht widerstehen. »Nein, ich fürchte, es hängt immer noch schief.« Sie dirigierte ihn und zeigte auf die rechte Seite. »Nein, mehr nach links«, befahl sie stirnrunzelnd. »Nein, ich glaube, das hat es nur noch schlimmer gemacht.« Als er es erneut versuchte, hielt sie den Atem an. »Ach, okay«, sagte sie schließlich. »Das sollte reichen. Fürs Erste.«
Grey nahm wieder auf dem Hocker Platz, die Beine jetzt weit von sich gestreckt. Er sah ihr in die Augen und wandte den Blick gleich wieder ab, sichtlich verärgert. »Kit, ich bin hier, weil Elliot mich gebeten hat, wegen der Scheidungsvereinbarung nachzufragen, und weil du und ich befreundet sind …«
»Sind wir das?«, fragte sie mit leiser Stimme.
»Ja«, sagte er. »Und ich weiß, dass das eine furchtbare Angelegenheit ist, und ich will nicht Partei ergreifen, Liebes – ich bin genauso im Team Kit wie im Team Elliot, das schwöre ich. Ich liebe dich so, als wärst du Teil meiner Familie.« Er hielt inne, das Taschentuch in der geballten Faust.
»Vielen Dank«, murmelte Kit mit einem Hauch von Sarkasmus in der Stimme. Sie bezweifelte, dass er diese Prise Spott bemerken würde – Grey war nicht nur extrem selbstbewusst, er war auch extrem unsensibel. Schon vor der Trennung konnte es vorkommen, dass er Kit mitten in einer Unterhaltung einfach stehen ließ, ohne ein Wort der Erklärung. Mindestens zweimal war das schon passiert. Einmal hatte sie Grey gerade eine Frage gestellt, als sein Blick auf einmal durch den berstend vollen Raum schweifte. Dann hatte er jemandem zugewunken und war einfach davon geschlendert. Der unerwartete Affront hatte sie verstört und gedemütigt. Zudem weckte er so manche Zweifel an seinen derzeitigen Liebes- und Treuebekundungen.
Offensichtlich war Grey als Elliots Abgesandter hier und machte sich bereit, eine einstudierte Rede vorzutragen. »Ich bin hier, um dich zu bitten, die Sache mit dem Scheidungstermin voranzubringen«, verkündete er.
Sie räusperte sich. »Du hättest dir die Mühe sparen und mich anrufen können, weißt du. Ich bin gerade mit den Vorbereitungen für eine längere Reise beschäftigt.«
»Ja, ich weiß.« Er warf einen Blick auf ihren Schreibtisch, wo Kits Reisepass auf einem Stapel Unterlagen lag. »Tatsächlich«, fuhr er fort, »hat Elliot mich genau deshalb gebeten, jetzt bei dir vorbeizukommen.« Grey blickte ihr tief in die Augen. »Du bist nie ans Telefon gegangen, wenn er angerufen hat, und er muss diese Sache so schnell wie möglich klären – vor deiner Abreise.«
Seufzend ließ sich Kit in ihren Stuhl zurückfallen. »Ich habe seine Anrufe nicht angenommen, das stimmt. Aber das liegt daran, dass die Anwälte sich jetzt um alles kümmern. Es gibt nichts, was ich persönlich da noch tun kann. Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Wir haben doch probiert, die Dinge unter uns zu regeln, aber es hat einfach nicht geklappt.« Sie hatten versucht, die Sachen aufzuteilen – die Wohnung, das Auto, die Möbel und ihre Rente. Vor ihrem geistigen Auge erschien Elliots Gesicht, rot und fleckig, wutverzerrt. Sie blinzelte, um das Bild wieder zu verscheuchen. »Es ist besser, solche Dinge von Unterhändlern regeln zu lassen.«
Wieso hatte Elliot jetzt Grey als Botschafter hergeschickt? Der Mann war alles andere als ein Diplomat.
»Ich bin hergekommen, um dir etwas zu sagen«, erklärte er wie als Antwort auf ihre unausgesprochene Frage. »Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast.« Er zögerte einen Moment. »Elliot und Melody erwarten ein Baby – im August. Ein kleines Mädchen.«
Seine Worte trafen sie wie ein Schlag. »Nein, das wusste ich nicht.«
Er bemühte sich nach Kräften, teilnahmsvoll zu wirken. »Mir ist klar, dass das schmerzhaft für dich sein muss«, sagte er ohne eine Spur von Mitgefühl. »Ich weiß, dass ihr, Elliot und du, versucht habt, ein Baby zu bekommen, also muss es sehr, sehr schwer für dich sein, das zu hören.« Er dämpfte seine Stimme, sprach ganz sanft. »Aber jetzt hat Elliot die Chance, mit Melody glücklich zu werden, und sie wollen, dass alles vorbei ist, wenn das Baby kommt. Wenn du noch etwas Liebe in dir hast, einen Funken Zuneigung für ihn, kannst du bitte, bitte deine Leute anweisen, sich ein bisschen zu beeilen? Vielleicht kannst du sie ja bitten, die Sache mit dem Rentenausgleich fallen zu lassen …?«
Kit wartete zwei Herzschläge lang, dann schenkte sie ihm ein grimmiges Lächeln. Grey war jetzt eindeutig vom Drehbuch abgekommen, denn Elliot hätte nie an ihre Gefühle appelliert. Elliot hätte ihr einen Tritt in den Bauch verpasst, aber selbst das wäre nicht so furchtbar würdelos gewesen.
»Gib ihm einfach irgendetwas«, sagte Grey, der ihr Lächeln als Zeichen ihres Wohlwollens missdeutete.
Sie lehnte sich zurück, verschränkte die Arme und neigte leicht den Kopf. Die Pose verlieh ihr ein wenig schmeichelhaftes Doppelkinn, aber das war ihr egal. Sie war erschöpft. »Ich bin ab nächste Woche weg und habe jede Menge Sachen zu packen«, erwiderte sie, ohne auf irgendetwas von dem, was Grey vorgetragen hatte, einzugehen. »Elliot wird sich mit meinen Anwälten in Verbindung setzen müssen. Es wird schwierig für sie sein, mich während des antarktischen Winters zu erreichen, und ich werde sie nicht direkt anrufen können. Ich bin von März bis November dort und werde die ganze Zeit arbeiten müssen. Aber die Anwälte sollten in der Lage sein, mir eine E-Mail zu schicken, wenn es nötig ist.« Sie seufzte. »Und vielleicht werde ich antworten.«
»Du willst einem früheren Termin also nicht zustimmen?«
»Nein.«
»Und es gibt nichts, was ich sagen könnte, um dich umzustimmen?«
»Nein.«
Er starrte lange und eindringlich auf ihren Schreibtisch. Als er wieder sprach, lag ein drohender Unterton in seiner Stimme. »Wenn du dich weigerst, wird Elliot dich vernichten. Er wird dir nichts lassen. Nichts, Kit. Du kannst froh sein, wenn du nie Kinder bekommst, denn du wirst sie in Armut großziehen müssen – das verspreche ich dir.«
Sie atmete kurz durch und zählte dann im Kopf bis zehn. Sie wünschte, sie könnte Grey auch wortlos sitzen lassen, so wie er es früher mit ihr getan hatte. Aber dies war nun mal ihr Büro, und er nahm ihren Raum in Beschlag. »Ich denke, du solltest jetzt gehen«, sagte sie.
Er blickte finster drein und hustete in sein Taschentuch. »Okay«, lenkte er ein. »Nun, ich glaube, das war sowieso alles, was ich zu sagen hatte.« Er stopfte das Taschentuch in sein Jackett.
Als Grey schon auf dem Weg zur Tür war, kam ihr eine Idee. »Weißt du, wenn ich es mir recht überlege, möchte ich Elliot doch etwas geben, als Zeichen meiner Zuneigung.«
Grey wandte sich verwundert um.
Kit stand auf und nahm das ungeliebte Gemälde von der Wand. Lächelnd drückte sie es ihm in die Hand. »Hier, gib ihm das.«
Als Grey die Tür zuschlug, lächelte sie noch immer.
Kit strich die Decke des überhitzten Bettes ihrer Mutter glatt. Sie stand auf und legte die Zeitung zurück auf den Nachttisch. Dann beugte sie sich vor und massierte Daphne sanft das Knie. »Ich muss jetzt los, Mum«, sagte sie.
»Wo gehst du hin, Liebes?«
»Ich verreise, Mum, ich werde dich eine Zeit lang nicht besuchen können. Ich hatte es dir schon gesagt.«
»Hast du das, Liebes? Ach, egal, das macht doch nichts. Geh du nur und tu, was du zu tun hast. Ich habe ja Maude, die mir Gesellschaft leistet.«
Maude war die ältere Schwester ihrer Mutter und seit frühster Kindheit das Ziel eines tief sitzenden Hasses, aber jetzt schien Daphne ihr vergeben zu haben. Es half, dass Maude seit dreißig Jahren tot war.
»Das freut mich zu hören«, sagte Kit. »Denn bei mir könnte es ein Weilchen dauern.«
2
Kit stand auf dem Dock und spähte empor zu dem gewaltigen orangefarbenen Schiff, das an Hobarts Macquarie Wharf festgemacht hatte. Die Southern Star, ein Eisbrecher und Versorgungsschiff für die Antarktis, ragte fast drei Stockwerke über dem Pier auf. Sie wirkte so robust und unverwüstlich wie ein Panzer, der alles in seinem Weg niederwalzen konnte, und verfügte über zwei Hubschrauber, ein Schleppnetzdeck und mehrere Forschungslabore. Das Schiff würde für die nächsten sechzehn Tage oder so ihr Zuhause sein, während sie die 5500 Kilometer von Tasmanien zur Macpherson-Station im australischen Antarktisterritorium zurücklegte.
Unten, im mächtigen Schatten der Star, waren zahlreiche Leute gerade dabei, sich feierlich von ihren Lieben zu verabschieden. Ein Mann ging langsam die Gangway hinauf, drehte sich hin und wieder um und winkte der Menge zu, als wäre er einer von den Beatles. Ein anderer schüttelte inmitten einer kleinen Menschenschar theatralisch eine Champagnerflasche. Und zwei kleine Kinder, ein Junge und ein Mädchen, spielten vergnügt mit Luftschlangen, wobei das Mädchen stocksteif dastand, während ihr Bruder sie einwickelte wie eine Mumie. Früher war es Tradition, dass bereits eingeschiffte Forschungsreisende und ihre Angehörigen am Hafen je ein Ende einer Luftschlange in der Hand hielten. Wenn das Schiff ablegte, dehnten sich die Papierstreifen so lange, bis sie schließlich rissen. Kit fand es schade, dass dieses Ritual nicht mehr erlaubt war. Die Kinder hatten etwas anderes gefunden, das sie mit Luftschlangen anstellen konnten, Kit aber gefiel die Symbolik, Menschen und Familien auf diese Art entzweizureißen. Es war so gnadenlos – und so endgültig.
Sie hatte sich der Expedition vor allem deshalb angeschlossen, um anderen Menschen zu entfliehen. Kit war noch nie in der Antarktis gewesen, doch als ihre Freundin Sally Ann Rivers ihr dort einen Job anbot, hatte sie die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Sie sehnte sich danach, irgendwo zu sein, wo niemand sie kannte, unter Fremden, die keine Ahnung hatten von dem Schmerz und der Erniedrigung, die sie durchlitten hatte. Sie brauchte eine Pause von den emotionalen Nachwehen der Scheidung. Also hatte sie unbezahlten Urlaub beantragt, und ihr Vorgesetzter hatte ihn genehmigt. Nun war sie offizielle Expeditionsteilnehmerin der Australian Antarctic Division, kurz AAD – der Antarktisabteilung der australischen Regierung. Sie hatte »einen geografischen Abgang« hingelegt, wie Sally es ausdrückte, in dem irrationalen Glauben, ein Ortswechsel würde all ihre Probleme lösen.
»Hey!«, brüllte eine vertraute Stimme freudig von oben.
Kit blickte auf und sah, wie Sally ihr vom ersten Deck der Star aus zuwinkte. Sie winkte zurück. Die beiden waren seit der High-School-Zeit befreundet. Damals war Sally noch ein wildes Partygirl mit langer dunkler Mähne gewesen. Sie hatte helle, geblümte Kleider und gemusterte Blusen getragen, während Kit eher ein stiller Bücherwurm gewesen war, der stets mit Dufflecoat und schweren Stiefeln rumlief. Im Laufe der Jahre hatten sich einige der Unterschiede zwischen ihnen ausgeglichen. Heute trug Sally ihr Haar kurz, und man traf sie eher in Trainingsanzug und Steppjacke. Kit hatte wie früher kurzes blondes Haar und bevorzugte meist Jeans und schwarze Rollkragenpullover – ein Outfit, das sie auch jetzt anhatte. Sie waren sich noch immer nah.
»Komm doch hoch!«, rief Sally. »Was machst du da unten?«
»Ich bin auf dem Weg zur Landungsbrücke«, erwiderte Kit.
»Gangway!«, antwortete Sally lachend. »Das nennt man heute Gangway.«
Bevor sie weiterlief, ging Kit im Kopf noch eine kurze Checkliste durch. Brieftasche und Reisepass befanden sich im kleinen Rucksack über ihrer Schulter. Die wichtigste Fracht war schon auf dem Schiff: ihre Forschungsinstrumente, ihre rote Überlebenstasche und ihre Polarausrüstung für Extremtemperaturen. Das waren die wesentlichen Dinge, die sie als Sallys Assistentin im Außeneinsatz brauchen würde. Solange noch die Sonne schien, würde Kit draußen in den eisigen katabatischen Winden der Ostantarktis arbeiten. Mithilfe ihrer Kenntnisse in forensischer Zahnmedizin sollte sie die Gebisse freilebender Weddellrobben untersuchen. Sie würde Sally dabei helfen, die Robben einzufangen, ihren Gesundheitszustand zu überwachen und ihren Kot aufzulesen. Im Grunde würde sie ans Ende der Welt reisen, um Kacke einzusammeln, hatte Sally gescherzt. Und als ausgebildete Zahnärztin würde sie zudem noch ein paar kleinere Aufgaben in der Krankenabteilung übernehmen.
Wenn die Sonne dann ab etwa Mitte Juni gar nicht mehr herauskam, würde Kit zusammen mit rund einem Dutzend anderer in der Station völlig im Dunkeln sitzen. Die letzte Maschine würde Anfang März vom Flugplatz Wilkins abheben und erst im Frühjahr wieder zurückkehren können. Es gab also kein Entrinnen aus der Isolation, nicht einmal in einem Notfall.
Die Wetteraussichten für den anstehenden Winter waren besonders düster. Trotz der Erwärmung durch den Klimawandel war dieser Februar unerwartet frostig gewesen. Anfang des Monats hatten Touristenschiffe vor der Antarktischen Halbinsel umkehren müssen, weil es, für die Jahreszeit absolut unüblich, schon Packeis gab. Jetzt war Mitte Februar, und die Witterung hatte sich weiter verschlechtert. Man überlegte, den Flugplatz vorzeitig zu schließen und die letzten Interkontinentalflüge zu streichen. Wenn das geschah, würde es keinen Weg zurück nach Hause geben, sobald die Southern Star ihre Versorgungsfahrt beendet und die Winterexpedition abgesetzt hatte. Kit würde dort festsitzen.
Sie konnte es kaum erwarten. Mit ungewohnter Leichtfüßigkeit schlenderte sie die Gangway empor.
An Deck erkannte sie ein paar vertraute Gesichter aus den Trainingseinheiten, die sie zur Vorbereitung hatte absolvieren müssen. Mitten auf dem Gang, den Rücken zu den Docks, stand einer der Hubschrauberpiloten. Er schien völlig davon eingenommen zu sein, Fotos vom Kunanyi zu schießen, auch Mount Wellington genannt. Er war glattrasiert und in eine dicke Jacke und einen Schal mit Tarnmuster gehüllt. Als sie sich vor ein paar Wochen zum ersten Mal begegnet waren, hatte er noch Wolverine-Koteletten, dazu trug er ein T-Shirt, auf dem The Man stand, mit einem Pfeil in Richtung Kopf. Ein zweiter Pfeil wies auf seinen Schritt. Über ihm prangten die Worte: The Legend. Sein Name war Kurt Wilder. Wie nicht anders zu erwarten, nannte Sally ihn seitdem »The Legend«.
Kit sah auch, wie der Stationsarzt Dustin Witherall einen der anderen Teilnehmer mit einer herzlichen Umarmung begrüßte. Wenn sie nicht draußen im Gelände war, würde sie Dustin unterstützen, sobald jemand von der Crew zahnärztlich behandelt werden musste. Dustin war ein umgänglicher Mann in den Vierzigern mit hoher Stirn und leicht vorstehenden Augen, die auf eine Schilddrüsenüberfunktion hinwiesen. Er war bei allen Expeditionsteilnehmern beliebt und hatte ihre Vorbereitungstreffen mit seiner herzlichen und humorvollen Art bereichert. Sie freute sich bereits darauf, mit ihm zu arbeiten, auch wenn ihr aufgefallen war, dass sein Feuereifer für Gesundheit und Sicherheit nahezu an Fanatismus grenzte. Bei der letzten Sitzung hatte er allen einen halbstündigen Vortrag darüber gehalten, wie wichtig es sei, schon zwölf Monate vor Abreise mit der Einnahme von Vitamin-D-Präparaten zu beginnen. Da Kit es vorzog, ihre Vitamine auf natürliche Weise zu sich zu nehmen, hatte sie ihre verschriebene Dosis, sobald sie sie erhalten hatte, klammheimlich entsorgt. Als Dustin sie jetzt entdeckte und ihr frenetisch zuwinkte, grüßte sie mit einer Spur schlechten Gewissens zurück. Sie wusste, dass er es gut meinte – schließlich war es sein Job, dafür zu sorgen, dass es ihnen an einem der unwirtlichsten Orte dieser Welt gut ging. Ein wenig Fanatismus war da schon verständlich.
Sie drängte sich zu Sally durch, die noch immer an der Reling lehnte und nach unten schaute. »Hey«, sagte Kit.
»Hey.« Sally drehte sich um und schlang einen Arm um sie.
Vom Kai aus winkten die Kinder mit emporgereckten Köpfen zum Schiff hinauf. Die beiden Freundinnen schauten Arm in Arm hinab und grinsten.
»Bereit für den Start zu einem anderen Planeten?«, fragte Sally.
»So bereit, wie ich nur sein kann.«
Sie hörten das Grollen der Schiffsmotoren und spürten es auch unter ihren Füßen. Es würde nicht mehr lange dauern bis zum Ablegen.
Sallys Blick wanderte zu den Ringen unter Kits Augen. »Glaubst du, er kommt, um Auf Wiedersehen zu sagen?«
Kit legte die Stirn in Falten. »Ganz bestimmt nicht. Elliot spricht nicht mal mehr mit mir. Ich glaube, ich hab’s geschafft, dass er endgültig angepisst ist.«
»Gut.« Sally hob ihre Wasserflasche zu einem gespielten Toast. »Darauf, Elliot gehörig ans Bein zu pissen.«
Kit prostete zurück. »Und auf die Mutter aller geografischen Abgänge.«
Sie lachten, während das Schiffshorn laut über den Hafen schallte.
Zwölf Tage nach Beginn der Reise saß Kit in der Schiffsmesse und musterte skeptisch sieben Paare körperloser Beine. Das Mobiliar des Gemeinschaftsraums bestand aus einer Reihe grauer am Boden festgeschraubter Tische und einem bunten Sammelsurium von Plastikstühlen. Vor einer der Wände hielten sich sieben Männer ein großes weißes Laken vor die Köpfe, um nicht erkannt zu werden, und stellten stolz ihre nackten Waden zur Schau. Kit und einige andere Frauen saßen in einer Reihe vor ihnen. Ihre Aufgabe bestand darin, die Besitzer der jeweiligen Unterschenkel zu erraten – der Wettbewerb trug den Namen »Finde deine Seemannsbeine«.
Die sieben Männer hatten sich erstaunlich schnell bereit erklärt, ihre Hosen auszuziehen. Einige hatten sich sogar ihrer Socken und T-Shirts entledigt. Auf einem Schild hinter der illustren Formation stand Bitte halten Sie diesen Bereich frei, doch keiner hatte sich darum geschert. Einer der Männer hinter dem Laken wollte wissen, ob eine der Frauen nicht Lust hätte, später am Abend unter seinem Bettzeug auch noch sein drittes Bein zu sehen. Die Männer grölten, die Frauen verdrehten nur genervt die Augen.
Eine kleine Schar hatte sich, in der Hoffnung auf etwas Unterhaltsameres als den üblichen Quizabend, zu der Veranstaltung eingefunden. Und doch war es nur ein Bruchteil der insgesamt siebzig Personen an Bord, von einigen ständigen Crewmitgliedern der Star – darunter der Erste und Zweite Offizier, ein Hubschraubermechaniker sowie die Köche – bis hin zu den Passagieren, einschließlich eines Journalisten, eines Wissenschaftlers und eines halben Dutzends Expeditionsteilnehmern, die nach Macpherson unterwegs waren.
In den letzten Tagen war das Schiff auf dem 60. Grad südlicher Breite unterwegs gewesen, und das Wetter hatte sich verschlechtert. Die Außentemperatur betrug eisige minus zwölf Grad Celsius – minus zwanzig, wenn man den Windchill-Effekt hinzurechnete. Die ozeanografischen Messungen des Tages hatten unter erschwerten Bedingungen begonnen, waren schließlich aber abgebrochen worden. Eine Gruppe von Wissenschaftlern der australischen Forschungsbehörde hatte einen Sensor hinabgelassen, um Versalzung und Sauerstoffgehalt zu bestimmen, doch die Strömung hatte die Leine vom Kurs abgebracht.
Etliche der erschöpften Crewmitglieder waren auf der Suche nach etwas harmloser Ablenkung. Zu Hause wären sie dazu wohl in den örtlichen Pub gegangen, hier jedoch mussten sie sich mit einem Gesellschaftsspiel aus den 1950ern begnügen. Der Konsum von Alkohol war von der Antarktisabteilung strengstens verboten worden. Der heiß begehrte Preis, der der Gewinnerin des Abends winkte, bestand in einer Packung eingeschmuggelter Anti-Übelkeits-Tabletten aus Neuseeland.
Man konnte wohl sagen, dass Kit noch immer nicht ganz seefest war, oder, wie man an Bord sagte, ihre »Seemannsbeine noch nicht gefunden« hatte. Nach einem langen Tag mit Orkanböen und neun Meter hohen Wellen hatte sie ihr Abendessen weit verteilt auf ihrem Bett wiedergefunden. Trotz seiner massigen, panzerartigen Bauweise wippte das Schiff in der rauen See unaufhörlich auf und ab. Aber Kit war nicht die Einzige, der blümerant geworden war. Auch Sally berichtete, sie habe ihr Müsli noch am Frühstückstisch in eine entsprechende Tüte erbrochen, und niemand habe mit der Wimper gezuckt. Nur die abgebrühtesten Seebären waren verschont geblieben. Diese Nacht, so hoffte Kit, würde etwas ruhiger werden.
Sally hatte sie aus ihrer Kabine gelockt, um sich mit ihr gemeinsam diesen Spaß zu gönnen. Als sie den Korridor entlangwankte, schob der Wellengang sie gegen die Wand. Die beiden torkelten in die Messe wie zwei Betrunkene auf Kneipentour. »Na, na, Mädels – nur nicht zu überschwänglich«, flachste einer der Hubschraubermechaniker von einem Tisch ganz in der Nähe.
Kit setzte sich ungeschickt auf einen Stuhl, und eine englische Expeditionsteilnehmerin namens Alessandra brachte ihr ein Blatt Papier und einen Bleistift. Alessandra, eine schlanke, aparte Frau mit grauem Haar, schaffte es auf wundersame Weise, selbst in Thermotop und wasserdichter Hose stylish auszusehen. Sally und Kit hatten sie ein paar Monate zuvor bei einem Vorbereitungstraining kennengelernt, und sie waren Freundinnen geworden. »Heute Abend soll das Wetter besser werden«, versicherte Alessandra ihnen lächelnd. Alessandra sollte es wissen – sie würde in diesem Winter in Macpherson ihre Meteorologin sein.
Sie hatte das heutige Spiel vorgeschlagen und überdies noch einen weiteren Vorteil: Ein Paar Männerbeine gehörte ihrem Gatten Gareth.
»Glaubst du, Alessandra wird Gareths Schienbeine erkennen?«, sinnierte Kit, als Alessandra wieder weg war.
»Oh, darauf würde ich nicht wetten«, erwiderte Sally. »Irgendwie bezweifle ich, dass Alessandras Eheleben ein endloses Fest hüllenloser, unbändiger Lust ist.«
Gareth war der unterkühlte einsilbige Typ Wissenschaftler, der anderen selten in die Augen sah. Groß, dürr und immer leicht gebückt war er Kit und Sally in den schmalen Gängen schon des Öfteren begegnet, ohne sie auch nur mit einem Kinnnicken zu würdigen. Alessandra wiederum war das komplette Gegenteil – extrovertiert und überaus kontaktfreudig. Sie beide würden in diesem Winter die Wetterstation in Macpherson überwachen, um sicherzustellen, dass sie ihre Daten automatisiert nach Australien sandte.
Nach einer kurzen Einführung in die Spielregeln waren die Männer schließlich hereingetrippelt, seitwärts wie im Krebsgang, das Laken sorgfältig über den Köpfen. Mehrere Minuten lang herrschte in Kits Kopf sowie auf ihrem Antwortbogen gähnende Leere. Sie kaute am Ende ihres Bleistifts herum, während sie angestrengt versuchte, die Haarfarbe des Beines ganz links zu erraten. Die stämmige Wade besaß so gut wie keinen Muskeltonus. Sie wirkte völlig unbehaart, doch als das Bein empor ins Licht geschwungen wurde – der halbherzige Versuch einer Burlesque-Show –, waren ein Hauch rotbrauner Stoppeln und Sommersprossen zu erkennen. Kit vermutete, dass das Bein dem rothaarigen Elektriker namens Blondie Richmond gehörte.
Kit hatte Blondie am zweiten oder dritten Tag der Reise etwas näher kennengelernt. Blondie war ein erfahrener Expeditionsteilnehmer und hatte sie im Nu als Grünschnabel entlarvt und aufgefordert, ihr am Bug Gesellschaft zu leisten, um gemeinsam Albatrosse zu beobachten. Mit seinem großen, rosigen Gesicht und seinem breiten, schelmischen Grinsen erinnerte er Kit an ihren kriminellen Vetter aus Bendigo.
Mit fünfzig war Blondie fünfzehn Jahre älter als Kit – anscheinend aber noch immer jung genug, dass er sich Chancen bei ihr ausrechnete. Ihr war aufgefallen, dass er in der Messe heimlich zu ihr herübergeschielt hatte, also bestand sie darauf, dass Sally mit nach draußen kam.
Mindestens eine halbe Stunde lang standen die drei in ihren dicken Fleecejacken und polarisierten Sonnenbrillen an Deck. Es war windig, und die Gischt benetzte ihre Haare und Gesichter. Die Reling fühlte sich eiskalt an, doch der Tag war hell und sonnig, der Himmel eine strahlend blaue Weite.
Staunend starrten sie hinaus aufs sanft wogende Südpolarmeer. Wenn sie sprachen, dann nur kurz – etwas Geplauder, ein paar beiläufige Beobachtungen. Sie schossen Fotos und schlenderten ziellos übers Deck. In der ganzen Zeit entdeckten sie nur einen einzigen Albatros: ein einsames weißes Kreuz am Himmel, das das Schiff dreizehnmal umkreiste.
Sally zählte mit. »Bringt das Unglück?«, fragte sie, nahm die Kamera herunter und spähte blinzelnd in den Himmel.
»Nö« antwortete Blondie. »Nur, wenn man ihn mit ’ner Armbrust abschießt.«
Sally lachte über die unerwartete Coleridge-Anspielung.
»Ich glaube, eigentlich sollten sie einem sogar Glück bringen«, stimmte Kit ihm zu. »Schau dir doch die Kreuzform ihrer Silhouette an. Wenn man religiös oder abergläubisch ist, ist das Zeichen des Kruzifix’ ein Segen.« Die allumfassenden Arme Jesu, dachte sie, die den Leidenden Beistand und Trost spenden. Oder so etwas in der Art. Sie breitete die Arme aus, um es zu zeigen.
»Ein Segen?«, fragte Sally verwundert.
»Klar«, sagte Blondie, »ein Segen. Wie der grüne Blitz – habt ihr schon mal vom grünen Blitz gehört?« Kit und Sally schüttelten den Kopf. »Unter den richtigen Bedingungen kann man in einer klaren Nacht auf See, wenn die Sonne am Horizont versinkt, einen grünen Blitz sehen. Einer schottischen Legende nach werden alle, die diesen Blitz erblicken, mit einer besonderen Fähigkeit gesegnet: Sie können in Herzensdingen nie wieder getäuscht werden. Sie werden in der Lage sein, klar und deutlich in ihr eigenes Herz zu blicken und die Gedanken anderer zu lesen.« Blondie spähte weise Richtung Horizont.
»O mein Gott«, entgegnete Sally. »Das ist kein Segen, das ist ein Fluch! Ich will nicht hören, was andere Leute denken.«
»Ich auch nicht«, pflichtet Kit ihr bei. »Schlimm genug, dass Millionen von Menschen jeden ihrer Gedanken in den sozialen Medien rausposaunen. Warum sollte man noch mehr davon hören wollen?« Auf dieser Reise hatten sie keinen Fernseher, kein Radio und kein Internet; in Macpherson würden sie nur eingeschränkten Zugang zu E-Mails haben und sehr begrenzt ein Satellitentelefon nutzen können. Kit war heilfroh, von ihrem Mail-Posteingang befreit zu sein.
»Genau, haltet endlich alle mal das Maul!«, donnerte Blondie derb gen Himmel. Die beiden Frauen lachten überrascht auf. »Aber den grünen Blitz, den gibt es wirklich«, fügte er hinzu. »Ich hab ihn mit eigenen Augen gesehen. Er ist nur ein optisches Phänomen, eine Lichtbrechung in der Atmosphäre. Aber es gibt ihn, Segen hin oder her.«
»Wie ich diese bärbeißigen Schotten kenne«, sagte Kit, »gilt er wahrscheinlich als Vorbote einer Tragödie oder Katastrophe. Du weißt schon, die bösen Geister, die uns eine Botschaft senden. Ich bezweifle, dass er etwas Gutes bringt.«
»Hey«, erwiderte Blondie mit gespielter Empörung. Er zog die Augenbrauen hoch und deutete auf seinen keltischen Rotschopf und sein sommersprossiges Gesicht. »Sag ja nichts gegen die Schotten.«
Blondies nackte Beine hatte Kit an diesem Tag nicht zu Gesicht bekommen. Er hatte einen knallroten Regenoverall getragen, den sie damals für reichlich übertrieben hielt, so lange bis sie in ihre Kabine zurückkehrte und merkte, wie feucht und klamm ihre Hosen geworden waren.
Nun musterte sie die nackten Männerbeine in der Reihe abermals. Wenn die hier Blondie gehörten, dann stand er wahrscheinlich neben seinem besten Freund, einem anderen Handwerker namens Warren.
Die Männer auf der linken Seite rammten sich ständig die Ellenbogen in die Seite und versuchten, ihre Kumpel zum Lachen zu bringen, damit sie das Laken fallen ließen.
Ja, das könnte es sein, dachte sie. Auf ihrem Zettel notierte sie in ihrer kleinen, engen Handschrift: 1. Blondie. 2. Warren.
Sally beugte sich zu ihr herüber und warf einen Blick auf Kits Antworten. »Und das muss The Legend sein«, flüsterte sie und zeigte nach ganz rechts.
Diese Beine waren braun und durchtrainiert – und womöglich gar rasiert. Sie sahen aus, als gehörten sie einem Radfahrer, jemandem, der sich am Wochenende gern in hautenges Lycra zwängte. Als er an der Reihe war, die Beine in die Luft zu werfen, schwang er sie so hoch, dass die Menge einen Blick auf seine rote Unterhose erhaschen konnte. Eine Frau hinter Kit stieß einen ohrenbetäubenden Schrei aus.
Kit zuckte zusammen. Um ehrlich zu sein, war sie nicht ganz bei der Sache, und auch ihre Seekrankheit meldete sich wieder; der Wellengang setzte ihrem Magen zu. Sie beugte sich nach vorn und schielte verstohlen auf ihre Armbanduhr. Sie war erst seit zwanzig Minuten in der Messe. O Gott, wie sich der Abend hinzog.
In diesem Augenblick fiel ihr der bärtige Mann auf, der vom anderen Ende der Messe aus zu ihr herübersah: Jamie Betterworth, der Erste Offizier. Sie war verwundert, ihn hier zu entdecken. Normalerweise saß er in einem bequemen Sessel auf der Schiffsbrücke, studierte eine Reihe Seekarten und einen riesigen Computerbildschirm. Jetzt hob er zum Gruß seine Tasse Tee. Kit hielt ihren Zettel hoch. Er lächelte und kam zu ihr und Sally herüber.
Als er sich neben sie hinkniete, geriet das Schiff plötzlich ins Schwanken, und er musste sich an ihrer Lehne festhalten. Er streifte sie mit seinem Arm, eine Woge menschlicher Wärme auf ihrem Schulterblatt. »Wow«, sagte er. »Möchten Sie mit hochkommen? Ich schulde Ihnen noch eine Führung.«
»Hey«, beschwerte Sally sich, »warum darf sie mit auf die Brücke?« Sally blickte noch immer unverwandt geradeaus, die Augen starr auf die Männerbeine gerichtet.
»Weil ihr hier euren Spaß habt, diese Lady aber aussieht, als könnte sie ein wenig Ablenkung vertragen«, sagte Jamie.
»Ablenkung!« Sally zeigte auf die illustre Schau stattlicher Gliedmaßen. »Was für eine bessere Ablenkung könnte sich eine Frau bitte noch wünschen?«
»Stimmt. Ich kann mir keine bessere Zerstreuung vorstellen als blasse, behaarte Männerbeine. Aber ich habe dieser Lady zu Beginn unserer Reise versprochen, ihr die Brücke zu zeigen, und jetzt ist schon Tag zwölf – die Fahrt ist fast vorüber.«
»Ja, ja«, sagte Sally mit gespieltem Ärger. »Nur zu, flaniert ihr nur über die Brücke. Mir doch egal.«
Mit Jamies Hilfe stand Kit auf. »Hier, nimm meinen Lösungszettel«, sagte sie zu Sally und verließ mit wackligen Schritten ihren Platz. »Und mach mir keine Schande.«
Draußen auf dem Gang lächelte Kit Jamie an. »Danke. Ich hatte keinen Schimmer, wer diese Männer waren.«
»Sie wirkten, als könnten Sie einen Vorwand brauchen, sich davonzustehlen«, antwortete er und grinste breit durch seinen Rauschebart. »Sie sehen ein bisschen grün um die Nase aus.«
»Ja«, antwortete Kit.
In geselligem Schweigen stiegen sie das schmale Treppenhaus zum Brückendeck empor. Das Triebwerk unter ihren Füßen gab ein leises Grollen von sich. Die Wände auf beiden Seiten vibrierten.
»Und was hat Sie dazu gebracht, zu dieser Festlichkeit herabzusteigen?«, fragte Kit.
»Eigentlich nur die Aussicht auf einen Happen zu essen. Ich war so dumm zu glauben, ich könnte etwas bei mir behalten.«
»Ach.« Sie war überrascht. »Ich dachte, Sie würden zu den wenigen Glücklichen gehören.«
»Nee, ich auch nicht«, erwiderte er lachend. »Wenn es draußen so lange derart rau ist, gibt es kaum jemanden, der sich nicht die Seele aus dem Leib kotzt.«
»Ach wie entzückend.«
»Trotzdem hatten wir ziemlich viel Glück. Es könnte schlimmer sein. Die Snow Petrel sitzt schon seit drei Wochen im Eis fest. Wir sind wenigstens unterwegs.«
Die Snow Petrel war ein Versorgungsschiff für die Antarktisregion. Es kam von der Casey Station und dem Amery-Schelfeis und war auf dem Rückweg Richtung Hobart in der Prydz Bay in schwerem Packeis stecken geblieben. Obwohl sie eigentlich imstande sein sollte, selbst Eis zu brechen, fand sich die Petrel nun in einem antarktischen Albtraum wieder, umschlossen von einer Wand aus Eis und völlig manövrierunfähig. Eine Weile lang war das Schiff erst auf die Küste zugetrieben, ohne den Kurs ändern zu können. Währenddessen blieb den vierundzwanzig Menschen an Bord – Crew samt Passagieren – nichts anderes übrig, als zu warten, bis das Eis sie wieder freigab.
Aus einer Entfernung von mehreren Hundert Kilometern hatte die Southern Star ihre Misere verfolgt. Es war nicht das erste Mal, dass ein Schiff im Sommer in der Bucht eingeschlossen war. In den Jahren 2001/2002 hatte das Versorgungsschiff Polar Bird einen ganzen Monat im gefrorenen Eismeer festgesteckt, bis ein anderer Eisbrecher ihm zur Hilfe gekommen war. Die Star wartete gespannt auf Neuigkeiten von der Petrel, für den Fall, dass sie diesmal gebraucht würde.
Wenn ein starker Südostwind aufkäme, meinte Jamie, dann könnte der das Eis genügend auflockern, damit die Petrel freikam. Doch die Kaffeevorräte waren bereits auf ein gefährlich niedriges Niveau geschrumpft – in ein paar Wochen würde die Crew anfangen müssen, Instantkaffee zu trinken. »Das wird ’ne Meuterei geben, sag ich Ihnen.« Jamie schüttelte den Kopf.
»Wie furchtbar. Werden sie dann unsere Hilfe brauchen?«, fragte Kit außer Atem. Sie hatte Mühe, mit dem Offizier Schritt zu halten, während sie ihm durch die engen Gänge folgte.
»Keine Ahnung.« Er zuckte die Achseln. »Wenn die Bedingungen dort wirklich so übel sind, wollen wir es nicht riskieren. Aber vielleicht kommen wir ja nah genug heran, um einen Hubschrauber zu schicken und einen Teil der Besatzung zu evakuieren. Wir könnten auch deren Vorräte aufstocken, wenn nötig.« Die Star hatte Notfallrationen für volle neun Monate geladen.
»Das könnte sie vor einem schlimmeren Schicksal bewahren als Instantkaffee«, sagte Kit.
»Kommt auf das Wetter an. Ein Helikoptereinsatz könnte gefährlicher sein als ein Versuch, das Eis zu brechen. Wir warten erst mal ab. Vielleicht ist es am besten, wenn wir uns eine Schneise schlagen und dann die Petrel rausschleppen.«
»Schleppen?«
»Ja, mit einem Schleppseil. Bei der Polar Bird hat das geklappt. Es ist nicht so schwierig, wie es klingt. Wir warten, bis wir vom Captain Bescheid bekommen. Es eilt wirklich nicht. Die kommen noch eine Weile zurecht.«
Kit und Jamie erreichten die Brücke. Er hielt ihr die Tür auf, und Kit betrat als Erste den Raum. Obwohl es schon früher Abend war, war die Brücke in helles natürliches Licht getaucht. Durch die Scheibe konnte Kit in der Ferne einige tafelförmige Eisberge erkennen. Ein Meer geriffelter Schäfchenwolken kräuselte den Himmel über ihnen, während gischtgekrönte Wellen an die Bordwand leckten.
Richard King, der Kapitän, saß mit einer Tasse Kaffee in der Hand in seinem bequemen Sitz am Steuerstand. King war ein schlanker grauhaariger Mann von etwa fünfzig Jahren. Er trug Jeans, einen Thermopulli und eine marineblaue Jacke. Sein legeres Äußeres stand im Kontrast zu den zwei Navigationsoffizieren, die beide in leuchtend orangefarbene Overalls gehüllt waren.
»Hallo zusammen«, sagte Jamie. »Ich habe Kit zu einer spontanen Führung mitgebracht. Wir haben gerade über die Petrel gesprochen.«
»Ach, stimmt«, sagte der Kapitän kopfschüttelnd. »Ich habe erst vor einer Stunde mit ihnen telefoniert. Sieht aus, als würden die da drüben die Kontrolle verlieren.«
»Über das Schiff, wegen des Eises?«, fragte Jamie.
»Nein«, erwiderte der Kapitän grimmig, »über die Crew.« Doch dann schenkte er ihnen ein beruhigendes Lächeln. »Nichts Ernstes. Nur ein bisschen Lagerkoller. Der Captain meinte, heute sei es auf dem Helideck zu Handgreiflichkeiten gekommen.«
»Handgreiflichkeiten?«, fragte Kit.
»Eine Schlägerei zwischen zwei Männern – zwei Wissenschaftlern, wie es scheint.«
»Prügelnde Wissenschaftler?«, fragte Jamie ungläubig. »Ach, du meine Güte. Klingt, als wäre es an der Zeit, die Leute rauszuholen.«
Richard lachte. »Nun …« Er zögerte. Dann sah er Kit an und fuhr eine Spur förmlicher fort: »Der Direktor für Expeditionen bei der AAD rät uns, im Moment nichts zu unternehmen. Das Wetter könnte sich bessern. Schließlich ist erst Februar, da kann sich noch eine Menge ändern. Die Schiffsleitung wird ein Programm mit Freizeitaktivitäten zusammenstellen – Sie wissen schon, die Leute dazu animieren, in Teams zusammenzuarbeiten. Vielleicht machen sie ein paar Auffrischungskurse, Quizabende, gemeinsames Kochen, Karaoke oder so was.«
»Klar doch. Karaoke. Das wird sie bestimmt aufmuntern«, höhnte Jamie. Mit einem flinken Satz sprang er auf seinen erhöhten Sessel.
Kit stand schweigend neben ihm und blickte aus den Panoramafenstern auf die grau wogende See. Das Glas war feucht und beschlagen.
»Ja, eine Party könnte auch was bringen«, meinte der Kapitän und nahm einen Schluck aus seiner Tasse. »Es scheint da ein paar Spannungen zu geben, die gelöst werden müssen.« Er sah hinab auf seinen Kaffee und runzelte die Stirn. Nach kurzem Schweigen fragte er: »Kennt sich einer von Ihnen vielleicht mit der Bibel aus?«
»Ich nicht«, antwortete Jamie.
Einen Moment lang herrschte Schweigen. Der Motor knurrte und ächzte unter ihren Füßen. Die Navigationsoffiziere hantierten an ihren Instrumenten.
»Ich schon, na ja, ein bisschen wenigstens«, sagte Kit. Als einstige Anglikanerin hatte sie früher immer den Kindergottesdienst besucht.
»Da war diese eine Sache, die der Captain erwähnt hat, bevor die Verbindung abgebrochen ist«, erklärte King. »Etwas, das sich anhörte, als stamme es aus der Bibel. Er hat es irgendwie gemurmelt, wie ein Gebet. Sagte es immer und immer wieder. Ich bin nicht sicher, was es bedeutet.«
»Ich sage Ihnen, was es bedeutet«, brummte Jamie. »Der arme Kerl verliert den Verstand, das bedeutet es. Zu viel Druck. All das Eis. Die Einsamkeit da draußen, nichts zu sehen außer diesem nackten, strahlend hellen Weiß. Und auch keine Bewegungsfreiheit. Das würde mich auch irre machen.«
Der Kapitän schenkte Jamie keine Beachtung. »Er sagte, sie hätten viele Dinge unternommen, um die Lage zu verbessern, aber eines hätten sie vernachlässigt. Eins aber ist not. Er sagte es immer wieder.« Er sah Kit an. »Haben Sie diesen Satz schon mal gehört?«
»O ja«, antwortete sie. Der Satz kam ihr sofort bekannt vor. Fast konnte sie das strenge Antlitz ihrer Mutter vor sich sehen, wie es auf sie herabblickte und jedes Wort so deutlich aussprach, als wäre es allein für sie geschrieben worden. »Er stammt aus dem Neuen Testament«, sagte sie. »Als Jesus die Schwestern des Lazarus besucht, tadelt er eine von ihnen – Martha, glaube ich – dafür, dass sie sich so um ihn sorgt und sich um alles kümmert, außer um das Wichtigste, ›was not ist‹.«
»Und was war das?«, wollte Jamie wissen.
Ratlos zog Kit die Stirn in Falten. »Ich glaube, dazu gibt es verschiedene Deutungen. Die meisten aber meinen, dass es sich auf die Erlösung der Seele bezieht. Das eine, ›was not ist‹, ist die Erlösung oder Errettung der Seele vor ihrer Vernichtung.«
Die drei sahen sich an. Kits verzog keine Miene, während Jamie verwundert und etwas verwirrt die Brauen hochzog.
Der Kapitän runzelte die Stirn, dann schüttelte er den Kopf. »Wahrscheinlich hat es nichts zu bedeuten. Er ist wohl nur ein religiöser Spinner.«
»Was meinen Sie damit, dass es nichts zu bedeuten hat?« Jamie lachte auf, ein freches Funkeln in den Augen. »Er hat doch eindeutig ein SOS gesendet! Offenbar ein ziemlich seltsames und kryptisches, aber doch ein SOS. Was er im Grunde damit sagen wollte, war: ›Rettet unsere Seelen.‹« Jamie verschränkte die Hände zu einem ironischen Bittgebet.
Einer der Navigationsoffiziere schielte leicht besorgt zu ihnen herüber.
Der Kapitän grinste und schüttelte weiterhin den Kopf. »Okay, ich glaube nicht, dass wir schon die Kavallerie losschicken müssen.«
Der Navigationsoffizier wandte sich wieder seiner Arbeit zu.
»Wenn der Captain der Petrel ein SOS senden möchte«, fügte Richard noch hinzu, »dann soll er gefälligst ein ordentliches Notsignal verwenden, wie alle anderen. Er muss keine Bibelsprüche runterbeten, und erst recht nicht vor einem Haufen Atheisten.«
Der Kapitän und sein Erster Offizier lachten gut gelaunt und glucksend auf.
Kit musste über diese Albernheiten schmunzeln. Insgeheim fragte sie sich jedoch, ob die Spannungen auf der Petrel eskalieren würden. Es war bestimmt nicht einfach, an Bord gefangen zu sein, ohne zu wissen, wann die Isolation enden würde – und sicherlich noch schlimmer, mit jemandem festzusitzen, den man hasste.
Nach einer kurzen Erklärung der Steuerinstrumente auf der Brücke bot Jamie Kit an, sie draußen herumzuführen. Er wollte mit ihr aufs Deck über ihnen gehen, aufs »Mandrill Island«, den höchsten Punkt des Schiffes. Dort oben hatte man die beste Aussicht, und sie würden den Sonnenuntergang betrachten können. Zuerst aber würden sie ihre Kälteschutzkleidung anziehen müssen. Die See war zwar ruhiger geworden, doch Sturmhauben und grell orangerote Overalls waren hier noch immer die streng vorgeschriebene Outdoormode.
Zurück in ihrer Kabine hockte Kit sich auf ihr Bett und vergrub das Gesicht in beiden Händen. Sie rieb sich die Wangen und starrte zu Boden. In Augenblicken wie diesen, wenn sie ganz allein war, kehrte der Kummer zurück. Jeder Gedanke an ihr Leben in Hobart – der Betrug, die gescheiterte Einigung, die Schwangerschaft – war wie ein Stich, der ihr Elend noch verstärkte. Wieder einmal dachte sie zurück an Elliots Miene, als sie ihn das letzte Mal gesehen hatte: Wütend und gequält hatte er Worte ausgespien, die ihr Herz trafen wie Giftpfeile. Sie hasste ihn für das, was er getan hatte, hasste ihn dafür, dass er sie verlassen hatte. Sie würde ihm nie verzeihen, dass er ausgerechnet dann gegangen war, als sich Daphnes Geisteszustand so verschlechtert hatte.
Schon bald würde sich nicht einmal ihre eigene Mutter mehr an sie erinnern. Es war eine schreckliche Vorstellung, so allein und ohne Liebe zu sein.
Am liebsten hätte Kit sich auf den kratzigen Teppich gelegt, sich wie ein Fötus zusammengekauert und vom Wogen des Schiffes in der Kabine hin und her rollen lassen. Doch das Auf und Ab der Star war jetzt nicht mehr so dramatisch, dieses tiefe Ein- und Ausatmen des Schiffes mit dem Wellengang. Es fuhr – Gott sei Dank – einigermaßen ruhig. Und sie wurde draußen auf Deck erwartet.
Kit schüttelte die Schwermut ab und schlüpfte in ihre Polarkleidung.