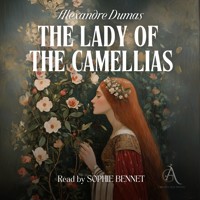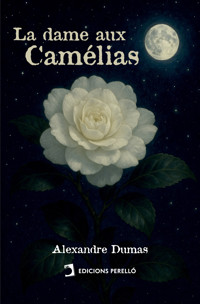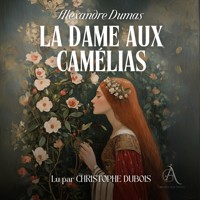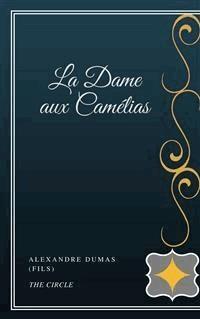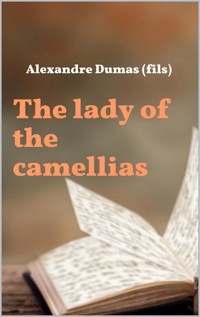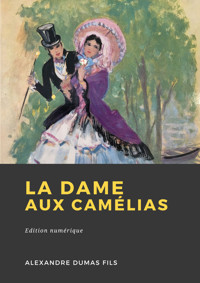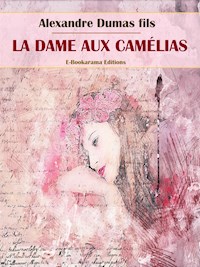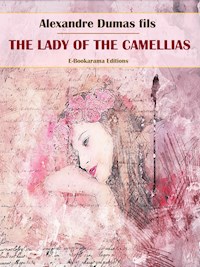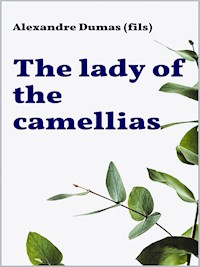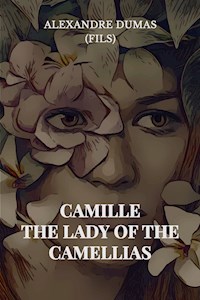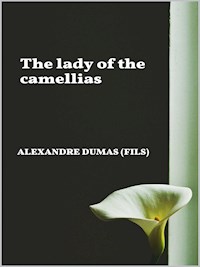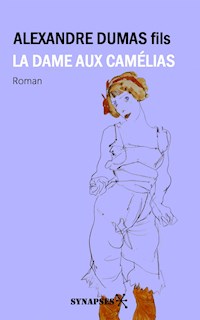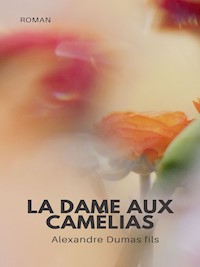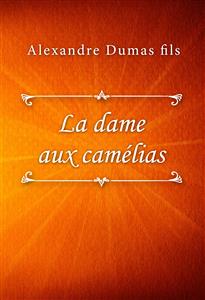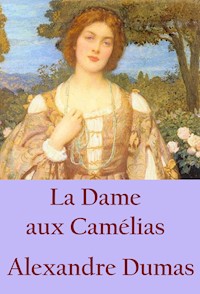5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Romeo und Julia in Paris.
Marguerite liebt Armand, einen jungen Mann aus den besten Pariser Kreisen. Als ihr von seinem Vater vorgehalten wird, sie stehe dem Glück Armands im Wege, beugt sie sich den Forderungen der Gesellschaft, die keine ehemalige Kurtisane in ihren Reihen dulden will ...
An der Wende von der Romantik zum Realismus entstand die ergreifende Geschichte der hochherzigen Kokotte, die aus Liebe ihrer Liebe entsagt.
"Dumas verpackt in seine Geschichte subtile Kritik an einer Gesellschaft, die mehr Wert auf Abstammung und Besitz legt als auf den Menschen selbst." NZZ am Sonntag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2021