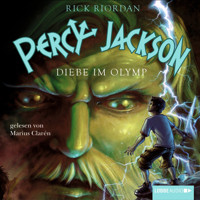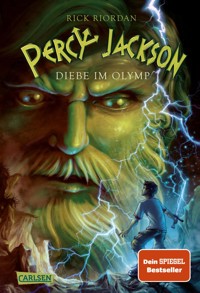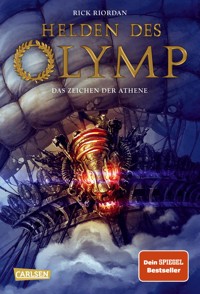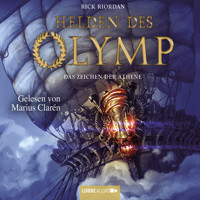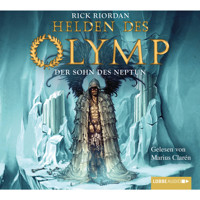Die Kane-Chroniken: Ägyptische Götter und mythische Monster – alle Bände der Fantasy-Trilogie in einer E-Box! E-Book
Rick Riordan
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Bei einem öden Besuch im Britischen Museum beginnt für Carter und Sadie Kane das Abenteuer. Ihr Vater, ein berühmter Archäologe, entpuppt sich als mächtiger ägyptischer Magier - und er hat sich mit den Göttern angelegt. Sadie und Carter müssen es mit jeder Menge ägyptischer Götter und Monster aufnehmen. Und sie selbst verfügen über mehr magische Kräfte, als sie sich je erträumt hätten. Spannung, Abenteuer und Humor – dazu jede Menge bestens recherchierte Informationen über die ägyptische Götterwelt! Diese E-Box enthält alle 3 Erzählbände der Bestseller-Serie DIE KANE-CHRONIKEN: Band 1: Die rote Pyramide Band 2: Der Feuerthron Band 3: Der Schatten der Schlange »Eine Geschichtsstunde über das alte Ägypten, die elegant in ein packendes Abenteuer eingewoben ist.« Publishers Weekly »Ein Fest für Rick Riordans Leser, ob jung oder alt.« The New York Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Carlsen-Newsletter: Tolle Lesetipps kostenlos per E-Mail! Unsere Bücher gibt es überall im Buchhandel und auf carlsen.de.
Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Weitere Serien von Rick Riordan bei Carlsen: Percy Jackson Percy Jackson - Der Comic Die Kane-Chroniken Helden des Olymp Percy Jackson erzählt Magnus Chase Die Abenteuer des Apollo
Auch als Hörbuch bei Silberfisch
Alle deutschen Rechte bei Carlsen Verlag GmbH, 2022 Originalcopyright © 2010/2011/2012 by Rick Riordan Originalverlag: Hyperion Books for Children, an imprint of the Disney Book Group Permission for this edition was arranged through the Gallt and Zacker Literary Agency Originaltitel: »The Red Pyramid«, »The Throne of Fire«, »The Serpent's Shadow« Copyright der deutschen Ausgaben © Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2011-2022 Umschlagillustrationen © Helge Vogt, trickwelt.com Umschlaggestaltung und -typografie: formlabor Aus dem Englischen von Claudia Max ISBN 978-3-646-93703-9
Von Rick Riordan im CARLSEN Verlag erschienen: Percy Jackson – Diebe im Olymp (Band 1) Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen (Band 2) Percy Jackson – Der Fluch des Titanen (Band 3) Percy Jackson – Die Schlacht um das Labyrinth (Band 4) Percy Jackson – Die letzte Göttin (Band 5) CARLSEN-Newsletter Tolle neue Lesetipps kostenlos per E-Mail!www.carlsen.de Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Alle deutschen Rechte bei CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2012 Originalcopyright © 2010 by Rick Riordan Originalverlag: Disney · Hyperion Books, New York, USA Permission for this edition was arranged through the Nancy Gallt Literary Agency. Originaltitel: The Red Pyramid. The Kane Chronicles, Book One Umschlaggestaltung: Helge Vogt, trickwelt Umschlagtypografie: formlabor Innenabbildungen (Hieroglyphen): Michelle Gengaro-Kokmen Aus dem Englischen von Claudia Max Lektorat: Kerstin Claussen Satz und E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-646-92186-1 Alle Bücher im Internet unterwww.carlsen.de
Für alle meine Bibliothekarsfreunde, Fürsprecher der Bücher, wahre Magier im Lebenshaus. Ohne euch würde sich der Autor in der Duat verlaufen.
Warnhinweis Was ihr hier lest, ist die Abschrift einer digitalen Aufnahme. An manchen Stellen ließ die Tonqualität zu wünschen übrig; einige Wörter und Sätze konnte der Autor daher nur erraten. Wurden wichtige Symbole erwähnt, sind nach Möglichkeit Illustrationen davon eingefügt worden. Hintergrundgeräusche wie Handgreiflichkeiten, Schläge und verbale Auseinandersetzungen zwischen den beiden Sprechern wurden weggelassen. Der Autor kann für die Echtheit der Aufnahme nicht garantieren. Es scheint ausgeschlossen, dass die beiden jungen Erzähler die Wahrheit sagen, aber entscheidet selbst.
CARTER
1.
Tod am Obelisken
Wir haben nur ein paar Stunden, also hört gut zu.
Wenn ihr diese Geschichte hört, seid ihr bereits in Gefahr. Vielleicht sind Sadie und ich eure einzige Chance.
Geht zu der Schule. Findet den Spind. Ich werde euch nicht verraten, welche Schule oder welcher Spind, denn wenn ihr die Richtigen seid, findet ihr beides. Die Zahlenkombination lautet 13/32/33. Wenn wir fertig erzählt haben, wisst ihr, was die Zahlen bedeuten. Aber denkt dran: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wie sie ausgeht, hängt von euch ab.
Das Allerwichtigste: Behaltet den Inhalt des Päckchens auf keinen Fall länger als eine Woche. Klar, es ist eine Verlockung. Immerhin gewährt er euch fast unbegrenzte Macht. Aber wenn er zu lange in eurem Besitz ist, wird er euch zerstören. Eignet euch seine Geheimnisse schnell an und gebt ihn weiter. Versteckt ihn für die nächste Person, so wie Sadie und ich ihn für euch versteckt haben. Dann macht euch darauf gefasst, dass euer Leben sehr interessant werden wird.
Okay, Sadie meint, ich soll nicht länger rumschwafeln und mit der Geschichte loslegen. In Ordnung. Alles fing in London an, an dem Abend, als Dad das British Museum in die Luft jagte.
Ich heiße Carter Kane. Ich bin vierzehn und mein Zuhause ist ein Koffer.
Ihr glaubt, das ist ein Witz? Mein Vater und ich reisen um die Welt, seit ich acht bin. Ich wurde in Los Angeles geboren, aber mein Vater ist Archäologe, deshalb ist er ständig unterwegs. Meistens fahren wir nach Ägypten, weil das sein Spezialgebiet ist. Geht in einen Buchladen und sucht euch ein Buch über Ägypten – mit ziemlicher Sicherheit ist der Autor Dr. Julius Kane. Ihr wollt wissen, wie die Ägypter das Hirn aus den Mumien herausgepult, die Pyramiden gebaut oder König Tuts Grab verflucht haben? Dann fragt am besten Dad. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Gründe, warum mein Vater so viel durch die Gegend gezogen ist, aber damals kannte ich sein Geheimnis noch nicht.
Ich bin nie zur Schule gegangen. Mein Dad hat mich zu Hause unterrichtet, falls man von »Unterricht zu Hause« sprechen kann, wenn man gar kein Zuhause hat. Er hat mir so ziemlich alles beigebracht, was er für wichtig hielt. Also eine Menge über Ägypten und Basketball und seine Lieblingsmusiker. Ich habe auch viel gelesen – so ziemlich alles, was ich in die Finger bekam, angefangen bei den Geschichtsbüchern meines Vaters bis hin zu Fantasyromanen –, schließlich saß ich oft in Hotels herum, auf Flughäfen und an Ausgrabungsstätten in fremden Ländern, wo ich niemanden kannte. Mein Vater meinte immer, ich sollte das Buch weglegen und rausgehen, um Ball zu spielen. Aber habt ihr schon mal versucht, in Assuan in Ägypten spontan ein paar Leute zum Basketballspielen aufzutreiben? Nicht so einfach.
Jedenfalls hat mir mein Vater früh beigebracht, meine sämtlichen Habseligkeiten in einem einzigen Koffer unterzubringen, den ich als Handgepäck mit ins Flugzeug nehmen konnte. Mein Dad packte genauso, allerdings durfte er zusätzlich noch eine Arbeitstasche für seine archäologischen Werkzeuge mitnehmen. Regel Nummer eins: Ich durfte nicht in seine Arbeitstasche schauen. Bis zum Tag der Explosion habe ich mich an diese Regel auch gehalten.
Es passierte an Heiligabend. Wir waren in London, weil der Besuchstag bei meiner Schwester Sadie anstand.
Da meine Großeltern ihn hassen, darf mein Vater sie nämlich bloß zwei Tage im Jahr sehen – einen im Winter, einen im Sommer. Nach dem Tod unserer Mutter hatten ihre Eltern (unsere Großeltern) diesen ganzen Rechtsstreit mit Dad angefangen. Nach sechs Anwälten, zwei Schlägereien und einem beinahe tödlichen Angriff mit einem Spachtel (fragt nicht) wurde ihnen das Recht zugesprochen, Sadie bei sich in England zu behalten. Sie war erst sechs, zwei Jahre jünger als ich, und meine Großeltern konnten sich nicht um uns beide kümmern – das war zumindest ihre Entschuldigung, mich nicht mit aufzunehmen. Sadie wuchs also als englisches Schulmädchen auf und ich reiste mit meinem Vater um die Welt. Mir war es egal, dass wir Sadie nur zweimal im Jahr sahen.
[Klappe, Sadie. Ja – dazu komme ich noch.]
Jedenfalls waren mein Dad und ich nach etlichen Verspätungen gerade in Heathrow gelandet. Es war ein kalter Nachmittag und es nieselte. Während der gesamten Taxifahrt in die Stadt wirkte mein Vater irgendwie nervös.
Dabei ist mein Dad ein ziemlicher Brocken. Wenn man ihn sieht, denkt man nicht, dass ihn etwas aus der Fassung bringen kann. Er hat die gleiche dunkelbraune Haut wie ich, durchdringende Augen, eine Glatze und einen Spitzbart, er sieht also aus wie ein muskelbepackter fieser Wissenschaftler. An diesem Nachmittag trug er seinen Kaschmirwintermantel und seinen besten braunen Anzug, den er immer zu Vorträgen anzieht. Normalerweise strahlt er ein solches Selbstvertrauen aus, dass er alle sofort für sich einnimmt, aber manchmal – wie an diesem Nachmittag – bekam ich eine andere Seite von ihm mit, die ich nicht richtig verstand. Ständig drehte er sich um, als würden wir verfolgt.
»Dad?«, fragte ich, als wir von der A 40 abbogen. »Stimmt was nicht?«
»Nichts von ihnen zu sehen«, murmelte er. Als er merkte, dass er es laut ausgesprochen hatte, sah er mich ziemlich erschrocken an. »Nein, Carter. Alles bestens.«
Das beunruhigte mich, denn mein Vater ist ein miserabler Lügner. Ich wusste immer, wenn er etwas vor mir verheimlichte, aber ich wusste auch, ich könnte ihn noch so sehr löchern – mit der Wahrheit würde er nicht herausrücken. Möglicherweise versuchte er, mich zu beschützen, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wovor. Manchmal fragte ich mich, ob es in seiner Vergangenheit ein dunkles Geheimnis gab, vielleicht war ein alter Feind hinter ihm her; doch die Vorstellung kam mir albern vor, Dad war schließlich bloß Archäologe.
Was mir auch Sorgen machte: Dad hielt seine Arbeitstasche umklammert. Wenn er das macht, sind wir meistens in Gefahr. Wie das eine Mal in Kairo, als Bewaffnete unser Hotel stürmten. Ich hörte Schüsse aus der Eingangshalle und rannte nach unten, um nach Dad zu sehen. Doch als ich ankam, zog er seelenruhig den Reißverschluss der Arbeitstasche zu, während drei bewusstlose Bewaffnete kopfüber vom Kronleuchter herunterbaumelten. Ihre Gewänder fielen ihnen über die Köpfe und man sah ihre Boxershorts. Dad behauptete, er hätte nichts mitbekommen, und am Ende schob die Polizei alles auf einen ungewöhnlichen Defekt des Kronleuchters.
Ein anderes Mal gerieten wir in Paris in einen Tumult. Mein Dad suchte sich das nächstbeste geparkte Auto, stieß mich auf den Rücksitz und befahl mir, mich zu ducken. Ich legte mich flach auf die Sitzbank und machte die Augen zu. Dann hörte ich, wie Dad in seiner Tasche herumkramte und etwas vor sich hin murmelte, während die Menge draußen herumgrölte und randalierte. Ein paar Minuten später erklärte er mir, ich könne wieder hochkommen. Alle anderen Autos auf der Straße waren umgekippt und angezündet worden. Unser Wagen dagegen war frisch geputzt und poliert und unter den Scheibenwischern klemmten mehrere Zwanzigeuroscheine.
Jedenfalls habe ich die Tasche zu schätzen gelernt. Sie war unser Glücksbringer. Wenn mein Vater sie an sich drückte, brauchten wir das Glück allerdings auch dringend.
Wir fuhren durch das Stadtzentrum Richtung Osten zum Haus meiner Großeltern. Wir passierten die goldenen Tore des Buckingham Palace und die große Steinsäule auf dem Trafalgar Square. London ist ziemlich interessant, aber wenn man so viel unterwegs ist, kann man die Städte kaum noch auseinanderhalten. Wenn ich andere Jugendliche treffe, sagen die immer: »Mensch, hast du ein Glück.« Aber Dad und ich verbringen unsere Zeit ja nicht mit Stadtrundfahrten und wir haben auch nicht genug Geld, um stilvoll zu reisen. Wir waren schon an ein paar ziemlich ungemütlichen Orten und wir bleiben selten länger als ein paar Tage. Die meiste Zeit kommen wir uns eher wie Flüchtlinge vor, nicht wie Touristen.
Man sollte ja denken, die Arbeit meines Vaters wäre nicht gefährlich. Er hält Vorträge über Themen wie »Ist ägyptische Magie wirklich tödlich?« und »Bestrafung in der ägyptischen Unterwelt« und anderen Kram, für den sich kaum jemand interessiert. Aber wie ich schon sagte: Er hat auch noch diese andere Seite. Er ist ständig auf der Hut und durchsucht jedes Hotelzimmer, bevor er mich hineinlässt. Er stürzt in ein Museum, um sich irgendwelche alten Artefakte anzusehen und ein paar Notizen zu machen, dann rennt er wieder hinaus, als könnte er so den Überwachungskameras entgehen.
Einmal, als ich noch kleiner war und wir durch den Flughafen Charles de Gaulle rannten, um auf den letzten Drücker noch einen Flug zu erwischen, und Dad sich erst entspannte, als der Flieger abhob, habe ich ihn einfach unumwunden gefragt, wovor er davonlief, und er starrte mich an, als hätte ich den Stift aus einer Handgranate rausgezogen. Einen Moment lang befürchtete ich, er würde mir tatsächlich die Wahrheit sagen. Doch dann antwortete er: »Carter, es ist nichts.« Als wäre »nichts« das Schrecklichste auf der Welt.
Danach beschloss ich, dass es vielleicht besser war, keine Fragen zu stellen.
Meine Großeltern, die Fausts, wohnen in einer Siedlung in der Nähe von Canary Wharf, direkt am Ufer der Themse. Das Taxi hielt an und mein Vater bat den Fahrer zu warten.
Auf halbem Weg zum Haus blieb Dad plötzlich wie angewurzelt stehen. Er warf einen Blick zurück.
»Was ist?«, fragte ich.
Dann sah ich den Mann im Trenchcoat. Er stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite und lehnte an einem großen dürren Baum. Er war klein und korpulent, seine Haut hatte die Farbe von geröstetem Kaffee. Sein Mantel und der schwarze Nadelstreifenanzug sahen teuer aus. Seine langen Haare waren zu Zöpfchen geflochten und den schwarzen Filzhut hatte er bis zum Rand seiner dunklen, runden Brille ins Gesicht gezogen. Er erinnerte mich an einen der Jazzmusiker, in deren Konzerte mich Dad immer schleppte. Obwohl ich seine Augen nicht erkennen konnte, hatte ich das Gefühl, dass er uns beobachtete. Vielleicht war er ein alter Freund oder Kollege von Dad. Ganz egal, wo wir waren, Dad traf ständig Leute, die er kannte. Aber irgendwie war es komisch, dass der Typ hier vor dem Haus meiner Großeltern wartete. Und er wirkte nicht gerade gut gelaunt.
»Carter«, sagte mein Dad, »geh schon mal rein.«
»Aber –«
»Hol deine Schwester. Wir treffen uns am Taxi.«
Er ging über die Straße zu dem Mann im Trenchcoat, was mir zwei Wahlmöglichkeiten ließ: ihm zu folgen und zu schauen, was passierte, oder zu tun, was man mir aufgetragen hatte.
Ich entschied mich für die etwas ungefährlichere Alternative. Ich ging meine Schwester holen.
Bevor ich auch nur klopfen konnte, öffnete Sadie die Tür.
»Wie immer zu spät«, stellte sie fest.
Auf dem Arm hielt sie ihre Katze Muffin, die Dad ihr vor sechs Jahren als »Abschiedsgeschenk« überreicht hatte. Muffin schien weder älter noch größer zu werden. Sie hatte wuscheliges gelb-schwarzes Fell wie ein Zwergleopard, wachsame gelbe Augen und spitze Ohren, die zu groß für ihren Kopf waren. Um ihren Hals hing ein silberner ägyptischer Anhänger. Sie sah absolut nicht wie ein Muffin aus, wahrscheinlich muss man Sadie zugutehalten, dass sie noch klein war, als sie ihr den Namen gab.
Auch Sadie hatte sich seit letztem Sommer nicht großartig verändert.
[Während ich das aufnehme, steht sie neben mir und wirft mir dauernd böse Blicke zu, ich bin wohl besser vorsichtig mit dem, was ich sage.]
Kein Mensch würde sie für meine Schwester halten. Erstens lebt sie schon so lange in England, dass sie einen britischen Akzent hat. Zweitens schlägt Sadie nach unserer Mutter, die weiß war, deshalb ist ihre Haut viel heller als meine. Sie hat glattes karamellfarbenes Haar, nicht richtig blond, aber auch nicht braun, meistens färbt sie ein paar Strähnchen leuchtend bunt. An diesem Tag waren es rote Strähnen auf der linken Seite. Sie hat blaue Augen. Ungelogen. Blaue Augen, genau wie Mom. Sie ist erst zwölf, aber sie ist genauso groß wie ich, was echt nervt. Wie üblich kaute sie Kaugummi und für den Tag mit Dad hatte sie abgewetzte Jeans, eine Lederjacke und Springerstiefel angezogen, als ginge sie auf ein Konzert und hätte vor, ein paar Leute plattzumachen. Für den Fall, dass Dad und ich sie anödeten, baumelten Kopfhörer um ihren Hals.
[Okay, sie hat mir keine geklebt, ich scheine sie also ganz gut beschrieben zu haben.]
»Unser Flug hatte Verspätung«, erklärte ich ihr.
Sie blies eine Kaugummiblase, streichelte Muffin über den Kopf und warf die Katze mit Schwung ins Haus. »Granny, ich geh dann mal!«
Irgendwo aus dem Haus brummelte Grandma Faust etwas Unverständliches, vermutlich: »Lass sie bloß nicht rein!«
Sadie schloss die Tür hinter uns und musterte mich, als wäre ich eine tote Maus, die ihre Katze gerade angeschleppt hatte. »Da bist du also wieder.«
»Genau.«
»Dann komm schon.« Sie seufzte. »Bringen wir es hinter uns.«
So ist sie nun mal. Kein Hallo, wie ist es dir die letzten sechs Monate ergangen?, Ich freu mich so, dich zu sehen! oder irgendwas in der Art. Aber das ist schon in Ordnung. Wenn man sich bloß zweimal im Jahr sieht, fühlt man sich eher als entfernte Cousins, nicht als Geschwister. Außer unseren Eltern hatten wir absolut nichts gemeinsam.
Wir liefen die Treppen hinunter. Gerade, als mir durch den Kopf ging, dass sie wie eine Mischung aus Alte-Leute-Wohnung und Kaugummi roch, blieb sie so unvermittelt stehen, dass ich gegen sie rannte.
»Wer ist das denn?«, fragte sie.
Den Typen im Trenchcoat hatte ich fast vergessen. Er und mein Vater standen auf der anderen Straßenseite neben dem großen Baum und hatten allem Anschein nach eine ernsthafte Auseinandersetzung. Dad drehte uns den Rücken zu, deshalb konnte ich sein Gesicht nicht sehen, aber er fuchtelte mit den Händen und das macht er nur, wenn er aufgeregt ist. Der andere Typ zog eine finstere Miene und schüttelte den Kopf.
»Keine Ahnung«, erwiderte ich. »Er stand schon da, als wir ankamen.«
»Er kommt mir irgendwie bekannt vor.« Sadie runzelte die Stirn, als versuchte sie sich zu erinnern. »Los, komm.«
»Dad will, dass wir im Taxi warten«, wandte ich ein, aber ich wusste, dass es nichts brachte. Sadie hatte sich bereits in Bewegung gesetzt.
Statt direkt über die Straße zu gehen, preschte sie den Gehweg fast bis zur nächsten Straßenecke hoch, duckte sich hinter Autos, dann überquerte sie die Straße und kauerte sich vor eine niedrige Steinmauer. Langsam pirschte sie sich an Dad heran. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihrem Beispiel zu folgen, auch wenn ich mir dabei ziemlich dämlich vorkam.
»Sechs Jahre in England«, brummte ich, »und sie hält sich für James Bond.«
Ohne sich umzudrehen, schlug Sadie nach mir und robbte weiter vorwärts.
Noch ein paar Schritte und wir befanden uns direkt hinter dem großen kahlen Baum. Ich konnte hören, wie mein Dad auf der anderen Seite sagte: »… tun müssen, Amos. Du weißt, dass es das Richtige ist.«
»Nein«, widersprach sein Gegenüber, der offenbar Amos hieß. Seine Stimme klang tief und ruhig – sehr nachdrücklich. Er hatte einen amerikanischen Akzent. »Wenn ich dich nicht aufhalte, Julius, dann tun sie es. Das Per Anch beschattet dich.«
Sadie formte lautlos die Worte: »Das was?«
Ich schüttelte den Kopf, mir war das genauso schleierhaft. »Lass uns abhauen«, flüsterte ich, denn vermutlich würden sie uns gleich erwischen und dann gäbe es richtig Ärger. Sadie überhörte meine Bemerkung geflissentlich.
»Sie wissen nichts von meinem Plan«, sagte mein Vater gerade. »Bis sie darauf kommen –«
»Und die Kinder?«, fragte Amos. Mir stellten sich sämtliche Nackenhaare hoch. »Was ist mit ihnen?«
»Ich habe Vorkehrungen getroffen, um sie zu schützen«, erklärte mein Vater. »Außerdem, wenn ich es nicht mache, sind wir alle in Gefahr. Jetzt lass mich in Frieden.«
»Ich kann nicht, Julius.«
»Du legst es also auf einen Zweikampf an?« Dads Tonfall wurde todernst. »Du besiegst mich nie, Amos.«
Seit dem Spachtel-Debakel hatte ich Dad nicht mehr gewalttätig werden sehen und ich legte auch keinen gesteigerten Wert auf eine Neuauflage, aber die beiden schienen auf eine Schlägerei zuzusteuern.
Bevor ich reagieren konnte, sprang Sadie aus unserem Versteck und rief: »Dad!«
Er wirkte überrascht, als sie auf ihn zustürzte und ihn umarmte, allerdings nicht annähernd so überrascht wie der andere Typ, Amos. Der machte einen solchen Satz nach hinten, dass er sich in seinem Trenchcoat verhedderte.
Er hatte seine Brille abgenommen und ich musste Sadie Recht geben. Er sah irgendwie vertraut aus – wie eine sehr weit zurückliegende Erinnerung.
»Ich – ich muss los«, murmelte er. Er rückte seinen Hut zurecht und lief schwerfällig die Straße hinunter.
Dad beobachtete, wie er davonging, und legte schützend einen Arm um Sadie. Die andere Hand steckte er in die Arbeitstasche, die über seiner Schulter hing. Als Amos schließlich um die Ecke verschwand, entspannte sich Dad. Er nahm die Hand aus der Tasche und lächelte Sadie an. »Hallo, Süße.«
Sadie machte sich los und verschränkte die Arme. »Ach, jetzt bin ich die Süße, oder wie? Du kommst zu spät. Der Besuchstag ist fast vorbei! Und was sollte das hier? Wer ist Amos und was ist Per Anch?«
Dad erstarrte. Er warf mir einen Blick zu und schien zu überlegen, wie viel wir wohl mitgehört hatten.
»Ist nicht wichtig«, sagte er und versuchte, fröhlich zu klingen. »Ich habe einen tollen Abend geplant. Wer hat Lust auf eine Privatführung im British Museum?«
Sadie ließ sich zwischen Dad und mich auf die Rückbank des Taxis fallen.
»Ich glaub es nicht«, maulte sie. »Da haben wir mal einen gemeinsamen Abend und du hast bloß wieder deine Arbeit im Kopf.«
Dad gab sich Mühe zu lächeln. »Süße, das wird lustig. Der Leiter der Ägyptischen Sammlung hat uns persönlich eingeladen –«
»Ach, wer hätte das gedacht.« Sadie blies eine rot gefärbte Haarsträhne aus ihrem Gesicht. »Heiligabend, und wir schauen uns irgendwelche schimmligen alten Überbleibsel aus Ägypten an. Denkst du jemals an was anderes?«
Dad war nicht sauer. Er ist nie sauer auf Sadie. Er starrte einfach aus dem Fenster in den dunkler werdenden Himmel und den Regen.
»Ja«, erwiderte er ruhig. »Manchmal schon.«
Ich wusste, dass Dad immer an Mom dachte, wenn er so still wurde und ins Nichts starrte. Die letzten paar Monate war das oft der Fall gewesen. Wenn ich in unser Hotelzimmer kam, saß er mit seinem Handy da, von dessen Bildschirm ihm Mom entgegenlächelte – ihr Haar war unter ein Kopftuch geschoben, ihre Augen wirkten vor dem Wüstenhintergrund verblüffend blau.
Oder wir waren an irgendeiner Ausgrabungsstätte. Dad starrte auf den Horizont und ich wusste, dass er sich daran erinnerte, wie er sie kennengelernt hatte – zwei junge Wissenschaftler im Tal der Könige, auf der Suche nach einer vergessenen Grabkammer. Dad war Ägyptologe, Mom war Anthropologin und erforschte richtig alte DNS. Die Geschichte hatte er mir tausendmal erzählt.
Unser Taxi schlängelte sich am Ufer der Themse entlang. Kurz hinter der Waterloo Bridge wurde Dad nervös.
»Entschuldigen Sie«, sagte er, als wir am Victoria Embankment entlangfuhren. »Halten Sie hier einen Augenblick an.«
Der Fahrer hielt am Straßenrand.
»Was ist denn, Dad?«, fragte ich.
Er kletterte aus dem Taxi, als hätte er mich nicht gehört. Als Sadie und ich ebenfalls ausstiegen und uns neben ihn stellten, starrte er an Cleopatra’s Needle hoch.
Falls ihr sie noch nie gesehen habt, die sogenannte Nadel ist ein Obelisk, keine Nadel, und sie hat überhaupt nichts mit Kleopatra zu tun. Als die Briten sie nach London brachten, fanden sie den Namen vermutlich einfach gut. Sie ist ungefähr zwanzig Meter hoch, was im Alten Ägypten vielleicht eindrucksvoll war, an der Themse zwischen all den hohen Gebäuden allerdings eher mickrig und kläglich aussieht. Man kann daran vorbeifahren und merkt überhaupt nicht, dass dort etwas steht, das tausend Jahre älter ist als die Stadt London.
»Gott.« Sadie drehte frustriert eine Runde um die Säule. »Müssen wir an jedem Denkmal stehen bleiben?«
Dad starrte zur Spitze des Obelisken. »Ich musste mir die Nadel noch einmal ansehen«, murmelte er. »Hier ist es passiert …«
Vom Fluss her blies ein eisiger Wind. Ich wollte zurück ins Taxi, aber allmählich machte ich mir echt Sorgen. So abwesend hatte ich ihn noch nie erlebt.
»Was hast du, Dad?«, fragte ich. »Was ist hier passiert?«
»Hier habe ich sie zum letzten Mal gesehen.«
Sadie blieb stehen. Unsicher warf sie mir einen mürrischen Blick zu, dann sah sie wieder zu Dad. »Moment mal. Du redest von Mom?«
Dad strich Sadie das Haar hinters Ohr und sie war so überrascht, dass sie ihn nicht mal wegstieß.
Ich hatte das Gefühl, dass mich der Regen in einen Eisblock verwandelt hatte. Moms Tod war immer ein Tabuthema gewesen. Ich wusste, dass sie bei einem Unfall in London gestorben war, und ich wusste, dass meine Großeltern Dad die Schuld dafür gaben. Aber kein Mensch hatte uns je die Einzelheiten erzählt. Ich hatte es aufgegeben, meinen Vater danach zu fragen, zum einen, weil es ihn so traurig machte, zum anderen, weil er sich strikt weigerte, irgendetwas preiszugeben. »Wenn du älter bist« war alles, was er sagte, und es war die frustrierendste Antwort überhaupt.
»Heißt das, dass sie hier gestorben ist?«, fragte ich. »An Cleopatra’s Needle? Was ist passiert?«
Er senkte den Kopf.
»Dad!«, protestierte Sadie. »Ich geh hier jeden Tag vorbei und jetzt erfahre ich, dass ich davon – die ganze Zeit – nichts gewusst habe?«
»Hast du deine Katze noch?«, fragte Dad, eine reichlich dämliche Frage, wie ich fand.
»Klar hab ich die Katze noch!«, erwiderte sie. »Was hat das denn damit zu tun?«
»Und dein Amulett?«
Sadie griff sich an den Hals. Als wir klein waren, kurz bevor Sadie zu unseren Großeltern kam, hatte Dad uns beiden ägyptische Amulette geschenkt. Meines war ein Horusauge, ein beliebtes Schutzsymbol im Alten Ägypten.
Wie dem auch sei, ich trug mein Amulett jedenfalls immer unter dem Hemd, aber ich hatte angenommen, Sadie hätte ihres längst verloren oder weggeworfen.
Zu meiner Überraschung nickte sie. »Sicher, Dad, aber lenk jetzt nicht vom Thema ab. Gran redet ständig darüber, dass du an Moms Tod schuld bist. Das stimmt nicht, oder?«
Wir warteten. Ausnahmsweise wollten Sadie und ich genau dasselbe – wir wollten die Wahrheit wissen.
»Als eure Mutter starb«, fing mein Vater an, »hier an Cleopatra’s Needle –«
Plötzlich erleuchtete ein Blitz die Uferpromenade. Ich drehte mich halb geblendet um und für einen kurzen Moment sah ich zwei Gestalten, einen großen blassen Mann mit einem Gabelbart und cremefarbenem Gewand und ein kupferhäutiges Mädchen in dunkelblauem Gewand und Kopftuch – Kleidungsstücke, die ich in Ägypten schon hundertmal gesehen hatte. Keine zehn Meter entfernt standen sie dort einfach nebeneinander und beobachteten uns. Dann verblasste das Licht. Die Gestalten verschwammen zu einem undeutlichen Nachbild. Als sich meine Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnt hatten, waren sie verschwunden.
»Äh …«, sagte Sadie nervös. »Habt ihr das gerade gesehen?«
»Steigt ein«, befahl mein Vater und drängte uns zum Taxi. »Wir sind spät dran.«
Von diesem Moment an gab mein Vater keinen Ton mehr von sich.
»Hier können wir nicht reden«, stellte er fest und warf einen Blick nach hinten. Er hatte dem Taxifahrer zehn Pfund extra versprochen, wenn er uns in weniger als fünf Minuten zum Museum brachte, und der Fahrer gab sein Bestes.
»Dad«, begann ich, »diese Leute am Fluss –«
»Und der andere Typ, Amos«, fügte Sadie hinzu. »Sind die von der ägyptischen Polizei oder so was?«
»Passt auf, ihr beiden«, sagte mein Dad. »Heute Abend brauche ich eure Hilfe. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber ihr müsst Geduld haben. Ich verspreche, dass ich euch alles erklären werde, sobald wir im Museum sind. Ich bringe alles wieder in Ordnung.«
»Was meinst du damit?«, beharrte Sadie. »Was willst du in Ordnung bringen?«
Dads Gesichtsausdruck war mehr als traurig. Er sah fast schuldbewusst aus. Mit einem Frösteln dachte ich an das, was Sadie gesagt hatte: dass unsere Großeltern ihm die Schuld an Moms Tod gaben. Das konnte nicht das sein, wovon er da redete, oder?
Der Taxifahrer bog in die Great Russell Street ein und hielt mit quietschenden Reifen vor dem Haupteingang des Museums.
»Lauft einfach hinter mir her«, befahl uns Dad. »Wenn wir den Leiter der Sammlung treffen, benehmt euch ganz normal.«
Sadie benahm sich ja eigentlich nie normal, aber ich beschloss, lieber den Mund zu halten. Wir kletterten aus dem Taxi. Während Dad dem Fahrer ein dickes Bündel Geldscheine in die Hand drückte, kümmerte ich mich um das Gepäck. Dann machte Dad etwas Seltsames. Er warf eine Handvoll kleiner Gegenstände auf den Rücksitz – sie sahen wie Steine aus, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. »Fahren Sie weiter«, befahl er dem Taxifahrer. »Nach Chelsea, bitte.«
Das ergab keinen Sinn, schließlich saßen wir gar nicht mehr im Taxi, aber der Fahrer raste davon. Ich sah zu Dad, dann wieder auf das Taxi, und bevor es um die Ecke bog und in der Dunkelheit verschwand, erhaschte ich einen seltsamen Blick auf drei Passagiere auf der Rückbank: Es waren ein Mann und zwei Kinder.
Ich starrte verständnislos hinterher. Das Taxi konnte unmöglich so schnell neue Fahrgäste aufgenommen haben. »Dad –«
»Londoner Taxis bleiben nie lange leer«, bemerkte er nüchtern. »Kommt, Kinder.«
Er marschierte durch das schmiedeeiserne Tor. Sadie und ich zögerten einen Augenblick.
»Carter, was geht hier vor sich?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, ob ich das wissen will.«
»Gut, dann bleib von mir aus hier draußen in der Kälte, ich werde jedenfalls nicht ohne eine Erklärung nach Hause gehen.« Sie drehte sich auf dem Absatz um und stapfte unserem Vater hinterher.
Im Nachhinein betrachtet hätte ich davonlaufen sollen. Ich hätte Sadie da rausschleifen und das Weite suchen sollen. Stattdessen folgte ich ihr durch das Tor.
2.
Eine Explosion zu Weihnachten
Ich war früher schon mal im British Museum gewesen. Genau genommen war ich schon in mehr Museen, als ich zugeben will, sonst haltet ihr mich für den totalen Streber.
[Das im Hintergrund ist Sadie, die rumbrüllt, ich sei ein totaler Streber. Danke, Schwesterchen.]
Egal, das Museum war geschlossen und nirgendwo brannte Licht, auf der Eingangstreppe jedoch erwarteten uns der Leiter der Sammlung und zwei Sicherheitsleute.
»Dr. Kane!« Der Leiter war ein kleiner schmieriger Kerl in einem billigen Anzug. Sogar Mumien haben zum Teil mehr Haare und bessere Zähne. Er schüttelte Dad die Hand, als hätte er einen Rockstar vor sich. »Ihr letzter Artikel über Imhotep – brillant! Wie haben Sie bloß diese Zaubersprüche übersetzt?«
»Im-ho-was?«, murmelte Sadie.
»Imhotep«, erklärte ich. »Hohepriester, Architekt. Manche behaupten, er war ein Magier. Hat die erste Stufenpyramide entworfen. Hast du bestimmt schon gehört.«
»Hab ich nicht«, entgegnete Sadie. »Ist mir auch egal. Aber danke.«
Dad bedankte sich beim Leiter der Sammlung, dass er uns an einem Feiertag empfing. Anschließend legte er mir die Hand auf die Schulter. »Dr. Martin, das sind Carter und Sadie.«
»Aha! Offensichtlich ihr Sohn und –« Der Leiter musterte Sadie unentschlossen. »Und diese junge Dame?«
»Meine Tochter«, erklärte Dad.
Dr. Martins starrer Blick hatte für einen Augenblick etwas Hilfloses. Gleichgültig, für wie aufgeschlossen und höflich sich Leute halten, immer gibt es diesen Moment der Verblüffung auf ihren Gesichtern, wenn sie mitkriegen, dass Sadie zu unserer Familie gehört. Ich hasse es, aber mit den Jahren wartete ich schon fast darauf.
Der Leiter fand sein Lächeln wieder. »Ja, ja, natürlich. Immer hier entlang, Dr. Kane. Es ist uns eine große Ehre!«
Hinter uns verriegelten die Wachleute die Tür. Sie nahmen unser Gepäck und einer von ihnen griff nach Dads Arbeitstasche.
»Nein«, lehnte Dad mit angespanntem Lächeln ab. »Die behalte ich lieber.«
Während wir dem Leiter in den überdachten Innenhof des Museums, den Great Court, folgten, blieben die Wachleute im Foyer. Der weite Platz hatte am Abend etwas Bedrohliches. Durch die Glaskuppel fiel schwaches Licht und warf ein Schattenmuster auf die Wände, das wie ein Spinnennetz aussah. Unsere Schritte hallten auf dem weißen Marmorboden wider.
»Also«, sagte Dad, »der Stein.«
»Ja!«, erwiderte der Leiter. »Auch wenn ich nicht nachvollziehen kann, welche neuen Informationen er Ihnen liefern könnte. Er wurde endlos erforscht – aber er ist natürlich auch unser berühmtestes Artefakt.«
»Natürlich«, bestätigte Dad. »Aber vielleicht erleben Sie eine Überraschung.«
»Was meint er damit?«, flüsterte mir Sadie zu.
Ich gab keine Antwort. Ich hatte einen leisen Verdacht, um welchen Stein es ging, aber ich konnte mir nicht erklären, warum Dad uns ausgerechnet am Weihnachtsabend hergeschleppt hatte, damit wir ihn uns ansahen.
Was hatte er uns wohl an Cleopatra’s Needle erzählen wollen – etwas über unsere Mutter und die Nacht, in der sie starb? Und warum drehte er sich ständig um, als erwartete er, dass diese seltsamen Leute, die wir an der Nadel gesehen hatten, wieder auftauchen würden? Wir waren in einem Museum eingeschlossen und von Wachleuten und neuester Sicherheitstechnik umgeben. Niemand konnte uns hier etwas tun – hoffte ich.
Wir bogen nach links in den Flügel mit der Ägyptischen Sammlung. An den Wänden reihten sich wuchtige Statuen von Pharaonen und Göttern, doch mein Vater beachtete sie nicht weiter, sondern steuerte direkt auf die Hauptattraktion in der Mitte des Raums zu.
»Wunderschön«, murmelte Dad. »Und es ist ganz sicher keine Kopie?«
»Nein, nein«, beteuerte der Leiter. »Das Original befindet sich zwar nicht immer in der Ausstellung, aber für Sie haben wir eine Ausnahme gemacht.«
Wir starrten auf eine Tafel aus dunkelgrauem Stein, die etwa einen Meter hoch und einen halben Meter breit war und hinter Glas auf einem Sockel stand. In die flache Oberfläche des Steins waren drei Abschnitte mit unterschiedlichen Schriftzeichen eingemeißelt. Der oberste Teil war altägyptische Bilderschrift: Hieroglyphen. Doch in der Mitte … Ich zermarterte mir das Hirn, bis mir einfiel, wie mein Vater sie nannte: demotische Schrift. Sie stammte aus der Zeit, als Ägypten in der Hand der Griechen war und sich viele griechische Wörter unter die ägyptischen mischten. Die letzten Zeilen waren in Griechisch geschrieben.
»Der Rosettastein«, stellte ich fest.
»Rosetta … Das ist doch ein Computerprogramm«, sagte Sadie.
Ich hätte ihr gern gesagt, wie dumm sie ist, aber der Leiter kam mir mit einem nervösen Lachen zuvor. »Junge Dame, der Rosettastein war der Schlüssel zur Entzifferung der Hieroglyphen! Er wurde 1799 von Napoleons Armee entdeckt und –«
»Ach ja, richtig«, meinte Sadie. »Jetzt weiß ich’s wieder.«
Das sagte sie natürlich nur, um ihn zum Schweigen zu bringen, aber mein Vater ließ nicht locker.
»Sadie«, sagte er, »bis dieser Stein entdeckt wurde, konnten Normalsterbliche … ähm, konnte jahrhundertelang niemand die Hieroglyphen entziffern. Die Schriftsprache Ägyptens war völlig in Vergessenheit geraten. Dann wies ein Engländer namens Thomas Young nach, dass die drei Sprachen des Rosettasteins alle dieselbe Nachricht übermittelten. Ein Franzose, der Champollion hieß, setzte die Arbeit fort und knackte das Rätsel der Hieroglyphen.«
Sadie schien unbeeindruckt. »Und was steht nun drauf?«
Dad zuckte mit den Achseln. »Nichts Wichtiges. Im Prinzip ist es ein Dankesbrief von ein paar Priestern an König Ptolemäus V. Als der Text damals eingemeißelt wurde, war der Stein nichts Besonderes. Doch über die Jahrhunderte … über die Jahrhunderte hat er immer mehr an Symbolkraft gewonnen und ist zur vielleicht wichtigsten Verbindung zwischen dem Alten Ägypten und der modernen Welt geworden. Es war so dumm von mir, dass ich sein Potenzial nicht früher erkannt habe.«
Ich konnte ihm nicht mehr folgen und dem Leiter des Museums schien es nicht anders zu gehen.
»Dr. Kane?«, fragte er. »Alles in Ordnung mit Ihnen?«
Dad atmete tief durch. »Entschuldigen Sie, Dr. Martin. Ich hab nur … laut gedacht. Ob Sie die Glasscheiben entfernen lassen könnten? Und wenn Sie mir die Dokumente aus Ihren Archiven bringen würden, um die ich Sie gebeten hatte …«
Dr. Martin nickte. Er gab einen Code in eine kleine Fernbedienung ein, daraufhin öffnete sich die Vorderseite der Vitrine.
»Es wird ein paar Minuten dauern, bis ich die Unterlagen geholt habe«, erklärte Dr. Martin. »Niemandem sonst würde ich leichtfertig Zugang zu dem Stein gewähren. Ich verlasse mich darauf, dass Sie mein Vertrauen nicht missbrauchen.«
Er musterte uns Kinder, als erwartete er, dass wir irgendwelchen Blödsinn machten.
»Wir werden vorsichtig sein«, versprach Dad.
Sobald Dr. Martins Schritte verhallt waren, drehte sich Dad zu uns, in seinem Blick lag etwas Gehetztes. »Kinder, das ist jetzt sehr wichtig: Ihr dürft nicht in diesem Raum bleiben.«
Er nahm seine Arbeitstasche von der Schulter und zog den Reißverschluss gerade weit genug auf, um eine Fahrradkette und ein Vorhängeschloss herauszunehmen. »Folgt Dr. Martin. Sein Büro liegt am Ende des großen Innenhofs auf der linken Seite. Es gibt nur einen Eingang. Sobald er drinnen ist, wickelt das hier um die Türgriffe und schließt ab. Wir müssen Zeit gewinnen.«
»Wir sollen ihn einsperren?«, fragte Sadie plötzlich interessiert. »Super!«
»Dad«, mischte ich mich ein, »was soll das?«
»Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärungen«, erwiderte er. »Das ist unsere letzte Chance. Sie kommen.«
»Wer kommt?«, fragte Sadie.
Er fasste Sadie an den Schultern. »Süße, ich hab dich lieb. Und es tut mir leid … vieles tut mir leid, aber jetzt ist keine Zeit. Wenn das hier funktioniert, verspreche ich, dass alles für uns besser wird. Carter, du bist mein tapferer Junge. Du musst mir vertrauen. Denkt dran, sperrt Dr. Martin ein. Und dann haltet euch von diesem Raum fern!«
Die Tür zu Dr. Martins Zimmer mit der Kette zu verschließen war einfach. Doch als wir fertig waren und uns umdrehten, flimmerte es so blau aus dem Ägyptischen Saal, als hätte Dad dort ein riesiges leuchtendes Aquarium aufgestellt.
Sadie sah mich eindringlich an. »Mal ehrlich, hast du irgendeine Ahnung, was er vorhat?«
»Keinen Schimmer«, erklärte ich. »Aber er hat sich in letzter Zeit komisch benommen. Denkt viel an Mom. Er hat ihr Bild …«
Mehr wollte ich nicht sagen. Zum Glück nickte Sadie, als würde sie es verstehen.
»Was ist in seiner Arbeitstasche?«, fragte sie.
»Ich weiß es nicht. Er hat mir verboten hineinzusehen.«
Sadie zog eine Augenbraue hoch. »Und du hast dich daran gehalten? Mann, das bringst auch nur du fertig, Carter. Du bist echt hoffnungslos.«
Ich wollte mich verteidigen, doch genau in diesem Moment bebte der Boden.
Erschrocken klammerte sich Sadie an meinen Arm. »Er hat uns gesagt, wir sollen uns nicht vom Fleck rühren. Diesen Befehl wirst du vermutlich auch befolgen?«
Eigentlich klang das ganz okay für mich, aber Sadie sprintete durch den Innenhof und nach kurzem Zögern rannte ich ihr hinterher.
Im Durchgang zur Ägyptischen Sammlung blieben wir wie angewurzelt stehen. Dad stand vor dem Rosettastein und drehte uns den Rücken zu. Auf dem Boden rings um ihn leuchtete ein blauer Kreis, es sah aus, als hätte jemand versteckte Neonröhren im Boden eingeschaltet.
Er hatte seinen Mantel ausgezogen. Seine Arbeitstasche lag aufgeklappt zu seinen Füßen und ließ einen Holzkasten erkennen, der ungefähr einen halben Meter lang und mit ägyptischen Symbolen bemalt war.
»Was hält er da in der Hand?«, flüsterte mir Sadie zu. »Ist das ein Bumerang?«
Tatsächlich, als Dad die Hand hob, fuchtelte er mit einem gebogenen weißen Stab herum. Doch statt ihn zu werfen, berührte er damit den Rosettastein. Sadie hielt die Luft an. Dad schrieb auf dem Stein. Überall, wo der Bumerang ihn berührte, erschienen auf dem Granit leuchtende blaue Linien. Hieroglyphen.
Das ergab keinen Sinn. Warum konnte er mit einem Stab auf einen Stein schreiben? Doch das Bild war klar und deutlich: Widderhörner über einem Kästchen und einem X
»Öffne dich«, murmelte Sadie. Ich starrte sie an, denn es klang, als hätte sie das Wort gerade übersetzt, aber das konnte ja nicht sein. Ich reiste schon seit Jahren mit Dad herum und selbst ich hatte nur wenig Ahnung von Hieroglyphen. Sie sind echt schwer zu lernen.
Dad hob die Arme und stimmte einen Sprechgesang an: »Wo-seer, i-ei.« Auf der Oberfläche des Rosettasteins leuchteten zwei weitere Hieroglyphen blau auf.
Obwohl ich total verblüfft war, erkannte ich das erste Symbol. Es war der Name des ägyptischen Totengottes.
»Wo-seer«, flüsterte ich, ich hatte noch nie gehört, dass es jemand so aussprach, aber ich wusste, was es bedeutete. »Osiris.«
»Osiris, komm«, übersetzte Sadie wie in Trance. Dann wurden ihre Augen größer. »Nein!«, schrie sie. »Nein, Dad!«
Unser Vater drehte sich überrascht um. Er setzte an: »Kinder –«, aber es war zu spät. Der Boden rumpelte. Das blaue Licht verwandelte sich in grelles Weiß und der Rosettastein flog in die Luft.
Als ich wieder zu mir kam, hörte ich als Erstes Gelächter – schreckliches, schadenfrohes Gelächter, das sich mit dem Schrillen der Alarmanlage im Museum vermischte.
Ich hatte das Gefühl, mich hätte ein Laster überrollt. Benommen setzte ich mich auf und spuckte ein Stück Rosettastein aus. Der Ausstellungssaal lag in Trümmern. Auf dem Boden züngelten Flammen. Riesige Statuen waren umgestürzt. Sarkophage hatte es von den Sockeln gerissen. Der Rosettastein war mit solcher Wucht explodiert, dass Splitter in den Säulen, den Wänden und anderen Ausstellungsstücken steckten.
Sadie lag ohnmächtig neben mir, sie schien jedoch nicht verletzt zu sein. Ich rüttelte sie an der Schulter und sie stöhnte: »Aah.«
Vor uns standen die qualmenden Überreste des Sockels, auf dem der Rosettastein gestanden hatte. Bis auf den leuchtenden blauen Kreis um unseren Vater war der ganze Boden schwarz und mit Scherben übersät.
Dad blickte in unsere Richtung, aber er schien nicht uns anzusehen. Er hatte eine blutende Schnittwunde am Kopf. Angespannt umklammerte er seinen Bumerang.
Mir war nicht klar, wohin er schaute. Plötzlich hallte das schreckliche Lachen erneut durch den Saal. Direkt vor mir lachte jemand.
Zwischen Dad und uns stand etwas. Zunächst konnte ich es kaum erkennen – ich spürte bloß Hitze. Doch als ich es genauer betrachtete, nahm es eine verschwommene Form an – es war der glutrote Umriss eines Mannes.
Er war größer als Dad und sein Lachen durchschnitt mich wie eine Kettensäge.
»Gut gemacht«, lobte er meinen Vater. »Sehr gut gemacht, Julius.«
»Dich hat keiner gerufen!« Die Stimme meines Vaters zitterte. Er hielt seinen Bumerang in die Höhe, doch als der glutrote Mann einmal mit dem Finger schnippte, flog der Stock aus Dads Hand und knallte gegen die Wand.
»Man ruft nie nach mir, Julius«, säuselte der Mann. »Aber wenn du eine Tür öffnest, musst du damit rechnen, dass auch ungebetene Gäste hereinspazieren.«
»Zurück in die Duat!«, brüllte mein Vater. »Ich habe die Macht des Großen Königs!«
»Ach, da fürchte ich mich aber«, sagte der glutrote Mann amüsiert. »Und selbst wenn du wüsstest, wie du diese Macht einsetzen musst – was nicht der Fall ist –, war er mir nie ebenbürtig. Ich bin der Stärkste. Nun wird es dir ergehen wie ihm.«
Ich verstand kein Wort, aber ich wusste, dass ich Dad helfen musste. Ich wollte den nächstbesten Steinbrocken aufheben, aber meine Finger waren vor Angst starr und taub. Meine Hände waren nutzlos.
Wortlos warf Dad mir einen warnenden Blick zu: Lauft weg! Mir wurde klar, dass er alles tat, damit der glutrote Mann sich nicht umdrehte und Sadie und ich unbemerkt fliehen konnten.
Sadie war immer noch wackelig auf den Beinen. Ich schaffte es, sie hinter eine Säule in den Schatten zu ziehen. Als sie protestieren wollte, presste ich ihr die Hand auf den Mund. Das rüttelte sie wach. Sie kapierte, dass es ernst war, und hörte auf, sich zu wehren.
Noch immer schrillten Alarmglocken. Um die Eingänge zum Ausstellungssaal züngelten Flammen. Die Wachleute waren sicher schon unterwegs, aber ob das gut für uns war?
Dad kauerte sich auf den Boden, ohne seinen Feind aus den Augen zu lassen, und öffnete den bemalten Holzkasten. Er holte einen kleinen Stock von der Länge eines Lineals heraus. Leise flüsterte er etwas, daraufhin verlängerte sich der Stock zu einem hölzernen Zauberstab, der so groß war wie Dad.
Sadie gab ein quiekendes Geräusch von sich. Ich traute meinen Augen nicht, aber es wurde noch merkwürdiger.
Dad warf dem glutroten Mann den Zauberstab vor die Füße. Der Stab verwandelte sich in eine riesige Schlange – über drei Meter lang und so dick wie ich – mit kupferfarbenen Schuppen und glühenden Augen. Sie stürzte sich auf den glutroten Mann, der sie ohne Schwierigkeiten festhielt. Aus seiner Hand zischten heiße Flammen und die Schlange verbrannte zu Asche.
»Was für ein alter Trick, Julius«, schalt der glutrote Mann.
Mein Vater warf einen Blick in unsere Richtung und drängte uns wortlos, davonzulaufen. Ein Teil von mir weigerte sich zu glauben, dass das hier wirklich passierte. Vielleicht war ich bewusstlos oder hatte einen Albtraum? Neben mir hob Sadie einen Steinbrocken auf.
»Wie viele?«, fragte mein Dad hastig und versuchte, die Aufmerksamkeit des glutroten Mannes weiter auf sich zu lenken. »Wie viele habe ich freigesetzt?«
»Tja, alle fünf«, erwiderte der Mann, als würde er einem Kind etwas erklären. »Eigentlich solltest du wissen, dass man uns nur als Gesamtpaket kriegt, Julius. Bald werde ich sogar noch mehr freilassen und sie werden mir sehr dankbar dafür sein. Man wird mich wieder König nennen.«
»Sie werden dich aufhalten, bevor die Dämonentage vorbei sind«, entgegnete mein Vater.
Der glutrote Mann lachte. »Glaubst du etwa, das Haus kann mich aufhalten? Diese alten Trottel schaffen es noch nicht mal, ihre Streitigkeiten zu begraben. Finde dich einfach damit ab, dass die Karten neu gemischt werden. Und dieses Mal kommst du nicht mehr an die Macht!«
Der glutrote Mann machte eine Handbewegung. Der blaue Kreis zu Dads Füßen erlosch. Dad griff nach seinem Werkzeugkasten, doch der schlitterte über den Boden.
»Bis dann, Osiris«, sagte der glutrote Mann. Mit einer weiteren Handbewegung zauberte er einen leuchtenden Sarg um unseren Vater. Zunächst war er durchsichtig, doch je mehr sich Dad wehrte und gegen die Seitenwände hämmerte, umso massiver wurde der Sarg – ein goldener ägyptischer Sarkophag, mit Juwelen besetzt. Mein Dad warf mir noch einen letzten Blick zu und formte lautlos das Wort: Lauft!, dann versank der Sarg, als hätte sich der Boden in Wasser verwandelt.
»Dad!«, schrie ich.
Sadie warf den Stein, aber er segelte, ohne irgendwelchen Schaden anzurichten, durch den Kopf des glutroten Typen hindurch.
Der Mann drehte sich um und für einen schrecklichen Moment war sein Gesicht in den Flammen zu erkennen. Was ich sah, ergab keinen Sinn. Es war, als habe jemand zwei unterschiedliche Gesichter übereinandergelegt – eines fast menschlich, mit blasser Haut, grausamen kantigen Zügen und glühenden roten Augen, das andere das eines Tieres mit dunklem Fell und scharfen Reißzähnen. Schlimmer als ein Hund oder ein Wolf oder ein Löwe – irgendein Tier, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Die roten Augen starrten mich an und ich wusste, dass ich sterben würde.
Hinter mir hallten Stiefel auf dem Marmorboden des Innenhofs. Stimmen bellten Befehle. Die Wachleute, vielleicht die Polizei – sie würden es niemals rechtzeitig in diesen Saal schaffen.
Der glutrote Mann stürzte sich auf uns. Kurz vor meinem Gesicht zerrte ihn etwas nach hinten. Die Luft sprühte vor elektrischer Energie. Das Amulett um meinen Hals wurde ungemütlich heiß.
Der glutrote Mann zischte und musterte mich eingehender. »Aha … du bist es also.«
Wieder erbebte das Gebäude. Am anderen Ende des Saals explodierte in einem grellen Blitz ein Teil der Wand. Durch das Loch stiegen zwei Personen – der Mann und das Mädchen, die wir an der Nadel gesehen hatten. Ihre Gewänder wirbelten um sie herum und beide hielten Zauberstäbe in der Hand.
Der glutrote Mann knurrte. Er sah mich ein letztes Mal an und sagte: »Bald, Junge.«
Kurz darauf ging der ganze Raum in Flammen auf. Eine Hitzewelle saugte alle Luft aus meinen Lungen und ich stürzte zu Boden.
Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass der Mann mit dem Gabelbart und das Mädchen in Blau über mir standen. Ich hörte, wie die Wachleute hin und her rannten und schrien. Das Mädchen beugte sich über mich und zog ein langes, gebogenes Messer aus ihrem Gürtel.
»Uns bleibt nicht viel Zeit«, erklärte sie dem Mann.
»Noch nicht«, sträubte er sich. Er hatte einen starken französischen Akzent. »Bevor wir sie vernichten, müssen wir ganz sicher sein.«
Ich schloss die Augen und versank in Bewusstlosigkeit.
SADIE
3.
Eingesperrt mit meiner Katze
[Gib mir das Scheißmikrofon.]
Hallo. Hier ist Sadie. Mein Bruder kann echt nicht gut erzählen. Tut mir leid. Aber jetzt bin ich dran, es wird also alles gut.
Wo waren wir? Die Explosion. Der Rosettastein in tausend Einzelteilen. Glutroter fieser Typ. Dad in einem Sarg verpackt. Ein gruseliger Franzose und ein arabisches Mädchen mit Messer. Wir bewusstlos. Genau.
Als ich zu mir kam, war wie zu erwarten alles voller Bullen. Mein Bruder und ich wurden getrennt. Das war mir ziemlich egal. Er nervt sowieso. Aber sie haben mich ewig im Büro des Leiters eingesperrt. Und haben tatsächlich unsere Fahrradkette dafür benutzt! Schweinsnasen.
Ich war natürlich fix und fertig, schließlich hatte mich gerade ein glutroter Was-auch-immer umgenietet. Ich hatte zugesehen, wie mein Vater in einen Sarkophag gesteckt wurde und durch den Boden davonrauschte. Das versuchte ich der Polizei alles zu erzählen, aber hat mir etwa jemand zugehört? Natürlich nicht.
Das Schlimmste von allem: Mir wurde überhaupt nicht mehr warm, es war, als pikte mir jemand mit eiskalten Nadeln in den Nacken. Es hatte angefangen, als ich auf diese leuchtenden blauen Worte sah, die Dad auf den Rosettastein zeichnete, und wusste, was sie bedeuteten. War das vielleicht eine Familienkrankheit? Kann es sein, dass das Wissen über öden ägyptischen Kram angeboren ist? So was kann ja mal wieder nur mir passieren.
Lange nachdem mein Kaugummi aufgehört hatte, nach etwas zu schmecken, holte mich schließlich eine Polizistin aus dem Büro des Museumsleiters. Sie stellte keine Fragen, sondern steckte mich kurzerhand in ein Polizeiauto und fuhr mich nach Hause. Selbst Gran und Gramps durfte ich nichts erklären. Die Polizistin brachte mich in mein Zimmer und ich wartete. Und wartete.
Ich hasse Warten.
Ich ging auf und ab. Mein Zimmer ist nicht besonders toll, einfach ein Raum unter dem Dach mit einem Fenster, einem Bett und einem Tisch. Ich konnte nicht viel machen. Muffin schnupperte an meinen Beinen und ihr Schwanz stellte sich wie eine Flaschenbürste auf. Offensichtlich stand sie nicht so auf Museumsmief. Mit einem Fauchen verkroch sie sich unters Bett.
»Vielen Dank auch«, brummte ich.
Ich öffnete die Tür, doch davor schob die Polizistin Wache.
»Der Kommissar kommt gleich zu dir«, erklärte sie mir. »Bleib bitte in deinem Zimmer.«
Ich konnte einen kurzen Blick ins Erdgeschoss erhaschen – Gramps lief im Zimmer auf und ab und rang die Hände, während sich Carter und der Kommissar auf dem Sofa unterhielten. Worüber sie redeten, war nicht zu verstehen.
»Kann ich mal aufs Klo?«, fragte ich die nette Polizistin.
»Nein.« Sie knallte mir die Tür vor der Nase zu. Als ob ich auf der Toilette was in die Luft jagen würde. Also echt.
Ich kramte meinen iPod heraus und scrollte durch meine Playlist, aber irgendwie gefiel mir nichts davon. Ich schmiss ihn genervt aufs Bett. Wenn ich keine Lust mehr auf Musik habe, ist es wirklich finster. Warum Carter wohl als Erster mit der Polizei reden durfte? Das war nicht fair.
Ich fummelte an der Kette herum, die Dad mir geschenkt hatte. Ich hatte keine Ahnung, was für ein Symbol das war. Das von Carter war eindeutig ein Auge, meines sah jedoch eher wie ein Engel aus oder vielleicht wie ein außerirdischer Mörderroboter.
Warum in aller Welt hatte Dad mich gefragt, ob ich das Amulett noch hatte? Klar hatte ich es noch. Es ist das einzige Geschenk, das ich je von ihm bekommen habe. Na ja, von Muffin mal abgesehen. Wenn ich mir allerdings die Allüren der Katze anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob ich sie wirklich als Geschenk bezeichnen soll.
Schließlich hatte mich Dad, als ich sechs war, quasi im Stich gelassen. Die Kette war meine einzige Verbindung zu ihm. An guten Tagen starrte ich sie an und dachte liebevoll an ihn. An schlechten Tagen (die wesentlich häufiger vorkamen) schleuderte ich sie durch den Raum, trampelte darauf herum und verwünschte ihn, weil er nicht da war. Das war so ’ne Art Therapie für mich. Am Ende legte ich die Kette aber immer wieder um.
Jedenfalls wurde sie während der seltsamen Ereignisse im Museum immer heißer – und das bilde ich mir nicht ein. Ich hätte sie fast abgenommen, aber irgendwie kam es mir vor, als würde sie mich tatsächlich beschützen.
Ich bring alles wieder in Ordnung, hatte Dads schuldbewusster Blick gesagt, den ich so gut an ihm kenne.
Tja, das ging gewaltig in die Hose, Dad.
Was hat er sich nur dabei gedacht? Am liebsten hätte ich es als schlechten Traum abgehakt: die leuchtenden Hieroglyphen, den Schlangenstab, den Sarg. So was passiert einfach nicht in echt. Aber so naiv war ich nicht. So etwas Furchteinflößendes wie das Gesicht des glutroten Mannes, als er sich zu uns umdrehte, konnte kein Traum sein. Bald, Junge, hatte er zu Carter gesagt, als hätte er vor, uns zu verfolgen. Beim bloßen Gedanken daran zitterten meine Hände. Auch über unseren Halt an Cleopatra’s Needle musste ich ständig nachdenken, wie Dad darauf bestanden hatte, sie zu sehen, als sammelte er Mut, für das, was er im British Museum vorhatte, und als hätte das etwas mit Mom zu tun gehabt.
Mein Blick wanderte durchs Zimmer und blieb an meinem Tisch hängen.
Nein, schoss es mir durch den Kopf. Auf keinen Fall.
Trotzdem ging ich zum Schreibtisch und zog die Schublade auf. Ich schob ein paar alte Zeitschriften zur Seite, meinen Vorrat an Süßigkeiten, einen Stapel Mathehausaufgaben, den ich nie abgegeben hatte, und ein paar Bilder von mir und meinen Klassenkameradinnen Liz und Emma, als wir auf dem Camden Market alberne Hüte aufprobierten. Und dort ganz unten lag das Bild von Mom.
Gramps und Gran haben stapelweise Bilder von ihr. Im Flurschrank haben sie sogar einen Schrein für ihre Tochter Ruby eingerichtet – mit Moms Kinderzeichnungen, dem Abschlusszeugnis, ihrem Foto von der Schlussfeier an der Universität, ihrem Lieblingsschmuck. Ganz schön krank. Niemals werde ich so werden und in der Vergangenheit leben. Schließlich erinnerte ich mich kaum noch an Mom und es war nicht zu ändern, dass sie tot war.
Doch das eine Bild bewahrte ich auf. Es zeigt Mom und mich in unserem Haus in Los Angeles, kurz nach meiner Geburt. Sie steht auf dem Balkon, hinter ihr der Pazifik, und hält einen schrumpeligen, pummeligen Klumpen Baby, der sich eines Tages zu meiner Wenigkeit entwickeln würde. Als Baby war ich nicht besonders hübsch, aber Mom sah umwerfend aus, selbst in Shorts und zerlöchertem T-Shirt. Sie hatte tiefblaue Augen. Ihr blondes Haar war zusammengebunden, ihre Haut makellos. Ganz schön deprimierend, wenn ich sie mit mir vergleiche. Die Leute behaupten immer, ich sähe ihr ähnlich, aber ich krieg nicht mal den Pickel an meinem Kinn weg, geschweige denn sehe ich so erwachsen und schön aus.
[Hör auf zu feixen, Carter.]
Das Foto faszinierte mich, weil ich mich an unser gemeinsames Leben kaum erinnern konnte. Doch der Hauptgrund, warum ich das Foto aufgehoben hatte, war das Zeichen auf Moms T-Shirt: Es war eins dieser Lebenssymbole – ein Anch.
Meine Mutter trug das Symbol des Lebens. Das ist so was von traurig. Allerdings lächelte sie in die Kamera, als kenne sie ein Geheimnis. Als grinsten mein Vater und sie über einen Insiderwitz.
Da fiel mir etwas ein. Dieser stämmige Mann im Trenchcoat, der sich auf der anderen Straßenseite mit Dad gestritten hatte – er hatte von Per Anch gesprochen.
Hatte er Anch, das Lebenszeichen, gemeint? Aber was war dann mit Per? Er meinte es doch sicher nicht wie in per Anhalter.
Ich hatte das schreckliche Gefühl, dass ich, wenn ich Per Anch als Hieroglyphe sehen würde, wüsste, was sie bedeutete.
Ich legte Moms Bild auf den Tisch, dann nahm ich einen Stift und drehte eines meiner alten Hausaufgabenblätter um. Was wohl passieren würde, wenn ich die Worte Per Anch zu zeichnen versuchte?
Würde ich einfach wissen, wie ich sie zeichnen musste?
Gerade als ich den Stift auf dem Blatt ansetzte, öffnete sich meine Zimmertür. »Miss Kane?«
Ich wirbelte herum, sprang auf und ließ den Bleistift fallen.
In der Türöffnung stand der Kommissar und runzelte die Stirn. »Was machst du da?«
»Mathe«, erklärte ich.
Da meine Zimmerdecke ziemlich niedrig ist, musste der Kommissar den Kopf einziehen. Er trug einen staubfarbenen Anzug, der zu seinen grauen Haaren und dem aschfarbenen Gesicht passte. »Also, Sadie, ich bin Hauptkommissar Williams. Wollen wir uns ein bisschen unterhalten? Setz dich.«
Ich setzte mich nicht, ebenso wenig wie er, was ihn garantiert nervte. Wenn man sich vorbeugen muss wie Quasimodo, sieht man nicht ohne weiteres aus, als wäre man der Chef.
»Erzähl mir bitte alles, was passiert ist«, forderte er mich auf, »und zwar von dem Moment an, als dein Vater dich abholen kam.«
»Das hab ich doch den Polizisten im Museum schon erzählt.«
»Wenn es dir nichts ausmacht, bitte noch mal.«
Also erklärte ich ihm alles von vorn. Warum auch nicht? Als ich ihm die komischen Einzelheiten mit den leuchtenden Buchstaben und dem Schlangenstab schilderte, wanderte seine linke Augenbraue immer höher.
»Also, Sadie, ich kann mir vorstellen, dass das alles ziemlich schwierig für dich ist. Ich verstehe, dass du den Ruf deines Vaters schützen willst. Aber er ist tot –«
»Sie wollten sagen, er ist in einem Sarg im Boden verschwunden«, widersprach ich. »Er ist nicht tot.«
Kommissar Williams spreizte die Finger. »Sadie, es tut mir sehr leid. Aber wir müssen herausfinden, warum er diesen Akt des … na ja …«
»Diesen Akt des was?«
Er räusperte sich unbehaglich. »Dein Vater hat unbezahlbare Artefakte zerstört und sich dabei offenbar selbst umgebracht. Wir würden sehr gern wissen, warum.«
Ich starrte ihn an. »Wollen Sie damit sagen, mein Vater wäre ein Terrorist? Ticken Sie noch ganz richtig?«
»Wir haben ein paar Kollegen deines Vaters angerufen. Nach dem, was ich gehört habe, neigt er seit dem Tod eurer Mutter zu unberechenbaren Handlungen. Er zeigte sich zunehmend verschlossen und ging völlig in seiner Forschung auf, verbrachte immer mehr Zeit in Ägypten –«
»Er ist ein Scheißägyptologe! Suchen Sie ihn lieber, statt mir blöde Fragen zu stellen!«
»Sadie«, erwiderte er und ihm war anzuhören, dass er mich am liebsten erwürgt hätte. Das passiert mir komischerweise oft mit Erwachsenen. »Es gibt extremistische Gruppen in Ägypten, die etwas dagegen haben, dass ägyptische Artefakte in ausländischen Museen aufbewahrt werden. Vielleicht sind diese Leute an deinen Vater herangetreten. Vielleicht war dein Vater in seinem Zustand ein leichtes Ziel für sie. Falls du irgendwelche Namen von ihm gehört hast –«
Ich stürmte an ihm vorbei zum Fenster. Ich war so sauer, dass ich kaum einen klaren Gedanken fassen konnte. Dad war auf keinen Fall tot! Nein, nein, nein. Und ein Terrorist? Also, bitte. Warum sind Erwachsene so doof? Ständig kommen sie einem mit »Sag die Wahrheit«, und wenn man dann ehrlich antwortet, glauben sie einem doch nicht. Was soll das Ganze?
Ich starrte auf die dunkle Straße. Plötzlich wurde das kalte kribbelige Gefühl noch schlimmer. Ich nahm den dürren Baum ins Visier, wo ich Dad am Nachmittag getroffen hatte, und dort, im schwachen Licht einer Straßenlaterne, stand der korpulente Typ im schwarzen Trenchcoat und mit der runden Brille und dem Filzhut. Und er sah zu mir hoch – der Mann, den Dad Amos genannt hatte.
Eigentlich hätte ich mich von einem seltsamen Typen, der mitten in der Nacht zu meinem Fenster hochstarrte, bedroht fühlen sollen. Aber er wirkte besorgt. Und er sah so vertraut aus. Es machte mich irre, dass ich mich nicht an den Grund dafür erinnern konnte.
Hinter mir räusperte sich der Kommissar. »Sadie, niemand gibt dir die Schuld an dem Anschlag im Museum. Wir wissen, dass du gegen deinen Willen da hineingezogen wurdest.«
Ich drehte mich vom Fenster weg. »Gegen meinen Willen? Ich habe den Leiter mit einer Kette in seinem Büro eingesperrt.«
Die Augenbraue des Kommissars wanderte wieder nach oben. »Wie dem auch sei, du wusstest nicht, was dein Vater vorhatte. War dein Bruder möglicherweise beteiligt?«
Ich schnaubte. »Carter? Also wirklich.«
»Du bist offenbar entschlossen, auch ihn zu decken. Du hältst ihn für deinen richtigen Bruder, oder?«
Ich konnte es nicht fassen. Am liebsten hätte ich ihm eine geklebt. »Was soll das denn schon wieder heißen? Weil er mir nicht ähnlich sieht?«
Der Kommissar starrte mich erstaunt an. »Ich meinte bloß –«
»Ich weiß, was Sie meinen. Logisch ist er mein Bruder!«
Kommissar Williams hob entschuldigend die Hand, aber ich kochte immer noch vor Wut. Sosehr mir Carter auf die Nerven ging, ich hasste es, wenn Leute dachten, wir wären nicht verwandt, oder wenn sie meinen Vater misstrauisch beäugten, wenn er uns drei als Familie bezeichnete – als hätten wir etwas falsch gemacht. Der dämliche Dr. Martin im Museum. Kommissar Williams. Es passierte jedes Mal, wenn Dad, Carter und ich zusammen waren. Jedes einzelne Mal, verdammt.
»Es tut mir leid, Sadie«, sagte der Kommissar. »Ich wollte bloß die Unschuldigen und die Schuldigen auseinanderhalten. Wenn du mit uns zusammenarbeitest, wird es für alle einfacher. Irgendeine Information. Irgendwas, das dein Vater gesagt hat. Personen, die er möglicherweise erwähnt hat.«
»Amos«, platzte ich heraus, nur um zu sehen, wie er reagierte. »Er hat einen Mann namens Amos getroffen.«
Kommissar Williams seufzte. »Sadie, das kann nicht sein. Das ist dir sicher klar. Wir haben vor weniger als einer Stunde mit Amos telefoniert. Er befand sich zu Hause in New York.«
»Er ist nicht in New York!«, beharrte ich. »Er ist genau –«
Ich warf einen Blick aus dem Fenster, aber Amos war verschwunden. War ja klar.
»Das kann nicht sein«, sagte ich.
»Genau«, antwortete der Kommissar.
»Aber er war hier!«, rief ich. »Wer ist er? Einer von Dads Kollegen? Woher wussten Sie von ihm?«
»Hör zu, Sadie. Dieses Theater muss aufhören.«
»Theater?«
Der Kommissar musterte mich einen Augenblick, dann schob er den Unterkiefer vor, als habe er eine Entscheidung gefällt. »Wir haben die Wahrheit bereits von Carter gehört. Ich will nicht, dass du dich aufregst, aber er hat uns alles erzählt. Ihm ist klar, dass es keinen Sinn mehr hat, euren Vater zu verteidigen. Du kannst uns also genauso gut helfen, es wird keine Anklage gegen dich erhoben werden.«
»Sie sollten Kinder nicht anlügen!«, brüllte ich und hoffte, dass man meine Stimme unten hörte. »Carter würde nie etwas gegen Dad sagen und dasselbe gilt für mich!«
Der Kommissar besaß nicht mal den Anstand, verlegen auszusehen.
Er verschränkte die Arme. »Es ist wirklich schade, dass du das so siehst, Sadie. Ich denke, wir gehen jetzt besser nach unten … um uns mit deinen Großeltern über die Konsequenzen zu unterhalten.«