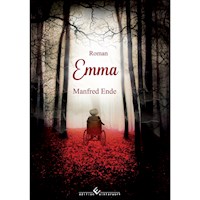Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition winterwork
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Humorvoll schreibt Manfred Ende, ehemaliger Hörspielautor, über seine Kindheit 1949 in einem kleinen Dorf der damaligen »Ostzone«. Geprägt von Kriegsjahren, führen Kinder zweier benachbarter Dörfer mit Holzschwertern und Schutzschildern aus Kuchenblechen einen Krieg gegeneinander, ehe sie ihre Leidenschaft für das Fußballspielen entdecken, sich zu einer Kicker-Mannschaft entwickeln. Armut ist allgegenwärtig und der Hunger ein täglicher Begleiter. Für den elfjährigen Walter, mit der Mutter aus Schlesien vertrieben, ist die Zeit in der neuen Heimat auch eine Zeit des Wandels, in der Fantasie, Einfallsreichtum und Erfindungsgabe zum Alltag gehören. Die Begegnung mit dem Zopfmädchen; Ein Fräulein als Direktorin und Pionierleiterin in einer Person; Weiße Mäuse, die zum Landfilm des Kintopp-Fritzen gehören; und vieles mehr lesen sie in diesem unterhaltsamen Buch des im Land Brandenburg beheimateten Autors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages gestattet. Verwendung oder Verbreitung durch unautorisierte Dritte in allen gedruckten, audiovisuellen und akustischen Medien ist untersagt. Die Textrechte verbleiben beim Autor, dessen Einverständnis zur Veröffentlichung hier vorliegt. Für Satz- und Druckfehler keine Haftung.
Impressum
Manfred Ende, »Kicker von Lindchendorf«
www.edition-winterwork.de
© 2019 edition winterwork
Alle Rechte vorbehalten.
Satz: edition winterwork
Umschlag: Manfred Ende
Kicker von Lindchendorf
für
Petra,
Kerstin,
Thomas
1 Mit Schwert und Streusel-Kuchenblech
Ich war elf und es war der Sommer 1949, als ich mit Holzschwert und dem umgebörtelten Kuchenblech meiner Mutter ins Feld zog. Vor Jahren hatte es schlesischen Streuselkuchen getragen, den ich manchmal noch zu riechen glaubte. Nun sollte es mir als Schutzschild gegen die Schleudergeschosse der Kinder aus dem Nachbardorf dienen. In eine Schlaufe aus Kunstgummi »Igelit« steckte ich meinen einst zum Führergruß erhobenen Arm.
Mit einem Handwagen, beladen mit Kochtöpfen, Suppenschüsseln, Bettzeug und einem Nachtgeschirr, wurden wir aus dem schlesischen Waldenburg vertrieben. Angekommen sind wir in Lindchendorf, unserer neuen, von den Siegermächten verordneten Heimat.
Später zogen wir mit dem Wägelchen, wie Mutter es nannte, durch die märkischen Wälder, um es mit Sammelholz für den Winter zu beladen.
Durch die Kiefernwälder schlängelten sich noch die mit Heidekraut bewachsenen Schützengräben, in denen wir Kriegsüberbleibsel fanden:
Stahlhelme, Stiefel, Aluminium-Essgeschirr und stinkende Uniformen, an denen Heldenabzeichen an dünnen Fäden hingen.
Aber auch scharfe Munition, mit der wir Kinder ahnungslos und ohne Furcht spielten, als wäre der Krieg ein »Räuber und Gendarm-Spiel«. Die heroischen Gesichter des Krieges hingen noch wie vertraute Stuben-Bilder in unseren Kinds-Köpfen. Infiziert vom Heldenspiel unserer Vorfahren, konnten wir uns lange nicht von ihnen trennen.
Daran änderte sich vorerst auch nichts durch die propagierte Friedenspolitik in der sowjetischen Besatzungszone, (Ostzone) die sich bald in einen »Arbeiter,- und Bauern-Staat« verwandeln sollte.
Wir wurden, nach sowjetischem Vorbild, in Pionier Hemden gesteckt, mit blauen Tüchern umhalst und im Auftrag der allgegenwärtigen Partei zur Friedensliebe erzogen. Aber die Saat, einmal gesät, haftete lange auf fruchtbarem Boden.
Ich lief barfuß über das aufgeheizte Pflaster der Dorfstraße. Über mir hing ein Sonnenball, der es seit Beginn der Schulferien besonders gut mit uns meinte.
Es machte mich stolz, von den Erwachsenen hinter Gardinen bestaunt zu werden. Mit einer unerklärlichen Vorfreude marschierte ich über die Felder, vorbei an Alleen mit Knupper-Kirschen, die für mich tabu waren. Erst nach der siegreichen Schlacht wollte ich sie mir pflücken.
Jetzt trachtete ich nach höheren Zielen, nach der hohen Strohmiete am Dorfende, die uns als Hauptquartier diente.
Meine Uniform bestand aus einem Turnhemd und einer speckigen Lederhose, die meine Mutter im Tausch von der Nachbarin erstanden hatte, deren Junge an Typhus gestorben war.
Sie war mir zwei Nummern zu groß, aber verstellbare Hosenträgerverhüteten Schlimmeres. Der Stahlhelm rutschte mir über die Ohren und manchmal fielen Rostpartikel in meine Augen.
Dennoch war ich fest entschlossen, die Ehre Lindchendorfs gegen die Bannewitzer zu verteidigen, die uns als »Maiköppe« beschimpften. Dafür nannten wir sie »Sandlatscher«.
Über die Gründe unserer Feindschaft war man später geteilter Meinung, am Ende schoben wir uns, wie die Erwachsenen so oft in der Geschichte, die Schuld gegenseitig in die Schuhe.
Schuhe waren eine Rarität, wer sie besaß, durfte sich Offizier nennen. Den Barfüßigen zählte man zum gemeinen Fußvolk.
Viele von uns trugen Holzpantinen, die Sattler Meister Kunz herstellte. Das Besondere an ihnen war ein an der Sohle befestigter Einweckgummi. Um die Ferse gespannt, gab er zusätzlich Halt. Der Meister ließ sich seine Erfindung mit einer Rubbel Kartoffeln pro Fuß bezahlen. Wem es nicht gelang, ausreichend Kartoffeln zu klauen, musste die Dorfschule einfüßig pantint besuchen.
Am Rande des Krämer-Waldes erkannte ich bereits die Strohmiete. Auf ihr flatterte die Fahne mit dem aufgemalten Maikäfer als Wappen.
Den Maikäfer hatte ich in der Zeichenstunde entworfen.
»Walter, nur du kannst das.«
Denn die Versuche der anderen ähnelten eher einer keimenden Kartoffel. Mich quälte jetzt der Hunger, die Fusselsuppe,gekocht aus rohen, geriebenen Kartoffeln und mit Süßstoff veredelt, konnte mich nicht satt machen, und Fett bekam ich ohnehin selten in den Bauch. Für ein Glas mit Mehl gestrecktem Schmalz vom Bauern musste meine Mutter schwere Feldarbeit verrichten. Einmal brachte man sie auf der Trage nach Hause. Kreislaufkollaps. Am anderen Morgen war sie wieder auf dem Feld..
Die letzten Häuser lagen jetzt hinter mir, einzige Abwechslung boten die alten, den Jahren trotzenden Linden.
Ich bog in den Feldweg ein, der zur Strohmiete führte. Deutlich sah ich die Fahne mit dem Käfer. Auch die Wachen schienen mich bemerkt zu haben, sie wedelten mit den Armen, schwenkten Knüppel und Schwerter. Dazu grölten sie, als würde General Rommel persönlich zu ihrer Verstärkung anrücken. Doch auch der Rekrut mit dem Holzschwert und dem Kuchenblech war willkommen.
Ich begann zu rennen, es zog mich förmlich zur Strohmiete. Immerhin war ich der Zweitschnellste unserer Schule, - aber viel schneller noch war an diesem Tag meine Mutter.
Genau in dem Augenblick, da ich mein Schwert zog und zum Endspurt ansetzen wollte, packte mich ihre Faust im Nacken.
»Dir werd ich dos Krieg spielen austreiba!«, polterte sie im schlesischen Restdialekt.
Sie zog mich derartig heftig zurück, dass ich nach hinten fiel und Helm und Hose verlor. Sie ließ mir noch Zeit, die Hose hochzuziehen, um sie wieder an den Trägern befestigen zu können, dann aber entwaffnete sie mich.
»Kehrt und Morsch!«, sagte sie und bohrte mir die Schwertspitze ins rückwärtige Teil der Lederhose.
Als sie ihr demoliertes Kuchenblech sah, erhielt ich einen Ritterschlag auf die Schulter.
Ich heulte. Ich fand es ungerecht, wegen eines Kuchenbleches geschlagen zu werden. Auch war es mir peinlich wegen der Kämpfer auf der Strohmiete, die in Gelächter ausgebrochen waren.
Ich stampfte trotzig meine Füße in den Sand und für Augenblicke verschwand Mutter in einer Staubwolke. Als sie mich wieder sichtete, drohte sie mir mit Lehrer, Pfarrer und Bürgermeister, als ob die Herren mich auf einen guten Weg bringen könnten.
Das Schlimmste aber war, sie drohte mir mit dem Entzug der Brennnesselsuppe, die an den kommenden Tagen meine verhasste Fusselsuppe ablösen sollte.
»Junge, wos sull nur aus dir werden!«, sagte sie. Aber das wusste ich selbst nicht. Künstler vielleicht, weil die aufdringlichen Tanten mir einreden wollten, ich wäre ein Zeichentalent. Dabei hatte ich mich nie bemüht, sie mit meinen Malstiften zu verschönern. Im Gegenteil, es machte mir Spaß, sie von der Hüfte abwärts in Birnen zu verwandeln und ihre geföhnten Köpfe auf Spatzengröße zu schrumpfen.
Ich lief schneller, das herüber tönende Geschrei meiner Kameraden war noch zu hören.
Mutter, nun mit Schild und Schwert beladen, hatte Mühe, mir zu folgen, sie geriet zunehmend in Rückstand, zumal sie Pantinen ohne Einweckgummi trug. Den Stahlhelm hatte sie längst weggeworfen.
Zu Hause befahl sie: »Stubenarrest!«
Durch geschickte Verhandlungen, bei denen ich das Wort »Amnestie« ins Spiel brachte, gelang es mir, ihre angeordnete Gefangenschaft von sieben Tagen auf vier zu verkürzen.
Dann schloss sie mich in unser Universum ein. So nannten wir unser Zimmer unterm Dach, das als Wohnstube, Esszimmer, Küche, Schlafstube, Bad und Toilette gleichermaßen diente. Damit war unser Universum überlastet und ein Kiefernstamm musste die Decke stützen.
Für den Himmel über uns bestand Einsturzgefahr. An den Wänden schlängelten sich Risse wie Wasserstraßen durch den Wandputz, sie alle mündeten hinterm Wandschoner neben meinem Bett in einem schwarzen, zehn Zentimeter tiefen Loch, das durch heraus bröckelnden Wandputz entstanden war. Ich machte es zu meinem Geheimsafe, verbarg dort meine Schätze: Glasmurmeln, Buntstifte, Maikäfer, Steinschleuder, Abziehbilder und einige Hefte aus der Reihe »Der Landser«.
Mutter band sich ihr Kopftuch um, schlüpfte in die Gummistiefel und drehte den Schlüssel zwei mal herum, bevor sie sich wieder ins Rübenfeld machte.
Das Fenster zum Hof ließ sich nicht verriegeln. Ich öffnete es, lehnte mich weit hinaus und blickte auf das Gitterfenster der Arrestzelle gegenüber, in die sie Landstreicher und Viehdiebe sperrten, aber auch die Bauern, die ihre Kuh oder Sau ohne die Genehmigung der Behörde schwarz geschlachtet hatten.
Rechts sah ich die rote Backsteinkirche mit dem Anhängsel, der Leichenhalle, auf deren Steinstufen in den langen Vollmondnächten die Ärmsten der Armen hockten und ihren selbst gebrannten Rüben-Schnaps soffen. Es war, als warteten sie darauf, eingelassen zu werden.
Frank aus meiner Klasse durfte manchmal beim Läuten helfen, dafür besaß er einen Zweitschlüssel zur Leichenhalle. Gegen ein Besichtigungshonorar war er gern bereit, uns Einblicke in die Gesichter der Toten zu gewähren. Mich schauderte es jedes mal, wenn ich auf dem Heimweg dort vorüber musste, dann rannte ich wie um mein Leben.
»Bleib Junge, scheiß dir nicht in die Hose!«, riefen mir die versoffenen Stimmen zu. Und ich rannte noch schneller.
Ich riss beide Fensterflügel auf, für einen Moment kam mir der Gedanke, einfach hinauszuspringen.
Es war seltsam, je länger ich darüber nachdachte, umso stärker wurde das Verlangen, es war wie ein Sog, der mich in die Tiefe zu ziehen drohte.
Einfach die Arme ausbreiten und fliegen wie ein Vogel – hin zur Strohmiete, unserem Hauptquartier. Und wenn ich abstürze? Mutter würde bestimmt weinen. Sollte sie doch, sie würde schon sehen...
2 Ein Zopf-Mädchen im Krämer-Wald
Ich knotete die Wäscheleine ans Fensterkreuz und ließ mich hinabgleiten. Dieses Mal zog ich ohne den Helm und das Kuchenblech in den Krieg gegen die Nachbardörfler. Nur das Holzschwert, das Mutter in den Kohlenkasten geworfen hatte, trug ich wieder bei mir.
Die Schlacht war in vollem Gange, das Geschrei der Kämpfenden weithin zu hören. Es gelang uns, die »Bannewitzer Sandlatscher« zurückzudrängen, wir verfolgten sie bis weit in den Krämer-Wald.
Zwischen den Kiefern wurde die Lage undurchsichtig, wir verloren uns in kleine Gruppen. Aus der offenen Schlacht war ein Partisanenkrieg geworden. Freund und Feind waren kaum zu unterscheiden.
Es klang wie das Gehämmer der Spechte, wenn die geschleuderten Kieselsteine gegen Baumstämme schlugen. Ich vermisste mein Kuchenblech und den Stahlhelm, immerhin bestand die Gefahr, am Kopf getroffen zu werden. Gebückt lief ich tiefer in den Wald.
Als ich stehen blieb, war eine tiefe Stille um mich. Ich horchte nach allen Seiten, denn ich befürchtete, heimtückisch angegriffen zu werden.
Plötzlich hörte ich einen spitzen Schrei, ich drehte mich um – vor mir stand, wie vom Baum gefallen, ein Mädchen mit maisgelben Zöpfen und verweinten Augen. Erschrocken starrte sie mich an, als sei ich ein Außerirdischer. Mein Gesicht hatte ich mit Erde eingerieben, nun versuchte ich, mich mit Hilfe eines Taschentuches wieder in ein Bleichgesicht zu verwandeln.
Aber sie schien mich nicht ernsthaft zu fürchten. »Junge, wasch dich bloß!«, sagte sie plötzlich.
Es waren die gleichen Worte, die ich jeden Abend von meiner Mutter zu hören bekam. Sollte sie vom Feind sein, nehme ich sie gefangen, nahm ich mir vor. Ich würde sie fesseln, verhören und abführen.
Ich musterte sie von oben bis unten. Sie trug ein hellblaues, kurz geschneidertes Sommerkleid, für das der Stoff nicht ganz gereicht zu haben schien.
Als ich einen Schritt auf sie zugehen wollte, stieß sie einen halblauten Schrei aus.
»Halt deine Gusche, oder es setzt was! Du hetzt mir die Bannewitzer auf den Hals. Es sei denn, du bist aus Lindchendorf, dann lasse ich dich laufen, aber ich kenne dich nicht.«
»Ich bin Bannewitzer«, sagte sie gefasst.
»Dann bist du mein Feind«, entgegnete ich kalt.
»Und warum bin ich dein Feind?«
»Ist eben so, wenn du aus Bannewitz kommst.»
Ich trat näher. Als sie wieder schreien wollte, hielt ich ihr den Mund zu. Sie spuckte mir auf die Handfläche und ich gab ihr eine Ohrfeige. Ihre Wange färbte sich rot, aber sie gab keinen Schrei von sich, sie hielt nur beide Hände vors Gesicht und weinte leise vor sich hin. Jetzt tat sie mir leid und ich bereute die Ohrfeige.
Dann versuchte ich, ihren Arm zu berühren, aber sie zog ihn sofort weg.
»Entschuldigung!«
Ich probierte es mit der Notverpflegung, zog einen Apfel aus der Tasche, brach ihn in zwei gleiche Hälften und schob ihr die eine zwischen Gesicht und Hände.
Sie schüttelte sich so heftig, dass der Apfel auf den Waldboden flog. Ich wollte ihre Hände wegziehen, sie schüttelte sich wieder, bis sich ihre langen Zöpfe in meinen Hosenträgern verfingen.
Ich schrie auf, sie hatte ihre Fingernägel in meinen Arm gebohrt.
»Verdammtes Biest!«
Ich drückte mein Taschentuch auf die Wunde und horchte. Aber der Lärm war in die Ferne gerückt.
»Wir kämpfen nicht gegen Weiber!«
Sie schien erleichtert, hob sogar die Apfelhälfte auf, schnippte ein paar gefräßige Ameisen weg und biss hinein.
»Warum haut ihr euch?«, fragte sie plötzlich.
»Zur Verteidigung!«, stammelte ich.
Sie meinte, das täten die Bannewitzer auch.
»Aber ihr habt angefangen«, beharrte ich.
»Umgekehrt!«, sagte sie trotzig.
Wir hätten uns noch eine Weile gestritten, wäre nicht plötzlich ein Schlachtruf zu uns gedrungen. Ich zog mein Holzschwert und befahl:
»Verschwinde, die Lage ist ernst!«
Sie sah mich mit großen Augen an.
»Na und?«
»Jetzt mach endlich, dass du die Kurve kriegst, oder willst du in der Schlacht fallen...«
Sie tippte sich mit dem Finger gegen die Stirn und wollte in Richtung Lindchendorf davonlaufen.
Ich hielt sie zurück.
»Zu spät, bleib jetzt!«, flüsterte ich, »Oder willst du den unseren in die Arme laufen?«
Das wollte sie nicht und ich zog sie ins Gebüsch, wo wir, eng aneinander gedrückt, abwarteten.
Ich spürte, wie sie zitterte. Weil weder Schlachtrufe noch sonstiger Lärm zu hören war, versuchte ich, sie zu trösten.
»Musst keine Angst haben.«
»Aber du blutest ja!«, rief sie erschrocken.
»Der Kratzer? Lächerlich.«
»Soll ich dich verbinden?« Sie zog ein sauberes Taschentuch hervor.
»Unsinn, ich bin ein Mann!«
Sie lachte, schüttelte das Tuch aus und band es mir behutsam um den Arm. Ich ließ es geschehen.
»Wenn Dreck in die Wunde kommt, gibt es eine Blutvergiftung!«
»Wie willst du das wissen?«
»Na weil ich später mal Ärztin werde«, sagte sie.
»Du, und Ärztin? Lass mich mal lachen.«
Ich konnte mir dieses Mädchen nicht im weißen Kittel vorstellen, womöglich mit Dutt, wie ihn die Gemeindeschwester trug.
»Und du?«, fragte sie. »Was willst du mal werden?«
»Ich werde Maler«, antwortete ich, etwas anderes wollte mir in diesem Moment nicht einfallen.
»I, sich mit Farbe bekleckern, das wär nichts für mich.«
»Ich meine Kunstmaler!«
»Kunstmaler?«, wiederholte sie mit einem leichten Spott in der Stimme.
»Kannst du denn malen?«
»Hab eine Eins im Zeichnen.«
Sie hielt plötzlich, als hätte sie es vorbereitet, Stift und Zettel in den Händen und bückte sich, damit ich ihren Rücken als Unterlage benutzen konnte.
»Die beste Malstaffelei bist du aber nicht! Und mach dich nicht so krumm, sonst werden es die Striche auf dem Papier auch!«
Dann zeichnete ich, so gut es ging, ein Mädchen, das ihr ähnlich sah, mit meterlangen Zöpfen an einen Baum gefesselt. Und in die Krone setzte ich mein Konterfei.
Sie lächelte und meinte erstaunt: »Du kannst.«
»Ach, nichts Besonderes.«
Inzwischen meldete sich wieder der Hunger, es wurde Zeit, dieses Halbdunkel unter kratzenden Fichtenzweigen zu verlassen und heimzukehren.
Aufmerksam verließen wir unser buschiges Versteck und ich musste an meine Mutter denken, die nichts von meinem »Fronteinsatz« erfahren durfte.
Nach einer halben Stunde Fußmarsch traten wir aus dem Wald. Zu unserer Überraschung sahen wir hüpfende Punkte in der Ferne, die näher kamen, größer wurden und sich zu Feldarbeiterinnen mit Kopftüchern und Kittel-Schürzen entpuppten.
Wir hörten Gewinsel und Gejammer, und dann sahen wir, wie jede der Frauen einen sich sträubenden Jungen hinter sich her schleifte. Die Mütter aus beiden Dörfern waren von der Feldarbeit desertiert, um die kindlichen Streitkräfte einzufangen. Ihre Schimpfkanonaden trug nun der Wind verstärkt herüber.
»Geht denn das schon wieder los? Euer Vater hat im Krieg sein Leben gelassen!«
Mich bewegte nur ein Gedanke: Hoffentlich war Mutter nicht unter ihnen. Und wenn, dann musste ich vor ihr zu Hause sein.
Ich machte also kehrt, warf mein Holzschwert in den Wassergraben und rannte, was die Füße hergeben wollten.
Das Mädchen aus Bannewitz, dessen Namen ich nicht erfahren hatte, lief in die entgegengesetzte Richtung, den Müttern direkt in die Arme.
Bald wuchs Gras über die Geschichte und meine Mutter glaubte, ich wäre friedfertig geblieben.
Das Mädchen mit den maisgelben Zöpfen aber hat mich nie verraten, immerhin trennten nur drei Kilometer Fußweg unsere Dörfer voneinander.
3 wir erfinden den Fußball
War nicht himmlischer Frieden, so war doch eine Art Waffenstillstand eingekehrt. Daran Anteil hatte auch Malermeister Zech, der vom Bürgermeister den Auftrag erhalten hatte, überall im Dorf Holztafeln aufzustellen, die er großflächig mit Kampfparolen zu bepinseln hatte..
Leim und Tapeten waren ohnehin Mangelware in diesen Tagen und die Farben wurden für die politische Agitation gebraucht, es gab wichtigeres zu tun, als Stuben zu renovieren.
Damit die Losungen in den Köpfen der Lindchendorfer Wurzeln schlagen konnten, sollten sie möglichst oft wiederholt werden.
Das brachte Zech auf eine Idee, er wurde Wiederholungstäter. Er fertigte für immer wiederkehrende Worte wie Vorwärts und Es lebehölzerne Schablonen an. Damit steigerte er die Produktivität der Pinselei um 25 %. Und auf den Tafeln war zu lesen:
»Vorwärts für eine bessere Zukunft!«, »Vorwärts für den Frieden, »Vorwärts unter dem Banner von Marx, Engels und Lenin!«
»Es lebedie unverbrüchliche Freundschaft mit der Sowjetunion!«, »Es lebe unser GenosseStalin!«, »Es lebe Marx und Engels!«
Allerdings waren Marx und Engels bereits vor sechzig Jahren gestorben, wie konnte man sie da noch leben lassen, wunderten wir uns.
Einmal war dem Zech ein Fehler passiert, er hatte das Wort Murx statt Marx geschrieben. Das hätte schlimm ausgehen können, wäre es ihm nicht gelungen, seinen Fehler noch in der Nacht, im Scheine der Taschenlampe zu korrigieren. Das Uließ sich problemlos in ein A umwandeln, und die Gefahr, künftig nur Gefängniszellen beschriften zu dürfen, war gebannt.