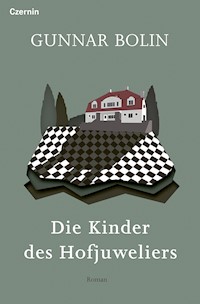
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maria, die Schwester des Wiener Bürgermeisters Karl Seitz, zieht von Wien nach Moskau und heiratet den Juwelier des Zaren. Nach der Russischen Revolution 1917 flüchtet sie mit ihrer Familie nach Schweden. Ihre Tochter Karin heiratet in den 1920er-Jahren den österreichischen Sozialisten Ernst Hoffenreich und deren Sohn Gerhard wiederum kämpft in der Wehrmacht. Der Journalist Gunnar Bolin legt nicht nur ein gefühlvolles und persönliches Romandebüt über drei Generationen seiner Familie vor, er erzählt ebenso europäische Geschichte. In der Familienvilla in Småryd findet Gunnar Jahre später zahlreiche Briefe und Dokumente und erkennt, dass noch viele Fragen offen sind. Er beginnt zu recherchieren und sucht Antworten. Wie kam seine Familie von Russland über Schweden nach Österreich? Wie erging es seiner Großmutter Karin und deren Mann Ernst während des Austrofaschismus? Und wie kam es dazu, dass Gerhard in der Wehrmacht kämpfte, sein Bruder Hans jedoch nach Schweden fliehen konnte? Gunnar Bolins Familienhistorie ist geprägt von Vertreibung und Verfolgung während der Diktaturen des letzten Jahrhunderts. Gleichzeitig aber bietet sie einen grandiosen Einblick in die Geschichte Europas. Aus dem Schwedischen übersetzt von Jürgen Vater.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gunnar Bolin
DIE KINDER DES HOFJUWELIERS
Roman
Aus dem Schwedischen von Jürgen Vater
Gunnar Bolin
DIE KINDER DES HOFJUWELIERS
Roman
Aus dem Schwedischen von Jürgen Vater
Czernin Verlag, Wien
Gedruckt mit Unterstützung des Zukunftsfonds der Republik Österreich und des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus
Bolin, Gunnar: Die Kinder des Hofjuweliers / Gunnar Bolin
Titel des Originals: Hovjuvelerarens barn
Wien: Czernin Verlag 2022
ISBN: 978-3-7076-0772-7
Copyright © Gunnar Bolin, 2019
First published by Albert Bonniers Förlag, Stockholm, Sweden
Published in the German language by arrangement with Bonnier Rights, Stockholm, Sweden
© 2022 Czernin Verlags GmbH, Wien
Aus dem Schwedischen von Jürgen Vater
Lektorat: Hannah Wustinger
Autorenfoto: Mattias Ahlm / Swedish Radio
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
Druck: GGP Media GmbH
ISBN Print: 978-3-7076-0772-7
ISBN E-Book: 978-3-7076-0773-4
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
Für die Großmutter meines Vaters, seine Babi: Maria Bolin, als Maria Seitz geboren in Wien 1865
Für meine Großmutter, meine Babi: Karin Bolin, geboren in Moskau 1897
Für die Großmutter meiner Kinder, deren Babi: Birgitta Bolin, als Birgitta Houmann geboren in Malmö 1933
Für meinen Vater: Gerhard W. Bolin, als Gerhard W. Hoffenreich geboren in Wien 1921
Inhalt
PROLOG
ERSTER TEIL
Russland
Moskau
Småryd
Umzug aus Moskau
Gespräch mit Vater
Im Kurort
Revolution vor dem Fenster
Die Familie wird schwedisch
ZWEITER TEIL
Österreich
Gespräch mit Vater
Wien
Die Familie Hoffenreich
Ernst Hoffenreich
Frieden
Hochzeit
Gespräch mit Vater
Allein in Österreich
Frau Hoffenreich werden
Familienleben
Osterglocken in Wiener Neustadt
Gespräch mit Vater
Besuch in Wien
Der Tag der Republik
Ungleichheiten
Die Zeiten werden schwieriger
Die Sommer auf Småryd
Antisemitismus
Gespräch mit Vater
Sauerbrunn
Austrofaschismus
Ostern 1933
Gespräch mit Vater
Das Licht wird gelöscht
Wöllersdorf 1934
Obstessig aus Småryd
Palffygasse
Nach der Politik
DRITTER TEIL
Österreich verschwindet
Eine neue Zeit
»Hier kommt das Dritte Reich«
Babi unterrichtet
Kriegszeit
Gespräch mit Vater
Der Krieg
Ernst im Kriegswinter 1942
Gespräch mit Vater
Mitten in diesem Chaos
Gespräch mit Vater
Karin in Stockholm
Gerhards Weg Richtung Schweden
Die Dame des Hauses
EPILOG
Gespräch mit Vater
Die Verwandtschaft
Das Ende
Nachwort
PROLOG
»Hallo, Bamsen, ich bin’s, Vater. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht mehr leben will. (Pause) Ich habe auch Nuffi angerufen und es ihm gesagt. Servus.«
Es war, soweit ich mich erinnere, ein ganz gewöhnlicher Morgen gegen Ende Juni 2012. Ich befand mich in Småland beim Sommerhäuschen meiner Frau und ihrer Schwester. Da der Empfang dort damals noch schlecht war, stand ich vermutlich irgendwo zwischen dem inzwischen kaum noch erkennbaren Sandkasten und dem großen Stein und hörte meinen Anrufbeantworter ab.
Welche Gefühle stiegen in mir auf?
Keine unmittelbare Panik. Kein kalter Wind, der mich durchfuhr. Kein unwiderstehlicher Drang, ins Auto zu stürzen und nach Stockholm zu fahren.
Die spärliche Lebenslust meines Vaters war nichts Neues. Er hatte seit Langem davon gesprochen, dass ihn nur zwei Dinge daran hinderten, sich das Leben zu nehmen. Das eine war, dass er sich nicht vorstellen wollte, dass seine Kinder nicht nur eine Mutter, sondern auch einen Vater hatten, die es vorzogen, ihr Leben auf diese Weise zu beenden. Das andere war, dass er zu feige sei.
In jüngster Zeit war es meistens die Feigheit gewesen, über die er sich beklagte. Es gebe keine Vorgehensweise, die garantiert schnell und sicher war. Einige Male hatte er die Guillotine erwähnt. Darüber konnten wir beide lachen, da ich zu bedenken gab, dass es heutzutage vielleicht schwierig sei, Guillotinenhändler zu finden. Überhaupt war der Begriff »Galgenhumor« eine Beschreibung, die gerade in seinen letzten Jahren gut zu meinem Vater passte. Aber das Lachen wurde immer seltener.
Ich rief ihn später am selben Tag zurück. Er hatte seine morgendliche Nachricht vergessen, und auf meine Frage, wie es ihm ginge, antwortete er wie gewöhnlich: »Geht so, geht so.«
***
Mein Vater hatte enorme Hände. Grob und rau, aber mit perfekt gepflegten Fingernägeln. In meiner Kindheit behandelte er sie sorgfältig, zunächst mit der Zange, die er selbstverständlich im Fachgeschäft von Walter Weiss in der Mariahilfer Straße 33 in Wien erstanden hatte. Nach dem Schneiden wurden die Nägel gewissenhaft mit einer kleinen Feile geschliffen, die er ständig in einem roten Plastiketui in der Innentasche seines Sakkos trug.
Viel später, als Vaters Gedächtnis auszufransen begann, bat er mich, eine neue Nagelzange zu kaufen, und zwar bei ebenjenem Herrn Weiss in der belebten Mariahilfer Straße. Niemand war so hartnäckig wie mein Vater, wenn es um etwas ging, das ihm von Nutzen war.
»Aber ich werde nur einen Tag in Wien sein und habe etliche andere Sachen zu tun«, sagte ich abwehrend. »Irgendwo hier in der Stadt findest du garantiert eine ähnliche.«
Vater senkte seine Stimme: »Nein, eben nicht. Meinst du, ich hätte nicht gesucht? Bitte, Lubel …«
Ich weiß noch immer nicht, woher dieser Kosename kam. Bamsen, wie ich sonst genannt wurde – und was sich sogar in der Bezeichnung unserer Familie niederschlug –, kam von meiner kindlichen Vorliebe für ein Lied von Klaus Klettermaus. Niemals sagte er Gunnar zu mir.
»Bitte, Lubel, es würde mir tatsächlich« – mit Betonung auf jeder Silbe – »eine große Freude bereiten. Versuch …« – mit Betonung auf beiden Silben – bleiern, bedrückt, bittend.
Natürlich ging ich bei Weiss vorbei, diesem unglaublichen Geschäft voller Cremen, Zangen, Bürsten und allerlei anderer Dinge, deren Verwendungszwecke ich nicht einmal raten konnte. Ich kaufte die schwere Nagelzange und als ich sie Vater überreichte, bekam ich umgehend die sechshundert Kronen zurück, die ich dafür ausgelegt hatte. So war er.
Wenn ich ihn in den letzten Jahren im Altenheim besuchte, bat er mich manchmal, ihm eine Zimtschnecke zu kaufen. Er sagte dann: »Hier sind alle völlig verrückt«, wobei er die Wörter so betonte, dass ein geübtes Ohr in seinem ansonsten akzentfreien Schwedisch den Ansatz einer fremden Sprachmelodie entdecken konnte.
Als ich mit der Zimtschnecke kam, hatte er bereits seine Brieftasche gezückt, um mir meine Auslagen zu erstatten.
»Was kostet sie?«
»Zwölf Kronen, aber ich kann bezahlen. Mach dich nicht lächerlich.«
»Zwölf Kronen? Ich glaube, du bist verrückt. Wo hast du die bloß gekauft?«
Er bestand darauf, bezahlen zu dürfen.
»Warum solltest du mir eine Zimtschnecke schenken, das verstehe ich nicht.«
Er runzelte die Stirn, wühlte in seiner Brieftasche herum und sah unglücklich aus.
Nein, warum sollte ich? Für Vater waren unmotivierte Geschenke etwas zutiefst Unangenehmes. In meinen dunkelsten Momenten schien mir sogar, dass Großzügigkeit etwas war, das seine Welt bedrohte, etwas, das sie langsam zum Bersten bringen könnte. Konsequenterweise quälte ihn das Geben ebenso wie das Nehmen, egal ob es eine Zimtschnecke oder Weihnachtsgeschenke betraf.
Es kam vor, dass mein Bruder und ich uns über ihn mokierten, indem wir ihm teure, ausgeklügelte Weihnachtsgeschenke machten, irgendetwas, das ihn wahrhaft in Verlegenheit brachte. Gewiss habe er ein neues Radio mit CD-Spieler haben wollen, aber deshalb könne man doch nicht einfach losgehen und so etwas kaufen?
Einmal wünschte er sich zu Weihnachten eine Monatskarte für Bus und U-Bahn, eine für Januar von mir und eine für Februar von meinem Bruder. Ein anderes Mal fragte er allen Ernstes, ob er sich nicht von allen Geschenken freikaufen könne: »Was würde es kosten, wenn mir Geburtstagsund Weihnachtsgeschenke für euch und die Enkel für den Rest meines Lebens erspart blieben?«
Es ging ganz entschieden nicht um Finanzen, sondern lediglich um den fast physischen Schmerz, den es ihm bereitete, wenn er Geld ausgab. Später im Leben sah ich ein, dass diese Eigenheit annähernd als Phobie zu betrachten war, und ich lernte, sie etwas besser zu tolerieren.
Aber einmal, als ich mit ihm einen Ausflug zum Café Brostugan auf Kärsön machte, half die Einsicht über seine Krankheit nicht, und ich fühlte mich durch sein Verhalten trotzdem furchtbar gekränkt. Der Ausflug war eine Ergänzung zu den wöchentlichen Abendessen bei uns zuhause, bei denen ich häufig eines seiner (und meiner) österreichischen Lieblingsgerichte auftischte: Schnitzel, Specklinsen, manchmal mit Knödeln.
Ich holte ihn immer ab oder brachte ihn zurück – fünfzig Minuten in eine Richtung. Für die andere Richtung zwang ich ihn, den Beförderungsdienst für Behinderte zu nehmen.
»Aber das kostet ja fünfundsiebzig Kronen!«
Als wir uns der Selbstbedienungskasse des Cafés näherten, fragte ich etwas ironisch, da ich die Antwort bereits ahnte: »Wer soll zahlen?«
»Was glaubst du? Du warst es doch, der hierherfahren wollte«, sagte er und glitt hinter meinem Rücken vorbei. »Wo ich wohne, ist der Kaffee kostenlos.«
Vater hatte ein ansehnliches Sparkapital auf der Bank. In den letzten Jahren verbrauchte er auch seine Pension nicht, sodass jeden Monat einige Tausender übrig blieben. Könnte das ein Argument in der Frage sein, wer zahlen sollte? Nein, ich wusste ja, dass die Diskussion fruchtlos wäre.
Auch als unsere Kinder klein waren und unsere Einkommen gerade eben ausreichten, gab er nie etwas ab oder fragte, ob er uns bei teureren Einkäufen unterstützen könnte. Unsere Kommunikation war Gott sei Dank immer frei von Zweideutigkeiten oder Andeutungen. Auf die Frage: »Wir würden wirklich neue Betten brauchen, kannst du uns nicht etwas dazugeben?«, bekamen wir daher immer eine ebenso geradlinige Antwort: »Nein, das möchte ich unter keinen Umständen. Es ist mir ein Gräuel, dass von mir erwartet wird, so große Summen zu verschenken.«
Und dennoch lachte die ganze Familie hinter seinem Rücken: »Weißt du, was er heute gesagt hat?«
Ich dachte an all die Anlässe, bei denen ich Kollegen und Freunden von meinem geizigen Vater erzählt hatte. Die Geschichte etwa, wie er versucht hatte, abgetragene Kleidungsstücke in dem vornehmen Stockholmer Warenhaus NK umzutauschen, indem er behauptete, sie seien neu. Oder wie es ihm gelungen war, sich einen Rabatt auszuhandeln, weil er angeblich Mitglied irgendeines Vereins sei. Oder wie er die Bäckerei ausfindig machte, die das gute deutsche Kümmelbrot herstellte, das aber in der Markthalle beim Konzerthaus ganze fünfundvierzig Kronen kostete. Vater fuhr zur Bäckerei hinaus, freundete sich mit den Leuten an (sagte er) und bekam das Brot für fünfundzwanzig.
Ich fand diese Situationen vor allem komisch. Dennoch stand ich dort im Café Brostugan und überlegte, wie es ihm und mir vorkommen müsste, falls er sagen würde: »Jetzt möchte ich wirklich bezahlen« – Kaffee und Zimtschnecke für fünfundvierzig Kronen –, »du lädst mich ja jede Woche zum Essen ein, kommst und holst mich mit dem Auto ab, rufst jeden Tag an. Jetzt möchte ich gern einmal bezahlen.«
Oder vielleicht: »Ich möchte die ganze Familie ins Restaurant einladen! Ich bin doch ständig bei euch, und ihr seid nie bei mir!«
Ich konnte nur lächeln, als ich mir diese Worte aus dem Mund meines Vaters vorzustellen versuchte.
Und als wir wieder in Vaters Altenheim zurückkamen, fragte eine Mitarbeiterin: »Na, Gerhard, war’s nett im Café?«
»Nun ja, einigermaßen …«, antwortete er.
Dann konnte ich leicht sarkastisch sagen, dass er ja in Zukunft seinen Kaffee allein auf seinem Klo trinken könne, und wir lachten beide. Diese Art von Scherzen mochte er am liebsten.
***
Dennoch durften gewisse Dinge etwas kosten, wie die Nagelzange vom ehemaligen kaiserlichen Hoflieferanten Weiss in Wien. Sie hatte, genau wie seine früheren, gerillte Außenseiten, damit sie gut in der Hand lag. Auf der Innenseite saß eine gespannte Feder zwischen beiden Bügeln, was der Zange eine angenehme Elastizität gab, wenn man die Fingernägel schnitt. Dass Vater, der sonst nie etwas Neues kaufte, falls das Alte nicht vollständig ausgedient hatte, mich gebeten hatte, eine neue zu kaufen, hatte einen besonderen Anlass: »Merkwürdig, meine schöne alte Zange funktioniert nicht mehr. Es ist, als würde sie plötzlich zu klein sein, ich versteh es nicht. Etwas muss passiert sein.«
Es war kaum überraschend, dass die neue auch nicht recht funktionierte, wie er es sich gedacht hatte. Ich weiß nicht mehr, ob es die Größe, die Elastizität oder das Design war. Vermutlich zog er daraus den Schluss, dass die Zeit der perfekten Nagelzangen und damit, was das Schmerzlichste war, die Zeit der vorzüglichen Nagelpflege vorüber war. Die Nagelfeile allerdings, die kleine in dem roten Etui, handhabte er souverän, solange er sich daran erinnerte, dass er mindestens einmal in der Woche seine Fingernägel damit zu feilen pflegte. Aber mit der Zeit verschwand auch sie.
In meiner Kindheit ereignete sich das Nagelfeilen vor dem Fernseher, rechtzeitig zu den Nachrichten. Die Hand wurde flach auf den ledernen Couchtisch aus Peru gelegt, den Vater einmal im Jahr mit Schuhcreme putzte. Vorsichtig feilte er um die Nägel, sodass feiner Staub einen Umriss des Fingers bildete. Dann blies er den Nagelstaub stoßartig fort und formte dabei mit dem Mund eher ein »u« als ein »ü«, wodurch das Blasen mehr Bass- statt Sopranklang erhielt. Dann betrachtete er zufrieden das Ergebnis, legte die Feile sorgfältig zurück und zündete sich eine Gauloises an, falls es vor 1970 war. Später war es eine Marlboro.
Altern heißt nicht nur, dass Gedanken und Gedächtnis ausfransen, sondern auch, dass die gewohnten physischen Bewegungen sich nicht mehr in dem verlässlichen Alltagstrott wiederholen lassen, den man, unterschiedlich exakt, zu Hilfe genommen hatte, um seinen Tagesablauf einzuteilen. Es muss eine ängstigende Einsicht sein, dass etwas unwiderruflich zu geschehen im Begriff ist, wenn man mit der alten Zahnbürste in der Hand dasteht und auf die blitzende Elektrobürste schaut und nicht weiß, welche man für gewöhnlich benutzt.
Für Vater waren zum Schluss fast keine Routinen übrig. Häufig sprachen wir gerade über etwas vollkommen Geläufiges, als er plötzlich antwortete: »Was, wovon redest du? Das habe ich nie gemacht.«
Solange ich zuhause wohnte, wusste ich über seinen rigiden Tagesablauf Bescheid, ob ich es wollte oder nicht. Ich hatte das Gefühl, dass er all seine Handgriffe in einem stockfinsteren Zimmer ausführen könnte.
Sein Tag begann mit dem Klingeln des Weckers. Das Schlafzimmer war pechschwarz, die Fenster mit dreifachen Verdunkelungsvorhängen versehen. Erst einer aus dickem Plastik mit Messingnieten, den man seitlich an Haken befestigte, sodass der Vorhang über das Fenster gespannt wurde. »Da darf kein Spalt sein!« Dann ein Rollo und schließlich dicke, gefütterte Vorhänge.
Der Wecker klingelte also, dieser dünne, schwere mit Lederrand, den er sich selbst zu Weihnachten geschenkt hatte. Für Mutter, die seinen alten erbte, hatte er einen Vers geschrieben, über dessen unbeschreiblichen Witz er selbst lachte, bis ihm Tränen in die Augen traten. Erst viel später verstand ich, wie sein leicht salonfähiger Sadismus meine Mutter gequält haben musste, denn sie bekam ja kein weiteres, liebevoll gewähltes Geschenk. Nein, das richtige Geschenk war etwas, das sie sich selbst ausgesucht und worüber man sich geeinigt hatte, weil die Familienfinanzen es erlaubten.
Aber zurück zur Morgenroutine meines Vaters. Nun schwang er seine Beine, die im Schlafanzug steckten, über den Bettrand, zog sich den Morgenrock an, ging zur Toilette, ließ Wasser und ging ins Schlafzimmer zurück. Morgengymnastik. An den Wochenenden saßen mein Bruder und ich hinten auf je einem Schenkel, während sich Vaters großer Rücken zur Zimmerdecke hob. Er faltete die Hände im Nacken, richtete den Oberkörper auf und drehte ihn nach rechts und links. Die Schenkel bewegten sich. Dann sprangen wir ab, er machte Liegestütze, Mühlenradbewegungen mit den Armen, um abschließend auf der Stelle zu joggen.
Wochentags hatte Vater stets Anzug und Krawatte an. Er ging in den Gang des oberen Stockwerks, nahm den Anzug ganz hinten aus dem Kleiderkasten, das oberste Hemd vom Stapel, und dann folgte die einzige Wahl des Tages: welchen Schlips dazu? Er ging die Treppe hinunter, bereitete sich einen Espresso auf dem Gasherd zu, rauchte zwei Gauloises und aß ein Stück Kardamomkuchen.
So verlief sein Morgenritual bis in die späten Sechzigerjahre, als die Gebote für einen gesünderen Lebenswandel sowie Eterna, das erste schwedische Müsli, es unmöglich machten, weiterhin Süßes zum Frühstück zu essen.
Um halb fünf kam mein Vater aus dem Büro nach Hause. Nie machte er Überstunden: »Ich bin zu faul.«
Ich wuchs mit seinem totalen Abscheu für Arbeit auf. Er arbeitete bei einer Exportfirma, die Propangas-Werkzeuge und -Küchen für Haushalt, Industrie und Camping verkaufte. Die Arbeit gefiel ihm, wenn er reisen konnte und für sich sein durfte, aber er hatte Schwierigkeiten, sich an die Sitzungen und langen Diskussionen im Büro zu gewöhnen. Am meisten verabscheute er es, wenn abenteuerliche Ideen umgesetzt werden sollten. Auf den Reisen konnte er die Spesen sparen, indem er vom Existenzminimum lebte und sich, sooft es ging, einladen ließ. Davon erzählte er höchst zufrieden, wenn er nach Hause kam.
Nach dem Familienessen, das etwa in einer Viertelstunde erledigt war, eine weitere Tasse Kaffee, weitere Gauloises, und dann wurde der Anzug ausgezogen, ganz vorne in den Kasten hineingehängt und die übrigen sechs zurückgeschoben, sodass der Kreislauf nicht unterbrochen wurde. Aufmerksame Kollegen konnten anhand des Anzugs meines Vaters ausmachen, welcher Wochentag gerade war.
Dann zog er Schlafanzug und Morgenrock an. Die Strümpfe behielt er an und steckte die Füße in ein Paar Hausschuhe aus schwarzem Leder.
Nach dem Essen rauchte er drei, vier Zigaretten vor dem Fernseher, oft mit einem Buch auf dem Schoß. Mutter saß entweder daneben und strickte oder befand sich im unteren Stockwerk und telefonierte.
Dann war es Zeit, ins Bett zu gehen, und Vater begab sich in das Schlafzimmer des Hauses in Bromma, um die Verdunkelung zur Nacht vorzunehmen.
Dass wir in einem Haus in Bromma, diesem gut situierten Vorort von Stockholm, wohnen konnten, hatten wir Tante Hilda zu verdanken. Was wir auch taten. Im Esszimmer hing ein enormes Porträt dieser Erbtante, der Schwester meines Großvaters, der kinderlosen Tante Hilda, in einem Goldrahmen. Vater trank immer auf ihr Wohl, wenn wir Gäste hatten und im Esszimmer aßen: »Na, servus Hüllietante!«
Das Österreichische war bei meinem Vater allgegenwärtig, vor allem aber als gemütlich-exotische Komponente meiner Kindheit. Mir war früh bewusst, dass die Familie meines Großvaters väterlicherseits, Ernst Hoffenreich, aus Österreich kam, dass aber auch der Name Bolin von der Seite meines Vaters, nämlich von seiner Mutter stammte und dass die Familie von daher noch immer ein großes Juweliergeschäft in der Sturegatan 12 in Stockholm besaß.
In dem Geschäft besuchte ich meinen Onkel Hans, seine Frau Jackie und die Geschwister meiner Großmutter, Margit und Henrik, die ich Gaba und Onkel Hinke nannte. Dort arbeitete auch die kleine nette Tante Lita zusammen mit anderen Damen und vereinzelten Herren, denen man höflich Guten Tag sagen musste. Darüber, dass mein Vater und meine Großmutter die Einzigen in der Stockholmer Bolin-Familie waren, die nicht in der stolzen Juwelierfirma arbeiteten, machte ich mir keine Gedanken.
Die Bolins waren Hofjuweliere des Zaren, flüchteten aber nach der Russischen Revolution von Moskau nach Stockholm, oder eher: sie wurden gezwungen umzuziehen.
Ich glaube, es war dem Geschäft zuträglich, dass sowohl Onkel Hinke als auch Gaba den Hauch einer nicht schwedischen Satzmelodie hatten, wenn sie sprachen, und dass sie sich miteinander auf Russisch unterhielten. Ich habe viele Stockholmer aus der Generation meiner Eltern getroffen, die versicherten, wie exotisch es war, die Juwelierfirma W. A. Bolin aufzusuchen, und dass die beiden großen, eleganten Geschwister Bolin aus einer anderen Welt zu kommen schienen.
Meine Großmutter, Karin Bolin, wurde in Moskau geboren, und auch sie sprach mit ihren Geschwistern stets Russisch. Ihre Mutter, Maria, kam aus Wien, aber Karin hatte väterlicherseits Wurzeln im Stockholmer Stadtteil Södermalm. Ihr Großvater, Henrik Conrad Bolin, »suchte sein Glück gen Osten, in Sankt Petersburg«, wie es in einer Familienchronik steht, nachdem das Schiff seines Vaters 1831 im Nebel vor Eastbourne von einem englischen Schiff gerammt wurde, woraufhin er ertrank und seine Witwe in schwerer wirtschaftlicher Not hinterließ.
Die exotische russisch-österreichische Familie hatte also weit zurückliegend auch verlässliche schwedische Wurzeln, was meinem Vater bereits als Kind eine doppelte kulturelle Zugehörigkeit gab: Er war sowohl Österreicher als auch Schwede.
Im Grunde war die Familie Bolin schwedisch. So kam mir Vaters Familie vor, als ich Kind war. Dass er einen österreichischen Vater hatte, wusste ich natürlich, aber er hatte außerdem noch weitere deutschsprachige Wurzeln, sodass das Schwedische bei den Bolins außerordentlich verwässert war, was mir erst viel später klar wurde.
Vater wuchs in Österreich auf und sprach mit seinen Eltern und seinem Bruder ausschließlich Deutsch. Sein durch und durch österreichischer Vater lernte nie Schwedisch. Aber in den Sommerferien in Skåne sprach Vater immer Schwedisch mit seinen Freunden. Dass ich Bolin und nicht Hoffenreich heiße, kommt daher, dass Vater den Mädchennamen seiner Mutter annahm, als er 1947 nach Schweden kam und sich entschied, hier zu bleiben.
***
Nachdem Vater neunzig geworden war, kam er nicht mehr allein zurecht und war schließlich gezwungen, von einer betreuten Wohnung in das Altenheim derselben Anlage in Nockeby in der Nähe der Stockholmer Innenstadt zu ziehen. Mein Bruder und ich hielten einen ständigen Kontakt mit ihm aufrecht und zweimal in der Woche bekam er von einem von uns Besuch. In den letzten Jahren musste, wer ihn besuchte, für den Gesprächsstoff sorgen. Mein Vater fragte immer: »Na, wie geht’s euch? Erzähl mal!«
Gegen Ende seines Lebens begann ich damit, kleine Nachforschungen über meine Großeltern im Österreich der Zwanziger- und Dreißigerjahre anzustellen. Vater hatte vierzigseitige »Memoiren« geschrieben, wie er sie nannte, die ein guter Ausgangspunkt waren. Sie begannen mit seinem üblichen Humor:
Auf inständige Bitte, um nicht zu sagen unerträgliches Quengeln (hier hatte Vater handschriftlich »fast« vor »unerträgliches« eingefügt) meines letztgeborenen Sohnes (das bin ich) möchte ich nun versuchen, solange mein Gedächtnis mir beisteht, nicht nur die Meilensteine meines Lebens, sondern auch Ereignisse und Erlebnisse aufzuzeichnen, die bedeutsam waren, ohne jedoch Dinge allzu persönlichen Charakters einzubeziehen, Dinge, für die man sich schämt, oder andere abschätzige Umstände, die in den Augen nachfolgender Geschlechter einen Schatten auf die goldene Aura des Stammvaters werfen könnten.
Vater liebte es, Weihnachtsgeschenke mit Versen zu versehen, die darauf hinausliefen, sich selbst zu huldigen oder den Reim zu preisen, den wir gerade gehört hatten. Daher war die Einleitung seiner »Memoiren« für mich recht amüsant und nett, auch wenn gerade die Weglassung der »Dinge allzu persönlichen Charakters« sich leider als wahr erwies.
Im Altenheim stellte ich ihm tropfenweise Fragen. Manchmal lag er auf seinem Bett, manchmal saß er in seinem Sessel. Der Blick war getrübt und glitt häufig durch das Zimmer und weiter zum Fenster hinaus. Bei nahezu jedem Besuch fragte er nach dem Wasserturm in Sätra, den er von seinem Fenster aus in der Ferne sah.
»Was ist das dort eigentlich für ein Turm?«
Der Auftakt meines Interesses für die österreichische Geschichte der Familie war ein kleiner Karton, den ich in unserem gemeinsamen Sommerhaus in Småryd bei Båstad gefunden hatte. Schon früher hatte ich dort eine Menge an Briefen entdeckt und darin geblättert: auf Russisch, Schwedisch, aber vor allem auf Deutsch, die meisten in einem Sekretär im Salon gesammelt. Sie enthielten ein Wirrwarr unterschiedlicher, mehr oder weniger lesbarer Handschriften, von Kindern an ihre Eltern, von Geschwistern untereinander und von allen möglichen Freunden und Bekannten, die entweder für den Aufenthalt danken oder fragen, wann sie kommen dürfen.
Das Haus auf Småryd war und ist noch immer wie ein gigantisches Archiv über die Familie Bolin. Auf dem großen Dachboden liegt ein unsortiertes Durcheinander von Schulbüchern aus Moskau, Stockholm und Österreich, vermengt mit Kinderzeichnungen, Zeugnissen und Spielzeug. Im Untergeschoß ist der Sekretär des Salons randvoll mit Briefen, losen Bildern, Einladungskarten, Beileidsschreiben, alten Fotoapparaten und Glasplatten.
Als wir ein Zimmer als Bibliothek umbauen ließen, sammelten wir alles an einer Stelle. In verregneten Sommern saß ich oft in einem Sessel und las etwas planlos in den Briefen. Aber in den Neunzigerjahren wurde ich systematischer. Die Juwelierfamilie und die Zeit in Russland waren gut dokumentiert, aber die Kindheit meines Vaters? Der Umzug meiner Großmutter nach Österreich, ihre Heirat mit einem jungen österreichischen Sozialisten – meinem Großvater? Vaters Zeit in der Wehrmacht? Warum wusste ich so wenig darüber?
Irgendwann Ende der Neunziger fand ich also den Karton aus vergilbter Pappe, hineingestopft in den oberen Teil eines Kleiderkastens, zwischen alten Hutschachteln und Gewand. Darin entdeckte ich die Briefe, die mich am meisten interessierten: von meiner Großmutter und ihrer Zeit in Österreich zwischen den Kriegen, Briefe, die sie ihrer Mutter nach Stockholm geschrieben hatte. Ich nahm sie mit nach Hause, las sie und schrieb eine Übersetzung für die jüngeren Verwandten ins Reine, die kein Deutsch konnten. Es handelte sich um eine sporadisch gesammelte Korrespondenz von 1918 bis 1947.
Ich versuchte, die Lücken zu füllen, und fragte Vater, wie es kam, dass sein Vater sozialdemokratischer Politiker wurde. Ernst Hoffenreich, geboren 1890, war doch ein vielversprechender Jurist und in einer katholischen, konservativen und großbürgerlichen Familie aufgewachsen, deren Oberhaupt Bankdirektor war. Er, der Stolz der Familie, dem eine glänzende Karriere in der österreichischen Doppelmonarchie vorausgesagt worden war. Dass er nach dem Ersten Weltkrieg Sozialist wurde, stieß auf totales Unverständnis. Er wurde sogar einige Monate interniert, als Österreich zur Diktatur geworden war, ehe die Nationalsozialisten an die Macht kamen.
»Ja, wie war es nun damit?«
Mein Vater schien es sich selbst zu fragen.
»Vater war Idealist«, sagte er etwas zögernd. »Aber eigentlich weiß ich es nicht, ich interessierte mich ja überhaupt nicht für Politik«, behauptete er mit einer deutlichen Betonung auf »überhaupt«.
Es gab so vieles, was ich über die Jugend meines Vaters wissen wollte. Wie erging es zum Beispiel meiner Großmutter, die wir Enkel immer nur Babi nannten, eine Diminutivform für Babuschka. Babi war in Moskau in einem Riesenhaus mit Köchinnen, Haus- und Kindermädchen aufgewachsen. Als die Revolution vor der Tür stand und der Erste Weltkrieg ausbrach, zog sie nach Schweden und als Dreiundzwanzigjährige wurde sie Hausfrau in einer kleinen Stadt südlich von Wien. Wie traf Babi meinen Großvater? Wie verliebten sie sich ineinander, das Mädchen aus der Oberschicht und der idealistische Sozialist Ernst Hoffenreich? Und wie empfand sie es, als sie dann in eine noch kleinere Stadt zogen, nach Sauerbrunn südlich von Wien? Dort wurde mein Großvater Bürgermeister.
Und wie war es, als mein Großvater im Februar 1934 von der faschistischen Regierung in Österreich festgenommen wurde? Damals wurde er in ein Lager geschickt – zusammen mit Nazis, die ebenfalls als Feinde des Regimes betrachtet wurden. Was taten meine Großmutter und ihre beiden Söhne, mein Vater und Onkel Hans? Wie brachten sie sich durch während der Monate, in denen mein Großvater inhaftiert war? Wie erlebten der sozialdemokratische Bürgermeister und seine Frau die Zeit nach 1938, als Österreich von den Nazis einverleibt worden war?
Und nicht zuletzt: Wie kam es, dass Vater 1934, als Dreizehnjähriger, nach Wien geschickt wurde, um bei der Schwester seines Vaters, Tante Hilda, und ihrem sadistischen und nazistisch angehauchten Mann Hugo zu wohnen? Fünf Jahre musste er bei ihnen bleiben. Wie konnte meine geliebte Großmutter, meine Babi, ihrem Sohn das antun? Und mein Großvater? Er, der mit seiner konservativen Familie fast gebrochen hatte, um seiner politischen Berufung zu folgen – was dachte er, als er die Erziehung seines ältesten Sohns diesem eingeheirateten Onkel mit völlig anderen Leitbildern überließ?
Und war es notwendig, dass mein Vater während des Zweiten Weltkriegs in der Wehrmacht kämpfte, während es Babi doch gelang, Hans herauszuholen und nach Schweden kommen zu lassen? Was tat Vater eigentlich im Krieg? Er war in Norwegen, sagte er selbst. Das war so gut wie alles, was ich wusste, und dass seine Sprachkenntnisse ihm das Leben retteten, als er in den amerikanischen Gefangenenlagern Dolmetscher wurde.
Warum wurde Vater diese rastlose Person, die ihr Leben lang andere verärgerte oder, wie er sagte, »geradeheraus« war, was meistens bedeutete, dass er sie verletzte. Woher kam seine Abneigung gegenüber wirklicher Gemeinschaft? Warum war er meistens allein oder zumindest immer mit Dingen beschäftigt, die vor allem ihn selbst amüsierten und befriedigten? War es der Krieg oder die Zeit bei Hilda und Hugo, der beziehungsweise die ihn geprägt hatte?
***
Auf meiner Suche reiste ich mehrfach nach Wien. Ich suchte in Archiven, traf Menschen, die sich an diese Zeit und sogar an meinen Großvater und meine Großmutter erinnerten. Ich versuchte, mir ein Bild von der Zwischenkriegszeit in Österreich zu machen, in der sie lebten: mein rastloser Vater und seine Mutter, die Tochter des Hofjuweliers aus Moskau.
Aus gewissen Jahren gibt es zwanzig bis dreißig Briefe meiner Großmutter an ihre Mutter Maria in Schweden. Dann gibt es mehrjährige Lücken, sporadische Briefe tauchen auf. Babi schrieb auch über Briefwechsel mit Freunden, Briefe, die ich mit wenig Hoffnung aufzuspüren versuchte. Ich fuhr nach Oslo, wo sich der Nachlass von Babis bester Freundin Gertrud bei deren Enkeln befindet. Babi und Gertrud schrieben einander in der gesamten Nachkriegszeit, aber nichts ist erhalten.
Vater hob seine österreichische Korrespondenz gewissenhaft in einem Ordner auf, aber dort befinden sich vor allem Briefe an Freunde und Geschäftspartner sowie massenweise Briefe an und von Wetti, der Haushälterin der Familie. Wetti kam in die Familie, als Vater sieben und sie achtzehn Jahre alt war. Sie hielten Kontakt miteinander, solange sie lebte.
Aber ich bemerkte, dass ich, um die Familie zu verstehen, die Wurzeln zunächst etwas tiefer verfolgen musste, bis nach Russland, wohin der Großvater meiner Großmutter bereits 1836 emigriert war.
ERSTER TEIL
Russland
Karin Bolin, meine Großmutter Babi, sieht auf den Fotografien, die aufgenommen wurden, als sie klein war, häufig glücklich aus. Auf einem Bild hat sie eine große Puppe im Arm. Das Bild ist etwas unscharf, aber man sieht, dass sie dem Fotografen lachend entgegenläuft. Sie mag etwa vier oder fünf Jahre alt sein, wir schreiben also 1901, 1902.
Karin ist nicht auf dieselbe Art konventionell süß wie ihre große Schwester Maja. Überhaupt haben alle vier Geschwister ihren eigenen Charakter, niemand ähnelt den anderen wirklich. Bilder mit den vier Geschwistern zusammen könnten ebenso gut vier Freunde darstellen.
Ihre Mutter, Maria, ist eine begeisterte Amateurfotografin mit eigener Dunkelkammer, sowohl in Moskau als auch im Sommerhaus der Familie in Skåne, wo sie ab 1903 ihre Sommer verbringen. Hierher, in ihre Dunkelkammer, kann sie sich zurückziehen und in Ruhe ihre Bilder entwickeln. Niemand darf herein: wird die Tür im falschen Moment geöffnet, können etliche Stunden Arbeit verloren gehen. Das weiß Karin. Maria ist auch Mitglied im Moskauer Fotoklub.
Maja ist drei Jahre älter als Karin. Die Brüder Erik und Henrik sind sieben beziehungsweise fünf Jahre älter. Als Maja sieben Jahre alt ist, stirbt sie plötzlich an Scharlach. Ich habe das kleine Buch, in dem Geburtsgewicht, Krankheiten und andere Kommentare zu ihrer Physis in schmalen Zeilen mit Bleistift eingetragen sind. Es handelt sich um recht alltägliche Aufzeichnungen über Husten, Fieber, Magenprobleme sowie Zu- und Abnahme von Gewicht. Das Buch ist dünn und hat einen braunen Ledereinband mit diskret geprägtem Muster auf dem Rücken. Dort steht mit einem Mal, kurz und schockierend, nach einem gewöhnlichen Eintrag über Husten, in Marias sorgfältiger, dünner Handschrift:
27. Oktober, erkrankt an Scharlach. 28. Oktober, entschläft sanft am Abend.
Weiter nichts. Nur diese entsetzlichen, lakonischen Worte.
Wie hat sich das abgespielt? Ich versuche, mir die Umstände vorzustellen. Ein siebenjähriges Mädchen bekommt hohes Fieber und stirbt innerhalb von vierundzwanzig Stunden.
Steht die Familie am Bett? Hält jemand ihre Hand? Eine vierjährige Schwester, zwei Brüder, neun und elf Jahre alt. Mama und Papa. Fieber, das steigt und steigt, bis das Herz es nicht mehr schafft. Dürfen die Geschwister Abschied nehmen? Oder werden sie zurückgehalten? Fürchtet man sich vor einer Ansteckung? Oder soll ihnen der Anblick ihrer toten Schwester erspart bleiben?
Auf Småryd in Skåne hängen noch immer zwei Fotografien in dem Zimmer, das das Schlafzimmer Marias, der Mutter meiner Großmutter, war. Sie zeigen ein auffallend hübsches Mädchen, das auf einem der Fotos den Kopf auf seine Hand stützt und in die Kamera schaut. Vermutlich hat Maria die Bilder selbst aufgenommen. Hinten drauf stehen Zeilen aus Ludwig Uhlands Gedicht:
Du kamst, du gingst mit leiser Spur.
Woher – wohin? Wir wissen nur:
Aus Gottes Hand – in Gottes Hand.
Mir wurde erzählt, dass das Mädchen auf dem Bild Maja heißt und also 1901 in Moskau starb, als sie sieben Jahre alt war. Aber ich höre ziemlich selten, dass von ihr, der großen Schwester meiner Großmutter, gesprochen wird. Wenn sie erwähnt wird, spricht man von »Maja 1«, weil ein Jahr nach ihrem Tod eine weitere Tochter geboren und ebenfalls auf den Namen Maja getauft wurde.
Als meine Großmutter Karin 1897 in Moskau als viertes Kind von Wilhelm und Maria Bolin geboren wurde, hatte die Familie bereits seit Langem in Russland gelebt. Karins Großvater war vom Gutshaus in der Wollmar Yxkullsgatan in Stockholm nach Sankt Petersburg gezogen, um in der Juwelierfirma seines Bruders zu arbeiten. Nachdem deren Vater, Kapitän zur See Jonas Wilhelm Bolin, im Ärmelkanal ertrunken war, reisten die Brüder nach Russland, um Arbeit zu suchen und ihrer Mutter nicht zur Last zu fallen.
Nach fünfzehn Jahren großer Erfolge als Juwelier gemeinsam mit seinem Bruder in Sankt Petersburg zog Karins Großvater, Henrik Conrad, nach Moskau, um eine Filiale zu eröffnen, die später von Karins Vater Wilhelm übernommen und ebenfalls sehr erfolgreich wurde.
1889 heirateten Wilhelm und Maria, die Eltern meiner Großmutter. Maria war eine geborene Seitz aus Wien im damaligen Österreich-Ungarn. Sie war Österreicherin, gehörte aber auch zur deutschsprachigen Bevölkerung und hatte daher an der gesamten deutschsprachigen Kultur teil.
Dass knapp zwei Jahrzehnte vorher eine deutsche Nation ausgerufen worden war, die später als Deutsches Kaiserreich bezeichnet wurde, veränderte nichts. Diese Staatsbildung nannte man »kleindeutsche Lösung«, weil der große deutschsprachige Bevölkerungsteil von Österreich-Ungarn nicht zum neuen Deutschland gehörte, dessen Hauptstadt zum Entsetzen aller Österreicher das preußische und protestantische Berlin wurde.
Aber die Österreicher, die Deutsch sprachen, identifizierten sich nach wie vor eben mit Deutschen und hatten mit ihnen in den deutschen Gemeinden und Zünften in Moskau ebenso ungezwungenen Umgang wie diejenigen, die aus dem gerade gebildeten Deutschen Reich kamen.
Maria Seitz war vier Jahre jünger als Wilhelm Bolin und kam aus gänzlich anderen gesellschaftlichen Verhältnissen. Ihr Vater hatte als Holzwarenhändler in Wien gearbeitet und starb, als die Kinder klein waren. Marias Mutter war gezwungen, zwei ihrer Söhne in ein Kinderheim zu geben.
Maria zog von Wien nach Moskau, vermutlich, um als Kindermädchen zu arbeiten. Wie Wilhelm und Maria einander kennenlernten, ist unklar, aber da Wilhelms Vater die Tochter des deutschen Konsuls in Moskau geheiratet hatte, geschah es wahrscheinlich in irgendeinem deutschkulturellen Zusammenhang.
Die deutsche Gemeinschaft in Moskau war bedeutend. Es gab vier große deutsche Kirchen, mit entsprechenden Gemeinden, und eine Menge von Vereinen für Deutschsprachige.
Die Bolins waren wohlhabend, und die Juwelierfirma in Sankt Petersburg war frühzeitig zum Hofjuwelier des Zaren sowie des enormen russischen Hofes geworden, der Unmengen von Schmuck und Silber bestellte. Die Filiale in Moskau richtete sich vor allem an die russische Oberschicht außerhalb des Hofes. Bei den Bolins wurden häufig große Essen gegeben, mit zahlreichen Bediensteten und allerlei Gesang. Wilhelm war ein begeisterter Amateursänger, und es gab ein besonderes Musikzimmer mit einem Flügel, wo Privatkonzerte gegeben wurden.
Meine Babi hatte also eine deutschsprachige Mutter, und da auch ihre Großmutter Deutsche war, wurde Deutsch die hauptsächliche Umgangssprache zuhause in Moskau. Aber sie und ihre Geschwister sprachen stets Russisch miteinander und fuhren damit ihr Leben lang fort.
Auf den Kinderfotografien aus der Zeit um die vorige Jahrhundertwende finde ich nur sporadisch Datierungen. Es gibt kaum welche auf den Bildern, die aus der Zeit um den Tod von Maja stammen dürften, obwohl eine Vielzahl von Fotos der Geschwister vorhanden ist. Manchmal haben sie russische Volkstrachten an, manchmal gestärkte Kragen und solide gebügelte Kleider, aber es gibt auch Bilder, auf denen sie spielen oder zwanglos auf einem Rasen oder in einem Spielzimmer sitzen. Allerdings fast keine Fotos, auf denen Maja dabei ist. Sind sie aussortiert worden? Wollte man die Kinder mit dem Gedenken an die tote Schwester verschonen?
Auch wenn meine Großmutter, Babi, nie mit mir über ihre große Schwester sprach, muss Majas Tod natürlich ein Kindheitserlebnis gewesen sein, das sich ihr tief eingeprägt hat.
Ich sehe den großräumigen Wohnsitz in Moskau vor mir, voller Verwandter und Freunde, die zum Begräbnis angereist sind. Tränen und Trauer statt Gesang und Festessen. Trauerflors hängen von eleganten Hüten herab, Trauerbänder sind auf maßgeschneiderten Revers befestigt. Cousins und Cousinen aus Moskau und Sankt Petersburg, aber diesmal sind sie nicht zu Spiel und Spaß gekommen. Kinder, die einander in unbequemer schwarzer Kleidung verstohlen anblicken.
Muss man weinen? Wie lange dauert die Beerdigung? Dürfen wir dann spielen?
Auch als Vierjährige muss Karin eine tiefe Leere empfunden haben, weil sie ihre drei Jahre ältere Schwester vermisste. Der Abstand zu Henrik war ja fünf, zu Erik sieben Jahre. Das Gleichgewicht innerhalb der Geschwisterschar war für immer verändert.
Vermutlich hatte sich Karin das Zimmer mit Maja geteilt. Eigene Zimmer für Kinder waren nicht üblich in ihrer Gesellschaftsschicht. Man schlief entweder mit einem Geschwisterkind oder einem Kindermädchen. Durfte sie mit Majas Sachen spielen, wenn sie vorsichtig war?
Erik und Henrik wurden erzogen, wie die Zeit es für Buben erforderte. Ihnen wurde frühzeitig klargemacht, dass sie es waren, die eines Tages die Juwelierfirma übernehmen würden. Ein vierjähriges Mädchen durfte weinen, so viel es wollte, die Buben hingegen wurden als alt genug betrachtet, um ihre Gefühle in Schach halten zu können.
Sowohl meine Babi als auch mein Vater haben von der allzeit anwesenden und liebevollen Mutter und Großmutter Maria erzählt, der Babi meines Vaters. Wie hatte sie Majas Tod überwunden? Galt es einfach, die Zähne zusammenzubeißen und das Leben weitergehen zu lassen? Oder war es ihr und Wilhelm erlaubt zu trauern? Konnte sie in der ersten Zeit Kraft für Karin aufbringen? Stand das Foto ihrer Tochter bereits zuhause in Moskau an Marias Bett?
Wilhelm und Maria kauften 1902 ein Anwesen westlich von Båstad in Skåne, das Gut Småryd. Ein entscheidender Schritt, der die Familie enger an Schweden knüpfte. Wilhelm hatten seine schwedischen Wurzeln immer am Herzen gelegen und er wünschte, dass die Familie neben der russischen und deutschen auch an der schwedischen Kultur teilhaben sollte. Sie ließen ein großes Sommerhaus bauen, die Villa Småryd mit zugehörigem Park, fertiggestellt 1904. Dazu begann man mit Obstanbau, dem damals größten in Schweden.
Als ich klein war, gab es auf Småryd noch ein verfallenes Mobiliar für Kinder. Hübsche Möbel im Miniaturformat. Eine weiß gestrichene Bank mit Sprossenlehne, ein runder Tisch mit schön geschnitzter Zarge sowie Sessel im selben Stil. Sie standen in dem großen Spielhäuschen, etwas schief, abgescheuert und verzogen. Heute sind sie weg, entsorgt bei einer resoluten Putzaktion. Ich gehe davon aus, dass es ähnliche Möbel in der Moskauer Wohnung gab. Die Kinderzimmer mussten entsprechend eingerichtet gewesen sein. Ein kleiner Schreibtisch, als man mit der Schule begann, Sessel und vielleicht ein Tisch.
In Moskau werden 1901 die kleinen Möbel eines plötzlich verstorbenen siebenjährigen Mädchens aus dem Zimmer getragen, das sie sich mit ihrer kleinen Schwester geteilt hat. Schreibtisch, Sprossensessel und ein kleines Bett. Stattdessen wird das Erwachsenenbett des geliebten Kindermädchens Asana hineingestellt.
Mitten in all der Trauer steht Karin da und wünscht sich, dass alles so sein würde wie vor der Katastrophe. Aber zu ihrem Entsetzen merkt sie, dass die Stimmen der Erwachsenen weiterhin gedämpft bleiben, das Lachen seltener, das Weinen alltäglicher, die Feste und Gesellschaften zu Ende.
Allmählich verschwindet die Farbe aus ihrem Alltag. Auch Karin lacht nicht mehr so oft, bewegt sich langsamer. Als würde man sich in einem grauen, geschlossenen Zimmer befinden, auch wenn man draußen ist.
Maria wird immer als liebevoll und gegenwärtig beschrieben. Vermutlich schaffte sie es, auch mitten im tiefschwarzen Abgrund der Trauer ihre Kinder zu sehen. Von Wilhelm weiß ich weniger. Er wird meistens als musikalisch, singend und freundlich geschildert. Und als gewandter Geschäftsmann. Aber wenn mein Vater mir von seiner Kindheit auf Småryd erzählt, kommt er hauptsächlich auf seine Babi, Maria, zu sprechen. Sein Großvater Wilhelm ist eine eher diffuse Gestalt. Auch meine Babi, Karin, und ihre jüngere Schwester Margit, Gaba, sprachen ständig mit Wärme in der Stimme von ihrer Mutter.
Maria war diejenige, um die sich alles drehte, wenn Cousinen und andere Verwandtschaft im Sommer nach Småryd in der Nähe von Båstad kamen.
***
Langsam verklingt die Erinnerung an die verstorbene große Schwester in Moskau aus dem Bewusstsein meiner Großmutter. Die Farbe kehrt zurück, das Lachen und der Alltag, vielleicht schon gegen Weihnachten, vielleicht Anfang des neuen Jahres 1902.
Endlich nimmt auch Maria den Trauerflor ab und Karins Erinnerungen an Maja werden immer nebulöser, Fragmente, die auftauchen, wenn ein Duft sie ins Gedächtnis ruft oder man über ein bestimmtes Ereignis spricht. Wie ein Gefühl in der Brust.
Wilhelm singt wieder, die Gäste in der großen Etage fangen nicht jeden Besuch mit Beileidsbekundungen an oder damit, ihr mit Tränen in den Augen den Kopf zu tätscheln, was Karin verabscheute. Asana, das Kindermädchen, spaßt und spielt mit der kleinen Kaja, wie Karin genannt wird, wie sie es immer schon getan hat. Auch die Köchinnen scherzen wieder und sie darf wieder beim Kochen helfen. Alles beginnt, dem Dasein zu ähneln, das vorhanden war, als Maja noch lebte, und Mutter hat einen runden Bauch: Karin wird bald ein neues Geschwisterchen haben.
Nach einigen Jahren werden auch die Besuche auf dem Friedhof, bei denen Mutter Maria dafür sorgt, dass ständig frische Blumen auf Majas Grab stehen, immer pflichtschuldiger. Schließlich kann sich Karin nicht mehr an die Stimme ihrer Schwester oder daran erinnern, wie es war, als sie sich ein Zimmer teilten. »Maja 1« ist zu einem familiären Andenken geworden, zu zwei Fotos, die noch immer an einer Wand auf Småryd hängen.
***
Wie stark war die Familie Bolin in Russland verwurzelt? Wilhelm lag etwas an den schwedischen Wurzeln und daran, dass die Kinder sie kennen sollten. Aber das Russische? War es austauschbar? War ihr geografischer Ort lediglich eine Konsequenz der Arbeit, oder fühlten sie sich als Russen? Waren sie über die Entwicklung im Land und das zunehmende Chaos beunruhigt? Betrachteten sie Russland als ihre Heimat? Die Familie hatte seit fast siebzig Jahren, seit 1836 in Russland gelebt. Zwei Generationen Bolin wurden dort geboren, aber man heiratete Deutsche oder Österreicher, nie Russen.
1905 ist das erste Revolutionsjahr in Russland. Karin ist nun acht Jahre alt und dürfte nicht viel mehr als die diskreten und besorgten Gespräche der Erwachsenen zuhause in Moskau aufgefasst haben. Sie hat inzwischen zwei neue Schwestern: Maja, geboren 1902, und Margit, genannt Gaba, geboren 1904.
Wilhelm verschwindet jeden Tag nach dem Essen hinter seinen Zeitungen. Er liest die deutschsprachigen russischen Zeitungen, aber auch die russischsprachigen. Auch Maria wird immer stärker von ihrer Umgebung in Anspruch genommen. Karin spürt, wie gedankenverloren ihre Eltern sind, dass sie ständig etwas Wichtiges zu tuscheln haben. Wenn sie Gäste haben, sehen alle besorgt aus, und die Herren gehen in Wilhelms Arbeitszimmer, seufzen und murmeln. Wie soll es weitergehen? Meinst du, wir können bleiben? Karin ist klar, dass sie nichts hören soll, aber sie tut es dennoch und mag es nicht, wenn ihre Eltern ernst und erwachsen mit ihren Brüdern, aber nicht mit ihr sprechen. Sie ist immerhin fünf Jahre älter als ihre Schwester, die neue Maja.
Nach dem katastrophalen Krieg des Zaren gegen Japan, dem eine schwere Missernte folgte, kamen die Unruhen im Land wieder in Gang. Russland wurde von Streiks und Krawallen gelähmt. Hochrangige Politiker wurden ermordet, Militär und Polizei erschossen Hunderte hungernde, friedliche Demonstranten. Generalstreiks rollten wie eine Welle durch das Land: Sankt Petersburg, Moskau, Kyiv, Vilnius, das russische Polen – überall streikten Arbeiter.
In Odessa meuterte die Besatzung des Panzerkreuzers Potemkin, Kosakentruppen und Polizei antworteten, indem sie Tausende Soldaten und Demonstranten erschossen.
Russland stand am Rande von vollständigem Chaos und Bürgerkrieg, aber der Zar und die politischen Kreise um ihn herum weigerten sich, die Macht dem neu geschaffenen Rat, der Duma, zu überlassen.
Dennoch liefen die Geschäfte in der Juwelierfirma nach wie vor glänzend. Die Mittel- und Oberschicht im Land lebte gut, aber sowohl Wilhelm als auch Maria waren beunruhigt über die Unfähigkeit des Zaren, das Land zu modernisieren und dafür zu sorgen, dass Russland eine zeitgemäße Monarchie mit weniger Macht wurde, wie die meisten Länder im übrigen Europa. Karin hatte einen Onkel in Wien, Karl Seitz, Marias Bruder, der in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts allmählich zu einem der führenden sozialdemokratischen Politiker in Österreich-Ungarn avancierte. Karin hörte, dass häufig über ihn gesprochen wurde, und ihr war klar, dass er im Begriff stand, im Heimatland ihrer Mutter, der großen Doppelmonarchie, eine bedeutende Person zu werden.
Maria Bolin hatte Verständnis für das politische Engagement ihres Bruders. Sie wusste wie er, was Armut hieß. Ihr Vater war an Typhus gestorben, als er nach zwölf Jahren in der Armee heimgekommen war, und ihre Mutter war gezwungen, ihre Söhne in ein Kinderheim zu geben, da die Not zu groß wurde. Karl sagte später, dass er dankbar sei, mehr Seiten des Lebens gesehen zu haben, als es die meisten Politiker seiner Generation getan hatten.
In der Schule zeichnete sich Karl Seitz durch Fleiß und leichte Auffassungsgabe aus. Einer seiner Lehrer verhalf ihm zu einem Stipendium, sodass er studieren und Volksschullehrer werden konnte. Aber es zog ihn immer stärker in die politische Arbeit, und ab 1905 war er als sozialdemokratischer Repräsentant im Reichsrat, wie das Parlament im deutschsprachigen Teil von Österreich-Ungarn hieß.
Die ganze Familie war stolz auf Onkel Karl, der immer häufiger in den Wiener Zeitungen zitiert wurde, auch wenn Wilhelm und Maria seine Ideen zu einer neuen Weltordnung vermutlich nicht teilten, bei der die Arbeiter die Produktionsmittel übernehmen sollten.
Aber reflektierten sie über ihre eigene spezifische Situation in Russland? Über die enormen Bestellungen, die die Juwelierfirma anlässlich großer Feste und Feiern noch immer vom Hof erhielt, während in weiten Teilen des Landes Hunger herrschte?
Nach den Revolutionsunruhen in Russland 1905 hatte Kaiser Franz Joseph in Österreich-Ungarn den Ernst der Stunde eingesehen und dem Reichsrat mehr Macht zugestanden. Er hatte auch einer der stärksten Forderungen der Sozialdemokraten nachgegeben: allgemeines Wahlrecht für Männer. Auch in Russland musste etwas geschehen, das sahen Maria und Wilhelm ein.
Maria korrespondierte mit ihrem Bruder Karl, der auf die Mängel und die falsche Politik des Zaren hinwies. Sie diskutierte die Briefe mit Wilhelm, und auch wenn Karin nicht alles verstand, dürfte sie sich über den Ernst der Lage bewusst gewesen sein. Maria und Wilhelm fanden, dass die Machtausübung des Zaren gegenüber der Opposition zu streng war. Man konnte der Gewalt nicht nur durch Gewalt begegnen. Das Volk hungerte, und täglich kam es irgendwo im Land zu Tumulten.
Die Jahre in Russland blieben unruhig und Karin fand, dass ihre Eltern versuchten, sie von den Gesprächen über Politik herauszuhalten, obwohl sie älter wurde. Das galt auch für die ständigen Diskussionen darüber, wo ihre beiden älteren Brüder ihre Schulbildung abschließen sollten. Wilhelm wollte, dass sie eine schwedische Reifeprüfung am Gymnasium Norra Latin in Stockholm ablegen sollten, während Maria mit ihrer österreichischen Herkunft vorschlug, dass sie in Berlin oder Wien zur Schule gehen sollten. Das Schwedische beherrschten sie ja bereits, vor allem wegen der langen Sommerferien, die seit 1904 in der neuen Villa auf Småryd verbracht wurden. Außerdem hatte Wilhelm in seiner Jugend selbst in Deutschland studiert, was dem üblichen Bildungsweg der oberen Gesellschaftsschichten in Moskau entsprach.
Aber im Lauf der Jahre hatte sich Wilhelm immer stärker nach Schweden ausgerichtet. Er hatte enge Kontakte zur Familie Nobel, mit der man auch Umgang pflegte. Auch das schwedisch-russische Handelshaus, das von Carl Hagman geleitet wurde, von dem Wilhelm Småryd gekauft hatte, bereitete ihm große Freude. Seit Mitte der Neunzigerjahre saß Wilhelm im Vorstand und war dadurch mit den Geschäftsverbindungen nach Schweden gut vertraut. Und nicht zuletzt schätzte er es, in einer schwedischsprachigen Vereinigung zu verkehren, zu der auch etliche Finnen gehörten.
Wilhelm wusste, wie es in den zahlreichen und großen internationalen Kreisen in Russland war: Man hielt sich an seine Gruppe. Es war entschieden normaler, dass die Kinder schwedischer, finnischer oder deutscher Freunde jemanden aus ihrem Kreis statt eines Russen oder einer Russin heirateten. Auch er hatte, wie schon sein Vater, eine Frau außerhalb der russischen Kreise geheiratet.
Als Kind hörte ich sehr selten, dass von Marias österreichischer Familie Seitz gesprochen wurde. Erst als Erwachsener wurde mir klar, dass meine Babi, ebenso wie mein Vater, zur Hälfte aus Österreich stammte. Was natürlich hieß, dass mein Vater in dieser bunt gemischten Familie eigentlich recht wenig »Schwede« war. Die starke Identifikation mit Schweden, die man in der Familie Bolin dennoch empfand, ging aus dem Familiennamen, der Sprache und nicht zuletzt aus den Sommern auf Småryd hervor. Aber von der österreichischen Familie seiner Großmutter erzählte mein Vater nur selten.
Moskau
1905, im ersten Revolutionsjahr in Russland, ist Karl Seitz noch ein junger Sozialdemokrat mit Sitz im Reichsrat von Österreich-Ungarn. Ein Rat, der allmählich mehr Macht im Verhältnis zu dem alten Monarchen Franz Joseph erhält, dem Kaiser mit dem grotesken Backen- und Schnurrbart, der ihm den Eindruck verleiht, aus einer ferneren und altmodischeren Zeit zu stammen. Aber 1907 sind endlich alle Männer in Österreich wahlberechtigt.
In Moskau haben Wilhelm und Maria Bolin nun entschieden, dass Karins Brüder Erik und Henrik in Stockholm zur Schule gehen sollen, um dort ihren Abschluss zu machen. Karin ist nun mit ihren kleinen Schwestern Maja und Margit allein in der großen Wohnung.
Im Herbst 1907 beginnen ihre Brüder am Gymnasium Norra Latin in der Drottninggatan. Wilhelm besorgt eine Dreizimmerwohnung in einem neu gebauten Haus in der Rörstrandsgatan im Stadtteil Vasastan. Dort werden Erik und Henrik zusammen mit der Haushälterin Ida Hjort gemeldet.
Im Einwohnermeldeamt schreibt Ida: »Bei mir hält sich vorübergehend auch Leutnant Hjalmar Axel Cedercrona auf.« Der Leutnant, der bei den Olympischen Spielen in London 1908 eine Goldmedaille in Truppengymnastik gewinnen wird, wohnte einige Tage im Monat bei ihnen. Vermutlich kam ihm das Zimmer bei Ida und den Brüdern Bolin äußerst gelegen, weil sich die Militäranlage Karlberg in der Nähe befand.
Ich kann diese Untervermietung nur so interpretieren, dass Wilhelm und Maria nicht wollten, dass ihre Söhne ein Luxusleben allein mit einer Haushälterin führen sollten. Konnte man einige Tage im Monat ein Bett vermieten, so tat man es. Dass Ida Hjorts Aufgabe darin bestand, die Söhne zu betreuen, steht deutlich geschrieben: »Unterzeichnete Haushälterin der Söhne von Hofjuwelier W. Bolin, Moskau, Ida Maria Hjort.« Die Brüder dürften ein gemeinsames Zimmer gehabt haben, der Leutnant, der seinen festen Wohnsitz in Jönköping hatte, schlief womöglich auf einem Sofa im Wohnzimmer und Ida Hjort in einem anderen Schlafzimmer.
Es scheint plausibel, dass Ida Hjort angewiesen war, die Brüder weitestgehend sich selbst zu überlassen, aber sie sollte sicherlich auch dafür sorgen, dass sie ihre Hausaufgaben machten und sich auch sonst anständig aufführten. In einem der Kartons auf Småryd, von denen ich überzeugt war, sie längst durchgesehen zu haben, habe ich ein einsames Tagebuch von Henrik, Onkel Hinke, aus dem Jahr 1909 gefunden. Es ist mit Bleistift und in etwas nachlässiger Handschrift geschrieben, durchgehend auf Deutsch, und besteht vor allem aus alltäglichen Notizen darüber, mit wem er Tee getrunken hat, wie lang die Lateinaufgaben waren, wann er die Schule geschwänzt hat und im Kino oder Theater war. Aber es steht auch etwas über die Reise in den Weihnachtsferien zur elterlichen Wohnung in Moskau: erst mit dem Schiff nach Turku in Finnland, dann mit der Bahn nach Sankt Petersburg, wo sich die Verwandtschaft, Wilhelms Cousins, um die Brüder kümmerten, und schließlich mit dem Nachtzug nach Moskau.
Onkel Hinke schreibt auch von anderen Zugreisen im Laufe des Jahres, oft mit dem Zusatz, dass er dritter Klasse fahre. Entsprach das ebenfalls dem Willen der Eltern, ihre Söhne zu formen? Nur nicht verwöhnen, »jungen Leuten tut es gut, im Zug ein wenig unbequem zu sitzen«. Oder war es eigene Sparsamkeit, damit das Geld reichte? Oder vielleicht eine Vorahnung davon, dass neue Zeiten bevorstanden und die Situation für einen Hofjuwelier in Russland nicht mehr so sicher war? Restaurantbesuche werden nicht erwähnt, hingegen emsige Spaziergänge: Djurgården, Karlberg und im Sommer durch die Wälder um Småryd.
Mit den Söhnen in Stockholm und immer längeren Sommeraufenthalten auf Småryd bereitet sich die Familie Bolin auf die Möglichkeit eines erzwungenen Exils in Schweden vor. Aber noch geht jeden Juni ein ganzer plombierter Eisenbahnwaggon mit Hausrat zum Sommerhaus bei Båstad und im September zurück nach Moskau.
Die Jahre bis zum Ersten Weltkrieg sind weiterhin unruhig in Russland. Tausende von Streiks im Land, große und kleine. Die Arbeiter spüren, wie die Macht wankt, immer mehr Politiker wagen es, den Zar offen zu kritisieren. Die Duma wird mehrfach eröffnet und geschlossen, weil das Regime ihm vorwirft, zu radikal zu sein. Die Politik wird spürbar, auch im Familienleben.
Karin besucht die reformierte deutsche Schule in Moskau, in der im Allgemeinen Deutsch gesprochen wird, ein bedeutender Teil des Unterrichts aber auch auf Russisch stattfindet. In der Schule wird großer Wert auf die russische Kultur gelegt, nicht zuletzt auf Literatur, die Karin liebt. Zuhause ist die Musik am wichtigsten, und Festessen und Geselligkeiten enden fast immer damit, dass Wilhelm singt und am Klavier begleitet wird.
In der Schule sind sie nur zwei Mädchen in Karins Klasse. Ich finde ein Foto in einem Schulkatalog, der in einem Karton auf Småryd liegt. Auf dem Bild sehe ich sie mit stolzer Miene in der ersten Reihe. Der große runde Hut sitzt weit zurückgeschoben auf dem Kopf. Sie hat eine weiße Bluse mit hohem Kragen, eine zweireihige Wolljacke mit Militärbiese und einen dunklen, vermutlich blauen Rock an.
Es sind unruhige Zeiten in Moskau, nicht zuletzt für Familien ausländischer Herkunft. Eltern aus vielen Nationen haben ihre Kinder auf der deutschen Schule, darunter auch etliche russische. Deutsch ist die häufigste Fremdsprache in Moskau.
In diesen Jahren geschehen mehrere Morde an hochrangigen Politikern, und auf dem Schulhof erscheinen immer ernstere junge Gesichter. Es florieren Gerüchte und die unterschiedlichen Nationalitäten unter den Schülern fangen an, sich bemerkbar zu machen, wenn neue Wohnorte diskutiert werden.
Wilhelm Bolin hat weiterhin gute und enge Kontakte nach Schweden. Die Söhne Erik und Henrik sind mit der Schule fertig und reisen nun zwischen Moskau und Stockholm hin und her. Beide sind an der Arbeit der Firma beteiligt. Die Sommer werden mit der ganzen Familie auf Småryd verbracht, wohin auch Freunde und Verwandte kommen. Im Gästebuch sehe ich, dass man nicht selten mehrere Wochen, manchmal bis zu einem Monat blieb. Häufig wohnen hier zehn bis fünfzehn Personen zusammen.
1912 eröffnet Wilhelm Bolin eine Filiale der Juwelierfirma in dem deutschen Kurort Bad Homburg vor der Höhe, in der Nähe von Frankfurt. Dort pflegt der Zar mit Teilen des Hofes und der russischen Oberschicht im Sommer auf Kur zu fahren. Der russische Einschlag im Kurort ist so bedeutend, dass man eine russisch-orthodoxe Kirche gebaut hat, deren Grundstein Zar Nikolaj II. 1896 gelegt hatte.
Der russische Hof gehört noch immer zu den Großkunden der Firma, die inzwischen Wilhelms Initialen in ihren Namen aufgenommen hat: W. A. Bolin – Wilhelm Andrejewitsch (Henriksson auf Schwedisch) Bolin.
Småryd
Als am 28. Juni 1914 die Schüsse in Sarajevo fallen, ist Karin mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern auf Småryd. Wilhelm ist noch in Moskau, will aber später nachkommen. Es ist ein gefühlsmäßig schwieriger Sommer für die Familie. Maria macht sich Sorgen um ihre österreichischen Verwandten, Wilhelm um seine deutschen auf mütterlicher Seite, und beide haben zahlreiche russische Freunde. Sollten die Söhne ihren Freunden nun plötzlich im Krieg gegenüberstehen? Der Gedanke schien völlig absurd. Immerhin sind sie dankbar, dass alle Familienmitglieder schwedische Staatsangehörige sind. Deutsche und österreichisch-ungarische Untertanen laufen in Russland Gefahr, schikaniert oder sogar verhaftet zu werden.
Karin liebt es, auf Småryd zu sein. Wenn sich das Schuljahr in Moskau dem Ende näherte, sehnte sie sich immer nach Schweden. Aber sie weiß auch, dass sie nach einigen Monaten anfangen würde, sich wieder nach Moskau zu sehnen. In diesem Sommer sagt ihre Mutter allerdings mit Nachdruck, dass Småryd ihre Rettung sei und alle sich hier versammeln könnten. Hier könne sie unbesorgt sein, denn die Kriegsgefahr sei minimal. Sie liebt das Haus, und sie denkt oft daran zurück, wie es ihnen gelungen ist, einen Architekten zu finden, der sich so gut auf ihre Wünsche und die der ganzen Familie verstand.
Willy, wie nur die Allernächsten Karins Vater nannten, hatte seinen Freunden in der Familie Wallenberg von seinem Grundstückskauf in Båstad erzählt und davon, dass er ein Sommerhaus dort zu bauen gedachte. Vermutlich waren sie es, die ihm den jungen Architekten Torben Grut empfohlen hatten, einen begeisterten Tennisspieler, der bereits als einer der hervorragendsten Architekten der neuen Generation von sich reden gemacht hatte. Es wurde sogar gesagt, das Kronprinzenpaar habe ihn hinzugezogen, um ein Sommerschloss in Skåne zu entwerfen.
Maria Bolin war durchaus zufrieden, dass Grut jung war, denn dadurch dürfte er ein Gefühl für die neuen Strömungen der Zeit haben. Sie war sehr gut mit William Morris und der Arts-and-Craft-Bewegung in England vertraut und fand die Architektur in Schweden hoffnungslos veraltet – aber der russische Stil war ihr ebenfalls fremd. In ihrer alten Heimatstadt Wien hingegen meinte sie, Gebäude zu sehen, die neue Ansichten über Wohnen und Baukunst repräsentierten.
Karin schaute in alle ausländischen Zeitungen über Einrichtungsfragen, die sich auf den Tischen zuhause in Moskau stapelten. Es handelte sich um handgezeichnete Bilder unterschiedlicher Firmen mit Vorschlägen zu Farben, Tapeten und Mobiliar für das neue Sommerhaus, das nun in Skåne gebaut wurde.
Stundenlang konnte sie neben ihrer Mutter sitzen und zufrieden nicken, wenn sie gefragt wurde: »Meinst du, das wird schön, Karin?«
Es bereitete ihr Freude, so zu tun, als würde sie Zimmer möblieren und Farben für Stoffe und Wände wählen.
Ich weiß noch, wie meine Großmutter Babi in die altersgerechte Wohnung in Nockeby umziehen wollte, in dieselbe Genossenschaft, in der zwanzig Jahre später mein Vater wohnen sollte. Ich war um die fünfzehn Jahre alt und bei ihr zuhause. Sie zeigte mir, dass sie maßstabgetreue Modelle aller Möbel und des neuen Zimmers mit Bettnische angefertigt hatte, sodass sie die Möbel auf dem Papier hin und her bewegen konnte, um zu sehen, wo sie Platz fanden und welche sie nicht mitnehmen konnte.
Damals galt es, von ihrer Zweizimmerwohnung in der Stadt in eine Einzimmerwohnung in Nockeby zu ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie und ihre Mutter siebzig Jahre früher auch maßstabgetreue kleine Modelle von Sesseln und Sofas ausgeschnitten hatten, mit denen sie dann die Zimmer auf Småryd probeweise möblieren konnten.
Torben Grut nahm sich des Auftrags mit Lust und Enthusiasmus an. Die Villa Småryd war eins der ersten Privathäuser, die man bei ihm bestellte. Er entwarf zwei große Stockwerke von jeweils zweihundert Quadratmetern, einen vollkommen eingerichteten Dachboden und einen Keller mit Küche, Waschküche und Zimmern für das Personal. Dreizehn Schlafzimmer, wenn man die des Personals hinzuzählte. Der Eingang an der Westseite des Hauses war diskret, fast unerheblich. Auch die Gesellschaftsräume waren eher auf Funktion als auf Repräsentation ausgelegt.
Im Herzen des Hauses befand sich ein großes Esszimmer, das in einen Salon mit Ausblick auf das Meer mündete.
Maria und Wilhelm waren sehr zufrieden und Grut war überrascht, dass seine verhaltene Jugendstil-Villa so rasch auf Anklang stieß. Zunächst hatte er ein noch größeres Haus mit dekorativen Zinnen und Türmen entworfen, was aber zu einer etwas dezenteren Villa modifiziert wurde.
Auch die Einrichtung wurde modern. Maria Bolin ließ einige der vorrangigsten Möbelhäuser in Europa das gesamte Mobiliar entwerfen, das dann mit Arbeiten örtlicher Tischler gemischt wurde.
Auf dem Stockwerk mit den Schlafzimmern sollte die Einrichtung hell und rustikal, aber nicht luxuriös sein. Auch in den Gesellschaftsräumen gab es keine Anforderungen an Eleganz aus repräsentativen Gründen. Das Esszimmer wurde in modernem Jugendstil eingerichtet, der Salon zum Meer im Neorokoko aus den Möbelwerkstätten von NK. Das Wohnzimmer mit seinem Podium für das Klavier wurde ebenfalls im Jugendstil gestaltet und hatte handgenähte cremeweiße Vorhänge sowie diskret stilisierte Blumengirlanden in Grün.
Das Haus sollte ein Ort der Begegnung für die Familie und alle Freunde werden. Hier sollte es keine pflichtschuldigen Abendessen für Kunden oder wichtige Kontakte geben.
***
Im Kriegssommer 1914 ist Karin sechzehn Jahre alt. Sie macht auf Småryd häufig Spaziergänge mit ihrer Mutter, die mit Unruhe in der Stimme von der Gefahr eines Großkriegs spricht. Sie erwähnt auch häufig ihre Geschwister in Wien und deren Kinder. Karin hört, dass sich ihre Mutter, die bislang nur in Großstädten gelebt hat, nun einzureden versucht, sie könne auf dem Land wohnen und sich dort wohlfühlen. Sie hört sie sagen, dass es vielleicht besser sei, für immer nach Småryd zu ziehen.
Karin wird nervös, sie will wirklich nicht in Schweden bleiben und auf dem Land wohnen. Sie will nach Hause, nach Moskau, und zu ihren Freunden, wenn der Sommer vorüber ist.
Ihre Mutter hingegen ist erstaunt, wie gut es ihr auf dem Land und in Småryd gefällt. Sie, die in der pulsierenden Großstadt Wien aufgewachsen und dann in der noch größeren Stadt Moskau gelandet ist, geht nun im geruhsamländlichen Schweden herum und genießt es.
Aber auch auf Småryd ist es nie ganz still. Die Bäche plätschern leise in den trockenen Sommermonaten und rauschen laut im Frühjahr und Herbst, wenn das Wasser grau gefärbt von Lehm und Kies ist, der von den Hängen des nahen Bergrückens mitgespült wird.
Zum Besitz gehört auch ein umzäunter alter strohgedeckter Schonenhof, auf dem es Kühe, Pferde, Schweine, Gänse und Hühner gibt. Man hat ein Bauernpaar angestellt, Hilmer und Olga Nilsson, die den Hof versorgen und außerdem die übrigen Angestellten des Obstanbaus mit Lebensmitteln versehen.
Maria notiert in Kassenbüchern, was die Eier kosten und wie viele Überstunden Hilmer und Olga arbeiten, indem sie im Garten und in der großen Küche im Keller der Villa helfen.





























