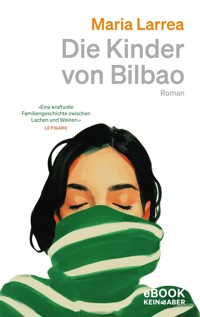
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es beginnt mit einer Geburt. Während die Ich-Erzählerin Maria an ihre eigene Kindheit in Paris zurückdenkt, rekonstruiert sie parallel die Kindheit ihrer Eltern: Victoria, geboren in Galicien, und Julián, einige Kilometer weiter in Bilbao. Beide wurden direkt nach ihrer Geburt weggegeben. Jahre später begegnen sie sich, verlieben sich ineinander, wandern gemeinsam nach Frankreich aus, bekommen eine Tochter.
Maria erzählt von drei Kindheiten, doch je tiefer sie eintaucht und je näher sie ihrer eigenen Geschichte kommt, desto dringlicher werden die Fragen: Ist wirklich alles so passiert, wie man es ihr erzählt hat? Und wer ist sie selbst, wenn auf einmal an ihren Wurzeln gerüttelt wird?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
Über die Autorin
Maria Larrea wurde 1979 in Bilbao geboren und ist in Paris aufgewachsen, wo sie später an der Fémis ein Filmstudium absolvierte. Sie ist Regisseurin und Drehbuchautorin. Die Kinder von Bilbao ist ihr erster Roman.
Über das Buch
Was bedeutet es für ein Leben, wenn plötzlich die Wurzeln gekappt werden? Als Maria mit Ende zwanzig erfährt, dass sie adoptiert ist, fühlt sie sich, als würde ihr der Boden unter den Füßen weggerissen. Sie begibt sich auf die Spuren ihrer eigenen Identität und versucht zu ergründen, wie sie zu der geworden ist, die sie jetzt ist. Während Maria in die Erinnerungen an ihre Kindheit in Paris eintaucht, imaginiert sie parallel die Geschichten ihrer Eltern: Victoria, geboren in Galicien, und Julián, einige Kilometer weiter in Bilbao. Jahre später begegnen sie sich, verlieben sich ineinander, wandern gemeinsam nach Frankreich aus, wünschen sich ein Kind. Maria erzählt von ihrer Suche nach dem Ursprung, von Herkunft und Prägung, von biologischen Eltern und Adoptiveltern, von Verlust und Liebe. Schreibend gewinnt sie Satz für Satz die Macht über ihr Leben zurück.
Für Victoria & Julián. Für Robin, Adam & Sol.
Prolog
Man erinnert sich nicht an den Moment seiner Geburt.
Ich erinnere mich nicht an meine, das ist von Geburt an so. Es ist schlicht unmöglich, die Hirnstrukturen, die für Erinnerungen zuständig sind, sind bei Säuglingen noch nicht ausgebildet. Ich weiß nur das, was man mir darüber erzählt hat. Du, Mamá, wie war es eigentlich, als du mich geboren hast? Pues como todo el mundo. Na, wie bei allen anderen eben. Eine Frau, eine Gebärmutter, ein Fötus, ein Neugeborenes im Anmarsch. Das ist die Reise, der Modus Operandi, wie ich ihn in meinem Kinderkopf sehe, in meinem Jugendlichenkopf, sogar noch in meinem Erwachsenenkopf.
Vor mir eine Szene in einem Krankenhaus oder einer Klinik. Eine Frau liegt auf einem Bett. Sie schwitzt, ihr Atem geht stoßweise, ihre Beine sind breit aufgestellt wie bei der Gynäkologin. Sie presst mit aller Kraft, ein Arzt beugt sich zwischen ihre Beine und verschwindet hinter einem Laken. Dann der erste Schrei.
Ein Mädchen.
Ich hatte amerikanische Seifenopern schon mit der Muttermilch aufgesogen, dazu die Horrorfilme donnerstagabends auf M6, Kinoabend auf TF1 jeden Sonntag und La dernière séance von Eddy Mitchell auf FR3, und in meinem kindischen Hirn stellte ich mir meine Geburt sehr lange so vor. Mit meiner Mutter und mir als Hauptdarstellerinnen. Das Ganze auf Spanisch, denn das wusste ich mit Gewissheit. Ich war an einem 2. November in Bilbao geboren worden, in Spanien. Der Dialog der Szene wäre also auf Kastilisch. Das r wird gerollt, wie es sich gehört, und vermutlich wird auch gehörig geflucht. Das alles ist reine Fantasie, und ich sollte erst viel später verstehen, weshalb. Weshalb ich Regisseurin werden wollte.
Ich hatte eine Inszenierung im Kopf, aufeinanderfolgende Bilder, die das Unbekannte erzählen würden, dieses klaffende Loch, den Ursprung der Welt. Um das zu tun, müsste ich den Beruf der Regisseurin erlernen. Dann könnte ich mich dazu entscheiden, eine Großaufnahme zu drehen, mit Teleobjektiv auf das Gesicht der entbundenen Frau.
Und Action.
ERSTERTEIL
»Is something wrong?«, she said
Of course there is
»You’re still alive«, she said
Oh, do I deserve to be?
Is that the question?
And if so, if so
Who answers, who answers?
Pearl Jam, Alive
1
Der Tintenfisch spuckte schäumenden Speichel auf die Felsen, als Dolores ihn packte.
Sie hatte keine Angst vor ihm, sie hielt ihn an der Stelle unter seinem Kopf umklammert, wo sich die Tentakel ausbreiteten. In seiner vollen Länge musste der Kopffüßer auf einen Meter kommen. Langsam schlang er einen seiner schleimigen acht Tentakel um Dolores’ Arm. Keine Spur von Entsetzen oder Ekel angesichts dieser Umschlingung des Tiers. Dolores marschierte vom felsigen Strand bis zu dem Betonbunker, der ihr als Haus diente. Trotz der Januarkälte, dieser feuchten und mörderischen Winterkälte an der Küste Galiciens, hatte sie bloße Arme. Sie trug ein leichtes Sommerkleid mit Blumen, denn nichts anderes passte mehr, ihr schwangerer Bauch stand kurz vorm Bersten.
Ein Windstoß erhob sich und peitschte ihre beinahe verbrannten Wangen. Mit zusammengekniffenen Augen, damit sich keine Sandkörner unter ihre Lider schoben, ging sie ins Haus. Ein schmuckloser, farbloser Klotz aus Beton ohne jegliches Bestreben nach Schönheit. Das Haus stand allein, vom Wind gebeutelt, in diesem kleinen Tal am Ozean und einen Kilometer vom kleinen Dorf Gateira entfernt. Wie kann ein Mensch so wenig architektonische Ambitionen haben? Im Erdgeschoss gab es ein Zimmer für alles, darüber wurde geschlafen. Die einzige Koketterie des Kastens war der Innenhof, wo die Wäsche trocknete und sich der Altar der ehrwürdigen Hausfrauen der Region befand: ein Spülstein, in dem Dolores die Wäsche schlug, den Tintenfisch und ihren Sohn.
Als sie begann, mit einem Stock heftig auf den Schädel der Krake einzudreschen, setzte ihre erste Wehe ein. Dolores erkannte, was sich dort in ihr zusammenbraute. Es war weniger schmerzhaft, als wenn Santiago sie schlug, weniger qualvoll, als wenn er gewaltsam in sie eindrang. Im Geiste rief sie den Herrn an, die Heilige Jungfrau, Fatima und eine ganze Reihe von Märtyrerinnen. Bitte macht, dass er nicht so schwachsinnig ist wie der Erste. Dass er aufs Meer fahren und Kabeljau fischen kann. Dass er mir eigenhändig ein schönes Haus baut. Dass er mich verteidigt, wenn sein Vater es wagt, die Hand zu erheben. Der Tintenfisch rang mit dem Tod. Dolores fuhr mit ihrem Werk fort, schlug brutal auf ihn ein. Die Wehen kamen nun schneller, man konnte es an der dreieckigen Form erkennen, die ihr Bauch annahm, und an ihren Lippen, die sie unvermittelt zusammenpresste und zu einer Grimasse verzog. Sie wollte nicht laut aufschreien. Stattdessen suchte sie im Inneren des Tiers nach dem schwarzen Schatz. Den Blick zum Himmel gerichtet, ließ sie sich von ihrem Tastsinn leiten und lächelte: Da war der Zaster. Behutsam, mit Zeigefinger und Daumen, zog sie den durchsichtig schimmernden Beutel hervor, der den köstlichen dunklen Saft enthielt. Dolores ging konzentriert vor, sie wollte ihn nicht zerreißen, doch eine nächste Wehe brachte sie ins Wanken. Unter der elektrischen Ladung in ihrem Körper krümmten sich ihre Finger. Die Blase zerplatzte, und die schwarze Tinte ergoss sich über ihre Hände und ihre weißen Beine.
¡Jesús!, schrie sie. Und meinte damit nicht den Sohn Gottes, sondern ihren eigenen. Jesús, fünf Jahre alt, Engelsgesicht, ein Lächeln wie ein Idiot. Er kam angelaufen. Sein Gesicht war verdreckt, aber es lag das freudige Strahlen des Kindes darauf, das endlich von seiner Mutter gerufen wird. Sie schickte ihn davon, damit er die Nachbarin holte. ¡Date prisa, imbécil! Jesús rannte los.
In der Zwischenzeit ging Dolores ins Haus und setzte Wasser auf, ihr Gesicht vor Schmerzen verzerrt, doch ohne den geringsten Laut, ohne ein einziges Stöhnen von sich zu geben. Das sparte sie sich für später auf. Sie legte sich hin.
Jesús kam mit der alten Clara herein.
Schweigend kniete die Nachbarin sich zu Füßen der Mater Dolorosa, die die Beine aufgestellt hatte. Ya está aquí. Er ist schon da. Jesús huschte hinter den gekrümmten Rücken der Hebamme, um zuzusehen. Unter Claras faltigen Händen konnte man, umkränzt von Schamhaar, den mit Flaum bedeckten Kopf des Neugeborenen erkennen. Empuja. Pressen. Dolores stieß das, was sie in den letzten Monaten so sehr eingeschränkt hatte, mit einem Mal ab. Was ist es?, wollte sie wissen. Clara hielt den Säugling in Händen. Nur ein Blick, und sie begriff, welches düstere Schicksal das Kind erwartete. Sie sah Dolores an und antwortete: Es ist ein Mädchen.
Diese Schmach nahm Dolores nicht hin. Sie hatte um einen Sohn gebeten, einen echten, einen starken, nicht um das hier. Nicht um eine Tochter. Die wollte sie nicht. Bring sie zu den Nonnen, sonst will doch niemand ein Mädchen. Clara zog ein kleines Spickmesser mit einer geschwärzten Klinge aus ihrer Schürzentasche und schnitt die Nabelschnur durch. Dolores stand wortlos auf, wischte sich das Blut aus dem Schritt, als hätte sie gerade uriniert, und machte sich beschwerlich auf den Weg nach draußen. Sie ging zum Spülstein, und erst dort fing sie an, sich die Seele aus dem Leib zu erbrechen, direkt neben dem toten Tintenfisch. Jesús hatte keinen Ton von sich gegeben. Tränen liefen ihm über das Gesicht, und der Schmutz auf seinen Pausbäckchen zerrann.
So kam es, dass Clara, die Nachbarin, das bemitleidenswerte namenlose Mädchen hochnahm und es eiligen Schrittes zum Kloster Santa Catalina brachte, das in der ganzen Gegend bekannt war für sein himmlisches Flanrezept. Sie klopfte ans Tor, das Baby in ein weißes Tuch gewickelt wie eine große Wurst. Meine Nachbarin möchte es nicht, sie hat kein Geld, ihr Mann ist auf See, ihr einziger Sohn ist tonto. Sie überreichte das Mädchen. Die Ordensschwester nahm es entgegen und beschloss, ihm ein anderes, charmanteres Schicksal zu schenken: Am Tag nach Dreikönig gab sie dem Wonneproppen den Namen Victoria. Ein erster Sieg über die Hölle.
Victoria ist meine Mutter.
2
Die junge Victoria lernte schnell. Keiner konnte so mit dem Kochlöffel umgehen wie sie, und Sor Isabel wollte keine andere an ihrer Seite, wenn sie den berühmten Flande las Hermanas zubereitete. Trotz Victorias zartem Alter und ihren kleinen Händen schlug sie die Eier perfekt auf. Mit nur einer Handbewegung trennte sie das Gelbe vom Weiß. Ein Geschenk des Himmels, dieses Kind! Die anderen Schwestern waren so ungeschickt, unzählige Eier zerschellten auf dem Boden. Sor Isabel hatte sich nie von dem Stück Eierschale erholt, an dem sie sich eines Abends die Zähne ausbiss. Gott sei Dank hatte sie es erwischt und niemand anderes. Gott sei Dank nicht Sor Ursula, die griesgrämige Mutter Oberin, die für ihren Hang bekannt war, es bei der Messe mit dem Wein zu übertreiben, man stelle es sich nur vor, womöglich hätte sie sich daran verschluckt oder den Gaumen verletzt.
Sor Isabel war eine Anhängerin Bernadette Soubirous. Was war ihre Freude groß, als sie an jenem eisigen Morgen am 7. Januar 1947 die Tür öffnete. Ihr neuer Schützling war am gleichen Tag geboren worden wie die ehrwürdige Pyrenäerin. Sor Isabel ließ sie umgehend vom Diakon taufen, der ihnen gerade seinen Besuch abstattete. Victoria Maria Bernarda hielt also ein zweites Mal Einzug in die Welt, diesmal unter dem Schutze einer Heiligen. Es würde sie ihr Leben lang zeichnen. Ein Leben als Selige und Märtyrerin, aber ohne die Anerkennung durch den Vatikan.
Victoria aß genüsslich ihren Flan am Tisch mit den anderen Waisenkindern. Zwölf Kinder, die schon sitzen konnten, das jüngste zwei Jahre alt, das älteste zehn. Dann waren da noch vier Säuglinge in einem eigenen Zimmer, wo der säuerliche Spuckgeruch sich mit dem Babyhautduft nach warmem Karamell vermischte. Zwei Nonnen wechselten sich ab, Spezialistinnen für Bäuerchen und Profis im Windelnwechseln: die damenbärtigen Schwestern Sor Gertrudis und Sor Maria de las Mercedes.
Die gewaltige Armut der Region brachte nur wenige Adoptiveltern zu ihnen. Kamen kinderlose Paare, konnte man die Nervosität der Unschuldigen förmlich spüren. Man roch ihre Angst buchstäblich, eine Spur von Lauch in ihrem Schweiß. Sie träumten von einem Zuhause und einer liebevollen Mama, wie in den Büchern, die sie bis zur Erschöpfung durchblätterten. Insbesondere den Nuevo Catón, mit dem sämtliche Kinder Spaniens seit 1939 das Lesen lernten und von dem der Konvent sechs nagelneue Exemplare besaß. Jeden Morgen nach dem Frühstück, in Milchkaffee getunktes Brot, und der Terz hatten die Kinder Unterricht. Lesen und Rechnen. Die Lesemethode war eine Silbenmethode. Ra, ri, ru, se, so, sa, su, az, oz, uz.
Die ersten Sätze, die Victoria las, waren die herzzerreißenden AMO A MIMAMÁMIMO A MIMAMÁMIMAMÁMEAMA. Wie grausam das Leben sein kann. ICHLIEBEMEINEMAMAICHVERWÖHNEMEINEMAMAMEINEMAMALIEBTMICH. Der Teufel steckt im Detail. Nach dem letzten Laut schaffte sie es kaum zu schlucken.
Am Nachmittag gingen die Mädchen in die Wäscherei, um die Laken zu waschen, zum Trocknen aufzuhängen und zu mangeln. Die Jungen gingen Ball spielen im Hof.
Victoria war kein trauriges Kind, aber besonders fröhlich war sie auch nicht. Ein einfaches Mädchen, das sich an das von Gottesdienst, Unterricht, Essenszubereitung und Putzen bestimmte und durchgetaktete Leben gewöhnt hatte. Zeit für Grübeleien über ihr Schicksal gab es keine. Zwar war sie auf grausame Weise ausgesetzt worden, doch hatte sie es in einer Schwesternschaft ohne allzu große Grausamkeiten noch gut getroffen.
Victorias Erscheinungsbild war außergewöhnlich. Sie war klein, wie alle Galicierinnen, und hatte dickes, pechschwarzes Haar, grüne Augen, eine mikroskopisch kleine Nase, einen milchweißen Teint und dichte Augenbrauen wie zwei gerade breite Striche. Ein Blick wie von einem Filmstar. Eine göttliche Schönheit. Sie war ganz einfach unwiderstehlich. Und doch ging sie nie mit den werdenden Eltern mit. Sie blieb allein zurück, zusammen mit den anderen Restposten. Wenn die zukünftigen Familienväter sie aus der Nähe betrachteten, bekamen die unfruchtbaren Frauen schmale Lippen und wandten den Blick ab. Victorias Schönheit war nicht sehr katholisch. Sie war nicht niedlich; nein, schon mit acht Jahren besaß sie die Gabe, Männer auf Abwege zu bringen. Sor Isabel hatte sich redlich Mühe gegeben, die Lage zu entschärfen, und band dem Mädchen jeden Tag den Oberkörper ab. Sie schnitt Victoria die Haare kurz, kleidete sie in Hosen und weite Hemden, aber nichts half. Der Dämon hatte sich irgendwo in ihr versteckt. Er floss dem Mädchen durch die Adern.
Trotz ihrer beunruhigenden Schönheit hatte Victoria kein Selbstvertrauen und bezweifelte, dass sie jemanden dazu bringen könnte, sie zu adoptieren. Immer wieder versuchte sie, noch lieber zu sein, wenn jemand zu Besuch kam, noch charmanter, aber das machte alles nur noch schlimmer. Also betete sie jeden Abend in ihrem Bett, die Stimme ein Flüstern, den Daumen an die Oberlippe gepresst. Mit den Fingerspitzen malte sie Kreuze auf ihre Lippen, und nach endlosen Rosenkränzen schlief sie erschöpft ein. Dios te salve, María. Hatte sie es irgendwann geschafft, ihre zweihundertdrei Ave-Maria aus dem Rosenkranzgebet an die Heilige Jungfrau zu richten? Sie hielt allein sich selbst für die Qual verantwortlich, dass niemand sie adoptierte. Sie betete nicht genug, nicht inbrünstig genug, nicht lieb genug, nicht klug genug, nicht gut genug. Somos hijos de Dios. Wir sind die Kinder Gottes, redete sie sich immer wieder gut zu.
Ihr ganzes Leben lang würde Victoria sich an den 6. Januar 1957 erinnern. Zur Feier des Dreikönigstags spendierten die Diözese und Francisco Franco, Caudillo, Regent von Spanien und gebürtig aus Ferrol, der Stadt, die ihrem Geburtshaus gegenüberlag, allen armen Kindern der Region einen Ausflug mit dem Bus, um den Film Das Geheimnis des Marcellino im Kino zu sehen. Victoria stieg zum ersten Mal in ein motorisiertes Fahrzeug. Die ganze Fahrt lang musste sie sich übergeben. Alle machten sich über sie lustig.
Das Kino diente zugleich als Zirkus, es stank nach Stroh und Raubtieren. Victoria war auch während des Films noch schlecht. Die Geschichte des Waisenjungen verstörte sie, sie weinte so heftig, dass sie auf dem Rückweg immer noch mit Übelkeit zu kämpfen hatte. Im Bus starrte sie auf ihre Füße, um sich nicht wieder zu übergeben. Sie hatte Bauchschmerzen, und ihr unterer Rücken tat ihr so weh, dass sie glaubte, sie müsse sterben. Es war der Abend vor ihrem zehnten Geburtstag. In dieser Nacht blutete sie zwischen den Beinen, und als sie es bemerkte, hielt sie sich für verflucht bis in alle Ewigkeit. Sie würde also vor Trauer sterben, nur wegen des Films. Oder wegen der Busfahrt.
Am Morgen rührte sie sich nicht aus ihrem Bett, sie lag in ihrem Menstruationsblut, ohne zu begreifen, was mit ihr geschah. Während die anderen den Schlafsaal verließen, betete sie, ihren kleinen Daumen an die Oberlippe gepresst, in Embryohaltung auf der Seite zusammengerollt wie ein verletztes Tier. Sor Isabel kam ins Zimmer geeilt, Victoria versteckte sich unter ihrem weißen Laken. Mit einem Ruck zog Sor Isabel das Leichentuch beiseite und begriff sofort. Das ist nichts, das ist ganz normal, was dir da passiert. Victoria, ich habe gute Neuigkeiten für dich, jemand ist gekommen, um dich abzuholen. Der Himmel hat dich erhört. Sie konnte nicht eher kommen, sie hatte nicht genug Geld, um dich durchzubringen, aber jetzt ist deine Mutter da, Victoria! Deine richtige Mutter.
Das Mädchen, blutverschmierte Schönheit, lag kraftlos da, und man verkündete ihr, ihre mamá sei da, sie sei zurückgekehrt, um sie zu holen, sich um sie zu kümmern, sie durchzubringen. Sor Isabel half Victoria in ihre Kleider und brachte sie zu den Duschen. Unter dem warmen Wasser löste sich die Spannung aus ihrem Körper. Sie sah zu, wie Blutgerinnsel auf die weißen Fliesen fielen, sich von der purpurrot gefärbten Flut mitreißen ließen und im Abfluss verschwanden.
Sor Isabel bereitete ein Mulltuch vor, das Victoria sich in die Unterhose legen konnte, und zog ihr ein neues Kleid an, das sie für besondere Anlässe aufbewahrt hatte. Für Abschiede. Ein neues Kleid aus marineblauer Baumwolle mit weißen Punkten. Sie nahm ein Fläschchen Eau de Cologne, das sie in ihrem Nachtschränkchen versteckt hielt, rieb sich die Hände damit ein und strich anschließend damit über den Kopf des Kindes. Als sie Victoria die Haare kämmte, spürte die Nonne einen Stich in der Brust, doch sie lächelte das Mädchen, das unter ihren Augen zur Frau wurde, weiter an. Sor Isabel hatte den Verdacht, dass diese Mutter, die jetzt gekommen war, um ihren Nachwuchs zu holen, nicht gerade die Mutter sein würde, von der die Kinder träumten.
Vielleicht war es nicht besonders christlich von Sor Isabel, die göttliche Vorsehung in dieser mütterlichen Rückkehr nicht zu erkennen, aber sie konnte nichts dagegen tun. Sie wusste es. Als Victoria bereit war, machte sie die Runde durch die Gemeinschaft, ihre Hand in der von Sor Isabel. Nie zuvor hatte Victoria sie so fest gedrückt. Dann setzte sie ihren Namen in ein Verzeichnis und verließ ihr Zuhause. Sie ging durch die Tür und stand endlich vor der, die sie geboren hatte.
Dolores sah das Kind mit strenger Miene an. Auf der rechten Hüfte hielt sie ein Baby und an der linken Hand ein etwa fünf Jahre altes Mädchen mit braunen Haaren. Jesús versteckte sich hinter ihr. Er betrachtete seine Füße, zwei Paar Socken, die wie eine Ziehharmonika an seinen zerschrammten Schienbeinen heruntergerutscht waren. Er war gewachsen, er war jetzt ein Jugendlicher. Dolores musterte ihre Tochter, ohne sich zu rühren, wie eine Skulptur wirkte das Trio, niemand atmete mehr, sie waren erstarrt angesichts des Schauspiels, das die prächtige Victoria ihnen bot. Dolores bereute, hergekommen zu sein. Dieses Mädchen war viel zu schön, sie würde ihnen nichts als Elend bescheren.
Zaghaft trat Victoria einen Schritt vor und lächelte.
Dieses Lächeln, das erste von einem Kind zu seiner Mutter, sollte ihr Leben lang unerwidert bleiben.
3
Ich war ein glücklicher Dummkopf.
Das hatte Pierre, der schönste Junge an der Grundschule Notre-Dame Saint-Roch, in der Turnstunde erlassen. Die ganze Klasse stand in Sportsachen vor den Gymnastikmatten Schlange, um einer nach dem anderen die Übungen nachzumachen. Die Halle war riesig, große Spiegel duplizierten meine Kameraden: eine Armee auf Socken. Nach Pierres Urteilsspruch hatte ich einfach weitergelacht, zwar nicht ganz sicher, ob das eine angemessene Reaktion war, aber hocherfreut, dass ich seine Aufmerksamkeit auf mich gezogen hatte. Dann war sein Blick auf meine Hände gefallen, ich trug abblätternden roten Nagellack auf angeknabberten Fingernägeln.
»Außerdem ist Nagellack billig.«
Zweites Urteil des Revolutionstribunals der dritten Klasse. In diesem Augenblick verflogen meine Zweifel, und mein Gesicht verschloss sich. Nach tausend Rollen vorwärts und rückwärts, Handständen und Radwenden, ausgeführt im Gestank von Politur, warmem Plastik und feuchten Füßen, war mir schwindelig und schlecht.
Nach Schulschluss, in der Horde von Kindern, die sich Richtung Ausgang drängten, sickerten mir Pierres Worte noch immer durchs Gehirn. Ich wusste, dass sie nicht als Kompliment gemeint waren, aber dieses eine Wort, glücklich, irritierte mich. Wenn ich einen glücklichen Eindruck machte, oder wenn ich tatsächlich glücklich war, dann konnte es mir doch völlig schnurz sein, ob er mich für dumm hielt. Mit Rotz in der Nase zwängte ich mich zwischen meinen Kameraden durchs Tor und entdeckte sie, die dort auf mich wartete. Immer war sie da, jeden Tag stand sie zwischen den philippinischen Kinderfrauen, den jungen Au-Pair-Mädchen aus England, die durch die Bank rote Haare hatten, und ein paar Müttern, die Hausfrauen waren. Meine Mutter, Victoria, dunkle Haare, zwar von bescheidener iberischer Statur, aber eine Naturgewalt, mit ihrem offenen Blick, der von den geradesten und schwärzesten Augenbrauen der Welt gesäumt wurde, zwei Striche, die ihre horizontale Welt beschrieben. Während meine Kameradinnen sich auf den Weg nach Hause machten und ein paar Worte auf Englisch mit ihren Beschützerinnen wechselten, rannte ich zu meiner Mutter, hielt ihr meinen Schulranzen hin und erzählte ihr auf Spanisch von meinem Tag.
Jeden Abend auf dem Nachhauseweg hielt ich sie zärtlich am Arm. Manchmal gingen wir noch durch den Monoprix, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Regelmäßig kam ich mit einem Spielzeug oder Süßigkeiten wieder heraus. Sie konnte nicht Nein zu mir sagen. Oder besser gesagt, konnte sie mir nichts ausschlagen, der einzige Vorteil des heiß geliebten Einzelkindes. Meine Wohltäterin und ich überquerten die Avenue de l’Opéra, gingen die Rue Gaillon entlang und kamen schließlich zu Hause an, in unserer Straße, in diesem seltsamen Bezirk, dessen geheime Grenze die Bar-Tabac zog.
Hier war das Hoheitsgebiet meines Vaters, Julián, der Pförtner des Théâtre de la Michodière in der gleichnamigen Straße. Ihm gehörten das Straßenpflaster und die verzinkten Tresen. Jeden Morgen öffnete er die Gittertüren des Theaters, brachte die Post in die Büros der Intendanz und setzte sich dann auf die breiten Steinstufen. Er grüßte und überwachte alle Menschen im Viertel, kannte jede Politesse beim Vornamen, klopfte den Bullen auf die Schulter. Er war der Leuchtturm der Straße. Ich sah ihn dort sitzen, mit seiner ganz eigenen Erscheinung eines volkstümlichen Ogers: die Baskenmütze auf dem dichten grau melierten Schopf, ein Lacoste-Hemd, ein schwarzer Dreiviertelmantel aus Leder, und stets makellos polierte Mokassins. Die Ärmel hochgekrempelt, sommers wie winters, sodass man die Tätowierung auf seinem linken Arm sehen konnte, Relikt seiner Zeit bei der Marine. Ein von einem Pfeil durchbohrtes Herz mit seinen Initialen und den Daten seiner Seereise. Die Tätowierung war einfarbig, ein verwaschenes Blau, und an manchen Stellen verblasst. Man konnte ahnen, dass sie handwerklich gestochen worden war, mit Nadel und Tinte und in starken alkoholischen Dämpfen. Ich fand ihn schön, meinen padre.
Wenn ich an seinen Checkpoint kam, gab er mir einen Kuss, und in seinem Atem lag bereits Wein, sein Blick war melancholisch. Meine Mutter und ich gingen weiter bis zum Künstlereingang, dann mussten wir am Glaskasten vorbei, in dem mein Vater bald den Abend damit verbringen würde, den Schauspielerinnen und Schauspielern die Tür zu öffnen und das Kommen und Gehen zu überwachen, bis er spätabends nach der Vorstellung die Gittertüren wieder schloss.
Nun gingen wir die Treppe hoch, die zur Intendanz führte. Auf der kaltgrauen Wand wies ein perfekt gezogener Strich mit Pfeil uns an: zur Intendanz dieser Linie folgen. Es war auch der Weg zu unserer Bleibe, unserer Dienstwohnung. Follow the yellow brick road. Ich folgte der Fährte und den verschiedenen Plakaten in Art-déco-Ästhetik, die die Vorzüge zahlreicher Eisenbahngesellschaften priesen. Die gewaltigen Lokomotiven des Orient-Express zeigten mir Tag für Tag den Weg. Hinter besagtem Büro des Intendanten und dem kurzen Abstecher nach Mitteleuropa kam ich im letzten Flur an, in dem es keine Wegweiser mehr gab. Endlich war ich zu Hause, in einer anderen Dimension: Ich überschritt eine unsichtbare Linie – Überblendung – und trat aus dem eleganten Theater, in dem die Geister von Pierre Fresnay und Sacha Guitry wandelten, in den dunklen Gang mit seinen bröckelnden Wänden, in dem meine Mutter unsere feuchte Wäsche aufhängte. Es kam vor, dass man die großen Laken mit der Hand beiseiteschieben musste, um sich einen Weg bis zu unserer Tür zu bahnen. Zwei Zimmer, die Diele, die mein Zimmer war, dann das Ess-Wohn-Elternschlafzimmer, eine winzige Küche und eine Toilette. Kein Badezimmer, wir benutzten die Duschen, die für die Schauspieler gedacht waren. Vor dem Abendessen huschte ich mit Handtuch und Seife bewaffnet hinunter zur Garderobe. Ich musste mich beeilen und so früh wie möglich duschen gehen, damit ich niemandem aus dem Ensemble oder von der Technik über den Weg lief.





























