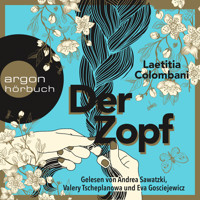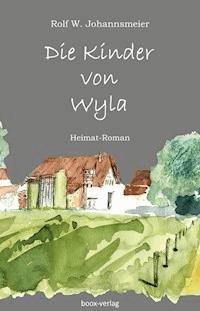
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: boox-verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
"Was ist passiert?" "Sind wir nur älter geworden?" "Oder einfach keine Komiker mehr?" "Oder sind wir zu sehr Schweizer geworden, wir Kinder von Wyla?" Ein Regisseur aus Köln macht sich mit seiner Frau und den zwei kleinen Söhnen auf, in die Schweiz auszuwandern um da als Lehrer zu arbeiten. Voller Enthusiasmus fahren sie los und treffen in Wyla, einem kleinen Dorf im Emmental, ein. Das unbedingt viel zu laute "Grüssgott miteinander!", das der Glatzenwilli bei der Ankunft fröhlich auf den Dorfplatz ruft, lässt die Neuankömmlinge von der ersten Sekunde an unangenehm auffallen. Doch sie lassen sich durch die angeborene Zurückhaltung ihrer neuen Schweizer Nachbarn nicht entmutigen, nehmen am Dorfleben teil, arbeiten, vergrössern ihre Familie, wühlen den kontaminierten Betonacker des Imkers um und renovieren sein Abbruchhaus zu ihrem "Bauernpalast. Die Frage bleibt: Gehören sie jetzt dazu? Was ist denn nun ihre Heimat? Sind sie Schweizer geworden? Im ihrem C-Ausweis steht: "Heimat-Ort: Deutschland"! Rosa, Joseph und Jonathan sind "Die Kinder von Wyla". In 44 Geschichten erzählen der kritische Jonathan, der Draufgänger Jonas und die patente Rosa von ihrem Leben in einem kleinen Schweizer Dorf und davon, wie schwierig es ist, sich ein Stück Heimat zu erobern. Rolf Johannsmeier ist Lehrer und Theatermacher. Er und seine Familie haben selber die Schwierigkeit erlebt, in einem fremden Land eine neue Heimat zu finden. In seinem Buch "Die Kinder von Wyla" erzählen drei Kids einer deutschen Einwanderer-Familie vom ganz normalen Integrationswahnsinn ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Ähnliche
Rolf W. Johannsmeier
Die Kinder von Wyla
Ein Heimat-Roman in 44 Geschichten
Illustriert vonPhilipp Guntern
Impressum
Erscheinungsjahr 2018
Alle Rechte vorbehalten © boox-verlag, Urnäsch
Cover/Illustrationen: Philipp Guntern
www.faces-and-more.ch
ISBN
978-3-906037-34-9 (Taschenbuch)
978-3-906037-35-6 (ebook)
www.boox-verlag.ch
(Mit 1% seiner Einnahmen unterstützt der Verlag eine Umweltschutzorganisation)
Was allen in die Kindheit scheint und worin nochniemand war:
Heimat
1935, Ernst Bloch, deutscher Philosoph im Schweizer Exil
Liebe In- und AusländerInnen
Alles ist wahr, und doch ist alles erfunden …
Dieser Roman berichtet von dem Versuch einer Ausländerfamilie in der Schweiz eine neue Heimat zu finden. «Fremd ist der Fremde nur in der Fremde» sagt Karl Valentin. Was aber, wenn der Fremde unter lauter Einheimischen ist?
In diesen Geschichten steckt viel Erlebtes und doch sind es eben Geschichten, Märchen, Erfindungen.
Wyla gibt es genausowenig wie Seldwyla aus Gottfried Kellers «Die Leute von Seldwyla» oder Bullerbü aus Astrid Lindgrens «Die Kinder von Bullerbü». Zwei Bücher, die mir sehr gefallen.
Der Glatzenwilli hat mir mal gesagt: «Wir suchten Bullerbü, aber wir fanden Seldwyla» … Nennen wir das Dorf also «Wyla», die kleine Schwester von Seldwyla.
Und die Leute, die euch in diesen erfundenen wahren Geschichten begegnen, mögen euch manchmal vertraut vorkommen (hoffentlich) – sie sind doch alle erfunden, und die Ähnlichkeit mit wirklich existierenden Personen ist rein zufällig und ungewollt.
Rolf W. Johannsmeier
Die Erzähler:
Jonathan, Johnny oder Jona: wunderlicher, eigensinniger Grübler und Sportskanone, erst fünf, dann neun, dann zwölf und vierzehn Jahre alt und älter!
Joseph, Jo: der leider immer zwei Jahre jüngere Bruder, Raubein, Poet und ADHS-Genie.
Rosa: ihre erst so kleine «rosa» Schwester, die sich dann plötzlich und unerwartet ganz nach vorne tanzt
Das übrige Personal:
Mammagena und Glatzenwilli: die armen Eltern, und …
Tom
Dänu Duck
Franz Lüthi
Fräddu
Gemeindepräsident
Röbi
Johnny Gitarre
Theo, Steffu, Ändu
Frau Neuenschwander
Dschamilja
… und, und, und … das ganze Dorf eben!
Was erzählt wird:
TEIL 1
Wie das kleine Schweizerdorf Wyla entstand
1.Rosa
2.Mutterschwester Furchtlose Blume
3.Der Angriff der Ogallala
Wie der Jonathan «Dütsch» lernte und wieder verlernte
4.Bern
5.Der Geburtstag
Wie der Joseph laufen gelernt hatte
6.Angriff der Killerkäfer
7.Das Geheimnis
Wie der Glatzenwilli in die Schweiz gekommen war
8.Ein Dorf in Europa
9.Der Lüthifranz
Wie die Mammagena in die Schweiz kam
10.Johnny Gitarre
11.Indianerinnen
12.Die Geschichte vom Sandwich
Wie die Rosa dann endlich auch mal spricht
13.Der Fussballgeburtstag
Wie die Luna nicht in Wyla blieb
14.Fussball ist Leben
15.Das Imkergespenst
16.Das Haus der Bienen
17.Hau weg den Dreck
Wie die Kinder von Wyla einen Bauernpalast gewannen
18.Heimatland
TEIL 2
19.Hier ist Rosa
20.Keine Rosa Zeiten
Wie die Petermüllers den Heimatzweifel nie verlieren
21.Der Alptraum
Wie aus den kleinen Kindern grosse werden
22.Die grosse Welt
23.Bauernfussball
Wie die Kinder (und Erwachsenen) von Wyla «gebodigt» wurden
24.Wilde Kerle Wyla
25.Das Tor zur Welt
Wie einmal die Krise kam
26.Die Reise
27.Das weite Land
28.Störtebeker
29.Naziwikinger
30.Das Traumkind
Wie der Willi und seine Mammagena ausgewandert und doch nicht angekommen sind
TEIL 3
31.Rosas Zeiten
32.Shyla
Wie einmal die Könige von Wyla starben
33.Die Schule des Lebens
34.Die Hundeflüsterin
Wie der Willi noch einmal Schüler sein durfte
35.Keinen Plan
36.Fussballameise
37.Balotelli werden
38.Django
39.Tango
Wie der Willi eine Rossnatur brauchte
40.Marco Polo
41.Hoch hinaus
42.Sorry …
43.Himmel über Köln
Wie die Petermüllers den Schluss vertagen
44.No borders – no nations!
TEIL 1
Wie das kleine Schweizerdorf Wyla entstand
Vor langer, langer Zeit, als es dem Gott der Geschichte so gefiel, entstand das Schweizer Mittelland. Lange noch bevor der Mensch auftauchte. Und das ging so:
Afrika brach ab vom Superkontinent Pangea, ein Graben entstand durch diesen Bruch und das Meer in der Mitte, das Mittelmeer, das eigentlich von den Küsten Nordafrikas bis zum Schwarzwald und den Vogesen reichte, wurde zusammengedrückt.
Beim ersten Druck entstanden Sardinien und Korsika, beim zweiten Druck entstanden aus der Erdkruste die Alpen, mit granitschwarzem Fels, der eigentlich der Boden des Urmittelmeeres war.
Dahinter, vom Wallis bis zum Schwarzwald, entstand ein flaches Meer, eine tropische Lagune, in der sich alle Saurier dieser Welt tummelten. Das Jura-Meer, in dem sich der vierzig Tonnen schwere Brontosaurier mühelos bewegen konnte, weil das Wasser seinen Megabauch trug.
Nach dem Jura-Meer wurde das ganze Zeitalter benannt: Jura – wie die Roger Federer Kaffeemaschine und in Hollywood der Jurassic Parc.
Vierzig Millionen Jahre Herrschaft der Saurier, bis ein dritter Druck auch noch dieses Flachmeer zusammenschob und sich aus dem Sand und dem Kalk der Lagune das Jura-Gebirge erhob: Mit vielen Fossilien, riesigen Saurierabdrücken auf senkrechten Felswänden aus Kalksand, die man heute noch, in Solothurn auf dem Weissenstein, bewundern kann.
So entstand das Schweizer Mittelland, oder besser die Schweiz, denn entgegen manchen Mutmassungen sind neunundneunzig Prozent der Schweizer keine Nachfahren von Friedrich Schillers Wilhelm Tell (der, wie man unschwer erkennen kann, ein Nachfahre des Ötzis war und, weil Schiller damals in Thüringen lebte, den Thüringer Nachnamen Tell trug), sondern Bewohner der Ebene zwischen Alpen und Jura, Gebirge, die sich im Halbkreis und wie eine Mondsichel gekrümmt, vom Mont Blanc bis zum Gotthard, schützend um das Flachland legen.
Des Mittellandes eben.
Sie waren alle Gallier mit Namen wie Asterix und Obelix (keine Germanen) oder Ligurer (Italiener) und lebten dort vor zweitausend Jahren, als die barbarischen Totschläger-Germanen namens Alemannen immer näherkamen.
Orgetorix, ein mutiger Schweizer, schlug vor, dass alle 250‘000 Gallier – oder Helvetier – aus dem Mittelland, der Rhone entlang, nach Süden auswandern, bis ans Mittelmeer, wo es auch viel wärmer wäre und wo eh viele von ihnen herkämen. Sie versuchten es.
Auf halbem Weg stoppte sie Cäsar mit seinen Legionen. So viele Legionäre hatte er, wie sie Einwohner insgesamt waren. Er würde alle totschlagen, wenn sie nicht wieder zurückgingen. Wenn sie das allerdings täten, würden seine Legionen sie immer schützen gegen die Barbaren, er würde die Schweiz zum Modell-Land machen für Europa – sicher vor Barbaren, reich an Städten, Amphitheatern und Kultur. Sie wollten überleben und kehrten zurück.
So wurde die Schweiz 1. römisch-italienisch, 2. städtisch und 3. Bollwerk gegen die Alemannen mit ihren schrecklichen Dialekten.
Allerdings – nach vierhundert Jahren war der Spass vorbei, dann kamen die «Dütschä», die Alemannen, brannten die Städte nieder, bauten aus den Stadtmauern Burgen, terrorisierten das Volk auf dem Land und zwangen es so lange, nicht mehr italienisch-römisch, sondern ihren germanischen Kauderwelsch zu sprechen, bis sie es für ihre eigene Sprache hielten. Die Berner das Bern-Deutsch, die Walliser das Walliser-Deutsch usw.
Die Abneigung gegen die «Dütschä» ist bis heute geblieben, auf die Sprache, die sie mitbrachten, ist man allerdings stolz. «Schwiizer-Dütsch»! Im Gegensatz zu «Dütsch-Dütsch» …
Auch der bayrische Herr auf Schloss Landsberg war eigentlich ein «Dütschä», wie man schon am Namen merkt, in seiner Herrschaft lag der kleine Weiler Wyla … Jeremias Gotthelf hat viel von diesen Zwingherren erzählt, und wie sie die kleinen Dörfer quälten. Darunter Wyla: Ein Dorf wie jedes andere, nicht weiter erwähnenswert, bis auf den Bauern V., der sei «än guetä Chaib» (hat er natürlich nicht so geschrieben, denn er schrieb Schriftdeutsch, aber so gemeint). Und der Ururenkel vom Bauern V. wird in unserer Geschichte auch noch eine Rolle spielen …
Wyla ist ein kleines siebenhundert Seelen Dorf, das erste, wenn man den Kanton Bern durch den Wyla Wald befährt, der ihn vom Kanton Solothurn trennt. Im Wald steht seit Neuestem ein Schild: Vorderes Emmental. Zum Tal gehören natürlich Berge, aber hier sind weit und breit keine zu sehen, nur die Alpen, ganz hinten, am südöstlichen Horizont, Richtung Oberwyla, mehr als dreissig Kilometer entfernt, und der Jura, näher, am nordwestlichen.
Aber die Emme gibt es, am Dorfrand, und Gotthelf hat die Wut der Flut der Emme bei Hochwasser sehr eindrücklich beschrieben, ein wahrer Tsunami war das, mit einer fünf Meter hohen Flutwelle, ausgerissenen Bäumen, kaputten Häusern, aufgedunsenen Kuhleichen und vielen toten Menschen, der alle paar Jahre das Emmental heimsuchte …
Der tiefere Teil des Dorfes war immer wieder unter Wasser, eben weil die Emme als wilder Gebirgssturz-bach oben in den Alpen entspringt und bei plötzlicher Schneeschmelze so viel Wasser produziert wie der Rhein. Als sie dann endgültig gedämmt worden war, vor hundert Jahren, entstanden dort zuerst wegen der Wasserkraft, später wegen der Abwässer, grosse Fabriken, in denen Papier oder Tuch hergestellt und bedruckt wurde, mit riesigen, welteinmaligen Textildruckmaschinen.
Das Dorf wurde durch die Landstrasse nach Bern geteilt – auf der höheren Seite blieb es Bauerndorf wie eh und je …
Hunderte Arbeiter zogen mit ihren Familien nach Wyla auf der tieferen Emme-Seite und bauten winzige Häuschen, eines bescheidener als das andere, aber alle eigene Häuser, während das alte Dorf mit den grossen, prachtvollen Hochstuthäusern, gebaut auf kleinen Hügeln gegen das Hochwasser (wie die grossen Farmen der Südstaatler in Amerika), umgeben von fruchtbaren Feldern, weiter vor sich hin glänzte und der Stolza l l e rwar …
Als aber vor mehr als zwanzig Jahren die Grenzen sich in Europa öffneten und die Arbeit eine weltweite Ware wurde, war sie in Wyla plötzlich zu teuer. Der Fabrikherr baute die welteinmaligen Textildruckmaschinen ab, vermietete und verkaufte sie nach Ägypten und Pakistan, und bald gab es keine Arbeit mehr für die Dorfbewohner auf der tieferen Emme-Seite in Wyla.
Sie und ihre Kinder blieben aber trotzdem, denn es gefiel ihnen so gut, das Leben auf dem Land. Sie wollten nicht zurück in ihre Vorstädte, und sie bauten ihren Kindern und sich selbst den ersten Abenteuerspielplatz weit und breit, und eine eigene Badi im Wald, und suchten sich eben Arbeit woanders …
Damals, vor mehr als zwanzig Jahren, fing es wieder an, dass die Leute überall in Europa sich auf den Weg machten und Arbeit woanders suchten, dort, wo man sie brauchte, und das kleine Wyla rieb sich die Augen und stellte fest: Es lag ja auch in Europa und zwar genau in der Mitte …
Und so kam vor fünfzehn Jahren, an einem Sommerabend ein merkwürdiges Gefährt aus dem Land der «Dütschä» in Wyla an, während die Jugend des Dorfes, wie gewohnt auf der schönen alten Seite, zwischen dem alten und dem neuen Schulhaus, rumhing und «Seich» machte: Ein riesiger Möbelwagen aus Köln.
Er hielt vor einem der eindrucksvollen zweihundert Jahre alten Hochstuthäuser. Möbelpacker stiegen aus, und aus dem kleinen französischen Begleitfahrzeug, ebenfalls mit Kölner Nummer, stieg eine schöne, junge, blonde Frau, die eher ein wenig wie aus Los Angeles als aus Köln wirkte, mit einem Baby auf dem Arm. Ihr kahlköpfiger, nicht mehr ganz so junger, bebrillter Begleiter hielt einen weissblonden, schüchternen, bleichen dreijährigen Jungen an der Hand, der durch den Mund atmete, mit leicht geöffneten Lippen, sich vorsichtig hinter das Bein seines Papas schob und die Szenerie misstrauisch beobachtete.
Die Dorfjugend unterbrach den «Seich», der Kölner Kahlkopf entbot ein aufgeräumtes, fröhliches und unbedingt viel zu lautes «Grüss Gott miteinander!» in die Runde, das bestimmt schweizervolkstümlich gemeint und doch so verräterisch fremd war …
«Schiissdräck – diä Dütschä», entfuhr es, leise natürlich, und unhörbar für die ankommenden Gäste, einem der jungen «Giälä», alle lachten und antworteten, um dieses Lachen fremdenfreundlich zu gestalten, laut und im Chor: «Grüässäch mitenang!»
So waren denn die «Dütschä», die schon längst aus dem Schloss Landsberg, oder allen anderen Emmentaler Burgen und Schlössern hatten ausziehen müssen, doch wieder hier in Wyla angekommen …
Dies ist also die Geschichte einer kleinen Kölner Familie, die es vor fünfzehn Jahren vom westdeutschen Rhein an die Ufer der Emme verschlagen hatte. Erzählt in ihren eigenen Worten, das heisst: so wie die drei Kinder Jonathan, Joseph und Rosa es erinnern. Es ist eine Art Einwandererkinder-Tagebuch über zehn Jahre und beginnt drei Jahre nach deren Ankunft.
1.Rosa
Joseph erzählt:
Rosa ist schon drei Jahre alt und älter.
Sie geht in die Grossspielgruppe, zwei Mal in der Woche, und das ist viel öfter als in die Kleinspielgruppe, die ist nur einmal pro Woche. Es ist also doppelt so oft – die Grossspielgruppe eben.
Ich bin im letzten Jahr auch noch reingegangen, das kommt vor dem «Chinsch», aber jetzt bin ich natürlich gross und ein Kindergärtler und geh jeden Tag ins Schulhaus in den Kindergarten, am Dienstag sogar zweimal.
Und in die Kleinspielgruppe müssen, wie der Name schon sagt, alle Kleinen, alle, die noch Windeln tragen und auch noch reinmachen.
Rosa macht schon lange nicht mehr rein, darum trägt sie auch schon lange keine Windeln mehr. Seit fast einem Jahr, sagt Mama.
Auch nachts nicht mehr, und dann haben wir den Salat, wenn sie abends wieder nicht pinkeln war, vor dem Schlafengehen, und wie immer hat sie unendlich viel Tee mit Orangensaft getrunken.
«Die Blase muss ja platzen», sagt Mama, aber es nützt nichts, raus muss es doch. Und wir lagen alle die längste Zeit im Trockenen, dann also im Nassen.
Mich störts ja nicht so, weil ich in der Ritze liege, zwischen Mama und Papa, da kommt nichts hin, aber Mama, vor deren Bauch Rosa mit ihrem Po immer löffelchenmässig kuschelt, kann Anfälle kriegen.
Andererseits hat Rosa Lolafee, ihre neue Puppe.
Natürlich nicht nur die, ist ja wohl klar, sie hat auch andere Puppen, viele, und Bären, und eine Puppe, die spricht, auch Plüschtiere und einen Hund. Aus Stoff natürlich, Papa könnte echte Hunde nicht ausstehen, die sabbern so und tropfen mit ihrer Spucke auf sein Hosenbein – Iiiigitt, sagt er. Und eine Plastikpuppe, die pinkeln kann wie Rosa selbst, wenn sie zu viel Tee oder Apfelmost getrunken hat, hat sie auch.
Aber Lolafee ist natürlich die Schönste, mit ihren gelben dicken Wollhaaren, ihrer komischen Stupsnase und ihrem seidenen Prinzessinnenkleid, weil Lolafee ist einfach … rosa. Rosa ist meine Schwester – und wer Rosa heisst, liebt natürlich die Farbe Rosa. Ich glaube aber, es liegt auch daran, dass sie ein Mädchen ist – wie Mama, und die liebt auch Rosa. Auf jeden Fall zieht Mama die Rosa immer rosa an. Vielleicht ist Rosa ausserdem noch ein bisschen dumm, weil sie so klein ist (sie ist fast zwei Jahre jünger als ich) und trägt deswegen immer rosa.
Obwohl sie im Spiel sehr gross sein kann, grösser, als sie eigentlich ist. Wenn wir Familie spielen, kann sie sogar die Mutter von uns Jungen sein, obwohl sie doch eigentlich unsere kleine Schwester ist.
«Mama», sagen wir dann zu ihr und trotzdem ist alles rosa, sogar das Zelt, aus dem wir dann die Bärenhöhle bauen, und das blödsinnige Feenkleid mit Flügeln und Silberkrone, das sie zum Geburtstag bekommen hat und zum Spielen trägt.
2.Mutterschwester Furchtlose Blume
Joseph erzählt:
Gestern hatte Rosa grossen Streit mit Jonathan, sie haben sich auch an den Haaren gerissen und «Arschloch!» geschrien und ins Gesicht gekniffen (ich zum Beispiel täte das nie – auf jeden Fall nicht alles zur gleichen Zeit. Eins nach dem anderen, sonst ist das ja reine Verschwendung).
Es war Sonntag und am Sonntag stehen die Erwachsenen immer später auf und frühstücken uuuh-lang, und dann wissen wir Kinder irgendwann gar nicht mehr, was wir noch machen sollen.
Also, Papa hatte versprochen, mit uns Indianer zu spielen, in der Wohnung, in Rosas Zimmer, weil es draussen regnete. Schade, im Wald hätte mir besser gefallen. Wir haben nämlich im Wald aus Zweigen ein Wigwam gebaut und aus Haselnuss-Ruten Pfeil und Bogen geschnitzt, und ich hatte im dritten Wettschiessen mehr Punkte als mein grosser Bruder.
Es regnete aber in Strömen, und wir mussten drinbleiben, also bauten wir in Rosas Zimmer aus ihren und unseren Bettdecken, den fünf Puppenwagen und dem Gemüseverkaufsstand eine Höhle. Mit zwei Kammern, versteht sich: Eine kleine, kuschelige für die Kinder und eine riesige für Papa, weil der Lulatsch bringt sonst immer alles zum Einsturz. «Meine Knie, Kinder, meine Knie!», ruft er dann, und: «Kinder, ich bin nicht mehr der Jüngste!»
Das wissen wir schon, er hat ja auch nur noch so wenig Haare, dass er sich immer eine Glatze rasiert, und sein Fünfeckbart um den Mund ist auch schon ziemlich grau.
Aber trotzdem: Eigentlich ist er dann nur zu faul, weil beim «Schuuttä» auf dem Rasenplatz vor dem Schulhaus nebenan – wir wohnen in der Schulhausstrasse – rennt er wieder alles um, zum Beispiel mich, und dann ist nichts mehr mit knien.
«Kinder meine Knie!», ruft er also beim Hüttenbauen, und – zack! – ist die tollste Höhle zum Einsturz gebracht, nur weil er zu faul ist, sich zu bücken. Also bauen wir jetzt die Erwachsenenkammer in den Höhlen immer höher (weil Mama ist auch nicht besser als Papa, obwohl viel jünger und auch etwas – allerdings nur etwas – kleiner).
«Den Sportteil will ich noch lesen», sagte er also gestern Morgen, «Dann bin ich sofort bei euch.»
Aber das kann dauern, sage ich Ihnen, der Sportteil ist immer das Wichtigste für Papa. Besonders wenn Bundesliga war … Obwohl er doch eigentlich Lehrer ist und er müsste sich schlau machen für seine Schule.
Aber Gott sei Dank gibt es in Wyla am Sonntag nur eine Schweizer Zeitung, und die Schweizer interessieren sich nicht so für die deutsche Bundesliga (zumindest tun sie in der Zeitung so, heimlich gucken sie alle Sportschau, vor allem, wo so gute Schweizer in der Bundesliga spielen).
Also war er wirklich bald fertig mit der Zeitung, kam zu uns in die Höhle, und dann wurden die Rollen verteilt.
Jonathan war «Furchtloser Panther», ich war «Furchtloser Bär», Rosa war «Furchtlose Blume» und Papa «Furchtloses Murmeltier».
«Und ich bin die Mutter von euch allen!», sagte Rosa, weil sie will schon die Squaw sein.
«Das ist die natürliche Arbeitsteilung!», sagt Papa. «Die Indianer waren Jäger und Sammler, die Männer haben gejagt, die Squaws gesammelt, und das heisst, eigentlich haben die Frauen die Männer oft ernährt, weil gesammelt wurde jeden Tag, gejagt nur selten.»
Manchmal merkt man eben schon, dass Papa Lehrer ist.
Also, Rosa ist gerne die Beerensammlerin, aber sie will auch zu sagen haben: «Ich bin die Mutter von euch allen.»
Alle konnten sagen, wie sie das fanden, Papa und ich hatte keine Probleme, aber Jonathan! Er ist der Älteste, also will er eigentlich immer bestimmen, wie gespielt wird. Wenn Papa dabei ist, haben die Kleinen mehr Mut, zu sagen, was und wie sie spielen wollen, und so kam es, dass Rosa jetzt die Chefin, die Mutter von allen sein wollte, sogar von Papa, «Furchtloses Murmeltier».
Vielleicht dachte sie da auch an die alte Zauberin aus Bärenbrüdern, die mit den Geistern sprechen kann. Jonathan ist auch ein Zauberer, obwohl er im Augenblick nur ein Jahr älter ist als ich. Er kann auch mit den Geistern sprechen, zum Beispiel mit dem Geist des toten Opa Trallala, Papas Vater, der uuuh-alt geworden ist und den wir im letzten Sommer beerdigen mussten. Sie spielen in Jonathans Träumen Schach miteinander, und Jonathan hat auch schon gewonnen. Obwohl der Opa im Krieg einmal gegen einen russischen Schach-Grossmeister gewonnen hat und deswegen nach Hause durfte. Erzählt Papa. Der hat übrigens als Kind immer gegen Opa verloren. Heute verliert er gegen Jonathan.
«Opas Geist ist über dich gekommen!», ruft er dann und lacht. Aber natürlich ärgert er sich. Was er gar nicht müsste, wir haben ihn ja trotzdem lieb, auch wenn er verliert.
Also, meinem Medizinmannbruder Jonathan hat das natürlich besonders Stress gemacht, dass Rosa «die Mutter von allen» sein wollte, also eigentlich die Chefin und Medizinfrau, und er hat Rosa ins Gesicht gekniffen, sie ihn an den Haaren gezogen, dann haben sie auf der Erde gelegen und die Höhle ist eingestürzt.
Papa und Jonathan hatten dann eine besonders gute Idee: «Wir sagen, Rosa sagt, sie ist die Mutter von uns allen, aber wir wissen, dass wir eigentlich alle Geschwister sind.»
Also: Mutterschwester Furchtlose Blume.
3.Der Angriff der Ogallala
Joseph erzählt:
«Wir lagen noch im tiefsten Schlaf, als die Ogallala angriffen. Wir hatten damit rechnen müssen, weil die ganze Nacht aus der Ferne ihre Kriegstrommeln zu hören waren. Aber als dann am Morgen die Sonne gerade über die Steppe schielte und die Spitzen des Grases in ihren roten Blick nahm, die Erde auch in unserer Höhle bebte, wachten wir auf und schauten uns verwirrt an: Das konnten nicht die Ogallala sein, so viele waren sie niemals. Häuptling Furchtloser Panther war der erste, der es bemerkte, und auch unsere Mutterschwester Furchtlose Blume, nachdem sie ihr Ohr auf die Erde gelegt hatte, bestätigte: «Da kommt etwas Ungeheures.»
Wir schauten aus der sicheren Deckung der Höhle in die Ferne. Ein Tornado? Eine riesige Staubwolke wälzte sich auf uns zu – bis wir begriffen: Es war der Stamm der «Schwarz Gehörnten», wie wir sie nannten, unsere Herde, unsere Nahrung, die unser Führer, Manitu, uns geschenkt hatte: eigentlich unser Leben. Das ganze Jahr zogen wir hinter ihnen her durch dieses unendliche Land, und hatten wir sie, wussten wir, wir hatten Wasser, wir hatten Fleisch, wir waren nicht verloren.
Seit Tagen hatten wir die Bisons aus den Augen und Ohren verloren, aber jetzt rasten sie auf uns zu. Wollten sie uns töten, waren sie wirklich Teufel geworden?
Nein – die Ogallala trieben sie vor sich her! Mit irgendetwas hatten sie die Tiere aufgeschreckt. Sie wollten die Büffel ihre dreckige Arbeit erledigen lassen. Sie wollten uns von ihren Hufen niedertrampeln lassen!
Aber sie hatten nicht mit der Geistesgegenwart unseres Stammes gerechnet. Wir waren nur wenige, nur vier, aber wir konnten rechnen: Wir hatten noch eine halbe Stunde Zeit. Mit unseren Fackeln setzten wir die Steppe in Brand, sollten die Schwarzen Teufel kommen. Das Buschfeuer würde ihnen Halt gebieten. Sie würden übereinander stürzen, es würde ein riesiges Chaos ausbrechen, bis zu uns würden sie nie vordringen, und dann – der Rückzug, die Ogallala würden überrollt werden. Wir waren vorbereitet. Weil wir unsere Fallen aushoben. Gemeinsam würden wir es schaffen.
Und genauso kam es: Im Getümmel des Rückzugs verirrte sich ein schwaches Tier und stürzte in die Falle, die wir unter einer Grasnarbe versteckt hatten. Wir hatten Fleisch, Fell und Knochen für die nächsten Wochen. Wir waren gerettet!
Als wir im Rhythmus der stampfenden Trommeln unseren Siegestanz um das erlegte Tier kreisten, kamen die feigen Ogallala. Wir sprangen auf unsere Ponys, die wir, auch unsere Mutterschwester Furchtlose Blume, ohne Sattel ritten, und im mutigen Zweikampf Mann zu Mann (oder, meinetwegen, auch Frau zu Mann) vertrieben wir sie aus unseren Jagdgründen …
Mama sagt, es hätte lustig ausgesehen, wie wir auf den Stühlen durch Rosas Zimmer gehoppelt wären, vor allem Papa auf ihrem Küchenhocker.
Rosa fiel natürlich aus dem Rahmen, weil sie ein echtes Steckenpferd hatte, mit Einhorn, von Lolafee, und es nützte nichts, wenn man ihr sagte «Nur auf der Stelle reiten.»
Sie war immer die Erste.
Wie der Jonathan «Dütsch» lernte und wieder verlernte
Als die Fünf hier angekommen waren, waren sie erst Vier.
Die Rosa war noch gar nicht im Bauch ihrer Mama gewesen, noch nicht einmal in ihrem Kopf. Oder wenn, dann nur ganz vorsichtig, nachts, als Traum. Als Traum davon, dass es toll wäre für die Mama, hier, in der Fremde, unter ihren drei Männern, noch eine «Schwester» zu haben.
Immer hatte die Mama von einer Schwester geträumt, schon als Kind, und hatte nie eine bekommen. Auch keinen Bruder – oder besser, schon, aber erst mit sechzehn, als sie die ersten Jungen kennenlernte und ihr eigenes Leben leben wollte.
Hier also durfte sie, zehn Jahre später, jetzt auf zwei Jungen aufpassen, während der Papa zur Arbeit ging. Aber das machte sie gerne, freiwillig, sie war es ja, die unbedingt hatte Kinder haben wollen. Diese Jungen waren ihr ganzer Stolz, bis dann nach knapp zwei Jahren auch noch die Rosa kam …
Der schüchterne blonde Monsieur, der sich bei der Ankunft hinter Papas Bein versteckte, war mittlerweile fünf Jahre alt geworden. Jonathan. Er war nicht gerade der redseligste, das Reden hatte sein junger Bruder übernommen – mittlerweile war der kein Baby mehr, das die Mama tragen musste, sondern ein wilder Vierjähriger, der draussen mit seiner Bauernlümmelbande zwischen Kuhwiese und Zwergenwald unterwegs war, Tag und Nacht. Der Joseph.
Ein echter «Bärner» geworden war der … und ein Landei!
Der Jonathan dagegen war auf Kölns grossen Spielplätzen und im Stadtpark gross geworden, dort hatte er sprechen gelernt. Eigentlich ein richtiges Grossstadtkind. Und Laufen hatte er auf der Bühne gelernt, wo seine Eltern als Papageno und Mammagena Theater probten. Denn eigentlich waren sie Theatermenschen gewesen …
Als er mit drei Jahren hier ankam, war er ein Plappermaul – aber alle taten so, als ob sie ihn nicht verstünden. Vor allem die Grossen.
«Was wotsch – red Bärndütsch!», fuhren sie ihn, ziemlich unsanft, an. Obwohl er doch genau die Sprache sprach, in der die Fernsehsendungen waren, von denen die anderen in der Spielgruppe morgens erzählten. Dazu noch aus Köln, WDR, Löwenzahn. Er kannte die Sendungen nicht so gut wie sie, weil es zu Hause nur einen kleinen Fernseher hatte, der selten rausgeholt wurde. Aber er kannte den Fritz Fuchs aus Löwenzahn, weil sein Papa mit dem Theater gemacht hatte in Köln …
Wenn dann seine Freunde ihn im schönsten Hochdeutsch nach dem Fritz ausfragten und er sich schon freute, sagte immer irgendein Grosser: «Redet aui Bärndütsch!»
Was sie dann taten, aber er konnte es nicht. Und sofort verstanden sie ihn nicht mehr, lachten über ihn und liessen ihn stehen.
Also lernte er «Bärndütsch». Es klang so ähnlich wie Kölsch, war auch so leicht zu lernen, eher eine Kinder- und Jugendsprache. Bald plapperte er fliessend in der neuen Sprache, wie einer von hier, und alle sprachen wieder mit ihm: Bis eines Tages einer schrie:
«Verschteisch, was dä da seit? I nid – hä ja, klar, wiä sött ä Dütschä Bärndütsch chönnä redä?»
Als sei dieser Dialekt hier, der doch «Dütsch» heisst und eine Spielart oder Mundart des Deutschen ist, wie Bayrisch oder Kölsch auch, mindestens so schwer wie Russisch oder Chinesisch.
Brav lachten alle Kinder über den kleinen Jonathan.
«Säg mal Chuchichäschtli!», schrien sie und freuten sich schon auf die kleinsten Fehler. Jonathan antwortete nicht mehr. Er sprach ab sofort nur noch zu Hause. Hochdeutsch.
4.Bern
Jonathan erzählt:
Ich meine, das ist wirklich wahr, mit der Rosa und dem Rosa. Mein Vater hat mich damals gefragt, vor dem dritten Geburi meiner Schwester Rosa, was wir ihr schenken sollten, und meine Mutter hat, als sie das hörte, gesagt:
«Dann fahrt doch ihr zwei nach Bern!»
Mein Vater hat gelacht:
«Damit wärst du wieder fein raus.» «Gut», hat Mami gesagt, «willst du dann zu Hause bleiben und den Geburtstagskuchen backen?»
Jetzt konnte sie lachen, denn natürlich war klar, was er lieber wollte.
Ich bin gerne mit Papi allein unterwegs. Und ich glaube, er auch mit mir.
«Ihr habt euch wohl immer was zu sagen?», fragte meine Mutter.
Und recht hat sie. Uns fällt immer etwas Interessantes ein. Wir sind dann nach Bern gefahren.
«Ein bisschen Grossstadtluft schnuppern», sagte mein Vater, obwohl er findet, dass Bern keine echte Grossstadt ist.
Wissen Sie, meine Eltern haben schon in vielen grossen Städten gelebt, Berlin, New York, Frankfurt, München, zuletzt in Köln. Da bin ich geboren worden. Aber mein Vater will in keiner Stadt mehr leben, seitdem wir Kinder da sind. Obwohl Mami manchmal schon gerne möchte.
Und recht hat er: Dieser Schmutz auf den Strassen!
«Welcher Schmutz?», fragte mein Vater, als wir nach Bern hineinfuhren, und lachte.
Wie gesagt, er kennt auch andere Städte, da liegt der Müll nur so herum, dass man gar nicht normal gehen oder Auto fahren kann, immer Füsse hoch oder Slalom.
«Nicht in der Schweiz natürlich», sagte er.
«Aber siehst du es denn nicht, Papi, halt einmal an.»
Er hielt tatsächlich an, weil, wissen Sie, mein Vater tut fast alles, was ich sage.
«Jetzt steig einmal aus und schau dir diese Flecken auf dem Pflaster an.»
Er hat sie tatsächlich nicht gesehen, so lange nicht, bis ich ihm die Augen öffnete.
«Diese weissen Flecken überall. Wie trübe Sterne in einem blassen, nachtgrauen Himmel.»
So muss man mit meinem Vater sprechen, dann merkt er was, dann hört er zu. Dann macht er die CD im Autoradio aus (er hört sowieso immer wieder die Fünf von «Was wir alleine nicht schaffen». Obwohl die Drei viel besser ist, vom Rhythmus her, weili c h… werde der Schlagzeuger bei uns. Aber er achtet eh nur auf die Melodie). Also schaltete er das Radio aus, stieg aus dem Auto und schaute sich um:
«Wie trübe Sterne in einem blassgrauen Nachthimmel? Tatsächlich.» Endlich hatte er’s gecheckt. «Die alten Kaugummis. Breit und platt und rund getreten. Mensch, also Johnny, was du alles siehst. Das stimmt wirklich. Da habe ich noch nie darauf geachtet. Selbst in der sauberen Schweiz, wo sie in Seldwyla in der Nacht die Gehsteige hochklappen und morgens fegen, als wäre es ihre Stiege …»
Sie merken, man muss ihm nur was hinwerfen, dann geht die Denk- und Quasselmaschine bei meinem Vater an (vor allem dann, wenn das Radio aus ist).
«Aber Papi», unterbrach ich ihn, «J e d eStadt ist dreckig und gegen Kinder und gegen Tiere undg e g e nMenschen, auch hier in der Schweiz, und darum ist es gut, dass wir in Wyla sind, nicht in Seld-wyla!»
«Weil Seldwyla istd i eSchweizer Stadt, aber Wyla ist ein Dorf», sagen wir im Chor. Das ist unser Spruch der Woche.
Ab und zu muss man so etwas einstreuen, damit sich die Grossen nicht doch noch überlegen, wegzuziehen.
So oft haben wir uns mit ihnen schon Häuser angeschaut, fast überall in der Schweiz, und am Ende haben wir Kinder immer wieder gewonnen. Weil wir Kinder wissen, was die Grossen noch rauskriegen müssen:
Nirgendwo ist es besser als in Wyla.
«Auch nicht schlechter, aber man müsste wieder ganz von vorne anfangen.»
Wenn Mami das dann gesagt hat, ist wieder Ruhe im Karton.
5.Der Geburtstag
Jonathan erzählt:
Also, in Bern hat es ein ausgezeichnetes Spielwarengeschäft, Erbsenlust, Bohnenglust oder so ähnlich. Da stehen alle die vielen Holzspielsachen: Burgen, Ostheimer Tiere oder wertvolle Holzeisenbahnen, die bei uns der Weihnachtsmann bringt. Ich denke mal, dass nicht nur wir, sondern auch der Weihnachtsmann hier einkauft, sonst könnten sie sich dieses Riesenangebot hier auch nicht leisten. Ich muss zugeben – schon oft haben wir uns mal eine schöne Rennkarre aus Plastik gewünscht, ferngesteuert, oder Raketen, und auch eine Carrerabahn. Unser Weihnachtsmann scheint aber hier zu bestellen – nur Remos Weihnachtsmann nicht.
Gott sei Dank haben wir noch einen Opa (Mamis Papa), der hat scheint’s gute Kontakte zu Remos Weihnachtsmann, denn letzte Weihnachten hat er dem Joseph ein ferngesteuertes Auto aus Plastik ins Paket gelegt. Allerdings – im Gegensatz zu den Ostheimer Tieren – ist es schon kaputt. Warum macht Ostheimer keine Rennkarren? O.K., weil Rennkarren die Luft verpesten, aber damit muss Papi jetzt nicht kommen, weil unser Auto hat auch sechs Zylinder und verbraucht 12,5 Liter von diesem schrecklichen Erdöl, das die Löcher in den Himmel reisst. Und eine Plastikrennkarre verbraucht überhaupt kein Benzin!
Da standen wir also in dem Laden, mein Vater und ich, und er hat doch tatsächlich gefragt: «Jonathan, was sollen wir bloss für unsere Rosa kaufen?»
Ich meine, e r ist der Vater, u n d der Lehrer, e r sollte sich auskennen, in bin kaum älter als meine Schwester.
Also habe ich gefragt:
«Wie heisst sie denn?»
«Wer?»
«Na, meine Schwester, deine Tochter?»
«Das weißt du doch: Rosa.»
«Na also.»
«Also was?»
«Kaufen wir Rosa. Rosa für die Rosa.»
Er hat dumm geguckt.
Die Verkäuferin hat laut gelacht.
«Oh, nein!», hat er noch gestöhnt, da hat sie ihn aber schon unterbrochen:
«Ach, wissen Sie», hat sie gesagt, obwohl sie doch Verkäuferin in einem Spezialgeschäft für wertvolle Holzspielsachen war, «als ich drei Jahre alt war, musste auch alles rosa sein: Das Kleid, die Puppe, das Bettzeug, sogar das Toilettenpapier.»
Warum sie das Letzte erwähnte, wusste ich nicht genau, weil Toilettenpapier verkauften sie hier doch gar nicht.
Aber Papi – mein Vater – musste jetzt auch lachen.
Und dann haben wir wirklich alles gekauft, was rosa war: Lolafee, und das Feenzelt, und, besonders abartig: ein rosadurchsichtiges Feenkleid mit Flügeln, einen Zauberstab und viele kleine glitzernde Aufkleber.
Es gab zwar kein Toilettenpapier – doch dafür war das Geschenkpapier auch rosa.
Was war das ein Fest, am nächsten Tag, Rosas Geburtstag. Am Abend vorher, als die Kleinen im Bett waren, habe ich mit den Grossen noch die Geburitorte gebacken und am Ende mit rosa Zuckerguss eine «3» darauf gemalt.
Wo man rosa Zuckerguss kauft? Nirgends, das ist meine Erfindung.
Man nehme:
Etwas Gelierzucker, heiss gemacht.
Den Saft von frischen Erdbeeren.
Vermische das Ganze mit Erdbeermarmelade.
Fertig!
Ich glaube, Rosa hat einfach noch nie so viel auf einmal geschenkt bekommen.
Und ihre Augen, die eh schon ziemlich gross sind, wurden immer noch grösser.
«Wie blauer Himmel, der sich in einem Sommersee unter Weizenfeldern spiegelt», hat mein Vater, Papi, gesagt.
Und er meinte damit, dass Rosas Augen mal nicht rosa sind, sondern eben hellblau, himmelblau, und dass sie blonde Wuschelhaare hat.
Mami fand, er übertreibt. «Soll ich das jetzt mitschreiben?», fragte sie und lachte.
Aber dann nahm sie die lachende und staunende Rosa in ihre Arme und hatte Tränen in den Augen. Für einen Moment wurde es ganz still. Man konnte sich genau vorstellen, wie es gewesen sein musste, als Rosa in Mamas Bauch war. Auf dem Foto, das der Joseph mit seiner ersten eigenen Kamera machte von Mami und Rosa, sahen sie so aus:
«Blond, blauäugig und verknuddelt», wie der Papi sagte. «Wie Schwestern.»
Wie der Joseph laufen gelernt hatte
Der Joseph war ein ganz schneller: Die erste Kamera, das erste Wort, der erste Schnuller – er musste die Nase immer ganz vorn haben. Natürlich – er war auch ein «Kölsche Jong», wie der Jonathan, und darauf waren sie beide stolz, aber er wusste gar nicht mehr, wie das war. Kein Wunder, er war ja erst zehn Monate alt, als er ausgewandert war!
Er war zwar mit dem Jona auf den Kölschen Spielplätzen gewesen, aber das Laufen hatte er auf dem einmaligen Wald- und Abenteuerspielplatz von Wyla gelernt. Der Spielplatz war der ganze Stolz des Dorfes, neben der eigenen Badi mit dem Naturschwimmbecken. Und die Mama war im Elternverein, sogar im Vorstand. Die hatten den Spielplatz gebaut und bauten ihn jedes Jahr weiter aus.
Und weil man bekanntlich das Sprechen beim Krabbeln und Laufen lernt, lernte er im Gegensatz zu seinem «Brüädsch» die richtige Sprache, nämlich «Bärndütsch» auf dem Spielplatz. Und weil nach dem Nasenstüber, den der Jona seinem Kollegen im «Chinsch» verpasst hatte, klar war in der Kinderszene des Dorfes, dass Kommentare über die Aussprache «bi dä Dütschä» unangebracht waren, klappte das bei ihm reibungslos mit dem «Bärndütsch» und der Integration. Man merkte ihm bald überhaupt nicht mehr an, dass er ein deutscher Junge war, auch zu Hause, am Küchentisch, wollte er «bärndütsch redä», zumal er auch dunkle Locken hatte wie ein Italiener – also wie die meisten Schweizer – und nicht so germanisch blond war, wie sein grosser Bruder, seine Mama oder die kleine Rosa.
Beim Papa-Glatzkopf liess sich die Haarfarbe nur raten, aber seinem kleinen Bärtchen unter der Unterlippe nach zu urteilen, müsste auch er eher der mittelmeerisch-ligurisch dunkle Typ gewesen sein.