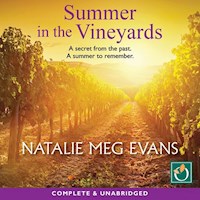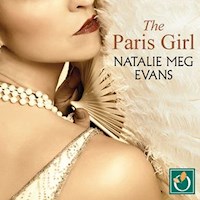5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine Hommage an die Haute Couture und an die Liebe
Paris in den 30er-Jahren: Die junge Telefonistin Alix Gower träumt davon, die glamouröse Welt der Haute Couture zu erobern. Der charmante und gut aussehende Paul verschafft ihr die Chance ihres Lebens – eine Anstellung in einem der berühmtesten Modehäuser der Stadt, allerdings mit dem Auftrag, die Frühjahrskollektion zu kopieren. Alix stimmt zu, ein doppeltes Spiel zu spielen. Dabei setzt sie nicht nur ihre Zukunft, sondern auch ihr Herz aufs Spiel ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 736
Ähnliche
DAS BUCH
Paris in den 30er Jahren. Die junge Telefonistin Alix Gower träumt davon, die glamouröse Welt der Haute Couture zu erobern. Der charmante und gutaussehende Paul verschafft ihr die Chance ihres Lebens – eine Anstellung bei Maison Javier, einem der berühmtesten Modehäuser der Stadt. Allerdings erhält sie sie nur, wenn sie die Frühjahrskollektion kopiert. Alix stimmt zu, ein doppeltes Spiel zu spielen. Dabei setzt sie nicht nur ihre Zukunft sondern auch ihr Herz aufs Spiel …
»Dieser Roman ist so glamourös wie die Mode, von der er erzählt.« The Lady
DIE AUTORIN
Natalie Meg Evans gab einst ihren Platz an der Kunstakademie auf, um einem Londoner Experimentiertheater beizutreten. Sie verbrachte dort fünf Jahre und schrieb in dieser Zeit auch eigene Theaterstücke und Sketche. Heute lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann im ländlichen Norden von Suffolk, umgeben von ihren Hunden und Pferden.
NATALIE MEG EVANS
DIE
Kleiderdiebin
ROMAN
Aus dem Englischen
von Stefanie Fahrner
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe THE DRESS THIEF
erschien 2014 bei Quercus, London
Vollständige deutsche Erstausgabe 10/2015
Copyright © 2014 by Natalie Meg Evans
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Angelika Lieke
Karte: © Natalie Meg Evans 2014
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-16182-8
www.heyne.de
Für Richard, der immer für mich da ist.
Prolog
Elsass, Ostfrankreich, 1903
Die dumpfen Schläge, die durch das Fachwerkhaus dröhnten, töteten einen Mann und stürzten einen anderen ins Verderben. Beim ersten Schlag krachte Metall gegen Knochen. Beim zweiten prallte der Kopf des Opfers gegen eine Ecke des Ofens.
Danach war alles still. Nur eine Staubwolke schwebte durch den Raum, und die Öllampe flackerte, weil sie fast leer war. Der junge Mann ließ die Eisenstange fallen. Er wollte, dass sich das Opfer zu seinen Füßen rührte, einen Ton von sich gab, aber Alfred Lutzmans Augen waren wie erstarrt in ihrer letzten Gefühlsregung. Das Porträt auf der Staffelei würde für immer unvollendet bleiben.
Er wollte weglaufen. Warum sollte er für einen Moment des Wahnsinns bezahlen, vielleicht sogar mit dem Leben? Ein erstickter Schrei hielt ihn an der Tür auf. Die Frau des Künstlers stand bewegungslos unter einem Oberlicht, auf dem sich der Schnee auftürmte. Das Blut, das ihre linke Schläfe hinabrann, schien sie gar nicht zu bemerken, wohl aber, dass er fliehen wollte. Sie sagte etwas auf Jiddisch, und ihre Stimme wurde schrill. Er unterbrach sie auf Deutsch – das war ihre gemeinsame Sprache. »Frau Lutzman, hören Sie mir zu. Das hier …« Er warf einen Blick auf den Toten und spürte Übelkeit in sich aufsteigen. »Das hier war ein schrecklicher Unfall.«
Sie flüsterte: »Nein, es war kein Unfall. Wir müssen zur Polizei.«
»Auf keinen Fall.« Sein Ton war so barsch wie der seines Vaters, wenn er mit Untergebenen zu tun hatte. »Sie würden uns vor Gericht stellen. Ich habe keine Angst davor, aber würden Sie ein Kreuzverhör durchstehen? Wissen Sie, welche Strafe auf Mord steht? Die Guillotine. Was würde aus Ihrem Kind werden? Wir müssen eine andere Lösung finden. Eine Geschichte, die den Verdacht von uns beiden ablenkt. Ich werde abstreiten, dass ich hier gewesen bin.«
»Und mich für alles zahlen lassen?«
»Wir sagen, dass sich Ihr Mann hierher zurückgezogen hat, um ein Bild fertig zu malen. Das stimmt ja auch. Sie waren … Sie waren in der Küche und bereiteten das Abendessen zu, und die Tür war geschlossen. Sie haben nichts gesehen und nichts gehört. Meinen Namen werden Sie nicht erwähnen, niemals.«
Danielle Lutzman starrte ihn an, und ihre Lippen formten tonlos seine letzten Worte. Im Winterlicht wirkte sie jünger, als er sie zuvor eingeschätzt hatte. Unter ihrem zerlumpten Kleid verbarg sich ein geschmeidiger Körper, und ihr schwarzes, glänzendes Haar ringelte sich unter ihrem Kopftuch hervor. Lag hinter der Verzweiflung ein Hauch von Verständnis in ihren Augen? Eine Ewigkeit verging, bis sie endlich nickte. »Ich habe nichts gesehen und nichts gehört.«
»Halten Sie sich daran, Frau Lutzman, und ich erledige den Rest. Erzählen Sie keiner Menschenseele, wie es gewesen ist. Schwören Sie mir das?«
Sie nickte, und er sah die Gelegenheit gekommen zu verschwinden. Der Geruch von Tod und Lampenöl war nicht mehr länger zu ertragen. Aber irgendetwas hinderte ihn daran, den ersten Schritt zu tun. Dann schlug unten eine Tür zu. Von Panik ergriffen starrten sie sich an.
»Mama, ich bin zu Hause«, erklang eine zarte Kinderstimme.
Danielle Lutzman keuchte. »Das ist Mathilda, meine Tochter. Lassen Sie sie nicht hier heraufkommen! Ich will nicht, dass sie das hier … Bitte, halten Sie sie auf!«
Er konnte sich nicht von der Stelle rühren.
»Mama, Papa, wo seid ihr?« Hölzerne Sohlen klapperten die Treppe herauf. »Ich bin früher nach Hause gekommen. Wir haben schneefrei. Papa, ich will dir eine von meinen Zeichnungen zeigen!«
»Halten Sie sie auf«, flehte Danielle.
Als er sich endlich wieder unter Kontrolle hatte, war es schon zu spät. Die Tür flog auf, und eine kleine Gestalt mit bunten Haarbändern und hüpfenden Zöpfen platzte ins Atelier.
• • • • •
I
• • • • •
1
Paris, 1937
Mathildas Tochter verließ das Gebäude der Telefonvermittlungsstelle. Sie trug ein dunkelgrünes Kostüm, das in seiner Strenge nicht ganz zu ihrer Jugend passte.
Ihr schräg aufgesetzter Trilby-Hut und ihre schwarzen Glacélederschuhe deuteten an, dass sie eine vermögende Dame war, genau wie die Seidenstrümpfe, die ihre schmalen Waden und zarten Knöchel betonten. Sie trug eine schwarze Handtasche und dazu passende Handschuhe. Als sie mit eiligen Schritten die Rue du Louvre entlangging, erntete sie so manchen bewundernden Blick – und gelegentlich auch ein anzügliches Lächeln.
Alix Gower zwang sich dazu, nicht zu reagieren. Achtzehn Monate in dieser Stadt hatten sie gelehrt, dass eine Dame von Stil niemals ein Lächeln erwiderte. Eiskalte Parisiennes betrachteten Bewunderung nämlich als etwas, das ihnen ohne jeden Zweifel zustand. Alix lernte gerade, nicht zu viel von sich selbst und ihren Wurzeln preiszugeben. Die lagen in London, wo sie die ersten achtzehn Jahre ihres Lebens verbracht hatte.
Auch ihr Vater stammte aus London; ein Mann der Arbeiterklasse, der den Krieg überlebt hatte, um dann an Tuberkulose zu sterben. Ihre Mutter, die Alix nie kennengelernt hatte, war eine elsässische Jüdin gewesen. Das Elsass, ein Landstrich, um den sich Frankreich und Deutschland seit Jahrhunderten stritten, brachte fatalistische Menschen hervor. Und Flüchtlinge.
Im Moment floh Alix gerade vor ihrer Schicht in der Vermittlungsstelle der Telefongesellschaft. Sie war im Begriff, etwas zu tun, das sie hinter Gitter bringen konnte, strahlte aber den Übermut einer Debütantin aus, die zur Bar des Ritz unterwegs war.
Auf der Rue Saint-Honoré ging sie etwas langsamer, denn sie liebte das schicke erste Arrondissement. Obwohl es schon Viertel vor fünf war und sie noch eine größere Strecke zurücklegen musste, betrachtete sie jedes einzelne Schaufenster, das auf dem Weg lag. Aber es waren nicht nur die Kleider, die sie so magisch anzogen. Ihr gefielen auch die Hoteleingänge mit den uniformierten Portiers, die gestutzten Bäumchen in ihren Töpfen, die kunstvollen Blumenarrangements. Und auch die Patisserien mit ihren glänzenden Tabletts voller Köstlichkeiten. Seit sie in Paris angekommen war, hatten sich ihre Sinne deutlich geschärft.
Es gab einen Laden an der Rue Staint-Honoré, dem sie einfach nicht widerstehen konnte. Die Patisserie Zollinger war ein Paradies aus edlen Pralinen; zu formvollendeten Pyramiden aufgetürmt standen sie im Fenster, gekrönt von Blattgold und kristallisierten Blumen. Am liebsten hatte sie die Pralinen mit Veilchencreme, denn das war die Lieblingssorte ihrer Mutter gewesen, und allein deswegen waren sie etwas ganz Besonderes.
Alles, was Alix über ihre Mutter wusste, hatte sie aus Erzählungen erfahren. Jedes einzelne Detail hatte sie sich gemerkt, und ob wirklich alles stimmte, war ihr dabei nicht so wichtig. Ganz sicher wusste sie jedenfalls, dass Mathilda mit neun Jahren nach London gekommen war und mit vierzehn die Schule verlassen hatte, um in einem Kaufhaus zu arbeiten, denn Alix besaß ihre Schulzeugnisse und ihre Abgangsbescheinigung. Und sie wusste auch, dass Mathilda im Krieg als Krankenschwester Dienst getan hatte. Es gab da nämlich ein Foto und ein Lehrbuch der Krankenpflege, die das bewiesen. Vermuten konnte sie dagegen nur, dass Mathildas Taillenmaß kaum mehr als 46 Zentimeter betragen hatte, weil sie einen dünnen Unterrock geerbt hatte, dessen Bund auf diese unfassbar winzige Größe eingestellt war. Die Kondolenzbriefe und Schleifen, die Alix’ Großmutter in einer Schachtel aufbewahrt hatte, verrieten ihr, dass Dutzende von Menschen Mathildas Beerdigung im Jahr 1916 beigewohnt hatten. Schließlich besaß sie noch das Hochzeitsfoto ihrer Eltern – ein Schnappschuss erstarrter Hoffnung. Den Rest hatte Alix sich einfach ausgedacht. Ihre Großmutter, die noch mehr Details zu der dürren Geschichte hätte beisteuern können, hüllte sich in Schweigen.
Alix zählte die Francs in ihrer Geldbörse und betrat die Patisserie. Nach einer am Umfang der Ausbeute gemessen absurd langen Zeit kam sie wieder heraus, in der Hand ein winziges Päckchen. Sie warf einen Blick auf die Uhr. Fünf nach fünf. Die Rue Saint-Honoré war lang, und sie hatte noch nicht einmal die noch exklusivere Rue du Faubourg Saint-Honoré erreicht. Dort befand sich nämlich ein selten wertvolles Stück in einem Schaufenster, und wenn sie sich nicht beeilte, hätte es vielleicht bereits jemand erstanden.
Den freien Nachmittag hatte sie sich teuer erkauft. »Mémé – ich meine, meine Großmutter – hat sich den Knöchel verstaucht und muss dringend zum Arzt«, hatte sie ihrer Vorgesetzten, Mademoiselle Boussac, erzählt. »Darf ich jetzt bitte freimachen, um sie zu begleiten?« Hinter dem Rücken hielt sie die Finger gekreuzt, um die Lüge abzumildern, aber die Vorgesetzte sah bloß ein bescheidenes, dunkelhaariges Mädchen, das demütig den Blick senkte. Ein Mädchen, das jünger wirkte als zwanzig, sich aber wie ein Mannequin kleidete und seine Arbeit ordentlich verrichtete. Das die englische Sprache beherrschte und deswegen für die Telefongesellschaft überaus wichtig war.
»Ich verstehe ja, wenn Sie jetzt Nein sagen …« Alix hob die dunklen Augen, in denen anscheinend die Verzweiflung geschrieben stand, denn Mademoiselle Boussac seufzte und sagte: »Na schön.« Alix durfte früher gehen, bekäme aber keinen Lohn für die Zeit, in der sie fehlte, und überhaupt dürfe so etwas nicht einreißen. »Die Firma kann nicht bei jedem Krankheitsfall in der Familie eine Ausnahme machen. Wenn Sie unzuverlässig werden, können wir Sie leicht ersetzen.«
Für Alix klang das wie ein Traum: Sie käme zur Arbeit, und in der Zwischenzeit hätte man sie ersetzt. Die heutige Erledigung war Teil eines Plans. Ein Schritt in eine Zukunft, in der es eine Wohnung an einem baumbestandenen Boulevard und die ungehinderte Verwirklichung ihrer eigenen Träume geben würde. Diese Träume waren schon einmal vorausgeflogen. Sie warteten auf sie im Haus Nummer 24 in der Rue du Faubourg Saint-Honoré.
»O nein!« Alix stampfte mit dem Fuß auf. Sie stand vor dem Haus mit der Nummer 24. Vor Hermès, dem Spezialisten für Leder und Seide. Das Objekt, für das sie gelogen und ihren kostbaren Lohn geopfert hatte, war noch immer am selben Platz – aber inzwischen durch den Henkel einer Handtasche gezogen worden, die wiederum an einem vorzüglich verarbeiteten Sattel lehnte. Sie musste es aber ausgebreitet sehen.
»Es« war ein Quadrat aus Seide, das erste Tuch, das aus der neuen Hermès-Fabrik in Lyon kam. Nun, soweit sie erkennen konnte, war es hauptsächlich weiß, und die Ränder waren von Hand gesäumt. Auf den Stoff waren Bäume gedruckt, oder vielleicht auch Büsche, und Wagenräder und Pferdeköpfe und vermutlich ein Mann mit Perücke. Sie sah an sich selbst herab. Würde sie es wagen, hineinzugehen und nach dem Tuch zu fragen?
Ihr Kostüm war zwar um Klassen besser als alles, was ihre Kolleginnen besaßen, aber es war noch lange nicht das, was man auf der Rue Faubourg Saint-Honoré trug. Was, wenn die Verkäuferin nur einen Blick auf sie warf und sie dann hinauskomplimentierte? Oder wenn sie gar ihre wahren Beweggründe erriet?
Das würde nicht passieren, versicherte sie sich selbst. Es war ja kein Verbrechen, etwas Neues und so Schönes anschauen zu wollen. Die Zeitschrift Marie Claire, deren neueste Ausgabe gerade erschienen war, verkündete, dass »das Selbstbewusstsein von innen kommt«. Leider galt das auch für Selbstzweifel und Magenbeschwerden.
Hinter ihr brummte ein Motor, und sie drehte sich um. Ein sandfarben glänzender Rolls-Royce hielt vor dem Geschäft. Ein Chauffeur stieg aus, zog sich die Lederhandschuhe glatt und öffnete die Fondtür.
Mit der Grazie einer Ballerina glitt eine Frau aus dem Auto. Keine Französin, befand Alix. Sie hatte schon viel über die gesellschaftlichen Regeln in Frankreich gelernt und wusste: Reiche Französinnen bändigten ihr Haar tagsüber. Aber die goldgelben Locken dieser Frau ringelten sich ungehindert unter ihrer Fuchspelzkappe hervor. Ihre Lippen waren nelkenrot, ihre Brauen geschwärzt. War sie ein Filmstar? Wer auch immer sie war – die Türen von Hermès öffneten sich bereits, als sie den Bürgersteig erst zur Hälfte überquert hatte.
Der Chauffeur zündete sich eine Zigarette an und blinzelte Alix zu. »Na Herzchen, machst du bloß einen Schaufensterbummel? Tja, ich auch.«
Alix warf ihm einen herablassenden Blick zu und folgte der Dame in den Laden.
»Mademoiselle?« Eine junge Verkäuferin – eine vendeuse – stellte sich ihr in den Weg. Alix spürte, wie das Mädchen im Geiste ihre Jacke auseinandernahm, den Schnitt beurteilte. Die Vendeuse suchte nach geheimen Zeichen des Wohlstands. Aber sie fand anscheinend keine, denn sie wiederholte in schärferem Tonfall: »Mademoiselle?«
»Handschuhe«, stieß Alix hervor. »Ich – ich hätte gern ein Paar Handschuhe.« Sie blickte in Richtung des Schaufensters, wagte aber nicht, sich dorthin zu bewegen.
»Handschuhe für das Frühjahr?«
»Äh, ja. Vielleicht in Braun?«
Braun fürs Frühjahr? Aber, aber. Die Vendeuse deutete auf einen Stuhl, der weit entfernt vom Schaufenster stand. »Wenn Mademoiselle mir bitte folgen würden.«
Die Dame aus dem Rolls-Royce wurde von einer älteren Vendeuse bedient. Alix hörte deutlich ihren amerikanischen Akzent, als sie auf Englisch ausrief: »Oho! Das ist also Mister Hermès’ neues Baby? Danach werden alle ganz verrückt sein! Hat es auch einen Namen?«
Alix lauschte. Sie sprachen über das Tuch.
Die Vendeuse entgegnete: »Monsieur Hermès hat es Jeu des omnibus et dames blanches genannt.«
»Donnerwetter, das müssen Sie mir übersetzen.«
»Madame, der Name bezieht sich auf das Omnibus-Spiel, das man im achtzehnten Jahrhundert spielte. Und auch auf die Dames Blanches, das waren die Pferdekutschen für die Menschen in den Städten. Die nannte man auch omnibus. Es ist ein kleines Wortspiel.«
»Nun, das ist leider zu hoch für mich«, sagte die Dame und hielt das Seidenquadrat gegen das Licht. »Aber ich kann es gar nicht erwarten, mir das Tuch umzubinden. Ist es mir wohl gestattet, so eine kostbare Kleinigkeit zu besitzen?«
»Für uns bei Hermès ist es eine Ehre, Madame Kilpin zu bedienen.«
Alix beugte sich hinüber. »Madame Kilpin« war sicher kein Filmstar, denn die nannten sich immer »Miss«. Genauso wenig war sie eine Diplomatengattin. Aber was war das? Alix’ Blick fiel auf eine flache Schachtel, die offen auf der Theke lag. Schlagartig wurde ihr klar, dass es noch mehr Exemplare des Tuchs gab. Natürlich gab es noch mehr! Sobald sich die Neuigkeit herumsprach, würden alle ein solches Tuch haben wollen. Umso wichtiger, dass sie sich jetzt alle Einzelheiten des Musters, alle Farben einprägte. Schwarz, dunkelorange, blau …
Das Motiv eines von Pferden gezogenen Omnibusses wiederholte sich in einem Doppelkreis. Alix zählte die Bilder und achtete auf deren Richtung. Im Zentrum befand sich ein umrahmtes Feld, in dem Damen und Herren des späten achtzehnten Jahrhunderts sich bei einem Spiel vergnügten. Sie zählte die Figuren und betrachtete deren Kleider und Frisuren. Ein sehr komplexes Muster.
»Und was wollen Sie von mir, Fräulein Stielauge?« Die Amerikanerin drehte sich zu Alix um. »Sie starren mich geradezu an.«
Alix stand auf. »Es tut mir leid, entschuldigen Sie bitte.« Sie floh aus dem Geschäft, hörte die Dame aber noch sagen: »Ich vermute, das war eine Journalistin, die den Zeitungen eine Geschichte über mich verkaufen will. Was für eine Dilettantin. Na ja, sie bekommt bestimmt ein Fleißkärtchen, weil sie sich solche Mühe gegeben hat.«
Die Sonne ging bereits unter, als Alix den Pont Marie über die Seine nahm und zum Quai d’Anjou hinunterging. Der befand sich auf der Île Saint-Louis, der kleineren der zwei Inseln, die das Zentrum des alten Paris gebildet hatten. Saint-Louis bestand aus herrschaftlichen Straßenzügen und bemoosten Ufern. Eines Tages würde sie in einer der baufälligen Villen hier wohnen, hatte Alix sich geschworen. Sie war schnell gelaufen, weil sie sich wegen des Vorfalls bei Hermès so schämte. Ein Fleißkärtchen …
Ihre Absätze klackten über das Kopfsteinpflaster, als sie auf einen rostigen holländischen Kahn zuging, der an einem Eisenring vertäut war. Das Boot hieß Katrijn, aber der Name war nach einer schon lange zurückliegenden Kollision nur noch bis zum »r« lesbar. Auf dem Boot wohnte ihr bester Freund. »Paul? Ich bin’s, Alix. Bist du da?«, rief sie.
Zwei identische blonde Köpfe tauchten aus der Steuerhaustür auf, und dann flitzten zwei kleine Mädchen in einfachen Baumwollkleidern zum Heck. Eine der beiden hielt eine kleine Violine mit Bogen in der Hand.
Alix begrüßte die Mädchen. »Lala, Suzy, ist euer Bruder zu Hause? Darf ich an Bord kommen?«
Lala, diejenige mit der Violine, sagte: »Psst! Er schläft. Er war heute schon um vier auf dem Markt.«
»Wart ihr denn heute in der Schule?«
»Teilweise. Ich hatte meine Geigenstunde, und Suzy war bei ihrer Sprechdame.«
»Du meinst ihre Sprachtherapeutin?« Alix lachte. »Bekomme ich ein Glas Wein? Ich verspreche, ich wecke Paul nicht auf.« Ihr brannten die Füße, und sie musste sich hinsetzen, um die Eindrücke in ihrem Kopf verarbeiten zu können. Die Mädchen ließen eine schmale Planke herunter, auf die Querhölzer genagelt waren, damit man nicht ins Rutschen kam. Als Alix es betrat, ermahnte sie sich selbst, nicht nach unten zu sehen, tat es dann aber doch – wie immer. Das Schicksal schien es regelmäßig so einzurichten, dass genau dann ein anderes Boot vorbeituckerte und die Katrijn zum Schwanken brachte, wenn sie gerade mitten auf der Planke stand. Sie würde nasse Füße bekommen. Die Schuhe konnte sie ausziehen, aber die Strümpfe hatten sie einen halben Wochenlohn gekostet.
Als sie ein Lachen hörte, sah sie auf. Eine starke Hand streckte sich ihr entgegen. Der dazugehörige Arm war gebräunt und unbekleidet. Genau wie der Oberkörper, von dem der Arm ausging. »Paul, du bist ja nackt!«, rief sie.
»Das darf ich doch wohl auch«, sagte Paul le Gal lachend und zeigte dabei seine kräftigen, unregelmäßigen Zähne. »Bist du hier, weil du mit mir ins Bett willst?«
»Sch! Die Mädchen hören uns!«
»Nein. Hör doch.«
Aus der Kombüse drang Gesang: Suzy bat Lala, eine Flasche Wein zu holen, und Lala bat Suzy, Gläser zu suchen. Suzy sprach nie, sang aber oft. Vor einem Jahr hatten die beiden ihre Mutter unter furchtbaren Umständen verloren. Sie erinnerten Alix ein bisschen an Entenküken, die im Kielwasser der Tragödie herumdümpelten. Sie schwammen und schwammen, weil sie sonst untergehen würden.
Paul half ihr über das Schandeck, fing sie in seinen Armen auf und küsste sie, während sie sich den Rost aus dem Rock strich. »Lass das. Ich bin zum Arbeiten hier. Ich habe das Muster im Kopf, aber ich muss es zu Papier bringen.«
»Ich habe geschlafen, aber ich habe dich im Traum gehört«, murmelte Paul, dessen Lippen noch immer auf ihren lagen. Er war erst zweiundzwanzig und damit kaum älter als sie, aber die Muskeln, die er sich bei der Arbeit als Kistenträger auf dem Gemüsemarkt antrainiert hatte, und die vom Rauchen raue Stimme ließen ihn älter erscheinen. Alix ließ zu, dass er sie küsste, obwohl das ihrer Beziehung nicht dienlich war. Sie waren Freunde und Geschäftspartner, und heute Abend ging es ums Geschäft.
Resolut schob sie ihn von sich. »Ich muss mich setzen, sonst vergesse ich, was ich mir gemerkt habe.«
Ein runder Tisch mit vier bunt zusammengewürfelten Stühlen füllte den Bug aus. Paul zog Alix einen Stuhl heran, zündete ihr die Laterne an und sah zu, wie sie ihr Skizzenbuch und ihre Buntstifte aus der Tasche holte. Jetzt saß er ganz ruhig da, und sein Gesicht wirkte direkt schön, trotz der Narben und der krummen, irgendwann einmal gebrochenen Nase. »Ich habe immer Angst, dass du bald einen reichen Mann findest und mich ganz vergisst«, sagte er.
»Vorhin habe ich eine reiche Frau gesehen«, erwiderte Alix. Suzy brachte mit unsicheren Schritten ein Tablett, das mit Weingläsern und einer Karaffe beladen war. »Sie trug Pelze, die farblich zu ihrem Auto passten.«
Mit der Ernsthaftigkeit eines Oberkellners schenkte Suzy den Wein aus, während Lala zwei Gläser Milch auf die alte Kabeltrommel stellte, die ihnen als Tisch diente. Paul, Lala und Suzy sahen schweigend zu, wie Alix zu skizzieren begann und dabei ein Blatt nach dem anderen verwarf. Sie versuchte, das Hermès-Tuch aus dem Gedächtnis nachzuzeichnen. Das Bild in ihrem Kopf war kristallklar, aber ihre Buntstifte wollten einfach nicht so wie sie. Langsam wurde es dunkel. Im Hôtel Lambert über ihnen gingen die Lichter an und projizierten goldene Spielkarten auf die Kaimauer. Am Ufer zur anderen Seite spiegelten sich die Lichter des Port de Célestins im Wasser. Alix’ Zuschauer wurden langsam unruhig, aber das machte ihr nichts aus. Schließlich saßen sie im selben Boot. Sie alle waren Überlebende. Lala beschützte Suzy und übte auf der Violine, damit sie eines Tages Straßenmusik für die Touristen machen konnte. Suzy, die sich auf eine Kiste stellen musste, weil sie so klein war, schnippelte jeden Abend sorgfältig das Gemüse fürs Abendessen. Paul arbeitete beinahe rund um die Uhr, um für alle Essen auf den Tisch bringen und den Mädchen den Schulbesuch ermöglichen zu können. Alix konnte die Traurigkeit der Kinder gut verstehen, war ihre eigene Mutter doch bei ihrer Geburt gestorben. Der Verlust musste noch viel schlimmer sein, wenn man die Mutter verlor, nachdem man sie sein Leben lang um sich gehabt hatte.
»Ach, das hätte ich fast vergessen!« Sie griff in ihre Handtasche und zog das Päckchen von Zollinger heraus. »Eine für jede, Mädchen.« Lala und Suzy starrten die Pralinen an, bis Alix ihnen lachend erlaubte, das Einwickelpapier abzustreifen.
»Darf ich wenigstens am Papier riechen?«, fragte Paul.
»Vier konnte ich mir leider nicht leisten. Weißt du übrigens, dass die Verkäuferinnen jede einzelne Praline ganz kunstvoll einwickeln? Das ist wirklich faszinierend. Nur war ich leider so ungeduldig, dass ich von einem Fuß auf den anderen gehüpft bin.« Paul wollte ihr antworten, doch Alix bat ihn zu schweigen. »Ich muss weitermachen.«
Sie arbeitete mit der gleichen konzentrierten Hingabe, mit der sich die Zwillinge ihren wunderbaren Pralinen widmeten. »Ich werde dieses verdammte Tuch schon irgendwie hinkriegen, und dann bekommen wir endlich Geld. Ein Fleißkärtchen? Eines Tages werden alle pelzbehangenen Damen in mein Geschäft kommen und darum betteln, einen meiner Entwürfe kaufen zu dürfen!«
2
Es war schon fast neun Uhr, als Alix ihr Skizzenbuch endlich zuklappte. »Ich muss los!«
Paul fuhr sie mit dem Fahrrad nach Hause und ließ sie dabei vor sich auf der Querstange sitzen. Alix wohnte am linken Ufer, in der Rue Saint-Sulpice im sechsten Arrondissement. Nachdem sie die Seine am Pont de Sully überquert hatten, rauschten sie den Boulevard Saint-Germain hinunter – mitten auf der Straße. Alix erschrak, als sie bemerkte, dass ein Paar Scheinwerfer auf sie zugerast kam. Kurz bevor sie die Nerven verlor, bog Paul in eine Seitenstraße ab, und dann lagen auch schon die Turmspitzen der Saint-Sulpice-Kirche vor ihnen.
»Paul, du kannst … aua!« Er war über einen Kanaldeckel gefahren. »Das letzte Stück laufe ich lieber.«
»Möchtest du nicht, dass ich dich noch das Treppenhaus hochfahre?«
»Sehr witzig. Dann würde Madame Rey herauskommen und dir den Wischmopp um die Ohren hauen.« Die Concierge von Alix’ Wohnhaus hielt eigentlich alles für eine Zumutung und benutzte ihren Mopp mehr zur Kriegsführung als zum Putzen. »Ich gehe lieber rauf, Mémé macht sich bestimmt schon Sorgen.« Sie trat einen Schritt zurück, weil sie ahnte, dass Paul sie umarmen wollte.
»Aber zwei Minuten mehr oder weniger machen doch keinen großen Unterschied.«
»Du kennst meine Großmutter nicht.«
Er stöhnte. »Warum darf ich mich nie richtig von dir verabschieden?«
Sie gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Sagst du mir Bescheid wegen der Hermès-Zeichnung? Meinst du, du kannst sie verkaufen?«
»Ich lege sie meiner Kontaktperson vor und halte uns die Daumen.« Das sagte er immer. Er nannte keine Namen und machte ihr keine Versprechungen. »Also dann, gute Nacht.«
»Gute Nacht. Beeil dich, damit du bald wieder bei den Mädchen bist.«
Sie sah zu, wie er ein paar geparkte Autos umkurvte und dann im Schatten der riesigen Kirche verschwand.
Die Tür zum Innenhof stand offen. Alix schloss sie leise und nahm einen unangenehmen Geruch wahr. Urin. In letzter Zeit wurde es immer schlimmer.
Kürzlich waren neue Mieter in die ehemaligen Waschhäuser hinter Alix’ Wohnhaus eingezogen. Manchmal versuchte sie, die Erwachsenen zu zählen. Es mussten mindestens fünf Familien sein, die sich in den Räumen drängten. Die anderen Bewohner beschwerten sich oft über die Essensgerüche und die klagenden Lieder der Neuankömmlinge. Alix fand sie interessant, hätte sich aber nie getraut, auf sie zuzugehen. Die Männer mit ihren Schnurrbärten betrachteten Alix fasziniert, und ihre schwarzhaarigen Frauen starrten sie unverhohlen an. Madame Rey bezeichnete sie als »ausländisches Ungeziefer«: »Die können nicht mal ein paar Worte auf Französisch, und sie geben sich auch nicht die geringste Mühe, etwas zu lernen.«
Alix beteiligte sich nie an diesen Lästereien. Wenn sie mit ihrer eigenen Familie nach Paris gekommen wäre, hätte sie ihr dürftiges Schulfranzösisch auch niemals verbessert. Nur, wenn man direkt ins kalte Wasser geworfen wurde, ohne einen einzigen Menschen, mit dem man sich in der Muttersprache unterhalten konnte, lernte man eine andere Sprache fließend sprechen. Für ihre Arbeit in der Telefonvermittlung musste sie korrekt Französisch sprechen; sie wusste nicht mehr, wann sie aufgehört hatte, herumzustottern und damit begonnen hatte, frei zu sprechen. Dank Paul hatte sie große Fortschritte gemacht, denn er verbesserte ihre Fehler, ohne sie zu tadeln, und er hatte ihr den Pariser Jargon und dazu noch einige Schimpfwörter beigebracht.
»Wenn du eine Sprache lernen willst, musst du dir einen Liebhaber zulegen.« Das war eins der ersten Dinge, die er zu ihr gesagt hatte – begleitet von einem schelmischen Grinsen.
Als Alix das Haus betrat, murmelte sie eine vertraute Beschwörungsformel: »Sechs Stockwerke Treppen, möge unsere nächste Wohnung einen Aufzug haben.« Vielleicht hatte die Großmutter ja noch gar nicht bemerkt, wie spät es war. Aber als Alix oben angekommen war, flog die Tür auf, und eine besorgte Stimme rief: »Wey ist mir! Aliki, hast du denn nicht bemerkt, dass die Sonne untergegangen ist und der Mond schon am Himmel steht? Ich habe mir Sorgen gemacht und gedacht, du bist umgebracht worden oder etwas noch Schlimmeres. Wo bist du gewesen?«
»Tut mir leid, Mémé. Ich habe die Zeit vergessen.« Zu Hause sprachen sie Englisch, oder eher das, was Alix als »Englisch à la Mémé« bezeichnete. Nur wenn die Großmutter aufgeregt war, verfiel sie manchmal ins Jiddsche.
»Setz dich an den Tisch. Ich bringe dir dein Essen. Du kannst mir erzählen, was dich aufgehalten hat, während du deine Suppe isst.«
In der kleinen Wohnung roch es überall nach Essen, wenn in der Küche gekocht wurde. Alix wusste daher sofort, dass es Zwiebelsuppe mit Thymian gab – aus Rinderbrühe gezaubert und mit einem Hauch Parmesan verfeinert.
Sie hängte ihre Sachen an die Garderobe und schlüpfte in eine dicke Strickjacke. In der Wohnung war es kühl. Die Kohle war im Mietpreis enthalten, und die zentrale Heizung sollte zweimal am Tag angefeuert werden, aber tatsächlich konnten sie froh sein, wenn das zweimal im Monat geschah. Im Winter mussten sie zusätzlich einen Petroleumofen benutzen, dem übel riechende Dämpfe entstiegen. Wenn sie sich über die Kälte beschwerten, behauptete Madame Rey immer, sie hätten die zugeteilte Menge an Kohle schon aufgebraucht, oder sie tat so, als spielte der Heizkessel verrückt. »Mein Sohn Fernand wird sich darum kümmern, wenn er kommt«, versprach sie jedes Mal. Doch Fernand ließ sich nie blicken. Sie betrog die Mieter, aber als Concierge hatte sie nun einmal die Macht im Haus. Sie war Auge und Ohr des Hausbesitzers.
Während Alix auf die Suppe wartete, blickte sie sich in der Wohnung um, und ihr wurde klar, dass die zehn Minuten bei Hermès ihre Vorstellung von Eleganz vollkommen umgekrempelt hatten. Die zweckdienliche Wohnstube wirkte auf einmal furchtbar trostlos. Das Linoleum war aufgeplatzt, und die Teppiche waren an manchen Stellen völlig durchgescheuert. Die Flecken an den Wänden erzählten traurige Geschichten vom Petroleum. Der einzige Lichtblick war eine kleine Sammlung von Gemälden des impressionistischen Malers Alfred Lutzman: Landschaften und Ansichten seines Heimatortes Kirchwiller im Elsass. Mémé hatte die Bilder aus der Zeit vor London gerettet. Lutzman war Mémés Ehemann gewesen – und Alix’ Großvater.
Alix hätte gern mehr über ihre Elsässer Wurzeln erfahren, aber wenn das Gespräch darauf kam, reagierte ihre Großmutter empfindlich. Sie murmelte immer bloß: »Ach, das waren schlimme Zeiten.« Dann wechselte sie das Thema oder wies Alix irgendeine Aufgabe zu. Aber das stachelte Alix bloß noch mehr an, Antworten auf diese wichtigen Fragen zu finden: wer und was sie eigentlich war.
Im September 1935 waren sie in Paris angekommen; Ausländer in einer von Unruhen und Arbeitslosigkeit geplagten Stadt. Es herrschte große Nervosität, weil die Deutschen direkt hinter der Grenze ihre Armee wiederaufbauten. Unnzählige Male wurde Alix nach ihrer Nationalität gefragt. Darauf gab es nur eine richtige Antwort: »Französisch«.
Aber sie war natürlich Engländerin. Und elsässisch-deutsch. Jüdisch, wenn auch nicht im religiösen Sinn. Genau betrachtet war sie französischer Herkunft, denn die Franzosen hatten das Elsass 1918 zurückerobert. Eine bunte Mischung also, doch sie konnte nicht mit einer spannenden Geschichte dazu aufwarten. Paris hatte ihre Unwissenheit ans Licht gebracht, und da ihre Großmutter ihr nicht weiterhalf, wollte sie sich an jemand anders wenden, um ihre Wissenslücken zu füllen. Sie hatte sich auf die Suche nach Raphael Bonnet gemacht.
Raphael Bonnet war einer von Tausenden Malern, die in Paris lebten. In Alix’ Augen war er jedoch etwas Besonderes, denn er war Schüler ihres Großvaters gewesen. Nach Alfred Lutzmans plötzlichem Tod hatte er Mémé und ihrer Tochter Mathilda bei ihrer Umsiedlung nach England geholfen – diese Episode in ihrem Leben bezeichnete Mémé immer als »Amputation ohne Betäubung«. Alix konnte sich vorstellen, wie wichtig Bonnet für einen so ängstlichen Menschen wie ihre Großmutter gewesen sein musste. Mémé sprach oft von ihm – dann kräuselte ein Lächeln ihre Lippen –, aber während der anderthalb Jahre, die sie nun schon in Paris wohnten, hatte sie sein Atelier im Montmartre noch nicht aufgesucht. Und Bonnet war auch nicht zu ihnen in die Wohnung gekommen.
Wenn Alix nach ihm fragte, erwiderte Mémé immer: »Er hat zu tun! Er arbeitet ständig an seiner nächsten Ausstellung – und wird natürlich nie fertig. Warum verschwendet er seine Zeit nicht mit uns?«
Ja, dachte Alix, das sollte er wirklich. Wenn Menschen sich gut verstanden, trafen sie sich zum Essen, gingen zusammen ins Museum oder spazierten durch den Park. Alix vermutete, dass Bonnet für ihre Großmutter einfach ein Stück Elsass war, das sie mit ins Exil nach England genommen hatte. Er war die Brücke zwischen der Heimat, die sie hatte aufgeben müssen, und dem neuen Ort, an dem sie immer eine Fremde bleiben würde. Als Bonnet zurück nach Frankreich ging, hatten sie die Freundschaft durch Briefe und Weihnachtskarten am Leben erhalten. Und als es in London langsam zu gefährlich wurde, orientierte Mémé sich als Erstes nach Paris, zu ihrem alten Freund. Wegen Bonnet war sie hergezogen, und jetzt ging sie ihm stur aus dem Weg. Vielleicht deswegen, weil so viele Jahre vergangen waren und sie sich beide verändert hatten?
Sie schrieben sich weiterhin Briefe. Mémé erlaubte Alix, seine Briefe zu lesen, was ihr dann jedes Mal große Lust machte, ihn kennenzulernen. Er klang respektlos und ein bisschen schelmisch. Wenn er die Leute aus seiner Umgebung beschrieb, war er sowohl erbarmungslos als auch sehr unterhaltsam. Außerdem machte er oft Andeutungen über die Vergangenheit im Elsass. Nur der Fluss und ein paar Arrondissements trennten sie voneinander. Und Paris war klein im Vergleich zu London. Es wäre geradezu fahrlässig, ihn nicht zu suchen, oder?
So überquerte Alix eines Nachmittags den Fluss und arbeitete sich nach Norden vor, entlang der großen Boulevards, bis die Straßen immer kleiner und enger wurden und bergauf führten: hinauf auf den Hügel, die Butte de Montmartre. In einem Tabakladen fragte sie nach Monsieur Bonnet, dem Künstler, und wurde zur Place du Tertre geschickt, zu einem Café im Schatten einer Akazie. Der Informant hatte gegrummelt: »Grauer Bart, Farbe auf der Jacke. Gehen Sie zur Bar. Da sitzt er und sichert dem Barkeeper sein Auskommen.«
Sie entdeckte einen stämmigen Mann mit Bart, auf den die Beschreibung passte. Als sie ihm ihren Namen nannte, blinzelte er ein paar Sekunden lang verwirrt und umarmte sie dann herzlich.
»Alix? Danielles Enkeltochter? Mathildas Mädchen? Mon dieu, wie könnte es anders sein? In Ihnen wird Mathilda wieder lebendig, und in Ihren Augen sehe ich den alten Mann!« Bonnet forderte erst seine Freunde, dann die ganze Bar dazu auf, Alix zu begrüßen. »Hört her! Alfred Lutzman hat in diesem wunderbaren Mädchen endlich seine spirituelle Heimat gefunden. Lasst uns auf dieses Wunder trinken!«
Ein Freund, eine Vergangenheit, eine Identität – alles auf einmal. Raphael Bonnet erzählte ihr in einer einzigen Stunde mehr über das Elsass und ihre Familie, als Mémé es je getan hatte. Aber er machte sie auch mit dem Rotwein bekannt, und mit einer munteren Truppe aus Künstlermodellen, Revuegirls, Musikern und jenen, die er als »Künstler des Glases« bezeichnete, denTrinkern. Bonnet erzählte, er habe sie in ihrer Wohnung in Saint-Sulpice besuchen wollen, doch Alix’ Großmutter hätte es verboten. »Sie hält mich für keinen guten Umgang, und da hat sie wohl recht.« Er deutete auf eine Menschentraube, die sich um das Klavier gebildet hatte. Dort hämmerte ein Afrikaner gerade einen Jazzsong in die Tasten. »Meinen Geschmack findet sie schockierend, und meine Freunde sind zu laut. Außerdem weiß ich zu viel. Ihre Großmutter möchte die Vergangenheit ruhen lassen. Darum sollten wir uns jetzt vielleicht besser wieder voneinander verabschieden.«
Doch Alix wollte mit Bonnet befreundet sein. Sie wollte mehr als nur eine Kostprobe dieses berauschenden Künstlerlebens. »Jetzt, wo ich Sie gefunden habe, gebe ich Sie nicht mehr auf, Monsieur Bonnet«, hatte sie ihm gesagt. Sie trafen sich noch immer mindestens einmal im Monat. Mémé ahnte nichts davon, dafür sorgte Alix.
Je mehr Bonnet trank, desto mehr erzählte er ihr. Bei einer Karaffe Beaujolais erfuhr Alix, dass Alfred Lutzman nicht im Bett gestorben war – er war ermordet worden.
»Aber warum? Und von wem?«
Bonnet antwortete ausweichend. Es sei ein überraschender Angriff gewesen. Einbrecher seien in das Haus eingestiegen und vermutlich gestört worden. »Fragen Sie lieber nicht weiter nach. Das würde Ihrer Großmutter nicht gefallen.«
Nein, wahrscheinlich nicht – hatte Mémé doch immer behauptet, Alfred sei im Schlaf gestorben, an einem Herzinfarkt. Alix versuchte, mehr aus Bonnet herauszubekommen, aber es war schwierig, ihn bei einem Thema zu halten. Mit seinen Anekdoten, die manchmal auch etwas Zotiges hatten, schweifte er ständig ins Reich der Fantasie ab, und dieselbe Geschichte veränderte sich mit jedem erneuten Erzählen. Er sprang wild über die Jahrzehnte und ratterte immer neue Namen herunter. Nach ein oder zwei Flaschen versuchte Bonnet immer, Alix anzupumpen. Aber sie mochte ihn trotzdem gern. Er hörte ihr nämlich wirklich zu und tat nicht bloß so. Er war auch absolut ihrer Meinung, dass Alfred Lutzman, hätte er länger gelebt, einer der bedeutendsten Künstler seiner Generation geworden wäre. Bonnet behauptete, Lutzman sei der damals größte Meister in der Darstellung menschlicher Haut gewesen. Von den Gemälden in Alix’ Wohnung zeigte nur eins ein menschliches Sujet, ein lächelndes Mädchen, dessen schwarze Zöpfe mit einer Haube aus steifer elsässischer Spitze gekrönt waren. Das Bild hieß Mathilda und war Alix das liebste von allen.
Mémé holte Alix aus ihrem Tagtraum, als sie eine dampfende Schüssel vor sie hinstellte und sich zu ihrer Enkelin an den Tisch setzte. Im Licht der Lampe über dem Esstisch sah Alix, dass ihrer Großmutter Tränen über die Wangen liefen. Fast hätte sie die Hand nach ihr ausgestreckt, doch sie beherrschte sich. Bei Mémé musste man den richtigen Moment abwarten, wenn man eine wichtige Frage stellen wollte. Mit einem Kopfnicken deutete sie auf den Arbeitstisch nebenan, auf dem hauchdünne Seide und Garnrollen lagen. »Ist das die Stickerei für Maison Javier? Die geben dir ja ständig neue Aufträge. Du musst ganz erschöpft sein.«
»Es ist harte Arbeit, aber ich kenne es ja nicht anders«, erwiderte Mémé. »Iss deine Suppe auf. Setz dich näher an den Tisch, oder willst du Flecken auf deinem Rock? Wie ist das Brot? Hart, oder?«
»Es schmeckt gut, wenn ich es eintunke. Schattenstickerei heißt das, wenn man auf der Rückseite des Stoffs arbeitet, nicht?« Alix legte den Löffel auf den Tisch. »Mémé?« Eine Träne kullerte der Großmutter aus dem Auge. Mémé puderte sich morgens und abends sorgfältig das Gesicht, um die Altersflecken abzudecken, aber jetzt war der Puder verschmiert, und die Narbe über ihrer linken Augenbraue stach weiß hervor. »Hast du dich so aufgeregt, weil ich nicht nach Hause gekommen bin?«
»Ich habe mir den ganzen Tag über Sorgen gemacht.«
»Meinetwegen?«
»Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass die Juden in Deutschland immer schlechter behandelt werden. Ich hatte Cousinen und Cousins dort. Was wird jetzt aus ihren Familien? Und dieser Bürgerkrieg in Spanien – wie viele Menschen müssen noch sterben, bis jemand eingreift? Und dann auch noch das mit dir. Den ganzen Abend über bist du nicht nach Hause gekommen. Bist du aufgehalten worden?«
Alix wollte gerade antworten, dass Mademoiselle Boussac sie gebeten hatte, ein neues Mädchen einzuarbeiten, aber da wurde ihr bewusst, dass sie schon zwanzig Jahre alt war, zu alt für Lügen oder Ausflüchte. »Ich habe mich mit Paul le Gal getroffen. Auf seinem Boot haben wir zusammen ein Glas Wein getrunken, da habe ich wohl einfach die Zeit vergessen.«
»Le Gal, der mit dieser schrecklichen Mutter? Du warst ganz allein mit diesem Schlachthauskerl?«
»Seine Schwestern waren auch dabei. Und er arbeitet nicht mehr im Schlachthaus, Großmutter.« Den Kosenamen »Mémé« brachte Alix in diesem Moment nicht über die Lippen. »Er arbeitet in Les Halles und lädt dort Obst und Gemüse ab.«
»So, so. Ganz allein mit einem Kistenträger, dessen Mutter ihren Lebensunterhalt auf der Straße verdient hat.«
»Das ist nicht wahr. Sylvie le Gal war niemals … das, was du andeutest. Ihr Geschäft ist pleitegegangen, das ist alles.« Alix hielt immer fest zu Sylvie, die ihr mit ihrem Lächeln über die ersten harten Wochen der Unsicherheit in Paris hinweggeholfen hatte.
Alix war auf dem Weg zu einem Einstellungsgespräch auf dem Boulevard Haussmann gewesen und hatte die Métrolinien durcheinandergebracht. Darum war sie kilometerweit von ihrem Ziel entfernt gelandet, bei der Place de la Bastille. Sie war den Tränen nahe – es war schon das sechste fehlgeschlagene Einstellungsgespräch in jener Woche gewesen. Auf der Suche nach Orientierung lief sie die Avenue mit erhobenem Kopf entlang – irgendwo musste doch ein Straßenschild sein. Deswegen stolperte sie prompt über eine Werbetafel mit der Aufschrift: »Lernen Sie Tango tanzen in nur zehn Wochen«. Ein blonder Kopf tauchte aus einem Fenster über ihr auf. »Weil Sie über mein Schild gefallen sind, bekommen Sie die erste Stunde gratis!«
Wie Bonnet war Sylvie ein freier Geist gewesen. Ihre Röcke waren zu eng, ihre Ausschnitte zu tief, aber sie war einer der seltenen Menschen, die Männer und Frauen gleichermaßen liebten. Sie regte sich nie auf, wenn man die Tanzschritte vermasselte, sondern verlangsamte einfach das Tempo. Am Ende jedoch musste sie ihre Schule schließen. Sie hatte Schulden und musste zwei Mädchen durchbringen, darum nahm sie halbseidene Engagements als Tänzerin bei balles musettes und in den Nachtklubs von Pigalle an. Paul erzählte, dass sie mit den Männern tanzte und manchmal auch … Schließlich sprang Sylvie von einer Brücke. Alix war bestürzt, weil die fröhliche Frau und ein Tod im eiskalten schwarzen Wasser in ihrem Kopf einfach nicht zusammenpassten. »Pauls Schwestern wollten, dass ich noch dableibe«, berichtete sie Mémé. »Sie vermissen ihre Mutter so sehr.«
Doch Danielle Lutzman war noch nicht bereit, klein beizugeben. »Was will dieser Paul denn machen, wenn die Mädchen erst größer sind und eine von beiden nicht spricht? Wie will er diesem Mädchen etwas über das Leben beibringen, wenn sie nicht redet?«
»Er wird es schon irgendwie schaffen. Die Leute sagen ihm dauernd, er soll die beiden ins Waisenhaus geben. Aber dann hätte der Fluss am Ende doch gewonnen.«
»Unsinn.« Mémé dehnte die Finger. Weil die feinen Näharbeiten ihre Spezialität waren, pflegte sie ihre Hände mit Paraffincreme und leistete sich von ihrem geringen Lohn eine Aufwartefrau, die in der Wohnung die groben Arbeiten erledigte. Und trotzdem sahen ihre Fingerknöchel aus, als wollten sie sich durch die Haut bohren. »Ich würde sie ja auch nicht zu den Nonnen geben«, räumte sie ein. »Als ich jung war, habe ich in der Spitzenfabrik in Straßburg gearbeitet. Dort besuchten uns die Nonnen ab und zu, aber nach den Jüdinnen haben sie nie gefragt. Sie haben sich immer bloß um die katholischen Jungfrauen gekümmert.« Mémé hielt kurz inne und fuhr dann fort: »Du hast eine gute Stellung in der Telefonvermittlung, du bekommst jeden Monat deinen Lohn. Vielleicht wirst du bald Dienstleiterin und findest einen Mann, der gute Anzüge zur Arbeit trägt und ein Haus in einem netten Vorort hat. Warum willst du dich bloß mit diesem Jungen vom Markt in Schwierigkeiten bringen?«
»Paul und ich sind doch nur befreundet.«
»So! Im Dunkeln zusammen Wein trinken, das macht man also, wenn man ›nur befreundet‹ ist?«
»Heute ist das anders als früher.«
»Manche Dinge ändern sich nie. Die Männer benehmen sich wie Schürzenjäger, die Mädchen geraten in andere Umstände, und dann ist das Leben ruiniert. Du bist alles, was ich habe, Aliki. Ich will, dass du gut auf dich aufpasst.«
Alix war kurz davor, ihrer Großmutter den Besuch bei Hermès zu gestehen. Im Kopf hatte sie sich schon die richtigen Worte zurechtgelegt: Ich will mein Leben nicht bei der Telefonvermittlung verbringen. »Ich verbinde Sie, mein Herr, einen Augenblick, bitte.« Ich will keinen Mann im langweiligen Anzug heiraten. Ich will das Modehandwerk erlernen und mein eigenes Atelier gründen. Ich will die neue Chanel, Vionnet, Jeanne Lanvin werden und ein Geschäft im ersten Arrondissement eröffnen. Doch ein Blick zum Nähtisch verriet ihr, dass ihre Worte auf taube Ohren stoßen würden. Deshalb sagte sie bloß: »Ich will ins Schneiderhandwerk.«
»So, so, du willst also sechzehn Stunden am Tag arbeiten und Hände wie Klauen bekommen?« Mémé hielt ihre krummen Finger in die Höhe. »Glaub mir, Aliki, wenn du dich für dieses Handwerk entscheidest, kannst du dein Leben gleich beim Roulette aufs Spiel setzen.«
3
Sie sollte auf sich aufpassen. Ach, Mémé hatte gut reden. Auf dem Weg zu Paul ging Alix durch den Jardin du Luxembourg und dachte über die Worte ihrer Großmutter nach. Sie hatte die Hände tief in den Taschen vergraben und hielt den Kopf gesenkt, um dem eisigen Wind nicht zu viel Angriffsfläche zu bieten. Als Mémé angekündigt hatte, dass sie nach Paris ziehen würden, hatte sie jedenfalls keine besondere Vorsicht an den Tag gelegt.
An einem Tag im Juli 1935 hatten sie am Küchentisch in ihrer Wohnung im Süden Londons gesessen. Es war drückend heiß, und durchs offene Fenster drang der Lärm der Straßenhändler. Alix genoss ihren einzigen freien Nachmittag im Monat; sie arbeitete im Kaufhaus Arding & Hobbs, wo sie gleich nach der Schule angefangen hatte. Eigentlich hatte sie vorgehabt, nach Clapham Common zu fahren und dort eine Skizze für ihre Mappe anzufertigen. Ihr geheimer Wunsch war damals nämlich, auf die Kunsthochschule zu gehen. Zuerst würde sie Abendkurse belegen und später auch tagsüber zeichnen – wenn sie es sich leisten konnte. Und dann würde ihr irgendwie der Sprung zur Modeschöpferin gelingen. Doch wie sollte sie das schaffen, wenn Mémé verlangte, dass sie an ihrem freien Nachmittag zu Hause blieb und einen Eimer Bohnen putzte?
Während Alix den Bohnen also die Fäden abzog und Mémé sie durchschnitt, verkündete die Großmutter: »Ich möchte, dass wir nach Paris ziehen.«
Alix lachte, ohne aufzusehen.
»Ich meine es ernst, Aliki. Ich kann London nicht mehr ertragen.«
»Warum ausgerechnet Paris?«
Mémé fuchtelte mit dem Gemüsemesser. »Neulich habe ich ein paar Spitzenkrägen in einen Laden am Portman Square gebracht. Stunden habe ich für die Arbeit gebraucht! Aber die Einkäuferin – so eine dumme Kuh – patscht an den Krägen herum, als hätte sie Salatköpfe in der Hand!«
»Was hat das denn mit Paris zu tun?«
»In Paris bekommen solche Mädchen keine Stellung als Einkäuferin. In Paris verkaufen solche Mädchen Salatköpfe. Ich weiß, dass ich in Paris glücklich sein werde.«
»Das glaube ich nicht. Da kennst du doch niemanden.«
»Doch, meinen Freund Bonnet.« Mémé verstummte plötzlich, wie überrascht von den eigenen Worten. Bevor Alix aber nachfragen konnte, setzte Mémé hinzu: »Er wohnt in einem schrecklichen Viertel und hat einen ganz anderen Tagesrhythmus, da werden wir ihn nicht treffen können. Ich wollte eigentlich sagen, dass das halbe Elsass in Paris lebt. Ich werde Leute kennenlernen, die aussehen und sprechen wie ich.«
»Aber ich werde keine Menschenseele kennen.«
»Was macht das denn für einen Unterschied? Hier kommen doch auch niemals Schulfreundinnen zu Besuch.«
»Weil sie alle aufs Internat in die Schweiz geschickt worden sind.« In Gedanken fügte Alix hinzu: Ich hatte noch nie Schulfreundinnen, jedenfalls keine, die mich hier besuchen würden. »Und was ist mit meiner Arbeit?«, fragte sie laut. »Letzten Monat habe ich eine gute Beurteilung bekommen, und in der Seidenabteilung wird bald eine interessante Stelle frei.«
»In Paris kannst du aus fünfzig Seidenabteilungen auswählen.«
Nach und nach kam dann die Wahrheit ans Licht: Mémés Wunsch hatte rein gar nichts mit den dummen Kühen aus der Einkaufsabteilung zu tun. Sie hatte vielmehr Angst vor dem immer judenfeindlicheren Klima in London. Zu Alix sagte sie: »Während du weit weg auf deiner Landschule warst, haben Oswald Mosleys blackshirts Unterricht bei Hitler genommen. Im East End werden jetzt Juden überfallen. London ist nicht mehr sicher.«
»Diese Blackshirt-Faschisten unterstützt doch kein vernünftiger Mensch.«
Aber Mémé ließ sich nicht von ihrer Überzeugung abbringen. In ihrer Vorstellung war London zu einer Nazi-Brutstätte geworden, in der Scheiben eingeschlagen und Menschen überfallen wurden. Mémé war schon immer ein schmales Persönchen gewesen, aber als die Augusthitze kam, wurde sie geradezu dürr. Da gab Alix nach. Sie reichte ihre Kündigung ein und verbrachte den August damit, die nötigen Reisedokumente zu organisieren. Sie verkaufte die Möbel und besorgte sich in der französischen Botschaft die Adressen einiger Wohnungsvermittler. Als die Blätter von den Bäumen fielen, saßen sie im Zug nach Dover auf dem Weg zur Fähre, und ihre Haushaltsgegenstände reisten wohlverpackt als Fracht hinterher. Alix gewöhnte sich langsam an den Gedanken an die neue Zukunft.
In Paris bekam Mémé ab und zu Aufträge von einem Stickatelier, wurde aber schlechter bezahlt als in London. Das war ein Schock: wie wenig man verdiente, wenn man für die Pariser Luxusindustrie arbeitete. Ein weiterer Schock war die Erkenntnis, dass man sechs Monatsmieten im Voraus zahlen musste, für eine winzige Wohnung im sechsten Stock, ohne warmes Wasser. Alix lief sich die Schuhsohlen ab auf der Suche nach Arbeit, aber entweder fehlte es an der behördlichen Erlaubnis, oder ihr Französisch war nicht gut genug, oder sie stand ganz hinten in der Schlange, die für »französische Staatsbürger« reserviert war.
Als ihre finanzielle Lage schon fast katastrophal war, bekam Alix die Stellung in der Telefonvermittlung. Auf diesen Glücksfall folgte ein weiterer, nämlich die Begegnung mit Sylvie le Gal und ihrem Sohn Paul. Sylvie lehrte Alix Foxtrott, Shimmy und Tango, und Paul führte sie in die Welt der Modepiraterie ein und verbesserte ihr Französisch. Jede Skizze, die Alix von einem Couture-Modell anfertigte, bevor es auf den Markt kam, verschaffte ihnen zweihundert Francs auf dem Schwarzmarkt. Sie und Paul teilten sich das Geld, und Alix hielt damit den Gerichtsvollzieher fern. Mémé jedoch ahnte nichts von alldem.
Wo war Paul bloß? Normalerweise verspätete er sich nicht. Alix nahm die verbotene Abkürzung über die Grasfläche. Wenn der Parkaufseher sie auf dem heiligen Rasen entdeckte, würde er in seine Trillerpfeife blasen. Paul wartete immer bei der Statue des Löwen, der seinen stolzen Bauch in den Rauch von Pauls Gauloises streckte. Fast eine Woche war vergangen, seit Alix auf der Katrijn vorbeigeschaut hatte – das bedeutete, er hatte länger gebraucht als üblich, um die Hermès-Skizze zu verkaufen. Das bereitete ihr Sorgen. Paris war voll von Frauen, die in jeder Saison um die aktuellen Kollektionen herumschwärmten und Zeichnungen davon anfertigten. Der März war ein ruhiger Monat, denn die Frühjahrs- und Sommerkollektionen waren bereits Geschichte. Im April gab es noch mal eine kurze Aufregung, wenn die Stücke der Zwischensaison lanciert wurden, und dann kam lange nichts, bis Ende Juli die Winterkollektionen gezeigt wurden und alle wieder verrücktspielten. Aber auch in ruhigeren Monaten durfte man nicht nachlassen. Wenn man es ernst meinte, musste man die Erste sein, die ihre Skizzen nach New York schickte.
Plötzlich tauchte die ihr bekannte Gestalt in einer Seemannsjacke hinter dem Sockel des Löwen auf. Alix rannte ihr entgegen. »Paul, du hast dich vor mir versteckt!«
»Ich bin bloß in Deckung gegangen, ich wusste nicht, dass du schon da bist. Du siehst aus wie eine frierende Prinzessin.« Sie tauschten Wangenküsse zur Begrüßung. »Dein Mantel gefällt mir.«
»Vom Flohmarkt«, entgegnete sie und drehte sich einmal um die eigene Achse, damit er die schwarzen Kaschmirschöße bewundern konnte. »Rue des Rosiers.« Vielleicht kein Original-Schiaparelli, aber eine gute Kopie eines bestimmten Stücks aus der Frühjahrskollektion der Italienerin. Der Mantel hatte einen Gürtel und war ursprünglich knöchellang gewesen, aber Alix hatte ihn gekürzt und Rosen auf den Kragen gestickt – jetzt war er ein Original von Alix Gower. »Sollen wir einen Kaffee trinken gehen?« Alix fand, dass Paul irgendwie angespannt aussah. »Hast du einen harten Tag gehabt?«
»Auch nicht härter als sonst.«
Sie bohrte nicht nach. »Wer passt auf die Mädchen auf?«
»Francine ist da. Komm, wir spazieren ein bisschen herum wie die Verliebten, die wir nicht sind. Hast du einen guten Arbeitstag gehabt?«
Im reinsten Englisch antwortete sie: »I’m sorry, sir, I cannot place your call as there is washing on the line.« Auf Französisch fuhr sie fort: »Was ist denn? Du bist ganz rot im Gesicht.«
»Ich verstehe diese verdammte Sprache einfach nicht. Das weißt du doch.« Seine grünen Augen flackerten ärgerlich. Paul war blondwie seine Schwestern und hatte ein typisch nordfranzösisches, grob geschnittenes Gesicht. Und er war sehr empfindlich.
»Ich hatte einfach Glück, dass mir jemand den Schulbesuch bezahlt hat«, sagte sie besänftigend. »Und du weißt, wie wichtig das Lernen ist, sonst würdest du dich nicht so abrackern, um deinen Schwestern Extraunterricht zu ermöglichen. Wenn Lala eines Tages in der Pariser Opéra oder der Mailänder Scala Violine spielt, ist das auch dein Verdienst.«
Sie schlenderten durch das menschenleere Quartier Latin. Im Park war es einsam, denn die Kinder und ihre Kindermädchen waren schon längst verschwunden. Die Schriftsteller und Studenten dagegen hielten sich in ihren Cafés auf. Einmal blieb Paul stehen, um sich eine Gauloise anzuzünden. Mit den Händen schützte er die Flamme, bis die Zigarette endlich brannte. Dann nahm er einen tiefen Zug, die Augen auf den Boden gerichtet.
»Jetzt sag’s mir endlich, bevor ich vor Neugier platze«, forderte Alix. »Wie viel hast du für die Hermès-Zeichnung gekriegt?«
Paul stieß eine Rauchwolke aus. »Nichts. Meine Kontaktperson konnte nichts damit anfangen. Die Skizze war nicht detailliert genug.«
»Nicht detailliert genug?« Zu Alix’ Enttäuschung gesellte sich die Angst. Wenn diese Einkommensquelle versiegen würde … Sie wollte nicht daran denken. »Zeig mir irgendjemanden in Paris, der so ein gutes Gedächtnis für Einzelheiten hat wie ich!«
»Niemand zweifelt an dir, Alix. Ich jedenfalls nicht. Aber darum geht es nicht. Sie brauchen das Original.«
»Ein halber Tageslohn beim Teufel! Was erwartet deine Kontaktperson eigentlich? Wenn jemand mir das Geld gibt, kaufe ich das Tuch.«
»Da ist dir wahrscheinlich schon jemand zuvorgekommen. Und das gute Stück ist sicher schon auf dem Weg nach New York, wo es als Blaupause für zehntausend Fälschungen im Monat dient. Tut mir leid, Alix. Ich hätte das Geld auch gebraucht.«
»Sie hätten mit meiner Zeichnung gut arbeiten können.«
»Sie meinte, es geht nicht.«
»Sie? Deine Kontaktperson ist eine Frau?«
»Hör jetzt auf.« Er versuchte ein Lächeln, brachte aber nur eine Grimasse hervor. Er hielt Alix fern von seinen »Kontaktpersonen« und den Hinterzimmern der Bars, in denen er seine Geschäfte abwickelte. Paul hatte schon auf dem Schwarzmarkt gehandelt, als er gerade alt genug gewesen war, um vor Polizisten davonzulaufen, aber Alix war zu unschuldig für diese Welt, fand er. »Du lächelst Polizisten an«, hatte er sie geneckt. »Das ist das erste Zeichen des Wahnsinns.«
Jetzt aber zuckte er mit den Schultern. »So ist das Leben.« Als sie stehen blieb und ihn ansah, deutete er ihre Absicht falsch und zog sie zu sich heran. »Ich will nicht, dass du dein Leben mit Stehlen verschwendest.«
Ihre Lippen trafen sich in einem sanften Kuss. Alix legte den Kopf in den Nacken und erwiderte: »Ich stehle nicht.«
»Na schön, du zeichnest ab. Dank Menschen wie dir bekommen die New Yorker Damen die Pariser Originale zur selben Zeit wie die Französinnen. Du leistest einen Dienst an der Gesellschaft, stimmt’s?«
»Stimmt. Jede Frau bekommt, was sie sich wünscht.«
»Bis auf die Modeschöpferinnen, die die Sachen entwerfen. Die würden dich am liebsten aufhängen.«
»Du hast mich da reingezogen«, erinnerte sie ihn. »Wir haben uns erst eine Woche gekannt, da hast du mich beim Pferderennen in Longchamps eingeschleust, damit ich mir die Kleider der feinen Damen einpräge. Du hast mir gesagt, du hättest einen Freund, der Zeichnungen an ein New Yorker Magazin verkauft, für einen Dollar pro Stück. Du hast mich verführt.«
»Ich weiß. Ach, Alix, ich wünschte, ich wäre nicht so abhängig von dir.« Paul küsste sie gierig, und Alix wand sich aus seiner Umarmung. Er hatte kein Recht dazu. Aber dann merkte sie, dass es ihr eigentlich doch gefiel. Sie mochte den leichten Druck seiner Lippen, das sanfte Kratzen seiner Bartstoppeln auf ihrer Haut. Selbst der Geschmack seiner Gauloises konnte dem guten Gefühl nichts anhaben.
»Willst du mir jetzt etwa sagen, wir können so nicht weitermachen?«
»Wer sorgt für meine Schwestern und für deine Großmutter, wenn wir geschnappt werden?« Er seufzte. »Ja, das will ich damit sagen. Jetzt ist Schluss.«
»Aber du hast noch einen Auftrag in petto?«, riet sie. Paul konnte einfach nicht lügen.
Er stöhnte auf. »Du wirst mir den Kopf abreißen.«
Sie zog ihn am Ärmel, küsste ihn erst zurückhaltend, dann provozierend. »Sag mir, was es ist, dann entscheide ich, ob ich es mache.«
Und Paul erzählte es ihr.
Alix schwirrte der Kopf.
»Wir stehlen die Frühjahrs- und Sommerkollektion 1937 von Maison Javier, einem Modeatelier an der Rue de la Trémoille, ganz in der Nähe der Champs-Élysées. Wir stehlen von dem Haus, für das Mémé gerade arbeitet … die gesamte Kollektion?«
Paul nickte. »Meine Kontaktperson will alles, jede einzelne Rüsche und Schnalle.«
»Unmöglich.«
»Habe ich ihr auch gesagt.« Paul nahm ihr Handgelenk, um einen Blick auf ihre Armbanduhr zu werfen. Sie hatten sich in ein Café gesetzt und billigen Wein bestellt, waren aber beide unter Zeitdruck, weil zu Hause jemand auf sie wartete. »Die Leute in Amerika sind ganz verrückt nach diesem Javier. Das ist wegen dieser Amerikanerin, die mit dem englischen König geschlafen hat.«
»Mrs. Simpson trägt Javier?« Alix dachte einen Moment nach und nickte dann. »Vielleicht sieht sie deswegen auf allen Fotos so groß gewachsen aus. Javier streckt alle Frauen in die Länge, bis sie aussehen wie eine Zuckerstange.«
Paul zuckte ungeduldig mit den Schultern. »Ich weiß nur, dass die amerikanischen Frauen Schlange stehen, um ein kopiertes Kleid von ihm zu kaufen. Meine Kontaktperson möchte, dass jemand von uns seine Frühjahrsschau besucht und jedes einzelne Modell abzeichnet.«
»Richte deiner Kontaktperson aus, dass sie dafür zu spät dran ist.«
»Nein, ist sie nicht.« Paul beugte sich vor und schob dabei das Tischtuch zusammen. »Javier macht seine Schau im April.«
»Keiner macht seine Frühjahrs- und Sommerschau im April.«
Paul streckte die offene Handfläche aus. »Javier schon, jedenfalls dieses Jahr. Frag mich nicht, wieso.«
In Alix’ Kopf wirbelten die Gedanken durcheinander. Die ganze Kollektion eines Hauses? »Dafür müsste man Zugang zum Atelier haben und alles mitnehmen können: Kleider, Skizzen, Muster … oder man müsste Javier selbst entführen.«
»Kannst du dich nicht ins Geschäft einschleichen und dir Notizen machen? Dort findet doch jeden Tag eine Modenschau statt, oder?«
»Nein, nicht bevor die Kollektion auf den Markt kommt. Normalerweise komme ich in eine Schau hinein, indem ich so tue, als wäre ich das Mädchen einer feinen Dame. Ich folge also einer gut angezogenen Frau hinein. Oder ich gebe die englische Adelstochter, die sich auf ihr erstes Pariser Modellkleid freut. ›Was für todschicke Sachen es hier doch gibt! Wie macht ihr Franzosen das bloß?‹ Darauf fallen sie immer rein. An einem guten Tag kann ich mir fünf oder sechs Modelle einprägen. Für eine ganze Kollektion bräuchte ich drei Gehirne oder eine Kamera.«
Ratlos rieb Paul sich die Nase. »Die Großhändler meiner Kontaktperson stehen schon in den Startlöchern. In New York haben sie riesige Nähstuben voller sogenannter ›Tischaffen‹ – das sind Leute, die Tag und Nacht nähen, um die Nachfrage zu befriedigen. Die amerikanischen Frauen wollen genau die Mode, die sie in den Zeitschriften sehen. Sie wollen Javier. Sie wollen das, was diese Mrs. …«
»Simpson.«
»Sie wollen das, was sie trägt, und am besten schon gestern.«
Alix schüttelte den Kopf. »Ich habe mich schon zu oft in die Modenschauen hineingeschlichen. Die Verkäuferinnen flattern aufgescheucht herum und stürzen sich auf jeden, der auch nur einen einzigen Bleistiftstrich macht. Paul, du hast recht gehabt, wir sollten damit aufhören.«
Paul betrachtete seine Finger. Die Haut um die Nägel herum war rissig von der harten Arbeit und vom Nägelkauen. »Ja, das mag sein, aber … weißt du, meine Kontaktperson kennt eine amerikanische Sprachtherapeutin an der Rue du Bac, die unglaubliche Erfolge vorweisen kann. Sie könnte Suzy wieder zum Sprechen bringen. Aber sie ist sehr teuer.«
Alix seufzte. »Jeder ist teuer, außer uns beiden.«
Paul trank sein Glas aus. »Jetzt schau nicht so unglücklich. Ich werde ihr sagen, dass die Sache eine Nummer zu groß für uns ist.«
»Nein. Paul, sag ihr … sag ihr, dass ich es mache.«
»Wirklich?«
Sie trank ihren Wein aus. »Ich muss bloß noch lernen, mich unsichtbar zu machen. Wie viel bekommen wir eigentlich dafür?«
Paul legte ein paar Münzen auf den Tisch und nannte eine Summe, die Alix erstarren ließ. »Ich weiß. Es ist, als würde man auf einen Außenseiter beim Prix de Diane setzen und dann ganz groß abräumen.«
4
Siebenhunderttausend Francs. Selbst durch zwei geteilt war das so viel, dass Paul die Katrijn in ein geeignetes Zuhause für die Kinder verwandeln und dazu noch ein ganzes Dutzend an Sprachtherapeutinnen engagieren konnte. Für Alix bedeutete so viel Geld das Ende ihrer quälenden Zeit in der Telefonvermittlung.
Auf ihrem Weg nach Hause war sie in Gedanken hin- und hergerissen. Sie wollte Paul so gern helfen. Und die Vorstellung, morgens ohne Geldsorgen aufzuwachen, war einfach verlockend. Auf der anderen Seite ernährte die Modeindustrie Tausende Frauen wie ihre Großmutter. Stahl man eine Kollektion, bestahl man Leute wie Mémé. Und doch … siebenhunderttausend Francs!
Aber was, wenn sie geschnappt wurden? Paul und sie erinnerten sich gegenseitig immer wieder an die Gefahren und machten sogar Witze darüber. Und wenn es tatsächlich einmal passierte? Wenn sie beim Zeichnen plötzlich eine feste Hand auf der Schulter spürte? Oder eine strenge Stimme hinter ihr rief: Darf ich einmal in Ihre Handtasche sehen, Mademoiselle? Paul war schon mehrfach verhaftet worden, und seine Erzählungen von fensterlosen, stinkenden Zellen machten Alix Angst. Sie nahmen einem die Schuhe und die Kleidung ab, und später bekam man sie völlig verlaust wieder zurück. Man wurde durchsucht bis auf die Unterwäsche. Frauen hatten normalerweise das Recht, von weiblichem Personal durchsucht zu werden, aber das wurde oft nicht so genau genommen.
In der Eingangshalle ihres Hauses ging Alix an Madame Rey vorbei, so tief in Gedanken versunken, dass sie sie gar nicht wahrnahm.
»Na, Hummeln im Hintern?«
Alix fuhr herum. »Wie bitte?«
»Haben Sie sich wieder mit Ihrem hübschen Kerl getroffen?«
»Nein, das heißt, doch.« Alix eilte den ersten Treppenabsatz hinauf.
Die Concierge rief ihr nach: »Morgen kommt mein Fernand und bringt Kohle. Sie werden ihm doch ein Trinkgeld geben? Er opfert seine kostbare Zeit, und das ist harte Arbeit mit diesen schweren Säcken.«
Vor der Wohnungstür blieb Alix kurz stehen und setzte eine betont harmlose Miene auf. Mémé machte gerade Kartoffelpuffer. Ihre mageren Schultern hingen traurig herunter, und Alix begriff sofort, dass etwas nicht stimmte.