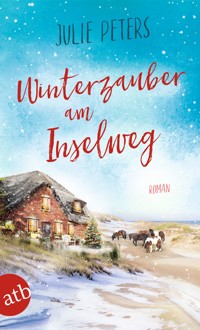10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kämpferische Frauen der Antike
- Sprache: Deutsch
Sie liebt einen griechischen Gott, doch ihre Bestimmung ist die Freiheit.
Otrere lernt als Amazone schon früh, zu kämpfen und zu reiten. Nach dem Tod ihres Vaters wird sie Herrscherin über die Skythen. Sie strebt danach, die freiheitliche Lebensweise ihres Volks zu bewahren – vor allem gegen die archaische Männerwelt der Griechen. Otreres Ideale werden auf eine harte Probe gestellt, als sie dem griechischen Gott Ares begegnet. Entgegen besserem Wissen lässt sie sich auf ihn ein, da er ein friedliches Miteinander beider Völker verspricht. Doch dann steht sie vor der größten Herausforderung im Leben einer Frau …
Der große Saga-Auftakt über die aufregendste Kriegerinnen-Dynastie der griechischen Mythologie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Otrere liebt ihr Leben auf der Steppe, sie liebt ihre Freiheit. Als Amazone wird sie von früher Kindheit an als Kriegerin ausgebildet. Nach dem Tod ihres Vaters wird sie Herrscherin über die Skythen und kämpft dafür, die freiheitliche Lebensweise ihres Volks zu bewahren, die durch die Siedlungspolitik der Griechen bedroht wird. Als sie dem griechischen Gott Ares begegnet, lässt sie sich auf ihn ein. Doch die Beziehung stellt ihre Unabhängigkeit, ihre Ideale und ihre Lebensweise in Frage, und Otrere muss sich entscheiden, wohin sie gehört – zu ihrem Volk oder an die Seite von Ares.
Über Julie Peters
Julie Peters, geboren 1979, arbeitete als Buchhändlerin und studierte Geschichte, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete.
Im Aufbau Taschenbuch sind bereits zahlreiche ihrer Romane erschienen, unter anderem historische Romane wie die erfolgreiche »Die Dorfärztin«-Saga sowie »Käthe Kruse und die Träume der Kinder« und »Käthe Kruse und das Glück der Kinder«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Julie Peters
Die Kriegerin – Tochter der Amazonen
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Historische Notiz
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Meine Geschichte werde ich nur ein einziges Mal erzählen, und danach wird sie im Wind vergehen wie die Geschichten meiner Ahnen. Ich weiß, wie das läuft. Ihr werdet sie weitertragen, an euren Lagerfeuern werdet ihr meine Geschichte zum Besten geben, als wärt ihr dabei gewesen. Die Sänger werden sich damit brüsten, dass sie wissen, wie es wirklich war. Dennoch werden sie niemals exakt meine Worte wählen, und mit jeder Erzählung wird meine Geschichte weniger meine sein. Bis niemand mehr da ist, der sie bestätigen kann, keiner, der zu ihrem wahren Kern vordringt.
So entstehen die Mythen, die nichts mehr mit den Ereignissen zu tun haben, die uns einst prägten. Es bleiben Fragmente, für viele unverständlich, die erst durch weitere Hinzudichtungen wieder Sinn ergeben. Aber nicht meinen Sinn. Und irgendwann werden sie nicht mehr erzählt, und auch das darf sein. Ihr dürft mich vergessen. Oder ihr lernt aus meiner Geschichte. Ihr lernt, wie es dazu kam, dass ich nun in eurer Erinnerung eine andere bin.
Also hört gut zu.
1
Das Trommeln der Hufe war mein zweiter Herzschlag. Tief beugte ich mich über den Hals des Falben. Meine Hände ruhten auf seinem Fell, seine Mähne peitschte mir ins Gesicht. Ich schloss die Augen, vertraute blind meinem Pferd, das mich immer trug. Das wusste, was ich brauchte.
Den scharfen Ostwind im Gesicht, der mir die Tränen der Wut von den Wangen wischte. Die Geschwindigkeit, nur fort von meinem Vater, meiner Familie, von meinem Stamm. Allein sein mit diesem Schmerz, der Verwirrung und der Angst.
Ja, ich hatte Angst. Auch wenn ich es mir nicht eingestehen konnte. Und mancher hätte vielleicht Angst gehabt, so zu reiten, wie ich es tat – mit geschlossenen Augen, ohne zu sehen, wohin der Falbe galoppierte, über die sanft geschwungenen Hügel der Grasebene. Jederzeit könnte mein Pferd in ein Kaninchenloch treten und stürzen, mich mit sich reißen und unter sich begraben. Das passierte.
Aber nicht uns.
Mich ängstigten andere Dinge. Fremde, die mit schnittigen Schiffen an unsere Küste segelten, die mit fünfzig bewaffneten Männern an Land gingen und Zelte aufschlugen. Männer, die nicht für das dauerhafte Leben in Zelten gemacht waren. Sie wetzten ihre Schwerter und rieben das Leder ihrer Schilde mit Öl ein. Sie waren nicht gekommen, um friedlich mit uns Handel zu treiben. Wer sein Schwert in den Sand eines fremden Gestades trieb, der kam auch, um es in die Leiber derer zu stoßen, die hier lebten.
Aber dies war unser Land. Auf der Steppe lebten wir, seit die Göttin Tabiti einem Vorfahren meines Vaters einst das Land anvertraut hatte. Meine ganze Kindheit und Jugend hatten mich darauf vorbereitet, diese Heimat zu lieben und sie zu verteidigen, falls es zum Kampf kam.
Mein Vater aber, der mit drei Dutzend Kriegern auszog, um sich mit den Kämpfern anderer Sippen zu vereinen, hatte mich lange angesehen, bevor er erklärte: »Du nicht, Otrere. Bleib du im Lager.«
Bei den Frauen, den Kleinkindern, die einem vor die Füße fielen, bei den zahnlosen Alten, die im Schatten ihrer Zelte nur noch auf den Tod warteten. Er traute mir nicht zu, für unser Überleben zu kämpfen, sondern befahl mir, bei den Zelten zu bleiben. Als wäre ich ein Kind, das man vor sich selbst beschützen müsse, und keine junge Frau von fünfzehn Sommern. Als wäre ich nicht die beste Bogenschützin unserer Sippe, vielleicht unter allen Skythensippen, die weit verstreut auf den Steppen rings um den Fluss Borysthenes und weit darüber hinaus lebten.
In aller Frühe waren sie heute aufgebrochen. Ich hatte ihnen nachgeblickt, und dann – spürte ich die Wut, die ich nicht zu bändigen wusste. Die nur der Wind mir mit den Tränen aus den Augen treiben konnte, und nur mit dem Rausch der Geschwindigkeit konnte ich langsam wieder zu Atem kommen, der Druck auf meine Brust legte sich.
Ich breitete die Arme aus. Spürte, wie der Wind an mir riss. Ich öffnete den Mund. Schrie meinen Kummer in den hohen, klaren Himmel, von dem die Sonne unerbittlich brannte.
Der Falbe wurde langsamer und verfiel in einen leichten Trab. Ich beugte mich über seinen Hals. Schließlich blieb er stehen. Ich spürte, wie seine Flanken bebten, Schweiß glänzte auf seinem goldenen Fell. Ich wendete ihn. Langsam ritt ich heim. Mein Zorn war nicht gänzlich verraucht.
Aber mein Blick weitete sich wieder für die Schönheit der sanft geschwungenen Hügel, auf denen der Wind durchs Gras strich, das sich in grünen Wellen bis zum Horizont erstreckte. Hinter der nächsten Hügelkuppe begann ein lichter Birkenwald, und dahinter begann das Weideland unserer Herden.
Immer noch fühlte ich mich zurückgesetzt. Hilflos, weil ich zurückgelassen wurde. Immer noch war ich auf meinen Vater wütend, der so selbstverständlich entschieden hatte, dass er mich nicht brauchte. Er war der König der Skythen und konnte über seine Kämpfer und Kinder verfügen, wie es ihm gefiel. Trotzdem zürnte ich ihm, denn meine älteren Geschwister hatte er mitgenommen. Wann durfte ich mich endlich beweisen wie Maspi und Melanippe?
2
Von meiner Schwester Melanippe und ihren Gefährtinnen lernte ich alles, was eine Kriegerin wissen musste.
Reiten. Bogenschießen. Die Wahrheit zu sprechen.
Wir bildeten eine eingeschworene Gemeinschaft, wir aßen mit den Kriegern, wir schliefen im Sommer unter dem Sternenhimmel und im Winter dicht aneinandergeschmiegt unter Fellen oder direkt neben unseren Pferden, wir ritten, wir rangen miteinander, wir maßen uns mit dem Bogen und beim Speerwurf. Jede von uns besaß ihr eigenes Pferd – keines von den schwerfälligen, älteren Tieren, die sich vor die Karren spannen ließen, sondern jene, die mit ihren langen, starken Beinen und dem Herzen eines Kriegers über weite Strecken galoppieren konnten.
Inzwischen war ich seit zehn Sommern bei den jungen Kriegerinnen und damit eine der Ältesten im Zelt. Wenn ein neues Mädchen zu uns kam, schlief es die ersten Nächte neben mir. Nushaba war längst zu den Kriegern gezogen, sie waren oft lange Zeit unterwegs auf Raubzügen oder um unseren thrakischen Nachbarn mitzuteilen, dass wir ihre Angriffe auf unsere Weidegründe nicht akzeptierten. Sie kehrte meist mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht zurück, mit Schätzen in den Satteltaschen und Melanippe an ihrer Seite. Solange unser Vater selbst unterwegs war, oblag die Verantwortung über unseren Stamm Melanippe und unserer Mutter.
Als Ältester unter den jungen Kriegerinnen oblag mir die Ausbildung der anderen Mädchen. Ich brachte ihnen bei, was ich einst von Melanippe und Nushaba gelernt hatte. Wie man einen Bogen baute. Wie viel Geduld es brauchte, bis der Leim hergestellt war, mit dem Holz und Knochen verklebt wurden. Wie lange es erst dauerte, bis der Leim getrocknet war! Viele Stunden, Tage, Mondläufe verbrachten wir mit dem Bau eines Bogens. Dabei hatte ich selbst erst vor drei Sommern mit meinem eigenen begonnen, als Melanippe meinte, ich sei nun groß genug, ich würde nicht mehr wachsen. Seitdem hatte ich einen halben Kopf mehr an Länge gewonnen, ich überragte alle Frauen und viele Männer in unserem Lager.
Doch auf eines wartete ich bisher vergebens: die Möglichkeit, mich im Kampf zu beweisen.
Nun bin ich kein Kind mehr. Noch nicht ganz Frau. Mein letzter Sommer, bevor ich das erste Mal mit meinem Vater und den anderen Männern und Frauen gegen den Stamm im Norden reiten sollte. Schon lange gab es Streit mit dieser Sippe; es ging um den saftigen Weidegrund direkt am Fluss, den wir jedes Jahr im Spätfrühling für uns einforderten oder den sie schon besetzt hielten, wenn wir mit der Sonne im Rücken unsere Schafe und Ziegen und unsere Milchstuten die sanften Hügel hinabtrieben.
Mein Vater kehrte mit unseren Kriegern nach einem halben Mondlauf zurück. Er verschwand mit den Beratern und mit Melanippe und Maspi in seinem Zelt. Wieder war ich ausgeschlossen, wieder sprang ich auf den Rücken meines Falben und trieb ihn bis zur Erschöpfung einen halben Tag Richtung Norden. Als ich mit Einbruch der Dämmerung zurückkehrte, waren die Kochfeuer entzündet und zwei Ziegen geschlachtet, um die Rückkehr der Krieger zu feiern.
Bereits vor vielen Sommern hatten die Fremden versucht, an unserer Küste eine Siedlung zu errichten. Damals waren sie gescheitert. Nach dem ersten Winter schon hatten sie sich zurückziehen müssen. Mein Vater hatte sich erleichtert gezeigt, weil die Fremden verschwanden. Daran erinnerte ich mich gut, denn er hatte mich damals mitgenommen.
Ich wollte mich gern den anderen anschließen. Mich zu ihnen setzen und ihren Geschichten am Feuer lauschen. Doch meine Glieder schmerzten von dem langen Ritt, und so kroch ich stattdessen in das Zelt der jungen Frauen und legte mich auf meine Strohmatte. So hörte ich nicht, was die Krieger von ihrem Kampf gegen die Fremden berichteten. Achaier. So nannten sie sich. Kamen aus Palästen jenseits des Meeres, wo ihre Könige in einer goldenen Pracht residierten. Sie lebten von Ackerbau und Viehzucht, Fischfang und Handwerk.
Ich wusste mehr über diese Fremden, als mir lieb war. Einst hatte ich meinen Vater zu ihnen begleiten dürfen, und dies hatte in mir eine Sehnsucht geweckt, die ich mir bis zu diesem Sommer nicht hatte eingestehen können. Erst als mein Vater mir dieses Jahr verwehrte, mit ihm nach Süden zu reiten, begriff ich, was diese Wut bedeutete, die seit jeher in mir wohnte.
Ich wollte sein, was er war.
Ich wollte Königin der Skythen werden.
3
Eine meiner frühesten Erinnerungen ist die an jenen Sommer, als ich sieben war. Schon seit zwei Jahren lebte ich mit meiner Schwester Melanippe im Zelt der Kriegerinnen, und meine Tage waren erfüllt vom Reiten, Bogenschießen und vom Raufen mit den Gleichaltrigen. Dass dieses Spiel, bei dem es darum ging, mein Gegenüber zu besiegen, allzu früh bitterer Ernst werden sollte, ahnte ich damals nicht. Ich liebte nur die Pferde und den kleinen Bogen, den ich sogar nachts an mich drückte.
In diesem Sommer durfte ich das erste Mal mit den Kriegern reiten.
Mein Vater nahm mich vor sich auf den Sattel. Sein Arm lag um meinen Bauch, während wir über die Ebene preschten. Ich hätte genauso gut selbst reiten können, doch der Falbe war damals erst zwei Jahre alt, und ich besaß kein anderes Pferd. Später begriff ich, dass ein reitendes Kind von sieben Jahren die Achaier vermutlich gehörig verwirrt, vielleicht auch beunruhigt hätte. Was hätten sie wohl dazu gesagt, wenn sie gewusst hätten, dass ich ein Mädchen bin?
Zu jener Zeit lebten wir noch weiter im Süden, näher an jenem Meer, das die Achaier Pontisches Meer nennen. Bis zur Küste war es ein halber Tagesritt. Ich juchzte, wenn mein Vater Mazjar seinem Braunen die Sporen gab. Aber ich spürte auch eine unerklärliche Anspannung, die alle unsere Krieger erfasst hatte. Sie waren auf der Hut. Sie fürchteten nicht direkt die Fremden, die an unserer Küste gelandet waren. Aber es waren Fremde, die sich auf unserem Land breitmachten, als gehörte es ihnen.
Die Achaier. Damals hörte ich auch das erste Mal von ihnen. Ich hörte meinen Vater und seine Berater über Tyras reden. So nannten die Fremden ihre Siedlung. Einer Siedlung einen Namen geben, das bedeutete, sie auf Dauer anzulegen. Nicht nur für einen Sommer an Land zu gehen und Handel zu treiben. Das sagte mein Onkel Arash eindringlich zu meinem Vater.
Wenn wir langsamer ritten, weil die Pferde eine Pause brauchten, sprachen sie leise über die Fremden. Vermutlich dachten sie, ich würde nicht verstehen, was sie sagten.
Was ich aber verstand, sobald wir das Ende unserer Reise erreichten, war die Beunruhigung meines Vaters. Weil wir nicht damit gerechnet hatten, dass diese Fremden, die aus dem Süden mit ihren Schiffen an unserer Küste gelandet waren, direkt nach ihrer Ankunft eine Festungsmauer bauen, Furchen in die fruchtbare Erde am Fluss graben und kleine Häuser errichten würden.
»Sieh dir nur an, wie sie den Boden aufreißen und ihn sich zu eigen machen«, murmelte mein Vater.
»Wer sind die, dass sie glauben, sie könnten ungestraft unser Land besetzen?«, zischte Arash neben uns. Sein Schimmel tänzelte unruhig unter dem Sattel.
Mein Vater atmete tief durch. Sein Arm um meinen Bauch verstärkte den Druck. »Sie glauben, ihnen gehört die Welt. Aber sie vergessen, dass die Götter bestimmen, wem welcher Teil der Welt gehört.«
»Und wenn ihre Götter ihnen gesagt haben, dieses Fleckchen gehöre nun ihnen?«
Mazjar kaute auf diesen Worten herum. »Ich muss mit ihnen reden.«
»Wir sind zu wenige. Zwanzig gegen … wie viele mögen es sein? Hundert? Hundertzwanzig?«
Wir standen auf einer Anhöhe. Zwanzig Reiter, die von den Menschen in der Ebene unter uns noch nicht bemerkt worden waren. Sie wuselten wie Ameisen herum, jeder wusste genau, was er zu tun hatte. Ich war fasziniert von ihrer Ordnung. Von den geraden Linien. Von den kleinen Häusern auch, denn ich hatte noch nie aus Stein errichtete Gebäude gesehen. Wir lebten in Zelten und auf den Karren, die von unseren Pferden gezogen wurden.
Mein Vater schnaubte. »Straßen. Sie bauen eine Siedlung. Die wollen bleiben, anders als jene vor ihnen.«
Arash runzelte die Stirn. »Und was gedenkst du zu tun?«
Mazjar gab sich einen Ruck. »Ich werde mit ihnen reden.«
»Aber wir sind zu wenige!«
»Dann sehen sie uns nicht als Bedrohung.« Er umfasste meine Brust fester. »Wir sind nur harmlose Nomaden, die mit ihren Kindern einen Ausritt machen, nicht wahr?«
Er ritt voran. Arash und drei weitere Reiter folgten uns. Der Braune schritt behutsam aus, erst nachdem wir die Ebene erreicht hatten, trabte er etwas zügiger. Ich spürte die Anspannung meines Vaters. Daran, wie er mich an sich drückte. Wie er versuchte, mit seinen Männern zu scherzen, obwohl ihm die Angst im Nacken hockte.
Fremde auf unserem Land. Was mussten die Achaier für mutige Menschen sein, dass sie dieses Meer überquerten! Wie sollten wir ihnen denn etwas entgegensetzen können?
Aber mein Vater vertraute darauf, dass wir nicht bedrohlich wirkten. Weil ich vor ihm im Sattel saß. Weil unsere Männer nur die Bögen auf dem Rücken trugen, die Dolche versteckt in einer Scheide am Stiefel. Ein paar Männer auf einem Ausritt. Allenfalls auf der Jagd nach einem Schneeleoparden oder wilden Mufflons.
»Sprichst du überhaupt ihre Sprache?«, fragte Arash.
»Nein. Aber sprechen sie unsere?«
»Und wie willst du dich mit ihnen verständigen?«
Mein Vater warf seinem Bruder einen Blick zu. Hob die Augenbrauen. Machte eine weit ausholende Bewegung mit dem freien Arm und neigte den Kopf.
Arash lachte. »Verstehe«, sagte er.
Schweigend legten wir den Rest des Wegs zurück. Inzwischen waren wir bemerkt worden. Rufe schallten über die Ebene; einige Männer hatten ihre Arbeit unterbrochen und sahen uns entgegen. Aus einer Gruppe lösten sich mehrere und kamen auf uns zu.
»Welcher ist der Anführer?«, fragte Arash.
»Na, welcher schon. Der mit diesem herausgeputzten Gewand, der vorwegschreitet.«
»Hübsches Kerlchen«, murmelte Arash, und die Männer lachten rau. Ich richtete mich etwas mehr auf und versuchte, diesen hübschen Kerl etwas besser zu erkennen.
Er trug eine weiße Tunika, die ihm bis zu den Knöcheln reichte. Später erfuhr ich, dass diese Tunika von den Achaiern Chiton genannt wurde. Dazu Sandalen, mit denen er bestimmt nicht reiten konnte. Und einen farbenprächtigen roten Mantel, um die Schultern drapiert wie bei einem König. Mit Königen kannte ich mich aus. Mein Vater war auch einer.
Der König der Siedlung breitete die Arme aus, er rief uns etwas entgegen. Wir blickten uns ratlos an, denn natürlich beherrschte keiner die Sprache eines Fremden, dessen Volk wir bisher nie begegnet waren. Er wirkte sogleich verärgert, rief etwas über die Schulter. Ein großer, breitschultriger Kerl schob sich nach vorn neben ihn. Mein Vater zügelte sein Pferd. Wir warteten ab.
»Willst du ihn nicht begrüßen?«, fragte ich.
»Na, der soll nur herkommen«, knurrte mein Vater. Er gab Arash ein Zeichen, und dieser ritt langsam an uns vorbei auf den hochgewachsenen Mann zu. Dieser trug einen Brustpanzer über seinem Chiton, der bronzen glänzte. Er schien sich vor uns nicht zu fürchten.
Wir beobachteten, wie mein Onkel sein Pferd zügelte. Er rief dem Fremden etwas zu. Dieser starrte ihn an, als müsste er seine Worte erst in eine sinnvolle Reihenfolge bringen, dann rief auch er ein paar Worte. Sie klangen entfernt vertraut.
Er schien derjenige der Fremden zu sein, der unserer Sprache mächtig war. Mein Onkel und er unterhielten sich eine Weile; beide wogen ihre Worte mit Bedacht ab, und einmal drehte sich der Fremde halb zu seinem Anführer um und rief etwas in seiner Sprache, das für große Heiterkeit sorgte. Inzwischen versammelten sich immer mehr Fremde um ihren Anführer. Mein Onkel nickte schließlich und kehrte zu uns zurück.
»Sie kommen von weit her. Nennen sich Achaier. Milet ist eine Stadt weit jenseits des Meers, aus der sie aufgebrochen sind.«
»Nie davon gehört.«
»Sie wollen dauerhaft hierbleiben. Sie fragen nicht um Erlaubnis, sondern sie behaupten, einer ihrer Götter habe sie angewiesen, sich hier niederzulassen und einen Palast für ihren König zu bauen.«
»Was soll das für ein Gott sein?«
»Sie haben viele Götter. Dieser soll Apollon heißen. Gott der Kolonisten.«
Mein Vater lachte auf. »Es klingt, als hätten sie sich das ausgedacht.«
»Er berichtete mir, es gebe ein Heiligtum in ihrer Heimat, zu dem jeder König geht, bevor er eine neue Siedlung gründet.«
»Und wie heißt ihr König?«
»Ihr Anführer ist kein König. Er ist nur der Erste unter ihnen. Sie sagen, sie wollen mit uns Handel treiben. Und sie haben uns eingeladen, bei ihnen über Nacht zu bleiben. Sie heißen uns willkommen und möchten unsere Freundschaft mit einem Festmahl feiern.«
»Erst feiern sie mit uns ein Festmahl, dann schlachten sie uns in der Nacht ab. So beginnen Kriege.«
Arash blickte meinen Vater lange an.
»Vertraust du ihnen etwa?«, fragte mein Vater. »Sie bauen einen Palast, und du vertraust ihnen? Der Platz wird ihnen nicht reichen, und dann breiten sie sich aus.«
»Er klang nicht feindselig. Sie möchten hier leben, das Land ist fruchtbar, sie betreiben Ackerbau. Und sie möchten mit uns handeln. Es könnte für alle Seiten von Vorteil sein. Sagt er.«
Mein Vater dachte nach. »Haben wir eine Wahl?«
»Wir haben immer eine Wahl, Bruder. Wir können nach Hause reiten und mit all unseren Kriegern wären wir nach einem halben Mondlauf zurück und würden ihre Stadt dem Erdboden gleichmachen.«
»Sie sehen nicht so aus, als wollten sie wieder gehen.«
»Nein, das werden sie wohl nicht tun. Es sei denn, wir vertreiben sie. Und dann kämen sie früher oder später zurück.«
Mein Vater drückte mich fester an sich. »Also dann. Gute Nachbarn sind mir lieber als schlechte Feinde. Sag ihnen, dass wir heute Nacht bleiben. Aber wir lagern außerhalb ihrer Befestigungsanlage.«
Arash nickte. Er wendete sein Pferd und ritt zurück, um Vaters Nachricht zu überbringen.
»Lass dich nicht von diesem Fremden täuschen, Otrere«, murmelte mir mein Vater ins Ohr. »Erst sagen sie, dass sie Handel treiben wollen, dann nehmen sie ungefragt dein Land. Und am Ende zerstören sie, was wir immer gewesen sind.«
»Das werde ich ihnen nie erlauben«, erwiderte ich fest. »Wenn du willst, vertreibe ich sie in deinem Namen.«
Er lachte. »Ach, Otrere. Wenn meine Söhne nur so werden, wie du jetzt schon bist. Dann muss ich mir um die Zukunft keine Sorgen machen.«
4
Die ersten fünf Jahre lebte ich im Bannkreis der Mütter und Schwestern, die folgenden zehn bei den Kriegerinnen. Sie nahmen mich in ihrer Mitte auf, als ich mit fünf Sommern vor die Wahl gestellt wurde – zu den Zelten oder zu den Weiden? Zu den Pferden!, rief ich. Sie brachten mich zu den Weiden und ließen mich ein Pferd auswählen, und ich nahm die falbe Stute mit der grauschwarzen Mähne, die sonst keinen an sich heranließ. Ihr Bauch war rund und prall, weil sie ihr erstes Fohlen erwartete. Sie legte so vertrauensvoll ihre Nüstern in meine Handfläche, wann immer ich zu ihr ging. Sie lief mir überallhin nach. Kurz darauf wurde ihr Fohlen geboren, und sie zeigte mir den kleinen Hengst, als wüssten wir beide, dass sie zum Reiten nicht taugte, er mir aber alle Zeit ein treuer Gefährte sein würde.
Ich lernte auf anderen Pferden reiten, und drei Jahre später war ich die Erste und Einzige, die auf seinen Rücken stieg. Ihm war es egal, ob ich ihm eine Handvoll Samen hinhielt oder das Gebiss, an dem ich seinen Zaum und die Zügel befestigte. Zaum und Zügel waren aus weichem Ziegenleder, ich hatte es selbst gegerbt, rot gefärbt und anschließend zugeschnitten und zu einem Zaumzeug vernäht, das ihm passte und nur ihm. Wenn ich ihm den Biss ins Maul schob, tänzelte er neben mir. Er konnte es nicht erwarten, mit mir über die Ebene zu fliegen.
Nachdem die Sippe gestern die Rückkehr der Krieger gefeiert hatte, war es in der Frühe noch still im Lager. Nur ein paar Frauen beaufsichtigten die Kinder, die in ihren kurzen Tuniken und mit nackten Füßen zwischen den Zelten tobten.
Heute brachte ich dem Falben keine Zügel, keinen Sattel. Nur Körbe, die ich mit einem Gurt auf seinem Rücken festschnallte, und er hob die Oberlippe, er schmollte mir.
»Ich weiß schon. Du wirst dich furchtbar langweilen, nicht wahr?«
Ich lachte und legte die Arme um seinen Hals. Das Gesicht vergrub ich in seiner Mähne, er duftete nach Pferd, nach Sommer und nach dem würzigen Thymian, der zu dieser Jahreszeit die Steppe überzog. Er liebte es, sich darin zu wälzen, und ich liebte diesen Geruch.
»Sprichst du wieder mit ihm?«
Ich blickte auf. Mein Bruder Maspi stand auf der anderen Seite meines Falben, er lächelte gutmütig. Sein Auge blinzelte gegen die helle Sonne.
»Und du bist schon wieder wach und nüchtern?«
Er grinste und schulterte die Schütten, die er für sein Pferd mitgebracht hatte.
»Wir müssen los, wenn wir heute die Körbe füllen wollen.«
Er hatte recht. Und er wusste, wie wenig mir diese Tage auf der Steppe behagten, wenn wir stundenlang mit dem Blick am Boden herumliefen, uns nach Kräutern und Beeren bückten und sie in den Schütten sammelten. Maspi hingegen liebte sie. An diesen Tagen musste er nicht Schwertkampf trainieren oder den Speer werfen. Den Bogen überließ er ohnehin mir und unserer Schwester Melanippe. Wir hatten schon früh gelernt, mit ihm Hasen zu jagen oder Vögel mit der Steinschleuder zu erlegen. Das alles fiel Maspi deutlich schwerer. Er sagte, ihm fehlte der scharfe Blick dafür, mit Distanzwaffen ein Tier zu erlegen. Aus der Nähe gelang es ihm besser. Aber wir wussten alle, ein großer Kämpfer würde aus meinem ältesten Bruder nie werden.
Dafür wusste er, wo es die süßesten Blaubeeren und die saftigsten Himbeeren gab. Seine Finger waren so geschickt, dass er die Brombeeren ernten konnte, ohne sich an den Dornen zu verletzen, und während er sich über die kleinen Büsche und das Gestrüpp beugte, summte er vor sich hin. Maspi war glücklich, wenn er Beeren sammelte.
Ich beneidete ihn. Um diese Leichtigkeit. Dass er das Glück in diesen kleinen Dingen fand. Dass er lachte, wenn die Kinder zu ihm gelaufen kamen und aus seinem Korb die dicksten Blaubeeren stibitzten. Er nahm das Leben leicht, obwohl es ihm so übel mitgespielt hatte.
Mich hingegen ließ die Sorge nicht los, was es bedeutete, wenn bewaffnete Achaier an unserer Küste landeten. »Was habt ihr im Süden erlebt? Ihr seid unverletzt zurückgekehrt«, sagte ich leise.
»Ja, das war interessant. Diese Achaier suchten Tyras.«
»Wozu braucht Tyras fünfzig bewaffnete Soldaten?«
Meine Besorgnis wuchs sich zu einem Knoten in meinem Bauch aus, ein ungutes Gefühl, da war es wieder. Die Angst. Fremde, die in unser Land drängten, die versuchten, uns etwas wegzunehmen, das uns von alters her gehörte. Als genügte es nicht, dass die Thraker im Westen beständig nachdrängten, sobald wir auch nur einen Weidegrund freigaben.
Ich kroch durch die Blaubeerbüsche und sammelte Beeren, während der Falbe hinter mir auf der Ebene graste. Maspi war etwa dreißig Schritt entfernt beschäftigt. Er warf eines der Kinder in die Luft, das bei ihm Beeren klauen wollte, und die anderen umringten ihn, sie juchzten und verlangten nach mehr. Ich seufzte. Er würde sie herumwirbeln, bis alle vor Schwindel ins Gras plumpsten, und am Abend würden seine Körbe und Holzschalen wie von Zauberhand trotzdem die vollsten sein, als hätte die Göttin Api, Mutter Erde, ihn als ihren liebsten Menschensohn auserkoren und ihre Gaben wie ein Füllhorn über ihm ausgekippt.
Ich hingegen blickte auf ein paar jämmerliche Blaubeeren, eine Handvoll Himbeeren. Lediglich Brombeeren hatte ich reichlich gepflückt, meine Arme waren ganz blutig gekratzt von den Ranken. Maspi lachte, weil ich das Gesicht verzog, als ich aus dem Brombeerdickicht kroch.
»Du musst dich mit der Göttin gutstellen«, neckte er mich.
»Was mir ja immer schon so vortrefflich gelungen ist.« Ich erwiderte sein Lächeln, fühlte mich dabei aber unzulänglich. Für Maspi war das Leben einfach. Beeren sammeln, mit den Kindern durch die Grasebene toben, und wenn sich wer eine blutige Nase holte oder in einem Kaninchenloch den Fuß vertrat, war er zur Stelle.
Im Vergleich zu Maspi war meine Position nicht so klar definiert. Ich war die Drittgeborene, und ich war mit fünf aus dem Karren unserer Mutter fortgelaufen, zu den Pferden, mehr wollte ich damals nicht. Dennoch hatten sie mich zuerst zurückgeschickt. »Eine Kriegerin genügt von eurer Familie.« Und das war Melanippe.
Doch ich hatte mich durchgesetzt. War zur Kriegerin ausgebildet worden, war eine der Besten geworden, weil ich unerbittlich trainiert hatte. Weil ich immer mit meiner Schwester konkurrieren musste. Weil ich stark sein wollte. Weil ich sah, wie die Skythen in Bedrängnis gerieten. Ich wollte meinem Vater zurufen, er müsse mehr um unsere Freiheit kämpfen, doch er befahl mir, bei den Frauen und Alten zu bleiben.
»Siehst du, da kommt Erlösung für deine armen Finger.« Maspi trat neben mich, er schüttete alles, was er in dem Tuch an seiner Hüfte gesammelt hatte, in den Korb meines Falben. Ich sah auf. Vom Lager näherte sich ein Reiter, und ich erkannte nicht nur an dem schwarzen Hengst, der sich über der Ebene streckte, dass es unser Vater war. Es war seine Haltung im Sattel, die ihn verriet.
»Was will er denn?«
Maspi antwortete nicht. Was vermutlich hieß, dass er es genau wusste, aber nicht darüber reden wollte.
Ich gab dem Falben einen Klaps, was für ihn hieß, dass er sich frei bewegen durfte, solange ich mit dem Sammeln pausierte. Inzwischen war mein Vater herangekommen. Er schwang das Bein über den Hals seines Rappen, der zugleich langsam wurde. Mein Vater glitt aus dem Sattel und landete fünf Schritte von mir entfernt im Gras. Er gab seinem Pferd ebenfalls einen Klaps und kam mit langen Schritten auf mich zu. »Hier bist du«, begrüßte er mich.
»Wir sammeln Beeren«, sagte ich und verzog das Gesicht. Er lachte. Jeder wusste, dass ich diese Arbeit nicht mochte. »Wollen wir ein Stück gehen? Gut möglich, dass wir ein paar Kaninchen fürs Abendessen erwischen.« Er klopfte auf seine Gürteltasche, in der er die flachen Kiesel aufbewahrte, die er mit seiner Steinschleuder benutzte. Ich nickte und lief zum Falben, um Köcher und Bogen zu holen. Mein Vater liebte die Steinschleuder, ich bevorzugte den Bogen.
Wir machten uns auf den Weg. Das Gras wogte und kitzelte meine nackten Beine. Wir gaben uns keine Mühe, leise zu sein. Wussten wir doch beide, dass bei dem Gewusel auf der Steppe alle Kaninchen in ihren Löchern blieben.
»Morgen brechen wir auf. Nach Tyras«, begann mein Vater, als wir ein Weilchen schweigend nebeneinander gelaufen waren. »Ich werde Maspi mitnehmen.«
Ich schwieg. Vermutlich wollte er nicht nur deshalb mit mir reden, um mich über seine Reisepläne zu informieren, denn im Grunde ging es mich nichts an.
»Mela reitet derweil nach Norden. Du wirst also ein paar Tage wieder für das Lager verantwortlich sein. Bis sie zurück ist. Deine Mutter ist auch da, aber du hast dich zuletzt bei dieser Aufgabe bewährt.«
Ich begriff. Darum hatte er mich zurückgelassen. Und ich hatte gedacht, es sei, weil er mich für zu jung hielt.
»Deine Mutter wird keine große Hilfe sein, aber …«
»Ich weiß«, sagte ich. Einen Angriff müsste ich mit den verbliebenen Kriegerinnen abwehren, Besucher würde ich empfangen und bewirten.
Mein Vater hatte recht behalten, als er vor acht Sommern vermutete, dass die neue Siedlung der Achaier bleiben würde. Nicht nur das. Inzwischen übte sie auf viele unserer jungen Leute eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Das Leben an einem festen Platz war für mich unvorstellbar. Beschränkt zu sein auf eine Lehmhütte, die halb in den Boden eingelassen war, dazu ein kleines Stückchen eingezäuntes Land, dem man mühsam in den kurzen, kühlen Sommern ein bisschen Gemüse oder Hirse abtrotzte … Doch allein von unserer Sippe waren ein Dutzend junge Leute in den vergangenen Jahren nach Tyras gezogen. Teils hatten sie Achaier geheiratet, teils ihre ganze Familie mitgenommen. Sie lebten als Händler und Handwerker in der Stadt am Meer.
Es waren die Jungen, die gingen, und sie hinterließen eine Lücke in unserem Volk. Die Wagemutigen, die mit den schnellsten Pferden, die sich etwas trauten. Sie nahmen ihr Vieh mit, das sie in Tyras verkauften, um von dem erlösten Gold ein Stück Land zu erwerben und sich eine Existenz zu schaffen. Sie übten ein Handwerk aus, das sie zuvor auch bei uns mit viel Erfolg betrieben hatten. Ich sah sie gehen und wusste, sie waren für uns verloren. Gelegentlich kamen sie zurück, auf Besuch, wie sie sagten, doch sie waren Fremdkörper für unsere Sippe, sie brachten teure Geschenke, mit denen wir nichts anfangen konnten, und sie saßen verloren an unseren Kochfeuern und klagten über die Speisen, die wir servierten, oder über die unbequemen Strohmatten, denn in Tyras, behaupteten sie, gab es gemütliche Betten, und niemand musste frieren.
Mit ihnen ging so viel Wissen verloren. So viele Stimmen, so viel Tatkraft. Es klaffte eine Lücke in unserer Mitte. Es gab die Alten. Es gab ein paar Familien, deren Kinder zu jung waren, um mit ihnen in die Stadt zu ziehen. Es fehlten die jungen Leute, die noch keine Familie gegründet hatten. Oder die Erfolgreichen, die mehr vom Leben erhofften und glaubten, in einer achaischen Siedlung direkt am Meer könnten sie mehr Goldschmuck verkaufen, sie könnten als Händler dort leben. Sie gingen fort, und sie fehlten uns.
Mir schien es schwer vorstellbar, so ein Leben zu führen. Fern meiner Familie, fern auch von der Grassteppe, auf der die Götter im Wispern des Windes zu hören waren. Deshalb hatte ich mich bisher geweigert, mit meinem Vater ein zweites Mal nach Tyras zu reiten. Dass er dort inzwischen einen eigenen Palast hatte errichten lassen, verstand ich nicht. Er sagte, es sei wichtig, gesehen zu werden. Für die dort lebenden Skythen da zu sein, wenn sie Probleme mit den Achaiern bekamen.
Die Achaier waren sehr verwundert, als sie begriffen, dass der Mann, der sie als Gesandter besucht hatte, der erste König der Skythen war. Sie hatten versucht, diese Scharte auszuwetzen, indem sie eine Delegation auf Gegenbesuch in unsere Siedlung schickten, die einige Tagesreisen nördlich am Fluss lag – im Herzland unseres Einflussbereichs, weit weg von Achaiern, Thrakern und anderen Skythenstämmen, die versuchen könnten, meinem Vater seinen Herrschaftsanspruch streitig zu machen.
Ich weiß bis heute nicht, woran es lag, doch ich fühlte mich meinem Vater immer mehr verbunden als meiner Mutter.
Nun wollte er wieder nach Tyras, und danach würde er nach Mamai-Gora weiterziehen. Und diesmal nahm er Maspi mit.
»Er wird mein Nachfolger, weißt du?«, sagte mein Vater leise.
Ich ging weiter neben ihm her, äußerlich regungslos, doch sobald ich begriff, was seine Worte bedeuteten, ballte ich die Fäuste.
»Er soll sich darauf vorbereiten. Mit den Achaiern in Kontakt treten. Und auch mit den Völkern im Norden, in ihren Städten. Ich möchte, dass er begreift, wie wichtig unsere Freiheit hier draußen ist. Dass wir sie aber vor allem bei den Achaiern und bei den Stämmen im Norden schützen müssen. Nicht hier draußen.«
»Wer wird dann hier draußen die Macht halten?«, fragte ich betont unbeteiligt und bückte mich nach einem Blaubeerstrauch. Mein Vater blieb neben mir stehen und schaute zurück. »Du gehörst hierher«, sagte er leise. »Als Kriegerin. Aber was wird aus Mela? Was wird mit Maspi? Sie sind beide älter, sie haben Ansprüche vor dir.«
»Die dürfen sie gerne haben.« Es sollte mich nicht stören. Nicht zum ersten Mal zeigte mein Vater mir, dass er Mela und Maspi mehr zutraute. Doch es schmerzte. Ich war eine gute Kriegerin. Vielleicht die beste von uns dreien. Und kämpfen mussten wir doch. Um unsere Zukunft.
»Gut möglich, dass wir eines Tages unter euch dreien einen Nachfolger wählen. Wohl eher eine Nachfolgerin.«
Er sprach nicht weiter. Musste er auch gar nicht, ich wusste nämlich, was er dachte. Was wir alle dachten.
Maspi als König? Schwer vorstellbar, sein Gemüt war zu sanft, sein Herz hing zu sehr in der Natur. Darin ähnelten mein Bruder und ich uns.
Mein Vater aber sah mich an, als wüsste er mehr über meinen Ehrgeiz. Ich steckte mir eine Handvoll Blaubeeren in den Mund. Einige süß, andere sauer. Wie alles hier draußen auf der Steppe, waren auch sie unberechenbar.
»Du wirst immer ein Kind der Steppe bleiben«, sagte er nachdenklich.
»Dann werde ich wohl nie die Königskrone tragen.« Ich lachte, denn die Vorstellung war wirklich absurd. Ich in einer Stadt, in einem steinernen Palast? Gekrönt mit einem Diadem aus Gold und Bernstein, den wir von den Skythen im Norden ertauschten, die ihn wiederum über verschlungene Handelswege von einem Volk viel weiter im Norden bezogen? Dann schon eher Maspi, obwohl er genauso wenig Begeisterung für das Regieren und das Leben in der Stadt hegte wie ich oder unsere Mutter.
»Mela?«, schlug ich vor. Meine Schwester war eine große Kriegerin. Sie besaß diese natürliche Autorität, der jeder und jede in ihrer Gruppe gehorchte, wenn sie sich auf die Jagd oder einen Feldzug begaben.
»Gut möglich.« Mein Vater ging weiter, den Blick auf den Boden gerichtet. Ich folgte ihm. Seine Gedanken verstand ich gut. Ich hatte noch jüngere Geschwister, doch wir drei, Melanippe, Maspi und ich, wir würden früher oder später zwischen uns die Nachfolge unseres Vaters regeln.
Wollte ich denn hier draußen bleiben?
Nicht, wenn die Machtkämpfe woanders ausgetragen wurden. Dabei stand für mich fest, dass ich hierher gehörte. Auf die Steppe. Zu den Pferden, dem Vieh, mit der Weite im Blick.
Bisher hatte ich mich jedes Mal verweigert, wenn mein Vater vorschlug, ich könnte ihn für eine Jahreszeit nach Tyras begleiten. Dorthin gehörte ich nicht, das spürte ich. Aber wenn dies für ihn Bedingung war, um mich in Erwägung zu ziehen? Wäre ich dann bereit, mein Leben hier draußen aufzugeben – und sei es nur vorübergehend?
»Nun, jedenfalls hoffe ich, ihr seid alle wohlauf, wenn wir zurückkehren.«
»Mela und ich werden schon dafür sorgen.«
Mein Vater wandte sich mir zu. Er legte die Hand an meine Wange, und ich schloss die Augen. Der Wind strich über uns hinweg, ich lauschte dem sanften Auf und Ab, mit dem er die Grashalme bewegte. Der würzige Duft, der sommers von den Kräutern aufstieg, sobald man über die sanft geschwungenen Ebenen lief, kitzelte mich in der Nase.
»Ich weiß, dass ihr immer hier sein werdet. Dass ihr für unsere Leute sorgen werdet. Aber du bist jung und deine Schwester ungestüm. Deine Mutter hat einen Säugling im Arm, es sind viele Umstände auf einmal, die dagegensprechen, euch allein zu lassen. Ich werde einige meiner Männer bitten, bei euch zu bleiben.«
»Nein«, widersprach ich heftig. »Dafür gibt es keinen Grund. Uns droht keine Gefahr, unsere Sippe lebt im Kernland unseres Reichs. Wir brauchen deine verweichlichten Stadtsoldaten nicht.«
Mein Vater schwieg. Das machte er oft, und ich vermutete, es war seine Art, mich zum Reden zu bringen. Schweigen hielt ich selten lange aus.
»Wir brauchen keine fremden Soldaten«, bekräftigte ich.
»Sie sind keine Fremden«, widersprach mein Vater.
»Na, du weißt schon. Keine, die unser Leben nicht gewohnt sind.«
»Sie bleiben.«
»Sie gehen. Unsere jungen Kriegerinnen sind genug. Diese Männer …«
Ich sprach nicht weiter.
Mein Vater unterhielt einen Trupp Soldaten, die in meinen Augen für das standen, was unser Volk nicht war. Sie waren nur fürs Kämpfen da. Wenn sie sich hier draußen aufhielten, waren sie nur im Weg, wie ein Fremdkörper, weil sie für sich blieben, weil sie den ganzen Tag herumsaßen und sich durch unsere Vorräte fraßen. Sie pfiffen den jungen Mädchen nach und verstanden nicht, was daran falsch war.
Sie verkörperten all das, was ich am Stadtleben verabscheute. Spezialisiert auf eine Sache, noch dazu etwas, das wir genauso gut selbst schafften. Wir konnten die Sichel und die Sammelkörbe beiseitelegen und zu den Waffen greifen. Sie waren nutzlos, bis sie gebraucht wurden.
Ich stampfte auf. Vor uns im Gras sprang ein Kaninchen davon. Bevor ich zu meinem Bogen greifen konnte, hatte mein Vater in einer einzigen, geschmeidigen Bewegung einen flachen Kiesel aus seinem Beutel gezogen, ihn in die bereits in Bewegung versetzte Schlinge eingesetzt und mit zwei weiteren Umdrehungen abgeschossen. Er verfehlte das Kaninchen.
Ich zog einen Pfeil aus dem Köcher und nockte ihn ein, ohne den Bogen zu spannen. Mein Blick glitt über das Gras, auf der Suche nach einem weiteren Kaninchen, das so leichtfertig war, sich in unserer Nähe aus dem Bau zu wagen.
Wir sprachen nicht mehr. Nun waren wir zwei Jäger, die über die Grasebene schritten und auf das leiseste Zeichen eines Beutetiers lauerten. Über die Soldaten, die er bei uns lassen wollte, verlor mein Vater kein Wort mehr.
Als er drei Tage später mit Maspi und seinen Leuten nach Süden aufbrach, ließ er keinen seiner Soldaten bei uns zurück.
5
Als ich fünf Sommer zählte, stieg ich eines Morgens aus dem Karren, auf dem meine Mutter mit ihren kleinen Kindern und den Sklavinnen lebte, und lief zu den Pferden. Meine Mutter versuchte nicht, mich aufzuhalten. Denn dass sie nach Melanippe auch ihre zweite Tochter an die Steppe verlieren würde, muss ihr schon lange zuvor klar gewesen sein.
Melanippe stand vor dem Zelt, das sie mit einigen anderen Mädchen bewohnte. Sie kämmte ihr Haar aus, das in weizenblonden Wellen über ihren Rücken floss. Als sie mich kommen sah, lachte sie. Ich reckte das Kinn und stapfte barfuß durch das Gras. Meine Mutter hatte mir am Tag zuvor gesagt, ab jetzt dürfe ich zu den Kriegerinnen, sie hatte es mir erlaubt, und als ich an diesem Tag die Augen aufschlug, gab es kein Halten mehr.
Ich wusste, wohin ich gehörte. Und dass Melanippe schon vier Sommer länger hier sein durfte, nahm ich ihr übel. Oh, wie oft hatten sie mich von den Pferden wegholen müssen! Kaum, dass ich laufen konnte, war ich zu ihnen gewackelt, so erzählten sie es mir immer. Einmal hatte ich der falben Stute aus einem Sack Körner geholt, die diese behutsam von meiner flachen Hand nahm. Jeder wusste, dass die falbe Stute ein Biest war, sie trat und biss jeden, der sich ihr nähern wollte. Mich nicht. In mich war sie ganz vernarrt, und wenn sie nicht angebunden war, lief sie mir ganz langsam durchs Lager nach und war lammfromm. Ihre Milch war die beste, die es gab. Im Sommer, als ich ins Kriegerzelt zog, wurde ihr erstes Fohlen geboren, und der kleine falbe Hengst tollte mit mir über die Steppe. Wir waren schon bald unzertrennlich, und nie stieß er mich vom Euter seiner Mutter weg, wenn ich frische Stutenmilch in eine Schüssel melkte. Der Falbe und ich, wir waren Milchgeschwister.
Mein Vater gab diese Geschichten abends am Lagerfeuer mit unverhohlenem Stolz zum Besten, während meine Mutter nur seufzte und den Jüngsten an sich drückte. Der Säugling war noch nicht ein Jahr alt und bekam erst seit Kurzem ein paar zerdrückte Beeren und vorgekautes Dörrfleisch zur Muttermilch.
Maspi war fort, und er fehlte mir. Er war doch immer da gewesen. Ich schlief schlecht in den Sommernächten, die er fort war. Als er nach nicht einmal einem halben Mondlauf mit einigen Kriegern zurückkam, aus dem Sattel sprang und in seinem Zelt verschwand, das etwas abseits von den anderen stand, spürte ich: In Tyras war etwas vorgefallen. Er wollte nicht darüber reden.
Doch ich wollte es.
»Was war da los?« Ich wandte mich an Soslan, den geschwätzigsten der Krieger, der die Zügel von Maspis Braunem aufgefangen hatte und diesen nun absattelte. Soslan war fast so groß wie Maspi, und wenn er lächelte, sah man, dass ihm die oberen Schneidezähne fehlten.
»Was soll los sein?«
»Mein Bruder. Dass er sofort im Zelt verschwindet, ohne uns zu begrüßen. War Tyras kein Erfolg für ihn?«
»Ah, kleine Otrere. Du bist neugierig.«
Ich lächelte, blieb aber vor ihm stehen und wartete. Natürlich war ich neugierig, Maspi war mein Bruder, und ich sorgte mich um ihn. Soslan konnte selten schweigen, wenn ich nur lange genug den Mund hielt.
Er warf einen Blick in Richtung Zelt. »Könnte sein, dass sie ihn in Tyras nicht mit offenen Armen empfangen haben. Damit meine ich nicht unsere Leute. Sie kennen ihn.« Er zuckte mit den Schultern. »Die Achaier. Ionier. Diese Leute, die aus dem Süden kommen und von ihren Steinstädten und Palästen schwärmen. Die ihre rachsüchtigen Götter anbeten und sie mit Tempeln und Altären besänftigen wollen, auf denen sie ihnen ihre halbe Ernte opfern und die kleinen Vasen mit teurem Öl zerschmettern. Sie reagierten voller Furcht auf ihn.«
»Sie hatten Angst?« Ich runzelte die Stirn. »Aber Maspi würde doch keiner Fliege etwas zuleide tun.« Nun, zumindest nicht, wenn er es vermeiden konnte. Mein großer Bruder liebte den Frieden.
»Sie hielten ihn für einen … ah, wie nannten sie es? Kyklop. Einen einäugigen Dämon, der von ihren ältesten Göttern abstammt. Uranos und Gaia. Wobei«, und hier lachte Soslan, »dieser Uranos soll wohl der Sohn von Gaia sein und mit ihm bekam sie diese einäugigen … Ungeheuer.« Er verstummte.
Ich starrte ihn an. Blickte zu Maspis Zelt. »Mein Bruder ist kein Ungeheuer«, sagte ich fest.
»Das weiß ich doch.« Soslan klang unwirsch, zugleich aber seltsam bedrückt. »Aber so haben es die Achaier gesehen. Sie hatten Angst vor ihm. Maspi hat versucht, mit ihnen zu sprechen, aber sie wichen vor ihm zurück. Keiner wollte sich mit ihm abgeben. Darum ist er irgendwann gar nicht mehr aus seinem Gemach gekommen, obwohl ihn die Steinwände verrückt machten. Der Palast deines Onkels ist größer als die meisten Häuser in Tyras, fast so groß wie der des Damokoros, doch wohlgefühlt hat er sich dort nicht.«
»Verstehe.« Ich nickte, obwohl ich nur die Hälfte von dem verstand, was Soslan erzählte. Rachsüchtige Götter? Mütter, die mit ihren Söhnen einäugige Ungeheuer zeugten? Damokoros? Der Begriff sagte mir etwas, so nannten die Achaier den Vorsteher ihrer Siedlung.
Die achaischen Götter waren so anders als unser kleiner Götterkreis. Eine Handvoll Gottheiten, der eine war der Gott des Kriegs, die andere Göttin der Ernte, ein anderer war der Gott der Sonne und des Mondes.
Aber ich wurde neugierig. Rachsüchtig sollten diese Götter sein? Schwer vorstellbar, an sie zu glauben und sich zufrieden ihrem Richtspruch zu fügen. Oder sie mit Opfergaben milde zu stimmen. Ich wollte mehr von diesen Göttern hören. Später.
Nun musste ich erst mit Maspi reden.
Er war immer schon der empfindsamste von uns Geschwistern gewesen. Das lag vielleicht auch an dem, was ihm widerfahren war, als er ein Baby war, das die meiste Zeit auf dem Schoß unserer Mutter schlief. Niemand wusste, was das für eine Krankheit war, die ihn von einem Tag auf den nächsten überfiel. Er fieberte nächtelang, sein Gesicht wurde von einem riesigen, eitrigen Geschwür überzogen, das sein linkes Auge wegfraß, bis nur eine leere Höhle blieb, über der sich wie eine runzlige Blüte die Haut schloss. Die Götter mussten etwas mit ihm geplant haben, das sich unserer Vorstellung entzog, dass dieser kräftige, große Säugling, der erstgeborene Sohn unseres Königs, diese Krankheit überstand und sie ihm dennoch das Auge nahm.
Durch das fehlende Auge konnte er nicht gut in die Ferne blicken. Der Kampf mit dem Bogen war ihm verwehrt. Auch ritt er ungern so schnell und waghalsig wie die anderen Krieger. Wenn die Götter ihm das Leben eines Kriegers hatten nehmen wollen, war es ihnen gelungen. Er hatte sich immer darauf gestützt, eines Tages unserem Vater als König nachzufolgen. Wir alle waren davon ausgegangen, auch ich. Obwohl ich sah, dass er zu sanft dafür war.
Und nun dies.
Als König müsste er auch manche Monde in Tyras leben, jener Stadt an der Flussmündung des Hypanis am Pontus, die neben Skythen auch Thraker, Achaier, Danaer und Ionier beheimatete. Seit der Gründung war die Siedlung mit jedem Jahr gewachsen, und seit einigen Sommern unterhielt mein Vater auch in dieser Stadt einen kleinen Palast. Mein Bruder säße an der Seite unseres Vaters und begegnete all den Würdenträgern anderer Völker.
Und nun fürchteten sie sich vor ihm. Weil sie ihn für ein gottgleiches Ungeheuer hielten, aufgrund des fehlenden Auges und seiner Körpergröße.
Ich lief zu Maspis Zelt. Selbst in der brütenden Stimmung, die ihn nach seiner Rückkehr befallen hatte, fürchtete ich ihn nicht. »Darf ich reinkommen?« Behutsam strich ich über die Zeltklappe. Von drinnen hörte ich ihn knurren. Das war kein Nein, und ich hob die Klappe.
Der Boden von Maspis Zelt war mit einem Teppich ausgelegt, ähnlich denen, die unsere Mutter im Karren liegen hatte. Geknüpft in all den langen, strengen Wintern, die wir in den Zelten auf die erste Frühlingswärme warteten. Ein Muster aus roten, goldgelben und weißen Ranken, die sich ineinander verschlangen. Ich streifte meine Stiefel von den Füßen.
Maspi hockte in der Mitte des Zelts, er hatte mir den Rücken zugewandt.
»Wie ich dich kenne, hast du schon erfahren, dass sie mich hassen.«
»Niemand hasst dich«, widersprach ich.
»Dann verabscheuen sie mich eben. Ist doch egal. Keiner dort will etwas mit mir zu schaffen haben. Schon gar keine Frau.«
Ich stockte.
»Bist du deshalb nach Tyras gegangen?«, fragte ich behutsam. »Weil du dachtest, dort eine Frau zu finden?«
»Die jungen Frauen hier …« Nun drehte er sich doch halb zu mir um, aber mit seiner rechten Seite. »Die sind entweder meine Schwestern oder Kriegerinnen. Oder sie lachen über mich. Jene, die für mich infrage gekommen wären, sind längst mit ihren Familien in Tyras.«
»Niemand lacht über dich«, widersprach ich.
»Na, ich bin eben anders.« Er zuckte mit den Schultern. »Und nun auch noch ein Ungeheuer.«
Ich hockte mich vor der Zeltklappe auf den Teppich. Meine Finger strichen über die roten und weißen Wollfäden. »Magst du mir davon erzählen?«
Maspi zögerte. »Es ist keine erbauliche Geschichte. Ziemlich unrühmlich für mich.«
»Ich möchte sie trotzdem hören.«
Also erzählte er mir. Von der Ankunft an der Seite unseres Vaters. Wie sie durch die Stadt zum Palast ritten. »Ich merkte es sofort. Wie sie uns ansahen. Als ich Vater fragte, ob die immer so starren, blickte er mich fragend an. Er hatte es nicht mal bemerkt, wie sie uns ansahen. Sobald er aber darauf achtete, verfinsterte sich seine Miene. ›Nein‹, sagte er. ›So starren sie nie.‹
Es dauerte, bis ich es begriff – sie starrten mich an. Weil ich so groß bin, dachte ich. Weil mein Pferd so prächtig geschmückt war. Doch je näher wir dem Palast kamen, umso mehr Menschen liefen zusammen. Sie fingen an zu murmeln, sie tuschelten miteinander.« Maspi starrte auf seine Finger. »›Woher kommt das Ungeheuer? Wen hat er da aus der Steppe mitgebracht? Ist er ein Gefangener? Seht nur, er trägt keine Fesseln. Er ist einer von ihnen. Ein Kyklop.‹ Da hörte ich das Wort zum ersten Mal. Ich begriff es nicht. Vater ritt weiter, er ließ sich nicht beirren. Erst als wir den Palast erreichten und von den Pferden stiegen, ergab sich Gelegenheit, ihn zu fragen. Sie halten mich für ein Monster, Otrere.«
»Du bist kein Monster«, erwiderte ich fest.
Ich sah nur sein schönes Gesicht mit dem sanften, braunen Auge und der geraden Nase. Mit dem kantigen Kinn. Er war gutaussehend, die Frauen blickten ihm nach. Zumindest bei uns daheim. Weil sie ihn nicht anders kannten.
Aber dort in Tyras …
»Sogar die Skythen hielten mich für ein Ungeheuer.« Maspi senkte die Stimme. »Nichts konnte ihnen die Angst nehmen. Sie haben zu viele der achaischen Geschichten gehört. Unser Vater hat große Hoffnungen in mich gesetzt. Wir wollen doch ein friedliches Miteinander, und nun … verabscheuen sie mich. Wie soll ich da herrschen? Wenn die anderen mich fürchten, was macht ihre Angst aus dem friedlichen Miteinander? Ich verstehe die Sorge unseres Vaters.«
»Ach, Maspi.«
»Und das ist nicht alles.« Bei der Erinnerung verzog er das Gesicht. »Ich habe nicht gewusst, wie eine Siedlung ist. So viel Stein, Tempel, Paläste und herrschaftliche Häuser mit mehreren Räumen. Ganz anders als Mamai-Gora. Du kennst unsere Siedlungen. Sie sind weitläufig, viel Platz zwischen den wenigen Lehmhütten.« Ich nickte. Meine Besuche dort waren selten, denn mein Vater hatte recht – ich war ein Kind der Steppe. »Unsere Leute halten sich dort Sklaven, die man auf dem Markt kaufen kann wie einen Krug Getreide«, fuhr Maspi fort. »Viele von uns nehmen die Lebensart der Achaier an, dass dir davon ganz übel wird. Sie beten nicht mehr zu unseren Göttern, sondern strömen zu den Tempeln und bringen ihre Opfergaben Zeus und Dionysos, Aphrodite, Demeter, und wie sie nicht alle heißen, dar. Sie zerschlagen kleine Tonkrüge mit teurem Öl auf dem Altarstein und flehen die achaischen Götter um Hilfe an. Es ist verstörend, zu sehen, wie sehr unsere Leute in Tyras vergessen, woher sie kommen.«
Ich spürte all seine Vorbehalte, die in einer Antwort auf die Frage gipfelten, die ich ihm bisher nie gestellt hatte. Er war der Ältere. Unser Vater hatte ihn zuerst mit nach Tyras genommen. Es war die natürliche Ordnung, dass ihm die Nachfolge zustand.
»Wenn du mich vorher gefragt hättest …« Nun zupften auch seine Finger an den Wollfäden. »Ich hätte gesagt, was kümmert mich das Getuschel der Leute, sollen sie reden. Ich bin der Sohn unseres Vaters. Eines Tages folge ich ihm. Nun bin ich da nicht mehr so sicher.« Sein Blick ging ins Leere. Zu gern hätte ich gewusst, was er dort sah.
»Es geht nicht nur um mich. Es geht um uns alle. Kann ich gut über uns herrschen, wenn die Achaier, die Ionier, die Thraker, sogar einige unserer Leute – wenn sie mich fürchten? Oder werden die Konflikte, die ohnehin schon in dieser mit einer Steinmauer umfassten Siedlung spürbar sind, sich in meiner Person vereinen? Sie werden gegen mich sein, vom ersten Tag meiner Regierung an. Ob unser Onkel dann noch lebt und mein Statthalter sein kann? Ich bezweifle es. Er ist sehr krank. Das kommt hinzu.«
Ich schwieg, obwohl die Lösung auf einmal ganz deutlich vor meinem Auge stand. Nur wagte ich nicht, sie in Worte zu fassen und vor ihn auf den Teppich zu legen wie ein Gastgeschenk. Ich fürchtete, er könnte mich auslachen. Dabei wäre es so einfach.
Als Drittgeborene könnte genauso gut ich die Herrschaft über unser Volk übernehmen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein nachgeborener Prinz oder eine Prinzessin dem Herrscher folgte. Ungewöhnlich wäre daran allenfalls, dass es keine schwerwiegenden Gründe gäbe, weshalb Maspi sich zurückzog – außer der Befürchtung, dass seine Herrschaft für uns alle Probleme mit sich brachte.
Weil Maspi weiter finster vor sich hinstarrte und ich diese Anspannung nicht länger aushielt, verlagerte ich mein Gewicht. Genau in dem Moment, als er sagte: »Du könntest es.«
»Was könnte ich?«
»Herrscherin über die Skythen werden.«
Ich schwieg.
»Du kannst das, Otrere«, bekräftigte Maspi und richtete sich auf. Plötzlich schien er von der Idee geradezu beseelt zu sein. »Du bist zur Kriegerin ausgebildet und kannst sie im Kampf anführen. Du hast alles von unserem Vater gelernt, was auch ich kann. Du bist hübsch, sie werden dich lieben! Eine wunderschöne, junge Frau, die unser Vater als seine Nachfolgerin präsentiert? Jeder wäre entzückt. Vater vor allem. Du weißt, wie sehr er dich liebt. Damals hat er dich nach Tyras mitgenommen. Nicht Melanippe, nicht mich.«
»Ja, aber … damals war ich noch ein Kind.« Ich schluckte. Maspis Idee, die ich selbst nicht auszusprechen gewagt hatte – warum eigentlich nicht? Weil ich ihm nichts wegnehmen wollte? Weil ich lieber hier auf der Steppe lebte, statt wie unser Vater mit dem Wechsel der Jahreszeiten nach Mamai-Gora zu ziehen?
»Es ist die beste Lösung. Ich könnte …« Jetzt wurde er ganz aufgeregt, auf seinen Wangen bekam er rote Flecken wie damals, wenn er als Jüngling etwas ausheckte. »Niemand wird etwas dagegen haben.« Maspi klatschte in die Hände. »Das ist die Lösung! Ich werde gleich Vater davon berichten.«
Er wollte aufspringen, doch ich hielt ihn zurück. »Es gibt nur ein Problem«, sagte ich leise.
Er runzelte die Stirn. »Ich sehe keins.«
Ich atmete tief durch. »Mela«, sagte ich leise.
Sie war die Zweitgeborene. Sie hätte vor mir das Recht. Und sie würde es sich nehmen, wenn es ihr angeboten würde.
6
Ich lebte in einem Zelt mit den jungen Kriegermädchen, doch wenn ich Rat suchte, kroch ich auf dem Karren meiner Mutter Barkida unter ihre Decken und schmiegte mich an sie. So auch an diesem Abend.
Da wusste sie schon, dass ich mich erst mal ausruhen musste, und sie strich über meine rötlich braunen Locken, lächelte aufmunternd und ließ mich in Ruhe vor mich hinbrüten. Ihr jüngstes Baby, mein kleiner Bruder Leiorgan, lag in ihrem Arm, ein verzücktes Lächeln auf den Lippen, ein Tröpfchen Milch auf der Wange. Barkida zog die Bänder ihrer Tunika zu. Sie legte den Säugling auf ihren gekreuzten Beinen ab.
»Du hast Kummer«, stellte sie fest.
»Nicht direkt«, erwiderte ich.
»Was ist es dann?«
»Maspi. Tyras. Mela.«
Meine Mutter verstand. »Mit Mazjar hast du noch nicht gesprochen?«
»Was soll er sagen? Maspi will nicht, und Mela darf vor mir … Sie wird das wollen, oder?«
»Und du willst es auch.«
Ich nickte stumm. Sie legte den Arm um meine Schultern. »Ach, Otrere. Du warst immer schon die Ehrgeizigste von euch allen. Vertrau doch darauf, dass Melanippe auch weiß, wo ihr Platz ist.«
»Aber …«
»Deine Schwester wollte immer da draußen sein. Die Steppe ist ihre Heimat. Niemand lebt so sehr mit unserem Land wie sie. Du hingegen …«
Meine Mutter dachte nach.
Mir lag die Steppe ebenfalls im Blut. Zugleich war mir das Lager oft zu klein gewesen. Ich brauchte mehr.
»Du blühst auf, jedes Jahr, wenn wir zum Herbst am Borysthenes zusammenkommen. Weil dort mehr Menschen sind. Das unterscheidet euch. Mela … Ihr geht es besser, je weniger Menschen sie um sich hat.«
Ich nickte. Das war eben auch mein Gefühl. Aber was, wenn Melanippe die Hand hob und die Nachfolge für sich beanspruchte? Ich wusste, einen Machtkampf würde unser Vater Mazjar nicht zulassen, und Melanippe wäre allein aufgrund ihres Alters im Vorteil. Mit gerade mal fünfzehn Sommern würde man meinen Anspruch als einen Witz abtun, zu jung, zu ungestüm, zu früh. Aber ich fühlte mich doch bereit! Ich war viel besser geeignet als Maspi oder Melanippe, eine gute Herrscherin zu sein!
»Du wirst zweierlei tun«, sagte Mutter. »Du wirst dich kleiden wie eine Herrscherin. Vom heutigen Tag an. Und du wirst mit deinem Vater nach Tyras reiten, schon nach dem jährlichen Erntefest. Du wirst dort deinen Anspruch geltend machen, weil du da bist. Weil du königlich bist.«
Ich nickte. Es fühlte sich merkwürdig an. Aber auch so, als hätte ich keine andere Wahl.
Ich wollte die Macht? Dann musste ich nach ihr greifen.
»Sie sind zurück! Sie sind zurück!«
Der Ruf begann irgendwo am Rand des Lagers, er lief in Wellen von den Zelten zu den Karren, die in der Mitte des Lagers verstreut standen. Kinder rannten herbei, die Alten grinsten zahnlos. Die Frauen hielten in ihrer Arbeit inne, sie beschatteten die Augen.
Ich hatte auf einem Holzklotz gesessen und das Zaumzeug des Falben ausgebessert. Er wusste, was ich da tat, und wann immer ihm langweilig wurde, trottete er durch das Lager zu mir und legte mir den Kopf auf die Schulter. Was machst du da?, schien er zu fragen. Ich schob seinen Kopf lachend weg.
Ein Riemen war verschlissen, und ich musste ihn austauschen. Ich ließ die Arbeit sinken und stand auf.
Eine Staubwolke am Horizont. Donnernde Hufe, die den Boden zum Erbeben brachten. Ich entdeckte die Reiterschar. Etwa ein Dutzend Reiterinnen, die sich über die Hälse ihrer Pferde beugten und sie für das letzte Stück anfeuerten. Ein kleines Wettrennen, wer zuerst das Lager erreichte.
Melanippe gewann. Wer auch sonst? Meine Schwester war in allem die Beste. Die Schnellste. Die Größte.
Die Beeindruckendste.
Meine Mutter hatte recht. Wenn Melanippe wollte, wurde sie die nächste Herrscherin über das Volk der Skythen.
Wenn ich sie glauben ließ, dass sie sich aus freien Stücken für eine Zukunft hier draußen entschied … Dann könnte ich das bekommen, wonach ich mich sehnte.
Ich musste es schlau anstellen.
Mit einem Pfiff rief ich den Falben herbei, der sofort angetrabt kam, die Ohren gespitzt, der Blick wach. Mit einer Hand in der Mähne sprang ich auf seinen Rücken. Er liebte es, wenn ich ihn ohne Sattel und Zaum ritt, wenn nur meine Beine um seinen Bauch und meine Hände an seinem Hals ihn lenkten. Ich beugte mich über ihn. »Lauf, so schnell du kannst!«, flüsterte ich ihm zu. Eine Aufforderung, die dieser Hengst kein zweites Mal brauchte. Er stürmte los, direkt auf die Gruppe der Reiterinnen zu, die müde und staubig vor uns auffächerten und uns durchließen.
Nur eine Reiterin wendete ihr Pferd – Melanippe. Ihre weiße Stute war nicht erschöpft, und ich vermutete, meiner Schwester ging es ähnlich. Sie liebte es, sich im Wettkampf mit anderen zu messen, und einem Rennen war sie nie abgeneigt.
»Zu den Kurgans?«, rief ich ihr zu, und sie nickte nur. Sie gab ihrer Stute den Kopf frei, und diese streckte sich über der Ebene. Schon bald donnerten die Hufe von meinem Falben und ihrem Schimmel nebeneinander über die Ebene, die beiden Pferde fanden mindestens so viel Gefallen an diesem Rennen wie ihre Reiterinnen. Schon tauchten vor uns die Hügelgräber unserer Vorfahren auf. Ich gewann mit einer Pferdelänge Vorsprung.
»Das war unfair!«, keuchte Melanippe, als wir unsere Pferde parierten. »Ihr wart ausgeruht.«
»Ich musste ihn ohne Sattel reiten! Du weißt, dass er sich da nicht antreiben lässt.« Ich lachte. Melanippe sah mich von der Seite an und runzelte die Stirn. »Du siehst anders aus als sonst.«
»Findest du?« War es ihr also sofort aufgefallen? Gut so.
»Dein Hemd. Hast du das gewebt?«
Wir wussten beide, wie sehr ich Sticken, Weben und alle anderen häuslichen Tätigkeiten vermied. Aber in diesem Fall nickte ich stolz. »Ich habe den Stoff gefärbt und gewalkt.«
Melanippe lachte. »Und gewebt hat ihn unsere Mutter, die üppigen Stickereien hat sie vermutlich auch aufgenäht und dir zum Geschenk gemacht.«
Ich stimmte in ihr Lachen ein. Natürlich hatte sie recht. Sie durchschaute mich immer.