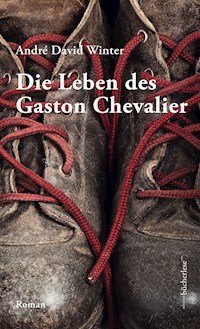Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition bücherlese
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Kind kennt Anina noch keine Grenzen, doch bald schon merkt das ungestüme einfallsreiche Mädchen, dass die Welt im kleinbürgerlichen Elternhaus eng ist. Sie zieht sich in ihre Welten zurück und entdeckt früh ihre künstlerische Begabung, die sie bis an die Akademie nach Paris führen wird. Auch hier erlebt Anina zahlreiche Enttäuschungen, die schließlich zum Abbruch des Kunststudiums führen. Insbesondere verwirrt sie ein Professor mit dem Satz, dass die Kunst etwas über sie wisse, das ihr noch verborgen sei. Diese geheimnisvolle Aussage löst bei ihr panische Angst aus. Enttäuscht und traurig kehrt sie in die Schweiz zurück, begräbt ihre Träume und wird Zeichenlehrerin. Bald schon wird sie von ihrem Jugendfreund schwanger und heiratet, nicht zuletzt in der Hoffnung, die »Kunst« lasse sie nun in Ruhe. Doch Ehe und Mutterschaft bringen ihr weder Glück noch Frieden, irgendwann realisiert sie, dass sie sich um ihr Leben betrügt. So bricht sie erneut auf nach Paris.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FÜR NICOLE
»WIR SIND DIE, DIE WIR SUCHEN.«
INHALT
1989 ZÜRICH
1977 ZÜRICH | HOCHVOGESEN
1989 ZÜRICH
1974 PARIS
1989 GÉRADMER
1974 PULLY | NYON
1990 ZÜRICH
1974 PARIS
1990 ZÜRICH | KLÖNTALERSEE
1964/1965 WALLIS
1990 BÖDMERENWALD | KLÖNTALERSEE
1990 ELSASS
1968 SION
1990 ELSASS | PARIS
1974 FONTAINEBLEAU | PARIS
1990 PARIS
1989 ZÜRICH
Anina drückte auf die Fernbedienung. Das Garagentor öffnete sich. Sie parkierte den Mercedes und stellte das Radio ab. Sie entdeckte das Altglas, das Luc zum Entsorgen hingestellt hatte. Sie stieg aus, öffnete den Kofferraum und stellte die beiden Taschen mit dem Glas hinein. Als sie ihre Zeichenmappe vom Rücksitz nehmen wollte, sah sie die Krümel auf der Rückbank. Am Morgen hatte sie Nathalie auf dem Weg zur Schule einen Schokoriegel hingestreckt, »aber nicht Papa erzählen, unser Geheimnis!«, und ihr dabei verschwörerisch zugezwinkert.
Von Luc bekam Nathalie nie Süßes. Vorsichtig wischte Anina die Schokokrümel in ihre Handfläche und wollte sie eben unters Auto werfen, als sie sich besann und sie hinunterschluckte. Sie kannte Luc. Wenn er die Krümel sähe, würde es wieder endlose Diskussionen geben.
»Anina, wie oft habe ich dich gebeten, Nathalie nichts zwischen den Mahlzeiten zu geben, vor allem nichts Süßes. Es ist frustrierend, wenn die eigene Frau die gemeinsamen pädagogischen Grundsätze hintertreibt, findest du nicht? Und für ein Kind zu kochen, das keinen Hunger hat, macht dir bestimmt auch nicht Spaß.«
Natürlich gab er ihr immer Gelegenheit, etwas dazu zu sagen.
»Unser Dialog ist mir wichtig«, war einer seiner Lieblingssätze. Seit Langem war es meist ein Monolog. Anina sagte nichts mehr. Sie wischte Krümel weg und schluckte sie hinunter. Sie entsorgte Beweisstücke zuunterst im Abfalleimer. Sie zog Nathalie zu warme Kleider und Schuhe an, wenn sie draußen spielte. Sie hatte auch im Sommer immer eine zusätzliche Jacke dabei. Mütze oder Sonnenhut waren Pflicht. Bei der Sonnencreme nur den Testsieger. Nach jedem Ausflug trug sie Nathalie ins Badezimmer und wusch sie gründlich. Spülte nachher den Dreck mit der Brause hinunter und putzte die Wanne. Hast du sie auf Zecken untersucht, Anina?
Anina, hast du daran gedacht …, Anina, hast du es gemacht …, Anina, hast du heute schon gelacht … Lachen ist wichtig, Anina, Kinder lachen bis zu zehnmal mehr als wir, sie können es aber verlernen, wenn wir Erwachsenen nie lachen, wir müssen ihnen da ein Vorbild sein.
Sie lächelte bitter und fühlte sich einmal mehr im goldenen Käfig, in einem Puppenspiel, in dem jeder an unsichtbaren Fäden hing und seine Rolle spielte, seine Scheißrolle. Sie presste die Lippen zusammen, es war unfair, Luc alle Schuld zu geben. Sie waren zusammen da hineingeraten.
1977 ZÜRICH | HOCHVOGESEN
Anina stand zum tausendsten Mal auf, ging ins Bad, tigerte zurück ins Zimmer, schaute unruhig aus dem Fenster, nur um sich wieder an den Tisch zu setzen. Um sich zum tausendsten Mal auf nichts konzentrieren zu können. Sie starrte auf die Tischlupe, sah darunter den von ihr in Originalgröße gezeichneten Riesenbockkäfer, Titanus Giganteus, den die Lupe noch vergrößerte. Ein Vertreter der Bockkäfer aus den tropischen Regenwäldern Südamerikas, der bis zu zwanzig Zentimeter groß werden konnte. Sie wusste nicht mehr, wie viele Stunden sie schon an ihm gearbeitet hatte, sie war noch immer nicht zufrieden, seine schwarzbraune Färbung war entweder zu hell oder zu dunkel, und es fehlte ihm dieser matte Glanz, der ihm seine Schönheit verlieh. Sie setzte sich wieder hin, nahm den Pinsel in die Hand und warf ihn in eine Ecke. Es half alles nichts, heute musste es sein. Sie stand auf. Jetzt gehe ich ins Badezimmer und mache diesen Scheißtest. Ihre Übelkeit konnte alles Mögliche sein, der ganze Druck und Stress der letzten Monate, der immer wieder verschobene Abgabetermin dieses verfluchten Käfers, ihre Diplomarbeit.
Sie riss die Packung auf, setzte sich auf die Schüssel und hielt das Stäbchen in den Urinstrahl. Sie schloss die Augen, wartete, bis sie es nicht mehr aushielt.
Sie starrte auf die beiden Striche in ihren Händen.
»Oh Gott, nein, nein, nein«, wimmerte sie.
Das Stäbchen fiel aus ihren zitternden Händen.
Das ist unmöglich, es ist nicht wahr, es ist einfach nicht wahr. Sie griff nach dem Stäbchen. Zwei Striche, zwei verdammte Striche. Sie schüttelte den Kopf.
»Nein, nein, das kann nicht sein.«
Einen Moment überlegte sie, ob sie noch einen Test machen sollte.
Sie hielt den Kopf über die Schüssel, würgte, es kam nichts. Sie zog sich hoch, schwankend ging sie ins Wohnzimmer, riss das Fenster auf, starrte hinaus in den Garten. Ein wunderschöner Tag. Irgendwo sang eine Amsel, eine sanfte Brise streifte die Baumwipfel im Nachbargarten, der ans zerfallene Haus daneben grenzte. Sie sah sogar den Schriftstellernachbarn, der nicht mehr schrieb. Schade, seine Bücher gefielen ihr. Er hatte, wie oft, eine erloschene Zigarre im Mund, zumindest sah sie keinen Rauch. Er schraubte an irgendetwas herum, sie sah nicht, was es war, weil er davorstand. Plötzlich drehte er sich um und ging zurück zum Haus, wie immer in Gedanken vertieft, als sammle er Stille. Jetzt sah sie, was er machte, er baute ein Hotel für Wildbienen, Osmia bicolor. Er kam zurück, verschwand immer wieder zwischen den Bäumen, diesmal brannte die Zigarre. Stumpen sagte er dazu, das sind doch nur Stumpen.
Tu was, Anina, mach was.
Sie schaute zum zerfallenen Haus hinüber, genauso fühlte sie sich jetzt. Durch die zerbrochenen Fenster hatte sie lange kaum ins Innere zu blicken gewagt. Immer hatte sie dabei das Gefühl gehabt, etwas Anstößiges zu tun. Letzten Sommer hatte das Haus einen Bewohner, einen Landstreicher. Sie hatte ihn nur einmal gesehen, aber täglich den Porzellangarten, den er angelegt hatte, bewundert. Er hatte Tassen, Krüge und Schüsseln auf die Veranda gestellt, sie mit Erde gefüllt und darin alles Mögliche gepflanzt. Kosmeen neben Steinkraut, Klematis und Margeriten, aus Sektgläsern blühte Mohn. In einer Suppenschüssel zog er Tomaten, in einem Topf Bohnen, aus einer Pfanne wucherten Zucchini. In die Mitte der Veranda hatte er einen großen Uhrenkasten gestellt. Eine Meise hatte ihn zu ihrem Nest umgebaut.
Mach etwas, Anina.
Ich muss hier raus, zu Luc, er muss es wissen. Ich muss es ihm sagen, er wird mir helfen. Sie ging in die Küche, ließ Wasser laufen, hielt die Hände unter den Strahl, benetzte die Stirn, den Nacken. Nahm ein Glas von der Spüle, füllte es mit Wasser, trank. Dann schlüpfte sie in ihre Schuhe. Sie sah ihr Gesicht im Garderobenspiegel und bemerkte erst jetzt, dass sie geweint hatte. Mit einem Taschentuch wischte sie Tränen und zerlaufene Mascara weg.
Luc hatte noch am selben Tag einen Termin beim Arzt arrangiert, der die Schwangerschaft bestätigte. Sie hatte keine Ahnung, wie er das geschafft hatte. Danach hatte sie es nicht mehr ausgehalten in der Wohnung, es war alles zu klein, zu eng, zu nah, zu viel.
Bring mich hier weg, hatte sie gefleht. Wohin? Egal wohin, einfach weg, nein, nicht egal, nach Frankreich, ja, nach Frankreich. Paris, hatte er gefragt. Einen Moment hatte sie überlegt, nein, nicht Paris, aber Frankreich. Er hatte nur genickt, sie hatten in aller Eile eine Reisetasche gepackt, waren in den alten Renault gestiegen und einfach losgefahren. Wohin fahren wir, hatte sie irgendwann gefragt. Ich weiß, wohin, mach dir keine Sorgen, hatte er gesagt.
Anina lehnte sich an einen Stamm. Sie mussten irgendwo in den Hochvogesen sein, aber sie hatte keine Ahnung, wo genau. Müde schaute sie in die Krone hinauf – keine Blätter, natürlich, es war Ende Januar. Sie schloss die Augen und fragte sich, ob sie noch irgendetwas wusste. Sollte sie weinen oder glücklich sein, oder beides, oder keins von beidem. Sie wusste es nicht.
Sie wusste nur, dass sie allein sein wollte. Luc war so liebevoll zu ihr, dass sie ihn kaum ertrug. Noch vor der Dämmerung war sie von der kleinen Pension aus losgelaufen, in die sie geflüchtet waren. »Sie sind schwanger.«
Sie hatte geweint, als der Arzt es ihr gesagt hatte. Er hatte sie aufmunternd angelächelt.
»Das wird schon, Sie bekommen von mir ein Zeugnis. Machen Sie ein paar Tage frei und bringen Sie Ordnung in ihre Gedanken.«
Dann hatte er sie ernst angeschaut.
»Falls Sie sich dagegen entscheiden, gibt es da Adressen. Aber damit wir uns recht verstehen, das habe ich Ihnen nicht gesagt.«
Sie hatte Luc keine Nachricht hinterlassen, er suchte sie bestimmt schon.
Endlich brach die Sonne durch den Nebel. Vor ihr eine Wiese, gefrorene Kuhfladen, viele Maulwurfshügel. Sie atmete tief ein. Die frisch aufgeworfene Erde dampfte und duftete nach Frühling, nach Neuanfang, nach Nestbau. Sie blickte zum Waldrand auf der anderen Seite. Haselnussstauden, an denen bereits gelbe Kätzchen hingen. Dahinter junge Bäume. Der Reif auf den Zweigen ließ den Hain wie einen Zauberwald aussehen. Sie sah sich umgeben von Wald und Wiesen. Vor Stunden hatte sie das letzte Haus gesehen. Hier war sie allein. Sie seufzte. Nie mehr würde sie allein sein. Noch einmal sog sie die Luft tief ein.
Sie trat auf die Wiese hinaus, ein Eichelhäher flog auf.
Zieh dir die Schuhe aus, Anina, lauf über die Wiese, wie früher, nein, lass das, du holst dir eine Erkältung. Fängt es so an? Mit Zweifeln und Ängsten, Vernunft, Verstand. War sie über Nacht erwachsen geworden? Endlich, würde ihr Vater sagen. Oder wurde sie es jetzt? Genau jetzt, wenn sie die Schuhe nicht auszog.
Als Luc ihr gestern Abend den Joint hinhielt, war ihr schon beim Gedanken, ihre Lungen mit diesem Rauch zu füllen, schlecht geworden.
Sie setzte sich auf die Wiese, zog die Schuhe aus – die Socken behielt sie an – und legte sich auf den Boden. Bereits nach kurzer Zeit spürte sie die Kälte in ihren Körper dringen. Ihr Körper gehörte nicht mehr ihr allein. In ihr wuchs, fingerhutgroß, ein Mensch. In knapp acht Monaten wäre sie Mama. Ihre Mutter war fast gleich alt gewesen, als sie sie bekam. Wollte sie das, Mama werden? Wollte sie eine kleine Anina? Sie schüttelte den Kopf, das nasse Gras kitzelte sie im Nacken.
»Nein, nein …«, schluchzte sie und schloss die Augen. Sie sah sich von weit oben hochschwanger auf der Wiese liegen. Ihr Bauch war riesig, er wölbte sich wie ein Ballonbauch, sie war ein Ballonbauch, der immer größer wurde. Ihre Beinchen und Ärmchen zappelten hilflos an ihrem monströsen Körper. Sie versuchte mit diesem Riesenbauch aufzustehen. Irgendwann schaffte sie es, hochzukommen, doch das Gehen fiel ihr schwer, das Atmen noch schwerer. Sie sah aus wie eine dieser russischen Puppen, ihr fiel nicht ein, wie sie hießen. Genauso fühlte sie sich. In ihr war eine klitzekleine Puppe, die immer größer wurde. Sie selbst war einmal eine gewesen, in ihrer Mutter und diese in ihrer und die wieder in ihrer, Mutterpuppe, Puppenmutter. Ihr wurde schwindlig. Sie öffnete die Augen, setzte sich auf und hielt die Hand auf ihren Bauch.
»Und wenn du ein Junge bist?«, flüsterte sie und merkte, dass sie zum ersten Mal mit ihm oder ihr sprach.
Anina stand auf und spürte die Nässe der Wiese in den Socken. Sie zitterte vor Kälte.
»Scheiße«, sagte sie laut und entschuldigte sich bei ihrem Ungeborenen.
Sie zog die Schuhe an und ging so schnell sie konnte in den Jungwald hinein. Weißer Reif bedeckte die Blätter, die auf dem Boden lagen, und ließ ihre feinen Adern leuchten. Die Zweige glitzerten, als wären sie aus Licht gemacht. Nur an den Stämmen war die Rinde zu sehen, auf denen tausend kreisrunde Flechten sie wie aus tausend Augen ansahen.
Sie spürte, was sie so lange nicht mehr hatte spüren wollen. Die Augen, die sie sehen.
»Sehen Sie, dass Sie gesehen werden«, hatte Professeur Perrot gesagt.
Sie hatte lange nicht mehr an ihn gedacht. An Paris, an Pralina, die Akademie und die Kunst. Was hatte sie nicht alles gemacht, um sie zu vergessen. Und jetzt stand sie wieder in einem Wald in Frankreich wie Corot und Perrot und sah, dass sie gesehen wurde.
In mir ist jemand. Plötzlich wusste sie, dass sie es behalten würde. Dass sie eine Mutterpuppepuppenmutter werden würde.
Sie trat aus dem Zauberwald. Es dunkelte schon, als sie die kleine Pension erreichte. Wie sie zurückgefunden hatte, wusste sie nicht. Unterwegs hatte sie immer wieder das Gefühl, als wäre da noch etwas. Anina hörte Zweige knacken, einmal glaubte sie, das Hecheln eines Hundes zu hören, ganz nah. Ruhig, Anina, das bildest du dir nur ein. Sie blieb stehen, blickte gebannt ins Unterholz. Da war nichts, nur eine Amsel, die in den Blättern raschelte. Sie suchte nach einem Stock, fand keinen.
Mit der kleinen Puppe wuchs eine Angst in ihr. Sie war noch klein, doch sie wuchs. Unsichtbar spürbar.
Luc erschrak, als er sie sah. Ihre Lippen waren blau, die Haare weiß vom Raureif, und sie zitterte. Er stellte keine Fragen, schimpfte nicht, machte ihr keine Vorwürfe, er nahm sie nur in die Arme und hielt sie fest.
»Du willst es, nicht wahr«, sagte er. Sie nickte und weinte.
»Dann ist gut, für mich ist es gut«, sagte er und weinte auch.
Zurück in Zürich, ging sie in ihre Lieblingsbuchhandlung, in der handverlesene Bücher unter einem eleganten Kronleuchter lagen. Der junge Buchhändler, ein Walliser, der auch einen eigenen kleinen Verlag hatte, sprach über Bücher mit einer Begeisterung wie andere über ihre Kinder. Natürlich war er nicht auf Schwangerschafts- und Elternliteratur spezialisiert und wohl auch ein wenig überrascht, als sie ihn danach fragte, aber er beriet sie wie immer sehr freundlich.
»Für meine Kundinnen mache ich mich gerne kundig«, sagte er und versprach ihr, eine Auswahl zu bestellen.
Die ersten fünf Bücher verschlang sie in wenigen Tagen. Als sie das letzte zuklappte, wusste sie, dass es ein Fehler war, sie gelesen zu haben, aber auch, dass sie noch mehr lesen würde. Es gab so vieles, was sie falsch machen konnte. Eigentlich alles. Sie ging zu spät ins Bett und stand zu früh auf, ihre Schultage waren zu stressig und ihre Freitage zu müßig, sie traf sich mit den falschen Leuten an den falschen Orten – zu schmutzig, zu laut, zu verraucht –, sie ernährte sich zu ungesund und zu unregelmäßig, trank zu viel Alkohol und zu wenig anderes, rauchte und kiffte definitiv zu viel, war zu selten draußen an der frischen Luft, bewegte sich zu wenig, stritt zu viel mit Luc, ihren Eltern und allen möglichen Leuten, regte sich zu oft und zu sehr auf, hörte die falsche Musik, überanstrengte ihre Augen beim Zeichnen, fuhr zu unvorsichtig mit dem Fahrrad. Einzelne Sätze aus den Büchern hafteten wie Kletten an ihr, vielleicht, weil sie sie so hasste. »Emotionale Schwankungen sind hormonell bedingt und gehören zu ihrer Gravidität, sprechen Sie mit Ihrem Partner darüber.« Sie musste mit Luc nicht darüber sprechen, er spürte es jeden Tag. Sie schrie ihn noch mehr an, er tat ihr noch mehr leid. Der Satz: »Genießen Sie die glücklichste Zeit Ihres Lebens, sie geht so schnell vorbei«, kam ihr immer in den Sinn, wenn ihr schon am Morgen übel war und sie daran dachte, ob sie heute ihren Tagesrekord beim Erbrechen übertreffen würde. Ihr Lieblingssatz war, dass sie sich nicht zu viele Gedanken über ihre Schwangerschaft machen sollte. »Grübeln Sie nicht zu viel und, vor allem, lesen Sie nicht zu viele Bücher, es wird Sie nur verunsichern. Ihr Körper zeigt Ihnen den Weg«.
1989 ZÜRICH
Die Schwangerschaft und später die Geburt und das Leben als Kleinfamilie hatten sie definitiv verändert. Angefangen hatte es jedoch bereits in Paris.
Ihre »gemeinsamen pädagogischen Grundsätze« waren Lucs Grundsätze. Zu denen sie sich zu Beginn noch geäußert und die sie sich bald schweigend angehört hatte, ebenso wie seine Vorträge über zeitgemäße Erziehung.
»Kein Laisser-faire, Anina, bitte. Ja, ich hatte auch meine Hippiephase, ich weiß, postpubertäre Adoleszenz eben. Aber glaub mir, nichts hat Kindern mehr geschadet als die Sünden der Siebzigerjahre und die Kuschelpädagogik. Waldorfschule, wenn ich das schon höre, ich bitte dich! Da lernen sie vielleicht schweben, aber nichts fürs Leben. Diese Kinder sind doch völlig verloren. Ein natürlicher Wettbewerb fordert und fördert. Das war bei mir genauso, auch wenn ich es lange nicht wahrhaben wollte. Ich sehe es jeden Tag in meiner Schule. Halt geben, ja, aber auch Halt sagen. Grenzen setzen. Meinst du, irgendwer wird Nathalie später fragen, wie sie es denn bitte schön gerne hätte? Oder die Mozart-Partituren abändern, weil sie für sie zu schwierig sind. Setz ihr bitte keine Flausen in den Kopf. Sie wird es später nur schwerer haben, das weißt du genauso gut wie ich.«
Sie war es so müde, sie war so müde.
Im Briefkasten waren Rechnungen, Kataloge und Modezeitschriften. Dazwischen lag ein Brief. Ihr Name stand in großzügig geschwungenen Buchstaben auf einem bunten Umschlag. Die Schrift hatte etwas Künstlerisches. Aber sie kannte keine Künstler oder Künstlerinnen, nicht mehr. Anina hatte den Kontakt zu ihren Mitstudierenden von der Kunstgewerbeschule schon während der Schwangerschaft auf ein Minimum reduziert und nach dem Studium ganz abgebrochen. Auch zu ihren Kommilitonen der Pariser Akademie hatte sie keinen Kontakt mehr. Sie rief niemanden an, schrieb niemandem zurück, entschuldigte sich bei zufälligen Begegnungen, sie müsse leider weiter, ein wichtiger Termin, du weißt schon.
Die meisten ihrer Bekannten waren Grafiker oder Lucs langweilige Lehrerkollegen und ein paar Leute aus der Verlagsbranche.
Sie dachte daran, dass der Brief wohl eine geschickt gemachte Werbesendung war, und wollte ihn schon wegwerfen. Dann hielt sie ihn doch gegen die Deckenlampe. Er war von Hand geschrieben.
Sie steckte ihn in die Innentasche ihres Mantels. Einer deiner Verflossenen, würde Luc spöttisch bemerken, dabei wusste er genau, dass er der Erste und Einzige war. Bis vor Kurzem wenigstens, aber das wusste er nicht, noch nicht. Sie überlegte kurz, ihm sofort alles zu sagen, noch heute, und entschied sich dagegen.
Sie hatte gewusst, dass er vor ihr mit anderen Frauen geschlafen hatte, und immer vermutet, dass er in der Zeit, in der sie in Paris war, nicht damit aufgehört hatte. Aber darüber schwiegen sie, wie über alles, was mit Paris zu tun hatte. Sie hatte es so gewollt. Okay, was war, das war, hatte er gesagt. Damit war das Thema für sie beide erledigt. Sie nickte, was war, das war! Sex war auch mal. Der war am Anfang richtig gut gewesen. Luc hatte eine kleine Studentenbude in Zürich-Höngg, wo sie ihn oft besuchte. Sie kifften zusammen, hatten Sex unter der Dusche, auf dem Teppich, dem Küchentisch, im Hauseingang. Das Klopfen der Nachbarn hatte sie noch mehr angetörnt. Jetzt kam es alle paar Monate dazu, wenn überhaupt, und aufregend war es schon lange nicht mehr. Sie hatte Zellulitis und Schwangerschaftsstreifen, ihre Brüste waren froh um den Push-Up-BH, er hatte Röllchen am Bauch, erste graue Haare im Bart, und sein Haaransatz verschob sich nach hinten.
»Hallo Schatz, wie war dein Tag?«, war der Standardsatz, mit dem Luc sie empfing.
»Er war leider noch nicht«, drohte zu ihrem zu werden.
»Ich muss noch Maturaarbeiten korrigieren. Hast du schon was gegessen?«, sagte er.
Sie nickte nur und hängte ihren Mantel auf.
»Ich kam auch zu nichts, hundert Telefonate wegen des neuen Buchs.«
Nachdem sie Nathalie ins Bett gebracht hätten, würden sie wohl beide wieder in ihren Arbeitszimmern sitzen. Mittlerweile sahen die meisten ihrer Freitagabende so aus. Samstag- und Sonntagabende waren mal heilig gewesen, aber seit Anina im Verlag arbeitete und er seinen Schulleiterlehrgang machte, war auch das Geschichte.
»Wo ist Nathalie?«
»Sie ist zu Rebekkas Geburtstagsfest eingeladen, vergessen? Aber sie wird jeden Moment kommen.«
Das Telefon klingelte.
»Nicht schon wieder«, sagte er entnervt.
Er ging in sein Arbeitszimmer, nahm ab, Anina verstand nicht, was er sagte. Zurück im Wohnzimmer meinte er nur:
»Monika hat angerufen, ob es okay sei, wenn Nathalie noch bei ihnen isst, damit sie nicht in den Feierabendstau kommt.«
Anina nickte nur. Schade, sie hatte sich den ganzen Tag auf sie gefreut und sich vorgestellt, wie sie ihr entgegenrennen würde. Jetzt würde sie wohl im Auto einschlafen, und Luc würde sie, wie so oft nach einem langen Tag mit Klavier-, Ballett- oder Nachhilfeunterricht, in ihr Zimmer tragen.
»Ich rauche noch eine Zigarette.«
Diesmal nickte Luc.
Sie nahm ihren Mantel von der Garderobe. Draußen war es recht kühl. Sie schlug den Kragen hoch und suchte nach den Zigaretten. Zündete sich eine an und zog den Brief aus der Innentasche. Nachdenklich betrachtete sie die Schrift. Dann riss sie den Umschlag auf – auch das Papier war bunt – und sah, dass er auf Französisch geschrieben war:
Géradmer, Villa Monplaisir
Salut Anina,
Wir laden Dich mit Kind und Kegel in die Villa Monplaisir ein, ummeinen Geburtstag zu feiern.
Wir freuen uns, mit Euch und anderen eine Fünf zu meinenDREISSIG Jahren zu legen, aber erzählt niemandem, dass ichschon so alt bin!
Es darf gehüpft und gesprungen werden. Anmeldung nicht nötig, einfach kommen, und falls Ihr die gute Laune nirgends findet, kein Problem, Ihr könnt von unserer haben.
Gekringelte Rauchzeichen
Nathalie (Pralina) – Erinnerst Du Dich?
Jules & Louise & Manon
PS: Ich würde mich riesig freuen, Dich endlich mal wieder zusehen.
Bitte komm!!! Übernachtung ist kein Problem, unser Haus ist groß.
Der Brief fiel Anina beinahe aus den Händen. Natürlich erinnerte sie sich. Nathalie Dupré, Pralina, ihre beste Freundin in Paris. Auch zu ihr hatte sie jeglichen Kontakt abgebrochen. Wie hatte sie sie nur gefunden? Und wie war sie in den Vogesen gelandet, ausgerechnet in Géradmer? Seit ein paar Jahren fuhren sie dort in die Winterferien. Die Villa Monplaisir war nur einige hundert Meter von ihrer Ferienwohnung entfernt. Sie waren, ohne es zu wissen, Nachbarinnen gewesen. Wie in aller Welt hatte es Nathalie geschafft, in diesem wunderbaren alten Haus zu wohnen? Egal, sie würde auf keinen Fall an dieses Fest gehen. Sie hatte einen Mann, ein Kind. Sie hörte Pralinas Vorwürfe, dass sie damals einfach aus Paris abgehauen war, ohne ein Wort zu sagen. Sie hatte zu große Angst gehabt, Pralina würde sie zurückhalten. Ihr Leben wäre anders verlaufen. Schlimmer, hatte sie damals gedacht, jetzt war sie sich nicht mehr sicher. Konnte es schlimmer sein als das traurige Theater, das Luc und sie einander jeden Tag vorspielten? Guten Morgen, gut geschlafen, es geht, und du, na ja, auch schon besser, also bis am Abend, einen schönen Tag dir, ja, danke, dir auch – bis in alle Ewigkeit.
Und was sollte sie ihr sagen, wenn sie sich wiedersähen. Hallo, tut mir leid, dass ich damals einfach auf und davon bin, es ging nicht anders, aber immerhin habe ich meine Tochter nach dir benannt, sie heißt Nathalie wie du, reicht das als Entschuldigung?
Sie wollte den Brief eben zerknüllen, als Monikas Auto auf den Parkplatz fuhr. Sie ließ ihn zurück in die Tasche gleiten.
Es war, wie sie gedacht hatte, Nathalie war im Auto eingeschlafen, Luc hatte sie in ihr Zimmer getragen und ins Bett gebracht. Sie hatte sich an den Computer gesetzt, konnte aber keinen klaren Gedanken fassen. Sie dachte die ganze Zeit an den Brief. Irgendwann gab sie auf und wünschte Luc eine gute Nacht. Er schaute von seinen Maturaarbeiten auf und sah sie überrascht an.
»Alles in Ordnung bei dir, so früh bist du schon lange nicht mehr ins Bett gegangen.«
Sie rieb sich die Stirn.
»Mmh, nur Kopfschmerzen.«
Sie gab ihm einen flüchtigen Kuss, aber er schien es nicht zu merken.
»Bis morgen.«
»Ja, bis morgen, schlaf gut.«
Natürlich fand sie keinen Schlaf. Sie dachte an den Tag, an dem sie Pralina kennengelernt hatte. Nach der Vorlesung von Professeur Perrot. Sie sah sein altes Gesicht. Noch immer schmerzte es, an ihn zu denken.
1974 PARIS
»Warum sind Sie hier? Warum wollen Sie, nein, warum müssen Sie malen? Wollen Sie, dass man Sie sieht oder dass man Ihre Bilder sieht? Corot, der wohl bedeutendste Landschaftsmaler Frankreichs, blieb im Hintergrund. Er war bescheiden, wollte einfach malen. Als alter Mann sagte er, er hoffe von ganzem Herzen, dass er im Himmel weitermalen könne. Wer so etwas sagt, muss malen. Etliche von Ihnen kennen wohl nicht mal seinen Namen. Unwichtig, das schmälert seinen Ruhm und seine Bedeutung für die Kunst in keinster Weise.«
Professeur Perrot, der Leiter der Kunstakademie, machte eine kurze Pause, stützte sich aufs Katheder und fragte eine Studentin, die vor ihm saß.
»Wollen Sie auch im Himmel weitermalen? Müssen Sie es?«
Die junge Frau wurde rot und nickte verlegen.
»Nun gut, wir werden sehen«, sagte er abwesend und wandte sich wieder ans Publikum.
Anina war froh, nicht vorne zu sitzen. Sie hatte schon von Perrot gehört, davon, wie er ganze Karrieren mit einem Satz oder nur mit seinem Schweigen auslöschte.
Er blickte ins Auditorium.
»Viele, die hier studierten, mussten es, sie mussten malen, sie konnten nicht anders. Deshalb kennt man ihre Namen. Viele wollten es nur, niemand kennt sie.«
Er machte eine Pause.
»Kunst weiß etwas über Sie, was Sie nicht wissen. Wollen Sie es wissen?«, fragte er in die Runde und zeigte mit seiner Linken auf das monumentale Rundgemälde hinter sich.
»Paul Delaroche hat die Arbeit an diesem siebenundzwanzig Meter langen Gemälde 1837 begonnen. Er malte vier Jahre daran, vier Jahre. Hat jemand von Ihnen schon, nun, ich denke nicht.«
Er räusperte sich.
»Im Stil von Raffaels Schule von Athen stellte er fünfundsiebzig Maler, Bildhauer und Architekten aller Epochen dar, die damals als Kanon der bildenden Künste gesehen wurden. Wer von Ihnen wird der Paul Delaroche unserer Zeit sein? Und wer von Ihnen wird von ihm verewigt werden?«
Wieder ließ er seinen Blick über die Reihen schweifen.
»In hundert Jahren werden wir es wissen«, er schmunzelte, »wir haben also noch ein bisschen Zeit. Und vergessen Sie nicht, allein schon, dass Sie hier sitzen, gibt Anlass zur Hoffnung. Ihre Arbeiten wurden geprüft, Sie haben sich als würdig erwiesen, in die École Nationale Supérieure des Beaux-Arts aufgenommen zu werden. In vier Jahren, die Zeit, die Delaroche für sein Bild brauchte, werden Sie wieder geprüft, wenn Sie dann noch hier sind. Nutzen Sie Ihre Zeit gut und denken Sie dabei immer daran, ob hässliche Kunst wirklich nötig ist. Fragen Sie sich das immer wieder. Es hängt allein von Ihnen ab, ob Sie wieder zur Prüfung zugelassen werden. Tun Sie alles, um sich dann erneut als würdig zu erweisen und Ihr Diplom in Empfang zu nehmen. Genug geredet, an die Arbeit, gehen Sie in Ihre Ateliers, gehen Sie, nein, laufen Sie, rennen Sie.«
Professeur Perrot stieg vom Katheder und rannte, trotz seines Alters, beinahe aus dem Saal.
Anina erhob sich wie alle anderen, um in ihr erstes Atelier zu gehen. Sie sah viele, die rannten und sich vorwärtsstürmend in die Seite pufften.
»Schnell, Poitier, komm, sonst stehst du nie neben da Vinci«, rief einer und knuffte seinen Kommilitonen.
»Ich bin schon auf Delaroches Bild, du hast mich nur nicht gesehen, weil da Vinci mich verdeckt«, lachte der Kollege und rannte noch schneller.
Andere überholten Anina, ohne eine Miene zu verziehen, es schien ihnen todernst zu sein damit, keine Zeit zu verlieren.
»Père Perrot hat sich mächtig ins Zeug gelegt, mehr Pathos geht nicht«, sagte eine Mitstudentin, die neben ihr ging.
Anina nickte nur.
»Erstsemesterin?«, fragte die Studentin.
Sie nickte erneut.
»Weißt du, warum man ihn Père Perrot nennt?«
»Nein, keine Ahnung.«
»Eine Anspielung auf Corots Spitznamen, Père Corot. Und er malt genau wie dieser.«
»Das habe ich gehört.«
»Er zitiert ihn ständig, für Perrot ist Corot der Größte. Es gibt nur ihn und alle, die vor ihm waren. Er unterrichtet, als hätte es Impressionismus, Expressionismus, Kubismus und Surrealismus und alle anderen Ismen nie gegeben. Moderne Kunst perlt an ihm ab. ›Marcel was‹, soll er zu einem Studenten gesagt haben, als er ihn auf Marcel Duchamp ansprach. So wie er malt heute keiner mehr, zumindest keiner, den man kennt. Bist du in seinem Kurs eingeschrieben?«
»Ja, aber erst in zwei Wochen.«
»Dann bonne chance. Wollen wir zusammen essen?«
»Gerne. Um zwölf in der Mensa?«
»Mein Atelier geht bis halb eins.«
»Auch gut.«
»Du bist nicht aus Paris, dein Akzent verrät dich, Elsass?«
Anina schüttelte den Kopf.
»Schweiz.«
»Dann hat dein Vater bestimmt eine Bank.«
»Nein, sogar zwei, oder drei, ich weiß nicht mehr genau.«
»Du gefällst mir, wie heißt du?«
»Anina, und du?«
»Pralina.«
Anina streckte ihr die Zunge raus.