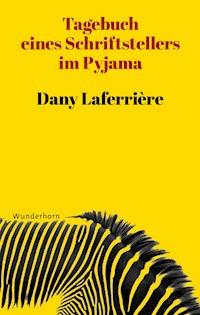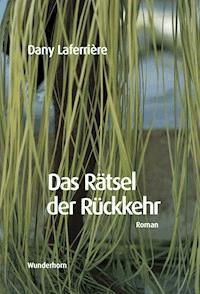Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Das Wunderhorn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Anfang der 1980er Jahre in Montreal: Zwei arbeitslose schwarze Migranten hausen zusammen in einer versifften Einzimmerwohnung in der Rue St. Saint-Denis, mitten in der Altstadt. Der eine liegt auf der Couch, hört den ganzen Tag Jazz, liest im Koran und zitiert Freud. Der andere schreibt auf dem ihm einzig wichtigen Besitz, seiner Remington 22 . Das nächtliche Klappern der Tastatur weckt die Neugier der weißen Studentinnen der angesehenen McGill-Universität und die bildungshungrigen Bürgertöchter werden zu Dauergästen in der Bude der Habenichtse. Für die beiden Freunde sind sie alle eine »Miz«. Miz Literatur, Miz Snob, Miz Sophisticated Lady, Miz Suizid … und aus dem Versuch, sich einen Reim darauf zu machen - unter Befragung der literarischen Tradition jeglicher Couleur -, wächst der Roman in einer souveränen, gewitzten Sprache, wird aus dem exotischen Lover ein Autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Übersetzerin dankt dem Freundeskreis Literaturübersetzer e.V. für ein Arbeitsstipendium, das vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg ermöglicht wurde.
Titel der Originalausgabe:
Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer
Erstveröffentlichung 1985 © Dany Laferrière, 2015 © Editions
Grasset & Fasquelle, 2016
© 2017 Verlag Das Wunderhorn GmbH
Rohrbacher Straße 18
D-69115 Heidelberg
www.wunderhorn.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Gestaltung & Satz: Leonard Keidel
Druck: NINO Druck GmbH, Neustadt / Weinstraße
eISBN: 978-3-88423-568-3
Die Kunst, einen Schwarzen zu lieben ohne zu ermüden
Dany Laferrière
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Sie müssen sich einen jungen Mann von 23 Jahren vorstellen, der in Port-au-Prince in einem Viertel der Unterstadt zusammen mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinen Tanten lebt. Seit ich denken kann, bin ich von Frauen umgeben. Sie bildeten einen Ring, um mich vor den Klauen der Bestie zu schützen. Die Bestie war der Diktator. Er war so grausam, dass er zu einer Märchenfigur wurde. Papa Doc, so hieß er, hatte meinen Vater ins Exil geschickt, als er Anfang Dreißig war. Seither kann meine Mutter nicht mehr atmen, nicht mehr gehen, sie kann nicht mehr essen und nicht mehr schlafen wie zuvor. Ich ertappe sie manchmal, wie sie im Dunkeln mit einem unsichtbaren Mann redet, der gerade ausgehen will, um die gleiche Zeit wie mein Vater einst zu seinen Parteifreunden ging, und sie erinnert ihn daran, dass er Brot und Milch mitbringen soll für das Frühstück der Kinder am nächsten Morgen. Nach dem Weggang meines Vates verschlechterte sich unsere finanzielle Situation erheblich. Meine Mutter sah ihre Mission darin, uns in die besten Schulen des Landes zu schicken. Wir hatten nicht jeden Tag zu Essen, aber wir bekamen eine gute Bildung, das musste sie meinem Vater versprechen, bevor er ging. Die Haitianer setzen alles auf die Bildung. Schon früh, mit etwa achtzehn Jahren, schloss ich mich einer Gruppe junger Journalisten an, die das Ziel hatten, der Macht ihren Nimbus zu rauben. Die Methode war einfach: es genügte, die Wahrheit über die Zustände in Haiti zu sagen. Es dauerte eine Weile, bevor das Regime darauf reagierte, indem es einige Journalisten einsperrte, und einen meiner Freunde, Gasner Raymond, hinrichtete. Er war genauso alt wie ich und als ich erfuhr, dass ich der Nächste auf der Schwarzen Liste war, ging ich sofort ins Exil nach Montreal.
Ich kam in eine Stadt in vollem Aufschwung, denn in diesem Jahr 1976 finden hier die Olympischen Spiele statt. Auf allen Bildschirmen sehen die Zuschauer bezaubert einer kleinen rumänischen Turnerin zu, die ihre akrobatischen Übungen mit so viel Anmut ausführt, dass die Punktrichter ihr nur die Note höchster Perfektion, die 10, geben können. Doch ist das so unerhört in der Geschichte der Spiele, dass die digitalen Anzeigetafeln sie gar nicht anzeigen können. Am Abend meiner Ankunft sitze ich bereits in einem kleinen Jazzclub des Stadtzentrums, dem Soleil Levant, wo Dizzy Gillespie und Nina Simone auftreten. Der Clubbesitzer Didi Boicel, ein Dichter und Koch aus Guadeloupe, umgibt mich wieder mit der karibischen Küche, so dass ich fast den Eindruck habe, gar nicht weggegangen zu sein. Aus meinem Winkel in dem kleinen überhitzten und verrauchten Raum beobachte ich Nina Simone bei ihrer Darbietung. Sie hält ein Glas Rum in der einen Hand, eine von Lippenstift gerötete Zigarette zwischen ihren langen, feingliedrigen Fingern in der anderen. Während sie singt schaut sie aus dem Fenster, als sähe sie eine Welt, die unseren Augen verschlossen ist. In diesem Moment weiß ich, dass ich Schriftsteller werden will – ein Schriftsteller wie Nina Simone eine Sängerin war. Sie besaß für mich einen großen Zauber. Ich war bereit zu leiden, wenn ich dafür ebenso unangestrengt schreiben konnte. Noch heute folge ich diesem Ideal. Etwas hatte ich mit Nina Simone gemeinsam, ich habe es aus Haiti, es ist die hemmungslose Lust am Träumen. Um einen Haitianer am Träumen zu hindern, muss man ihn totschlagen. Weder die Fabrik, wo ich acht Jahre lang schuftete, noch die Tage des Hungerns und die eiskalten Nächte in den Parks haben mich daran hindern können, davon zu träumen, dass ich einmal ein Schriftsteller sein würde. In der Nähe meiner Wohnung war ein kleiner Laden, wo Fahrräder, Musikinstrumente und ein paar vorsintflutliche Schreibmaschinen verkauft wurden. Ich kaufte eine von ihnen und stellte sie auf meinen kleinen Tisch mitten in meinem Zimmer zwischen die Blumen und die Früchte, in Erinnerung daran, dass meine Mutter das Haus mit Blumen schmückte, auch wenn wir nichts zu Essen hatten. Diese Vorstellung von Schönheit bleibt mir immer im Sinn.
Damals las ich viel, vor allem amerikanische Schriftsteller, denn ich bewunderte ihre Technik, ein verwundetes Herz hinter den Grobheiten des Alkoholikers zu verstecken – Charles Bukowski ist das beste Beispiel dafür. Ich erkannte, dass Hemingway kein großer Autor sein konnte, wenn er nur der größte Macho unter den amerikanischen Literaten war, und dass in ihm auch ein Nähmädchen steckte, das an den Pullovern für die kälteren Monate strickte. Ich liebte Henry Miller, weil er das Leben so freudig aufnimmt, dass es ihn unwiderstehlich macht. Ich fand heraus, dass der Stil von Bukowski nuancenreicher und raffinierter ist, als es zuerst scheint. Ich mag es, wenn einer nicht gleich sein Spiel aufdeckt. Nicht der Schriftsteller sollte weinen, sondern der Leser. Nun war ich im Ghetto, das sind die Viertel, wo sich Leute ähnlicher Lebenssituation zusammenfinden, um der Erniedrigung durch den rassistischen Übergriff zu entgehen. Aber wenn man unter Seinesgleichen lebt, lernt man nichts. Mein Tagesablauf war so einfach geworden, dass er nur mich betraf. Da beschloss ich, meine Energie nicht mehr in der Fabrik zu verschwenden, sondern mich in ein völlig verrücktes Abenteuer zu stürzen: einen Roman zu schreiben, um meinem Leben vor dem Exil einen Sinn zu geben. Ich wollte dem fatalen Diktator entrinnen, der aus der Tiefe seines Spinnennetzes unsere Gefühle zu manipulieren scheint. Mit diesem Roman wollte ich von dem Leben berichten, das ich am Carré Saint-Louis im Quartier Latin von Montreal führte.
Meine Jahre unter der Diktatur von Papa Doc. Das brennende Exil meines Vaters. Der Schmerz meiner Mutter. Aus alledem schließe ich, dass es der Bestie ständig kalt ist und sie unsere Leidenschaften braucht, um sich zu wärmen. Was sie aber in Schrecken versetzen kann ist, wenn ich aus meinem Universum heraustrete, um das ihre zu gestalten. Denn ob man den Diktator hasst oder liebt, was er vor allem braucht ist, dass wir ihn ins Zentrum unseres Lebens stellen. Als ich vor meiner Remington 22 saß, war mein erster Entschluss, die Bestie nicht in meinen Roman hereinzulassen. Das kleine versiffte Zimmer, in dem ich wohnte, das weiße Blatt Papier, auf dem ich schrieb, sollte mein Land werden. Ein geträumtes und zugleich wirkliches Land, zu dem keine Polizei Zugang hat und wo man keinen Ausweis vorzeigen muss, ein Land, in dem das nie endende Fest des Alphabets gefeiert wird.
Dany Laferrière (2017)
Für Roland Désir,der irgendwoauf diesem Planetengerade schläft
„Der Neger ist ein mobiles Gut.“Code Noir, 1685
IDer Schwarze Narziss
Nicht zu fassen, jetzt legt Bouba zum fünften Mal die gleiche Platte von Charlie Parker auf. Der Typ ist völlig jazzverrückt und diese Woche ist Parker dran. Die Woche davor hatte ich Coltrane zum Frühstück, Mittag- und Abendessen, heute gibt’s Parker.
Diese Bude hat nur einen Vorteil, du kannst um 3 Uhr morgens Parker, sogar Miles Davis oder einen richtig lauten Coco wie Archie Shepp hören (bei papierdünnen Wänden), ohne dass ein Idiot kommt und dir sagt, du sollst leise stellen.
In diesem Sommer gehen wir ein vor Hitze, eingezwängt zwischen der Fontaine de Johannie (einer üblen Esskneipe für die untere Unterwelt) und einer Mini-Obenohne-Bar, in der Rue Saint-Denis Nummer 3670, genau der Rue Cherrier gegenüber. Eine vergammelte Höhle, die der Hausverwalter für 120 Dollar im Monat an Bouba vermietet. Wir wohnen im dritten Stock. Ein winziges Zimmer, zweigeteilt von einem scheußlichen japanischen Wandschirm mit großen stilisierten Vögeln. Ein Kühlschrank im Dauerstress, wie wenn du über einem Bahnhof pennst. Als wir ankamen, waren überall an die Wände Bunnies aus dem Playboy gepinnt, wir haben sie sofort runtergeholt, um dem Selbstmord vorzubeugen, den so was unausweichlich nach sich zieht. Ein Herd mit eiskalten Platten wie die Nippel einer Hexe, die bei minus 40 Grad durch die Gegend fliegt. Und als Krönung das Kreuz auf dem Mont Royal, schön in der Mitte unseres Fensterrahmens.
Ich schlafe in einem versifften Bett, Bouba hat sich mit der gerupften Couch arrangiert. Er lebt mit dieser Couch. Er trinkt, liest, isst, meditiert und vögelt auf ihr. Inzwischen hat sich sein Körper vollkommen der Hügellandschaft dieser wattegestopften Schlampe angeglichen.
Kaum hatten wir das enge Dreckloch betreten, legte sich Bouba mit Freuds Gesammelten Werken, einem uralten Wörterbuch, in dem die ersten Buchstaben fehlen (A, B, C, D und Teile vom E), und seinem zerfledderten Koran auf die Couch.
Bouba tut scheinbar den ganzen Tag nichts. In Wahrheit reinigt er das Universum. Der Schlaf heilt uns von allen Unreinheiten des Körpers, allen Krankheiten des Geistes und Perversionen der Moral. Zwischen seiner Koranlektüre macht Bouba Schlafkuren, die bis zu drei Tage dauern können. In seiner unendlichen Weisheit sagt der Koran: „Jedes Lebewesen soll den Tod kosten. Und ihr werdet euren Lohn erst am Tage der Auferstehung voll erhalten. Wer also dem Feuer entrückt und ins Paradies geführt wird, der hat es wahrlich erzielt. Und das irdische Leben ist nur ein trügerischer Genuß.“ (Koran 3,185)1 Mag die Welt in die Luft fliegen, egal was passiert, Bouba schläft.
Manchmal steht er im Schlaf unter Hochspannung wie Miles Davis’ Trompete. Dann liegt Bouba in sich verknäuelt, das Gesicht verschlossen, die Knie bis zum Kinn hochgezogen. An anderen Tagen finde ich ihn lang hingestreckt, die Arme ausgebreitet, das Maul ein schwarzes Loch, die Zehen zeigen in Richtung Decke. In seiner unendlichen Barmherzigkeit sagt der Koran: „Du lässest die Nacht übergehen in den Tag und lässest den Tag übergehen in die Nacht. Du lässest das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und lässest das Tote hervorgehen aus dem Lebendigen. Und Du gibst, wem Du willst, ohne zu rechnen.“ (Koran 3,27) Bouba hofft, sich auf diese Weise einen Platz an der Seite Gottes zu verdienen (sein Name sei gepriesen).
Charlie Parker stirbt in der Nacht. In einer feuchtheißen Nacht der Traurigen Tropen. Jazz versetzt mich immer nach New Orleans, das macht einen Schwarzen wehmütig. Bouba liegt auf der Couch in seiner üblichen Stellung (auf der linken Seite Richtung Mekka), schlürft Tee aus Shanghai und blättert in einem Buch über Freud. Da Bouba vollkommen jazzverrückt ist und nur einen Guru hat (Allah ist groß und Freud ist sein Prophet), brauchte er nicht lange für seine ziemlich komplizierte und anspruchsvolle These, bei der am Ende ungefähr herauskam, dass Freud den Jazz erfunden hat.
„Mit welchem Stück denn, Bouba?“
„Totem und Tabu, Alter.“
Echt, er nennt mich Alter.
„Wenn Freud Jazz geschrieben hätte, Heilige Scheiße, wäre das längst bekannt.“
Bouba holt tief Luft. Das tut er immer, wenn er einen Ungläubigen, einen Cartesianer, einen Rationalisten oder sonst einen Hirni vor sich hat. Der Koran sagt: „Aber seid auf eurer Hut. Gewiß, Allah bereitet für die Ungläubigen schmachvolle Strafe.“ (Koran 4,102)
„Hör mal“, flüstert Bouba endlich etwas gequält anstelle einer Erklärung, „du weißt doch, dass S. F. in New York war.“
„Klar.“
„Er hätte also bei irgendeinem schwindsüchtigen Musiker in Harlem Trompete lernen können.“
„Möglich.“
„Weißt du überhaupt, was Jazz ist?“
„Ich kann dir das nicht genau sagen, aber wenn einer Jazz spielt, weiß ich’s.“
„Gut“, sagt Bouba nach einer langen Minute der Meditation, „dann hör dir das an.“
Und schon bin ich angesaugt, abgegessen, zerkaut, verdaut, weggespült durch diesen Redeniagara in Irrsinnstempo, untermalt von Surengesang in jazzigem Takt, bis ich langsam darauf komme, dass Bouba mir gerade synkopisch zerhackt die tiefsinnigen Seiten 68 und 69 aus Totem und Tabu vorliest.
Das Bild der ägyptischen Prinzessin Taïah thront über der alten Couch, auf der Bouba liegend oder im Lotussitz seine Tage verbringt, während neben ihm Duftharze in einem orientalischen Schälchen glimmen. Auf seinem Spirituskocher brüht er ununterbrochen Teewasser auf, zu dem er rare Bücher über assyrische Kunst, die englischen Mystiker, die Vévés des Voodoo oder die Fata Morgana von Swinburne liest. Auch verbringt er seine kostbare Zeit damit, auf einem in der Rue Saint-Denis gekauften Stich den jugendlichen Körper der Beata Beatrice von Dante Gabriel Rossetti zu bewundern.
„Hör dir das an, Alter.“
Schon zum dreißigsten Mal diese Woche höre ich mir das an. Es ist eine Nummer von Parker. Bouba, mit einem Gesicht gespannt wie ein Mittelmast, hört auch zu. Man könnte ohne weiteres eine Tse-tse fliegen hören. Heiliger Parker aus der Hölle, bete für uns. Ich lausche so gut ich kann. Bouba saugt buchstäblich jede rauhe Note, die aus Parkers Sax kommt, in sich auf. Genau in der Mitte von Parkers großer Nummer (Bouba dixit), genau in dem Moment, als der olle Parker (1920–1955) die kostbaren Sekunden anschlagen will (128 Takte), die den Jazz, die Liebe, den Tod und unsere ganze verdammte Sensibilität revolutioniert haben, genau in diesem Moment kracht der Himmel über uns zusammen in Form einer Vögelei in Höchstgeschwindigkeit, schraffiert von den schrillen Schreien eines verwundeten Tiers und dem Geräusch zerreißenden Fleischs (Eingeweide unter der Kavalkade wildgewordener Pferde, genau über unseren Köpfen). Der Plattenteller bibbert wie ein kleiner Frosch mit Saugnäpfen an den Füßen. Was ist denn das? Der Zorn Allahs? „Wollen sie denn nicht über den Koran nachsinnen? Wäre er von einem andern als Allah, sie würden gewiß manchen Widerspruch darin finden.“ (Koran 4,82) Ist es Ogoun, der Feuergott aus dem Voodoo-Pantheon? Bouba glaubt ganz einfach, wir haben das Vorzimmer zur Hölle gemietet und über uns wohnt Beelzebub persönlich. Der Krach fängt wieder an, diesmal noch heftiger. Noch lauter. Noch schneller. Es ist eindeutig die wilde Jagd der vier Pferde der Apokalypse. Parker hat gerade Zeit, Cool Blues zu spielen, und gleich darauf das kleine Teufelswerk der Einfälle, diese Tontollerei, Ko-Ko (1946). Das einzige Musikstück, das es mit diesem Irrsinn aufnehmen kann, der vom Himmel auf uns herunterfällt. Die Decke sackt in einer rosa Staubwolke einen Millimeter ab. Dann das Nichts. Wir erwarten voll Ungeduld, atemlos, das Ende der Welt. Die private Apokalypse. Genau bemessen. Stille. Dann dieser gespannte, hohe, lange, nicht menschliche Schrei, ein zweigestrichenes C, mal allegro, mal andante, mal pianissimo, er hört nicht auf, untröstlich, elektronisch, geschlechtslos, vor dem Hintergrund von Parkers Sax; der einzige Gesang, der die aufgehende Sonne begleitet.
1Der heilige Koran. Übersetzung Scheich Abdullah As-Samit (F. Bubenheim) und Dr. Nadeem Elyas, Internetversion: islam.de; Ausgabe unter Aufsicht des Ministeriums für Islamische Angelegenheiten, Stiftungen, Da-Wa und Rechtweisung im Königreich Saudi-Arabien. 1424 n.H. / 2003 n.Chr. (2. Auflage)
IIDas westliche Zeitenrad
Für einen gewissenhaften, professionellen schwarzen Aufreißer sind jetzt schlechte Zeiten. Offenbar ist die Négritude endgültig vorbei, has been, kaputt, finito, gestrichen. Schwarze raus! Go home, Nigger. Die Große Nummer der Blacks, finie! Hasta la vista, Negro. Last call, colored. Geh zurück in deinen Busch, p’tit nègre. Macht Harakiri, ihr wisst schon wo. Schau mal Mama, sagt das weiße Mädchen, der Schwarze ist beschnitten. Ein guter Schwarzer, antwortet der Vater, ist ein Schwarzer ohne Eier. So steht es, am Anfang der Achtziger Jahre, die ein schwarzer Stein in der Kulturgeschichte der Schwarzen markiert. An der Börse der westlichen Werte ist Ebenholz schon wieder abgestürzt. Wenn der Schwarze wenigstens Erdöl ejakulieren würde. Das schwarze Gold. Schade, aber das Sperma des Schwarzen ist weiß. Dafür kommt der Gelbe wieder zurück. So ein Japaner ist sauber, braucht nicht viel Platz und beherrscht das Kamasutra wie seine erste Nikon. Du musst nur die gelben Puppen sehen (1 Meter 25, 50 Kilo), praktisch wie der Kosmetikkoffer am Arm hoch aufgeschossener Mädchen (Models oder Verkäuferinnen aus den großen Läden), das könnte dir echt den Blues geben. Anscheinend sind Japse gut für die Disco, wie Schwarze für den Jazz. Das war nicht immer so. God war nicht immer gelb. Der Verräter. In den Siebziger Jahren war Amerika noch spitz auf rot. Die weißen Studentinnen machten ihren sexuellen Bachelor sozusagen in den Indianerreservaten. Die im Studentenheim blieben, begnügten sich mit den wenigen indianischen Studenten, die auf dem Campus zu finden waren. Natürlich eilten Rothäute in großer Zahl von ebensovielen Stämmen herbei, angelockt vom Geruch des Fleischs der jungen weißen Squaws. Selbst für einen stolzen jungen Irokesen ist kostenloses Vögeln besser als Schnaps. Daher ließen sich die weißen Mädchen am Huron ficken. Der Cheyenne fickt am besten. Das ist schon etwas, mit jemand im Bett, dessen richtiger Name Wütender Stier ist. In den Schlafsälen konnte man nachts bei jedem Lustgeheul an den Höhen und Tiefen erkennen, ob gerade ein Huron, Irokese oder Cheyenne eine junge Weiße mit seinem roten Sperma besamte. Das ging so lange, bis jeder Indianer seine chronische Syphilis weg hatte. Die weiße angelsächsische Rasse war in ihrem Überleben bedroht, aber das Establishment konnte das Massaker noch im letzten Moment stoppen. Die Wasp-Töchter wurden mit drastischen Penicillindosen behandelt, die indianischen Studenten hatte man schon längst in ihre jeweiligen Reservate zurückgeschickt, und damit klammheimlich den Genozid fortgesetzt, der mit der Entdeckung Amerikas begonnen hatte. Die Universitäten nahmen ihren altgewohnten Trott wieder auf, trist, farb- und ausweglos. Aber in dem Moment, als die Mädchen anfingen, sich ernsthaft mit den faden, blassen und lahmen Jungs von der Ivy League zu langweilen, brachen auf dem Campus die ersten gewaltigen, machtvollen und aufrührerischen Demonstrationen der Black Panthers