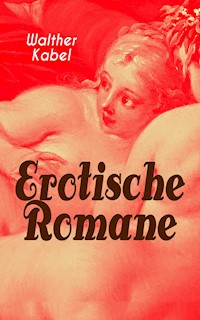Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Benu Krimi Edition
- Sprache: Deutsch
Der Schriftsteller Dr. Karl Wilde und sein Freund Viktor Ruhnau dringen eines Nachts in ein altes, leerstehendes Haus in der Nähe des Danziger Hafens ein, nachdem sie aus dem Gebäude den Schrei eines Menschen in höchster Todesangst gehört haben. In dem Haus entdecken sie die Spuren menschlicher Füße, hören das Zuschlagen einer Tür und entdecken hinter einem riesigen Kachelofen eine an einem Haken hängende Leiche. Neben dem Toten finden sie eine geheimnisvolle indische Vase, die auf einen Mord hinweist. Entschlossen begeben sich die beiden jungen Männer auf die Spur des Mörders. – Die Kriminalgeschichte: ›Die Lahore-Vase‹ ist so spannend wie eine Erzählung von Edgar Allan Poe. Auch das Schauerliche fehlt nicht. Der Roman erschien erstmals 1919 als Band 1 der Krimi-Reihe Gelbstern-Bücher im Verlag moderner Lektüre GmbH Berlin. Buchdruckerei P. Lehmann GmbH, Berlin. Die Schreibweise des Originaltextes wurde für die vorliegende Ausgabe beibehalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Impressum
1. Kapitel
Er fand, sie habe etwas Madonnenhaftes an sich. Diese Ansicht korrigierte er jedoch schon nach drei Minuten.
›Schön, aber auf faulen Pfaden …!‹ dachte er. ›So sieht sich nur jemand um, der …‹
Ah – sie war verschwunden, hatte aber noch schnell dort vor jener Haustür die dichte weiße Gesichtsgardine, die bisher sehr gefällig den Rand des englischen Strohhutes eingefaßt hatte, herabgezogen.
Er war nun vor jenem Hause ebenfalls angelangt. Stutzte – schaute nochmals hin – – lächelte …!!
Sollte sie etwa auch …?! – Das wäre wahrhaftig ein merkwürdiger Zufall gewesen …!! Dann wäre nämlich die seltsame Scheu der Madonna erklärt …!! – –
*
Es mag dies für einen Kriminalroman eine etwas ungewöhnliche Einleitung sein.
Aber – nachdem ich mir bei zwei Zigarren und zweitausend Schritten, immer mein Zimmer auf und ab, überlegt hatte, wie ich das, was Viktor Ruhnau und ich zusammen damals erlebt hatten, am besten auf diesem Wege in Geld umsetzen könnte, entschloß ich mich, nicht nach dem üblichen Rezept für Kriminalromane in den ersten drei oder vier Kapiteln die Entdeckung eines Verbrechens zu schildern, sondern selbst auf die Gefahr hin, das geneigte Lesepublikum zu einem Kopfschütteln zu veranlassen, alles so zu berichten, wie es sich zeitlich abgespielt hat, wobei es etwas sehr kraus hergehen wird.
Ich hätte mich in dem soeben beendeten Bandwurmsatz genauer ausdrücken sollen. Viktor Ruhnau ist die Hauptperson in dieser Geschichte, und ich habe nur einen Teil davon miterlebt, was immerhin zur Folge hatte, daß die Tante Emma in Königsberg, der Stadt der berühmten Klopse, die der Mops nicht fressen wollte, Nervenanfälle kriegte, als sie meinen Namen in der Zeitung las und zwar in einem blutigen Artikel, der die Überschrift trug: ›Das Geheimnis der indischen Vase‹.
Da ich hier nun schon mal von mir angedeutet habe, daß ich gewerbsmäßiger Schilderer spannender Ereignisse bin, denen ich dem Brauche gemäß den Namen Roman gebe, obwohl dies eine Anmaßung ist, will ich noch über mich schnell zur Orientierung das Nötigste anführen, soweit es hier erforderlich ist. –
Ich habe neuere Sprachen studiert. Mißliche Vermögensverhältnisse und eine gewisse Uneinigkeit, die zwischen meinen würdigen Eximinatoren und mir im Staatsexamen über den Umfang meiner positiven Kenntnisse herrschten, zwangen mich mit fünfundzwanzig Jahren in die Stellung eines Hauslehrers bei einem gräflichen Majoratsherrn hinein, bei dessen drei Söhnen sich feststellen ließ, daß das Wort ›je mehr Ahnen, die weniger Ahnung!‹ doch wohl recht häufig zutrifft. Auch mir gelang es nicht, den heranwachsenden Jünglingen Interesse für die Wissenschaft einzuflößen. Die Saat fiel auf allzu dürren Boden. Diese Enttäuschung, trotz aller Liebesmüh den edlen Sprossen wahrscheinlich nur ›die Reife für das Einjährige‹ eindrillen zu können, wurde gemildert durch die landschaftlich wirklich bezaubernde Lage des Schloßes und durch viel, sehr viel freie Zeit. Und diese Freistunden verführten mich, die erste Erzählung zu schreiben, in der ich dann den Haken fand, der mich hinab oder hinauf – wie man’s nehmen will! – in einen neuen Beruf zog. Ich wurde die Erzählung nämlich bei einer sehr anständig zahlenden Redaktion los, und die zweihundertundzehn Mark Honorar täuschten mir vor, ich besäße Talent …
Ich schrieb von da an in der freien Zeit nur noch Erzählungen. Aber – so gut wie das erste Kindlein meiner Muse und Muße geriet nichts mehr, vielleicht deswegen nicht, weil die Geldgier stets hinter dem Stuhl des Poeten stand und vor seinen Augen in flammenden Lettern das Wort ›Honorar‹ … – –
Nachdem ich die drei Jünglinge nacheinander glücklich durch das Einjährige gebracht und sie reif für die Fähnrichspresse gemacht hatte, kehrte ich dem feudalen Majoratssitz den Rücken, siedelte mich in der alten Hafenstadt Danzig an und … schrieb weiter, schrieb, um zu leben, um satt zu werden. – –
Viktor Ruhnau kannte ich von Berlin her. In Danzig begegneten wir uns nach drei Jahren dann wieder und wurden bald Freunde.
So – das genügt. – Nun zurück zu der scheuen Madonna …
*
Nachdem in Danzig die Technische Hochschule eröffnet war, öffneten auch verschiedene neue Leihhäuser in weiser Voraussicht kommender Dinge ihre Pforten.
Eine dieser Neugründungen lag in der Breitgasse in einem hohen Hause im ersten Stock und gehörte einem Herrn Isidor Katzenstein, der über der Haustür ein Riesenschild ›Pfandleiher‹ hängen und in seinem Herzen eine ehrliche Vorliebe für Studenten sitzen hatte.
Herr Katzenstein war ein schwächliches, altes Männchen, das zusammen mit seiner Frau, die ihm getrost einige dreißig Pfund hätte abgeben können, die Finanzgeschäfte erledigte. –
Um nicht einmal von bösen Menschen mit verbrecherischen Neigungen überfallen zu werden, hielt er sich einen Hund, einen dressierten Wolfshund namens Pinkus. Im allgemeinen schwärmen die Glaubensgenossen Katzensteins nicht für Hunde. Frau Rebekka und Isidor aber liebten ihren Pinkus über alles. Doch mit der Zeit war Pinkus fett und faul geworden. Nur seines Kopfes feiner Linienführung konnte die andauernde Mastkur nichts anhaben. Er blieb ein schönes Tier, – nur die Wächtereigenschaften hatten gelitten. So war er nur noch ein unschädliches Schreckmittel für gewalttätige Eigentumsverächter. –
Der alte Herr Katzenstein schaute zum Fenster auf die Breitgasse hinaus, wo soeben eine Elektrische ratternd vorüberfuhr. Es war vormittags gegen elf Uhr. Er machte zu seiner Gattin, die im Lehnstuhl am anderem Fenster saß und den Roman aus der Morgenzeitung las, eine Bemerkung über das herrliche Maiwetter und anschließend eine zweite über den flauen Geschäftsbetrieb. –
Dann ging die Tür auf, die Glocke schlug gellend an, und die verschleierte Madonna trat ein.
Katzenstein rückte den Nickelkneifer zurecht, kam an die Tombank, stützte sich mit beiden Händen darauf, verbeugte sich tief, weil er hier sofort ›bessere‹ Kundschaft witterte – des Schleiers wegen, der das verlegene Gesicht verbergen sollte, das zum erstenmal vielleicht das Innere einer Pfandleihe schaute! – und fragte nach dem Begehr der Kundin.
Die legte schweigend, aber mit unsicherer Hand ein längliches Etui auf die Glasplatte des Tomtisches und flüsterte: »Wie viel würden Sie für den Schmuck geben?«
Isidor horchte auf. – Schmuck …!! – Das klang vielverheißend.
Am Fenster fuhr er dann beim Anblick der schillernden Brillantenschnur leicht zusammen, beherrschte sich aber schnell und prüfte mit dem Vergrößerungsglas zunächst jeden einzelnen der erbsengroßen Steine.
Dann fragte er: »Haben Sie eine Legitimation mit, meine Dame? – Etwas so Wertvolles beleihe ich nur, wenn … – Na, – man muß eben vorsichtig sein.«
Die Madonna stotterte darauf: »Legitimation? – – Nein, – daran habe ich gar nicht gedacht.«
Katzenstein wiegte bedauernd den mageren greisen Kopf hin und her …
Da schlug die Türglocke abermals an.
Der neue Kunde war ein schlanker, fast überelegant angezogener jüngerer Herr, – etwa Mitte der Zwanzig, trug ein Monokel und trat sehr sicher auf.
Er stellte sich neben die Madonna an die Tombank, schaute sich in dem als Kontor mäßig eingerichteten Zimmer um und betrachtete dann den Wolfshund, der zu Frau Rebekkas Füßen lag.
Um die Madonna kümmerte er sich nicht.
Sie dagegen war beim Anschlagen der Türglocke erschrocken herumgefahren und hatte offensichtlich alle Mühe, nicht zu zeigen, wie ängstlich sie war und wie gedemütigt sie sich hier fühlte. –
»Schade!« meinte der alte Mann freundlich und drückte das Etui wieder zu, so daß es einen harten Knacks gab, bei dem Pinkus etwas den Kopf hob – »Schade, – aber ohne Legitimation …?!« Er hob die Schultern in aufrichtigem Bedauern, kam an die Tombank zurück und fuhr fort: »Haben Sie denn gar nichts bei sich, meine Dame, wodurch Sie sich legitimieren könnten?«
Die blonde Madonna öffnete ihr schon etwas beschabtes ledernes Handtäschchen und reichte ihm wortlos ein zusammengefaltetes Papier. Ihr schien inzwischen eingefallen zu sein, daß sich dieses vielleicht als Ausweis benutzen ließe.
Katzenstein las und nickte befriedigt.
»Ich rechne auf Ihre Diskretion!« sagte die Madonna leise.
»Gewiß – dürfen Sie bestimmt. – – Tausendfünfhundert Mark will ich geben … Zufrieden, meine Dame?«
Ein leises Ja! – Aber es klang enttäuscht und zögernd.
»Hatten Sie auf mehr gehofft?« Katzenstein bewies, daß er aus dem Tonfall dieses einfachen ›Ja‹ richtige Schlüsse gezogen hatte.
»Auf zweitausend,« lautete die geflüsterte Antwort.
»Nu – gut, – zweitausend!«
Wenige Minuten später war die Madonna wieder auf der Straße, um zweitausend Mark und einen Pfandschein reicher, – reicher auch um die Kenntnis, wie es in einem Leihhaus zugeht.
Der Herr mit dem Monokel aber war, nachdem die junge Dame kaum den Raum verlassen hatte, ihr gefolgt. Seine goldene Uhr mit Kette hatte er Katzenstein vorher übergeben und gesagt: »Können Sie hundert Mark dafür geben? – Schätzen Sie die Sachen ab. Ich komme wieder!« –
Der alte Mann ging zu Frau Rebekka hin, trat Pinkus in der Aufregung auf die Rute, so daß der Hund heulend hochschnellte, und meinte zu der wohlgenährten Lebensgefährtin: »Gott steh mir bei, Rebekka, – was habe ich gekriegt for e Schreck! Schau dir an das Kollier – – ganz genau!«
Die weißhaarige Frau begann plötzlich zu zitternd. Und über ihre Lippen kam’s mühsam wie in maßlosem Staunen und doch auch wieder wie in heller Freude: »Das – das indische Halsband!! – Isidor – Isidor – was hat das zu bedeuten …?! – Mir – mir ist ganz wirr im Kopf …!!«
2. Kapitel
Ahnungslos kam Viktor Ruhnau um halb ein Uhr mittags nach Hause. –
Er sagte, als er mir diesen Teil der Geschichte erzählte: »Sieh mal, meine schön angezogene Seele, lieber Trommler, war noch so ganz erfüllt von dem weichen, entzückenden Liebreiz der Verschleierten, daß ich der Bande ganz wie im Dusel in die Krallen fiel …« –
Gut gelaunt, betrat er sein Zimmer, legte Hut und Stock weg und steckte sich gerade eine Zigarette an, als die alte Dörte erschien.
»Der junge Herr möchte mal in den Salon kommen.«
Viktor nickte nur. Er dachte an die Madonna … Hätte er schärfer achtgegeben, wurde ihm kaum entgangen sein, daß Dörte, die ganz auf Seiten des Herrn Manfred Schimpel stand, höhnisch grinste und denselben Hohn auch in die Aufforderung legte, die ja völlig die Frage offen ließ, wer eigentlich Viktor zu sprechen wünsche. –
Im Salon der geräumigen, vornehm und solide ausgestatteten Wohnung des Herrn Konsuls Schimpel – den schönen Titel und einen Orden verdankte er einer mittelamerikanischen Republik und dem Umstande, daß er dem Vermittler tausend Mark mehr geboten hatte als sein Konkurrent, Herr Konrad – saßen um den großen Tisch in stilvollen Seitensesseln die Vertreter der Familie Ruhnau–Schimpel. –
Erstens: Die Hauptperson: der Herr Konsul, mittelgroß, kräftig, leicht ergrautes Haar, hochgestrichener, gefärbter Schnurrbart, goldener Kneifer, dahinter ein Paar kühle, graue Augen – sehr sorgfältig angezogen – im ganzen eine Erscheinung, die imponierte. –
Zweitens: Frau Anna Schimpel, verwitwete Ruhnau – korpulent, Doppelkinn, stark gepudert und parfümiert; Gesicht ganz unbedeutend. –
Drittens: Herr Gymnasialprofessor Dr. Pinkemüller, Bruder der Frau Schimpel, solide, ehrbar, verknöchert und verbittert durch den Daseinskampf bei fünftausend und achthundert Mark Gehalt und sieben Kindern. –
Viertens: Fräulein Adele Ruhnau, altes, hageres Fräulein mit freundlichem, aber stets etwas verängstigtem Gesicht und dem Naturparfüm der Katzenliebhaberin, deren Pussis und Mietzen nicht stubenrein sind. –
Das war der Gerichtshof, vor dem Viktor sich heute urplötzlich zu verantworten hatte.
Als der schlanke, so selbstsicher auftretende Student die feierlichen Gesichter sah, wußte er sofort Bescheid. – Das würde wieder einen netten Tanz geben …!! Wer weiß, was der hohe Familienrat wieder von ihm wollte …!!
»Setz’ dich!« begann der Konsul sehr ernst, aber mit einem Unterton, als habe er tiefes Mitleid mit dieser verirrten Seele.
Viktor hatte sich leicht verbeugt.
»Ich kann auch stehen,« meinte er, indem er sich gegen den Flügel lehnte, sein Monokel vornahm und es zu putzen begann.
Der Konsul seufzte leise. Dann hub er an, erst mit halber Stimme, die aber in scheinbar wachsender Erregung mehr und mehr sich verstärkte: »Du bist jetzt wieder einmal vier Wochen während der Osterferien in deinem Elternhause gewesen, so daß wir Gelegenheit gehabt haben, dich und deine Daseinsführung unparteiisch und persönlich betrachten zu können. Zu unser aller größtem Kummer mußten wir feststellen, wie wenig all unsere eindringlichen Ermahnungen früherer Zeiten genützt haben. Nach wie vor vergeudest du das Geld mit vollen Händen, treibst dich die Nächte umher, betrinkst dich …«
Konsul Schimpel mußte hier innehalten. Hell und scharf war Viktors Stimme dazwischen gefahren …: »Betrinken? – Bitte – Beweise?!«
»Ja – du betrinkst dich – sinnlos sogar! Du bist vorgestern morgen sieben Uhr heimgekehrt in einem völlig durchnäßten, mit Schlamm beschmutzen Anzug, ohne Hut …«
»Aha – Dörte hat wohl die Angeberin gespielt?!«
»Allerdings – aus ehrlicher Entrüstung heraus! Du hast ihr gegenüber zugegeben, ins Wasser gefallen zu sein als …«
»Danke – kenne ich!« schnitt Viktor den Satz mit ironischem Lächeln entzwei.
»Unerhört!« stieß Professor Pinkemüller hervor.
Der Konsul machte eine Handbewegung, als wollte er sagen: ›Sieh ihm das nach, dem armen Gestrauchelten!‹ Dann nahm er die Aufzählung der moralischen Gebrechen seines Stiefsohnes wieder auf: »In diesen vier Wochen bist du fünfmal betrunken nach Hause gekommen …«
»Bitte – viermal, und nur stark angeheitert …« verbesserte Viktor seelenruhig.
Der Professor klopfte, flatternd vor Empörung, mit dem Knöchel des gekrümmten Zeigefingers auf den Tisch …
»Wüstling!!« fauchte er dazu.
Viktor sah ihn an und zuckte nur die Achseln.
»Fünfmal – fünfmal!« donnerte der Konsul los.
»Streiten wir uns nicht um einmal mehr oder weniger,« meinte Viktor indem er sich seine Fingernägel besah.
»Dann weiter hast du auch wieder Schulden gemacht – Rechnungen sind eingegangen, die …«
»… die nur ein Schnüffler, mit einem Nachschlüssel bewaffnet, bei mir im Zimmer gefunden haben kann,« vollendete Viktor kalt.
»Soll das auf mich gehen?!« brüllte der Konsul, der jetzt jede Selbstbeherrschung verloren hatte. »Deine Mutter hat nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, sich zu überzeugen, ob …«
»Arme Mama, hast du dich zu dieser Spioniererei wirklich bestimmen lassen?« fiel der Student dem Tobenden abermals ins Wort.
Der Konsul schnellte empor.
»Genug, genug, Lotterbube …!! Wir werden dir zeigen, daß …«
Da erhob sich auch Professor Pinkemüller und streckte den Arm so gebieterisch gegen den Lasterhaften aus, daß ihm die Manschette über die Hand flog und seiner Schwester gerade in den Schoß fiel.
»Wir könnten dich deines Lebenswandels wegen unter Vormundschaft stellen lassen,« sagte er voll tiefster Verachtung. »Aber wir haben noch ein anderes Mittel! Dein seliger Vater, der dir gegenüber nur leider stets zu schwach gewesen ist, der schon aus dem heranwachsenden Jüngling einen eitlen Fant[1], einen …«
Bis jetzt hatte Viktor sich beherrscht. Nun aber riß auch ihm der Geduldsfaden.
»Ich verbiete mir, daß hier das Andenken an meinen Vater durch derartige Bemerkungen geschmäht wird!« rief er mit einer Stimme, die all das Müde, Blasierte völlig verloren hatte. »Ich weiß jetzt, woran ich bin! In dieser Sache liegt System! Man will mich aus dem Vaterhause verdrängen, will mich als einen moralisch Verkommenen hinstellen! – Gut – ich gehe freiwillig! Nur verlange ich natürlich, daß …«
Sein Zorn war schon wieder verraucht. Diese Leute hier – auch seine ihm längst völlig entfremdete Mutter, standen ihm so fern wie gänzlich Unbekannte. Für seinen Stiefvater und den scheinheiligen Professor empfand er sogar nur Verachtung. Einzig und allein die Tante Adelheid bildete eine Ausnahme, war nichts als eine Verführte, die in ihrer Altjungferlichkeit und Weltfremdheit alles glaubte, was man ihr nur mit der nötigen Überzeugungstreue vorerzählte. Sie saß denn auch jetzt ganz verschüchtert da, rang stumm die Hände und wußte nicht, wo sie die Augen lassen sollte.
Nein – sein Stiefvater und der Professor waren es wirklich nicht wert, sich über sie aufzuregen! Und daher wurde auch Viktors zu anfangen so scharf klingende Verteidigung schnell wieder matter und ging in eine ironische Tonart über, die, freilich unbeabsichtigt, auf den Konsul den Eindruck der Unsicherheit machte und ihm den Mut gab, Viktor ins Wort zu fallen.
»Was du zu verlangen hast und was nicht, werden wir dir nachher mitteilen. Zunächst bitte ich mir so viel Achtung aus, daß du mich nicht unterbrichst! – Wenn es lediglich deine Trunk- und Verschwendungssucht wären, die uns Sorgen bereiten, schwere, schwere Sorgen, ging das noch hin. Aber – du bist als Sohn einer hochachtbaren, hochangesehenen Patrizierfamilie dieser alten Handelsstadt schon so weit gesunken, daß du … deine Wertsachen versetzt …!! Heute Vormittag bist du in einem Leihhause gewesen …«
»Ah – soweit geht die Spioniererei schon!« lachte Viktor verächtlich auf.
»… gewesen und hast Uhr und Kette deines seligen, hochverehrten Vaters, – – wie meintest du eben?«
»Ekelhaft! – sagte ich.«
Der Konsul warf seiner Frau einen Blick zu, als ob er sie ganz besonders auf diese bodenlose Frechheit aufmerksam machen wollte. – Dann fuhr er eisig fort: »Auch sonst bist du auf Abwege geraten, die dich notwendig in das moralische Verderben hineinführen müssen. Du bist heute, nachdem du dem Pfandleiher Katzenstein Uhr und Kette vorläufig übergeben hattest, einem jungen Mädchen nachgeeilt, hast sie …«
»Danke für Einzelheiten. Ich weiß das alles sehr gut!« fiel Viktor ihm ins Wort, indem er sich mit übertriebener Höflichkeit verbeugte. »Wenn irgend etwas mir die Augen über diese Umtriebe hier zu öffnen im Stande war, so ist es diese harmlose Geschichte. Ich glaube, daß mein mißglücktes Abenteuer von heute noch immer anständiger ist, als wenn ein Familienvater und Pädagoge in aller Heimlichkeit Kneipen aufsucht, die …«
»Bube – Bube!!« Der Professor war aufgesprungen. Wieder flog ihm die rechte Manschette über die Hand und auf Viktor wie ein weißes Geschoß zu. Der stieß sie mit dem Fuß bei Seite …
»Bube – wagst du mich etwa zu verdächtigen?! – Schwager – heraus jetzt mit dem, was zu sagen ist, damit dieser junge Mensch einsieht, daß wir – wir seine Meister sind …!!«
Eine Dunstwolke von Haß und unüberwindlicher Feindseligkeit schien das Zimmer zu füllen.
Gegensätze prallten hier aufeinander, wie sie kaum größer sein konnten …
[1] veraltet für unreifer junger Mensch
3. Kapitel
Als mein Freund Viktor eine Stunde nach der soeben geschilderten Familienaussprache bei mir erschien, sah ich ihm sofort an, daß etwas Außergewöhnliches seiner nur schwer zu erschütternden, leicht blasierten Ruhe und seiner beneidenswerten Abgeklärtheit einen argen Stoß versetzt haben mußte.
Mein Erstaunen wuchs, als hinter ihm ein Dienstmann auftauchte, der einen mächtigen gelben Reisekoffer schleppte.
»’n Tag, Karl. Du bekommst Besuch,« sagte er, indem er mir seine tadellos gepflegte Hand hinstreckte, deren Nägel er stets lackierte, so daß sie förmlich schillerten. »Stellen Sie den Koffer nur dorthin,« wandte er sich an den Dienstmann. »Bringen Sie jetzt noch die beiden anderen Stücke herauf.« –
Wir waren allein. Der Dienstmann polterte die dunkle Stiege hinab, die zu meiner Mansardenwohnung hinaufführte. Es waren dies drei Räume; wenn man die winzige Küche mitrechnete, sogar vier, nämlich ein zweifenstriges und ein einfenstriges Zimmer, eine Kammer und die erwähnte Küche.
Ich war bisher nicht zu Wort gekommen, fragte nun: »Was ist denn eigentlich los, Tory?«
Tory, das war sein Spitzname von der Universität her, weil es gerade damals Mode war, alles Überfeine mit ›hochtory‹[1] zu bezeichnen. –
Er hatte sich in den Schaukelstuhl geworfen und die Beine lang von sich gestreckt.
»Ich bin obdachlos, Karl,« meinte er, leicht die Stirn runzelnd. »Man hat mich aus dem Elternhause verjagt, besser – weggeekelt! Ein ganzes Komplott, sage ich dir – wahrhaftig! Heute war große Familiengerichtssitzung. Zum Schluß wurde mir ein mir bisher verheimlichter Passus im Testament meines Vaters vorgelesen. Diese Nachschrift enthält die Bestimmung, daß mir mein Vermögen unter gewissen Umständen auch nach Vollendung des 25. Lebensjahres nicht ausgehändigt werden solle. Ob diese Umstände vorliegen oder nicht, hätte der Familienrat zu bestimmen, bestehend aus meiner Mutter, dem Pinkemüller und der Tante Adelheid. – Der Familienrat hat heute gesprochen. Zugegen war natürlich noch der Herr Konsul, der jetzt in meinem elterlichen Hause allein entscheidet, was gut oder schlecht, was moralisch oder unmoralisch ist. Kurz, meine Hoffnung, binnen acht Tagen endlich über mein Erbteil frei verfügen zu können, ist hinfällig geworden! – Nicht genug damit, hat der hohe Gerichtshof noch dahin entschieden, der Student der Rechte Viktor Ruhnau gibt seine Studien auf und tritt sofort in das Geschäft seiner Mutter, die Firma ‚Ernst Ruhnau, Zucker- und Getreideexport’ als Lehrling ein. – – Fein, was?!«
Ich war tatsächlich sprachlos. Erst nach einer Weile platzte ich heraus: »Wie konnte dein Vater nur eine solche Bestimmung treffen?! Er wußte doch …«
Tory winkte ab. »Rege dich nicht auf, Karlchen! – Mein Vater war der beste Mensch unter der Sonne, – nur Einflüsterungen leicht zugänglich. Diesen Nachtrag zu seinem Testament verdanke ich fraglos dem damaligen Herrn ersten Prokuristen, meinem späteren Stiefvater. – Papa starb vor sechs Jahren, gerade als ich mein Abiturexamen bestanden und im Anschluß daran ihm runde tausend Mark Schulden aus der fidelen Primanerzeit in dem alten Ordensstädtchen an der Weichsel reumütig gebeichtet hatte. Kurz vor seinem Tode hat er mir, der nach Herrn Manfred Schimpels Ansicht so deutliche Spuren übergroßen Leichtsinns gezeigt hatte, ›die Flügel etwas beschnitten‹, wie sich der fromme Herr Pinkemüller ausdrückte. – Ist das ein Duett, diese beiden Ehrenmänner, die stets die Flöte und das Cello höchster Vollkommenheit spielen und die dabei in Wahrheit gräßliche Heuchler sind!!«
Ich wußte, daß Viktor nach dem 25. Lebensjahre ein großes eigenes Vermögen zu erwarten hatte. Über dessen wirkliche Höhe war ich jedoch nicht unterrichtet.
»Du wirst dir diesen Urteilsspruch doch nicht etwa gefallen lassen!« meinte ich ehrlich empört, denn – mochte mein Freund auch allerhand kleine Schwächen haben, mochte er eitel, genußsüchtig, leichtlebig und … recht bequemen, um nicht zu sagen faul sein, – er hatte dagegen so viele gute Eigenschaften in die Wagschale zu werfen, daß jeder diese Schwächen dem liebenswürdigen, hübschen Menschen nachsah.
»Nein, Tory – niemals schweigst du dazu – das wäre noch schöner!« ereiferte ich mich weiter. Es gibt doch noch Gerichte, die über die Erfüllung oder Nichterfüllung einer solchen Testamentsklausel zu entscheiden haben!«
»Sehr richtig. Aber – ich verschmähe diesen Weg.«
»Weshalb denn in aller Welt?! – Recht muß Recht bleiben!«
»Weshalb? – Weil dann so verschiedenes an den Tag käme, was mir peinlich wäre.«
Ich verstand ihn nicht ganz. – Sollte er doch so einiges ›berissen‹ haben, was gegen ihn zeugte?! – – Ich konnte mir ja über sein Leben und Treiben in Berlin, wo er jetzt noch ›studienhalber‹ sich aufhielt, kein Urteil erlauben. Wir kamen nur in den Studentenferien hier in Danzig zusammen, dann freilich fast täglich. –
Der Dienstmann brachte die beiden anderen Gepäckstücke – einen Lederkoffer und einen sogenannten Stiefelsack. – Nachdem Viktor den Mann abgelohnt hatte, fragte er mich: »Ich kann doch vorläufig bei dir bleiben, Karl, bis ich mich entschieden habe, was nun werden soll?«
»Selbstredend! Ich räume dir das kleine Zimmer ein. Wir schaffen den Diwan von hier dort hinüber. Er schläft sich ganz gut darauf.«
Er schüttelte den Kopf. »Du sollst nicht aus deiner gewohnten Ruhe und Bequemlichkeit kommen, Karl! Ihr Schriftsteller seid ja wie die alten Stiftsdamen. Eure Stimmung ist lediglich von Äußerlichkeiten abhängig; eure seelische Verfassung knetet ihr euch schon mit Hilfe eurer Phantasie zurecht. – Ich beziehe die Dachkammer! Dabei bleibt’s! Ich werde mich dort schon häuslich einrichten. – – So, nun hilf mir mein Gepäck dorthin schaffen, und dann leg’ dich aufs Ohr! Du bist an eine Stunde Verdauungsschlaf gewöhnt.«
Es war nichts zu machen. Er blieb in der Dachkammer. Sein Riesenkoffer war eigentlich für die Tropen bestimmt, für Forschungsreisende, und ließ sich sehr einfach in ein Bett verwandeln.
Ich legte mich denn auch wirklich auf den Diwan. Aber geschlafen habe ich nicht.
Drüben bei Viktor war alles still. Er gab sich wohl redlich Mühe, während des Auspackens leise zu sein.
Ich dachte über das nach, was er mir erzählt hatte. Noch nie hatte er sich so abfällig über seinen Stiefvater und über seinen Onkel geäußert. Er war überhaupt auch in seiner Ausdrucksweise meist sehr gemessen, sogar etwas allzu geschraubt. Heute mußte sein ganzes Innere in Aufruhr sein, sonst wären Worte wie ›gräßliche Heuchler‹ nie über seine Lippen gekommen.
Ich muß hier notwendig kurz die Lage der einzelnen Räume meiner Mansardenwohnung zueinander dem Leser klarzumachen versuchen. –
Das Haus, in dem ich damals wohnte, als sich die merkwürdigen Ereignisse abspielten, die ich hier unter dem Titel ›Die Lahore-Vase‹ zusammengefaßt habe, liegt in der Nähe des Hafens in einer engen Gasse, die den wenig poetischen Namen ›Pfeffergang‹ hat. Dieses Haus ist uralt, schmal, hoch, hat einen spitzen Giebel und viele Eigentümlichkeiten, auf die ich im Laufe dieser Geschichte noch zu sprechen komme – Der Leser darf nicht ungeduldig werden, weil ich so ins einzelne gehe. Er kann mir glauben: ›Die Lahore-Vase‹ wird sehr bald so spannend wie eine Erzählung des Edgar Allan Poe. Auch das Schauerliche fehlt nicht –