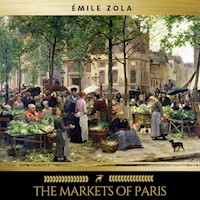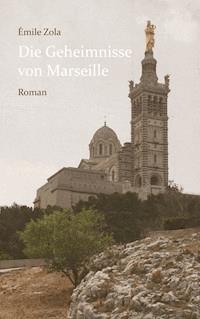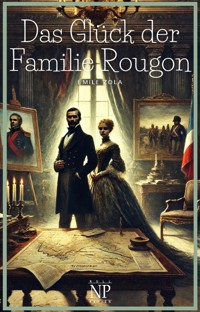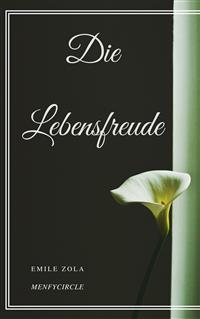
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gérald Gallas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman erzählt die Entwicklung eines jungen Mädchens im Frankreich der 60er und 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. Er schildert seine Pubertät, die Liebe zu seinem Vetter und seine Einbindung in die Lebensverhältnisse einer bürgerlichen Familie. Zugleich nimmt er die verdorbenen, von Egoismus und Gier nach persönlichem Vorteil dominierten gesellschaftlichen Strukturen der Zeit unter die Lupe.Zola beschreibt, wie auf diesem Nährboden das junge Mädchen in einer schmerzhaften Entwicklung zu einem demütigen und barmherzigen Menschen wächst, wie es Kraft und Stärke entwickelt und sich so zu einem überlegenen Charakter und personifizierten Gegenentwurf zum Geist der Zeit bildet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Die Lebensfreude
Emile Zola
Émile Zola (2 April 1840 – 29 September 1902) was an influential French novelist, the most important example of the literary school of naturalism, and a major figure in the political liberalization of France.
Kapitel1
Als die Kuckucksuhr im Speisezimmer die sechste Stunde schlug, gab Chanteau jede Hoffnung auf. Er erhob sich mühsam aus dem Lehnsessel, in dem er vor einem Koksfeuer seine schwerfälligen, gichtkranken Beine wärmte. Seit zwei Stunden bereits wartete er auf seine Frau, die nach einer Abwesenheit von fünf Wochen ihm heute ihre kleine Base Pauline Quenu zuführen sollte, eine zehnjährige Waise, deren Vormundschaft das Ehepaar übernommen hatte.
»Es ist unbegreiflich, Veronika«, sagte er, indem er die Tür zur Küche aufstieß. »Es muß ihnen ein Unglück geschehen sein.«
Die Magd, ein stattliches Mädchen von fünfunddreißig Jahren mit Männerhänden und der Miene eines Gendarmen, nahm gerade eine Hammelkeule vom Feuer, die zweifellos bereits mehr als gar geschmort war. Sie brummte nicht, doch der Zorn entfärbte die rauhe Haut ihrer Wangen.
»Die Frau wird in Paris geblieben sein«, gab sie trocken zur Antwort. »Diese Geschichten nehmen schon sowieso kein Ende mehr, das Haus ist bereits auf den Kopf gestellt.«
»Nicht doch,« erklärte Chanteau, »die Depesche von gestern abend sprach von der endgültigen Regelung der Angelegenheiten der Kleinen … Meine Frau muß heute früh bereits in Caen eingetroffen sein, wo sie einen kleinen Aufenthalt nehmen wollte, um bei Davoine vorzusprechen. Um ein Uhr ist sie weitergefahren, um zwei Uhr ist sie in Bayeux ausgestiegen; um drei Uhr hat sie der Omnibus von Vater Malivoire in Arromanches abgesetzt, und selbst wenn Malivoire seinen alten Wagen nicht sofort angeschirrt haben sollte, hätte meine Frau trotzdem bereits gegen vier Uhr hier sein können, spätestens um halb fünf. Von Arromanches bis Bonneville sind kaum zehn Kilometer.«
Die Köchin hörte alle diese Berechnungen an, ohne den Blick von ihrer Hammelkeule abzuwenden, und zuckte nur mit dem Kopfe. Nach kurzem Zögern setzte Chanteau hinzu:
»Du solltest einmal bis zur Ecke gehen, Veronika.«
Sie sah ihn an, und der verhaltene Zorn machte sie noch bleicher.
»So? Und warum? … Herr Lazare panscht draußen schon bis zu ihrer Ankunft im Schmutze herum; es verlohnt sich gerade, daß ich mich auch noch bis zu den Schenkeln vollschlampe.«
»Es ist nur, weil auch der Junge mir angst zu machen beginnt«, bemerkte Chanteau sanft … »Er kommt auch nicht wieder. Was hat er nur seit einer Stunde auf der Straße zu suchen?«
Veronika nahm, ohne ein Wort weiter zu verlieren, einen alten, schwarzen Wollschal vom Nagel, den sie über Kopf und Arme zog. Als ihr Herr ihr auf den Flur hinaus folgte, sagte sie schroff zu ihm:
»Machen Sie nur, daß Sie wieder an Ihr Feuer kommen, sonst heulen sie morgen vor Schmerzen den ganzen lieben Tag.«
Auf der Vortreppe zog sie ihre Holzschuhe an, nachdem sie die Tür eilig zugeschlagen hatte, und schrie dabei in den Wind hinaus:
»Gott von einem Gotte! Muß so eine Rotznase kommen, die sich schmeicheln kann, uns alle toll zu machen!«
Chanteau regte sich nicht weiter auf. Er war bereits an die heftige Art des Mädchens gewöhnt, das mit fünfzehn Jahren in den ersten Monaten seiner Ehe bei ihm in den Dienst getreten war. Als das Klappern ihrer Holzschuhe verhallt war, machte er sich wie ein Schulbube auf Ferien davon. Er pflanzte sich am anderen Ende des Flurs hinter einer Glastür auf, welche die Aussicht auf das Meer bot. Ein kleiner, dickbäuchiger Mann mit farblosem Gesicht, stierte er mit seinen großen, hervorquellenden blauen Augen unter der schneeigen Hülle seiner kurz geschorenen Haare einen Augenblick gedankenlos den Himmel an. Er zählte erst sechsundfünfzig Jahre, die Gichtanfälle hatten ihn jedoch frühzeitig gealtert. Von seiner Besorgnis abgelenkt, dachte er mit in die Weite sich verlierenden Blicken darüber nach, daß die kleine Pauline schließlich wohl auch Veronika für sich gewinnen werde.
War es im übrigen seine Schuld? Als der Pariser Notar ihm schrieb, daß sein seit sechs Monaten verwitweter Vetter Quenu ebenfalls gestorben sei und ihn, Chanteau, laut Testament zum Vormunde seines Töchterchens ernannt habe, hatte er es nicht über sich vermocht, sich dieser Aufgabe zu entziehen. Man kannte sich allerdings kaum, denn die Familie hatte sich hierhin und dorthin zerstreut. Chanteaus Vater hatte ehedem einen Handel mit Holz aus dem Norden begonnen, nachdem er vom Süden fortgezogen war und ganz Frankreich als schlichter Zimmergeselle durchwandert hatte. Der kleine Quenu dagegen war nach dem Tode seiner Mutter nach Paris verschlagen, wo ein anderer Oheim ihm späterhin eine große Wurstmachern mitten im Hallenviertel abgetreten hatte. Man war sich kaum zwei- oder dreimal begegnet, seitdem Chanteau, durch seine Schmerzen gezwungen, sein Geschäft aufgegeben hatte und mehrfach nach Paris gekommen war, um einige medizinische Berühmtheiten zu Rate zu ziehen. Die beiden Männer schätzten sich aber gegenseitig, auch hatte der Sterbende vielleicht gedacht, daß seinem Kinde die Seeluft gut tun werde. Im übrigen war dieses als Erbin einer Wursthandlung gewiß nichts weniger als eine Last. Frau Chanteau war daher sofort mit allem einverstanden und zwar so lebhaft, daß sie selbst ihrem Manne die gefährliche Strapaze einer Reise abzunehmen wünschte. Sie war allein gefahren und hatte mit ihrem gewohnten Drange nach Tätigkeit die Pariser Straßen abgelaufen, um diese Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Chanteau wünschte nichts weiter, als daß seine Frau zufrieden war.
Aber warum kamen die beiden noch immer nicht? Angesichts des blassen Himmels, an dem der Westwind große schwarze Wolken gleich berußten Fetzen dahinführte, deren Löcher und Risse weit über das Meer sich schleppten, befielen ihn von neuem allerlei Befürchtungen. Es tobte gerade einer jener Sonnenwendestürme, wo die Brandung wütend die Küsten peitscht. Die Flut, die erst zu steigen begann, zeichnete sich am Horizont nur wie ein weißer Saum, ein feiner, sich verlierender Gischt ab. Das an diesem Tage so weithin bloßgelegte Ufer, diese Meilenweite von düsteren Klippen und Seegras, diese kahle, mit Pfützen durchsetzte Ebene war unter der sinkenden Dämmerung der Flucht aufgescheuchter Wolken von einer erschreckenden Trübseligkeit. »Der Wind mag sie auch in einen Graben geschleudert haben«, sagte Chanteau zu sich.
Ein Bedürfnis nach Umschau wurde in ihm lebendig. Er öffnete die Glastür und wagte sich mit seinen Pantoffeln aus Stoffleisten auf die den Ort beherrschende Terrasse hinaus. Einige vom Orkan verwehte Regentropfen schlugen ihm in das Gesicht, der Wind klatschte ihm den blauen, grobwollenen Rock an den Körper. Er krümmte zwar den Rücken, wich aber nicht zurück, trotzdem er ohne Mütze war. Er lehnte sich über die Brüstung, um die unten vorbeiführende Straße überschauen zu können. Diese Straße kam zwischen zwei Abhängen hervor: Ein Axthieb in den Felsen schien eine Schlucht geöffnet zu haben, die auch die wenigen Meter Erde geliefert hatte, in welche die fünfundzwanzig oder dreißig baufälligen Hütten von Bonneville eingesetzt waren. Jede Hochsee, so sollte man meinen, mußte sie auf ihrem schmalen Bette von Strandschiefer gegen die Felsen schmettern. Zur Linken sah man einen kleinen Ankerplatz, eine Sandbank, auf die Männer etwa zehn Barken unter regelmäßigem Rufen zu ziehen sich bemühten. Das Dorf zählte kaum zweihundert Bewohner. Sie lebten schlecht genug vom Meere, klebten aber mit der blöden Verbohrtheit von Schleimtieren an ihrem Felsen. Über den Winter für Winter eingeschlagenen, elenden Dächern sah man auf dem steilen Gestade in halber Höhe rechts nur die Kirche und links das Haus der Chanteau, beide getrennt durch die Schlucht der Landstraße. Das war ganz Bonneville.
»Oh! He! Welch hundsföttisches Wetter?« rief jemand.
Chanteau blickte auf und erkannte den Pfarrer, Abbé Horteur, einen untersetzten Mann von bäuerlich derber Gestalt, dessen fünfzig Jahre seine roten Haare noch nicht gebleicht hatten. Auf einem Teile des Friedhofgeländes vor der Kirche hatte sich der Pfarrer einen Küchengarten geschaffen. Dort stand er und betrachtete eben die ersten Salatstauden. Die Sutane hatte er zwischen die Schenkel geklemmt, damit der Wind sie ihm nicht über den Kopf schlage. Chanteau, der nicht gegen den Sturm zu sprechen vermochte, mußte sich mit einer grüßenden Handbewegung zufrieden geben.
»Ich glaube, sie tun gut, die Boote auf das Trockene zu bringen«, fuhr der Pfarrer aus vollem Halse fort. »Gegen zehn Uhr werden sie tanzen.«
In diesem Augenblicke schlug richtig ein Windstoß ihm den Priesterrock über den Kopf und er verschwand hinter der Kirche.
Chanteau hatte sich nun gewandt und hielt mit hochgezogenen Schultern den Anprall aus. Seine Augen standen ihm voll Wasser. Er warf einen Blick auf seinen vom Meere verwüsteten Garten und auf den zweigeschossigen Ziegelbau mit den fünf Fenstern nach vorne, deren Läden trotz der Sicherheitsriegel entführt zu werden drohten. Als der Windstoß vorübergebraust war, beugte er sich von neuem zur Straße hinab. Veronika kam zurück und fuchtelte lebhaft mit den Armen.
»Wie? … Sie sind draußen? … Wollen Sie wohl sofort hineingehen, Herr!''
Sie erreichte ihn auf dem Flur und kanzelte ihn wie einen ungehorsamen Knaben ab. Wer würde ihn wieder zu pflegen haben, wenn er am nächsten Tage zu leiden habe?
»Du hast nichts gesehen?« fragte er in unterwürfigem Tone.
»Ganz gewiß nichts, gar nichts habe ich gesehen … Die Frau ist jedenfalls irgendwo in Sicherheit.«
Er wagte ihr nicht zu sagen, daß sie habe weiter reisen sollen. Jetzt quälte ihn namentlich das Ausbleiben seines Sohnes.
»Ich habe bemerkt«, begann die Magd von neuem, »daß das ganze Dorf auf dem Kopfe steht. Diesmal fürchten sie, auf dem Platze zu bleiben. Schon im September hatte das Haus des Cuche von oben bis unten einen Riß bekommen. Prouane, der gerade zum Angelusläuten hinaufstieg, versicherte mir, morgen werde es ganz am Boden liegen.«
In diesem Augenblick nahm ein großer, junger Mann von neunzehn Jahren die drei Stufen der Vortreppe mit einem Sprunge. Er hatte eine breite Stirn, sehr helle Augen und den feinen Flaum eines kastanienbraunen Bartes um das lange Gesicht.
»Um so besser, da ist Lazare«, sagte Chanteau sichtlich erleichtert. »Wie durchnäßt du bist, mein armer Junge!«
Der junge Mann hängte im Vorraum einen vom Regen durchnäßten Matrosenmantel auf.
»Und?« fragte abermals der Vater.
»Nichts«, antwortete Lazare. »Ich bin bis Verchemont gewesen und habe vom Wagenschuppen der Herberge aus nach der Straße ausgelugt, die einem wahren Dreckstrom gleicht. Aber es kam niemand! … Darauf bin ich umgekehrt, weil ich fürchtete, du würdest dich ängstigen.«
Er hatte die Schule in Caen im August nach Bestehen der Hauptprüfung verlassen und trieb sich schon seit acht Monaten zwischen den Küstenfelsen herum. Er konnte sich nicht zu einer ernsten Beschäftigung entschließen, gab sich aber leidenschaftlich der Musik hin, was seine Mutter zur Verzweiflung brachte. Sie war grollend abgereist, weil er sich geweigert hatte, sie nach Paris zu begleiten, wo sie eine Stellung für ihn zu finden hoffte. Ein unwillkürlicher Verdruß, den die Gemeinsamkeit des häuslichen Lebens noch verschärfte, ließ daher im Hause alles drunter und drüber gehen.
»Jetzt weißt du alles«, begann der junge Mann wieder. »Ich möchte nun noch bis Arromanches vordringen.«
»Nein, nein, es wird schon Nacht«, rief Chanteau. »Deine Mutter kann uns unmöglich ohne Nachricht lassen. Ich erwarte eine Depesche. Halt! Das klingt wie ein Wagen.«
Veronika hatte abermals die Tür geöffnet.
»Es ist der Wagen des Doktors Cazenove«, meldete sie. »Haben Sie ihn herbestellt, Herr? … Ach mein Gott, da ist doch unsere Frau!«
Alle eilten hastig auf den Vorflur. Ein dicker Berghund, eine Kreuzung vom Neufundländer, der in einer Ecke des Vorraumes geschlafen hatte, sprang mit wütendem Gekläffe auf. Durch das Gelärm angelockt, erschien auf der Schwelle auch eine kleine, weiße, äußerst zart gebaute Katze. Angesichts des schmutzigen Hofes durchlief ein leichtes Erzittern ihren Schwanz. Es ekelte sie sichtlich vor dem Hofe, und so setzte sie sich auf die oberste Stufe, um von hier aus den Vorgängen zuzuschauen.
Inzwischen war eine Dame von fünfzig Jahren mit der Behendigkeit eines jungen Mädchens aus dem Wagen gesprungen. Sie war klein und mager, ihr Haar noch tiefschwarz, ihre Züge angenehm, aber durch eine zu große Nase geschädigt. Mit einem Satze legte der Hund ihr die Pfoten auf die Schultern, als wolle er die Frau umarmen. Sie ärgerte sich darüber.
»Mathieu! Willst du wohl … Bist du endlich fertig, dickes Tier?«
Lazare kam hinter dem Hunde über den Hof. Er rief schon von weitem:
»Es ist dir doch kein Unglück zugestoßen, Mama?«
»Nein, nein«, antwortete Frau Chanteau.
»Mein Gott, wir waren nicht wenig besorgt«, sagte auch der Vater, der trotz des Windes dem Sohne gefolgt war. »Was ist nur geschehen?«
»Nichts als Verdrießlichkeiten die ganze Zeit hindurch«, erklärte sie. »Die Wege sind zunächst so schlecht, daß man von Bayeux bis hierher fast zwei Stunden brauchte. In Arromanches endlich brach sich ein Pferd von Malivoire das Bein. Er konnte uns kein anderes geben, und so sah ich mich im Geiste schon bei ihm übernachten … Schließlich hatte der Doktor die Güte, uns seinen Wagen zu leihen. Der brave Martin hat uns hergebracht … «
Der Kutscher, ein alter Stelzfuß und früherer Matrose, der durch den damaligen Marinechirurgus Cazenove operiert worden und später in dessen Dienst geblieben war, schirrte gerade das Pferd fester. Frau Chanteau unterbrach ihren Bericht, um ihm zuzurufen:
»Martin, helft doch der Kleinen beim Aussteigen.«
Niemand hatte an das Kind gedacht. Da das Schutzdach des Wagens tief heruntergelassen war, sah man nur sein Trauerkleid und seine kleinen schwarzbehandschuhten Hände. Es wartete jetzt nicht mehr, bis ihm der Kutscher half, sondern sprang ohne weiteres leichtfüßig auf die Erde. Die Windsbraut pfiff und verfing sich in den Kleidern des Kindes; Strähnen braunen Haares zerzausten sich unter dem Krepp des Hutes. Das Mädchen war für seine zehn Jahre eine kräftige Erscheinung, es hatte starke Lippen, ein volles, farbloses Gesicht, von der Weiße jener Mädchen, die in den Pariser Hinterläden aufwachsen. Alle blickten es an. Veronika, die zur Begrüßung ihrer Gebieterin herbeigekommen war, hielt sich mit eisigem, eifersüchtigem Gesicht abseits. Mathieu dagegen beobachtete diese Zurückhaltung nicht, er drängte sich zwischen die Arme des Kindes und beleckte mit der Zunge dessen Gesicht.
»Fürchte dich nicht,« rief Frau Chanteau, »er ist nicht bösartig.«
»O, ich habe durchaus keine Furcht«, antwortete Pauline sanft. »Ich habe Hunde sehr gern.«
Sie blieb in der Tat völlig gelassen bei den rauhen Zudringlichkeiten Mathieus. Ihr kleines, ernstes Gesicht überflog trotz seiner Trauer ein Lächeln; dann drückte sie einen kräftigen Kuß auf die Schnauze des Neufundländers.
»Die Menschen umarmst du nicht?« sagte Frau Chanteau. »Hier hast du deinen Onkel, denn du nennst mich ja Tante … Und hier also deinen Vetter, einen großen Taugenichts, weit unverständiger als du selbst.«
Das Kind zeigte sich durchaus nicht verlegen. Es umarmte alle und fand mit der Anmut der kleinen, in allen Höflichkeiten bereits bewanderten Pariserin für jeden ein passendes Wort.
»Ich danke dir, Onkel, daß du mich in dein Haus aufnehmen willst … Du sollst sehen, Vetter, wir werden uns gut vertragen.«
»Sie ist allerliebst«, rief Chanteau entzückt.
Lazare sah Pauline starr an; er hatte sie sich kleiner und scheuer vorgestellt, wie es so junge Dinger gewöhnlich sind.
»Ja, ja, allerliebst«, wiederholte die alte Dame. »Und tapfer, ihr habt keine Ahnung, wie tapfer! … Der Wind kam uns in diesem Wagen von vorn und blendete uns fast durch den Wassers taub. Wohl zwanzigmal glaubte ich, daß der Verschlag, der wie ein Segel krachte, in Stücke gehen werde. Was glaubt ihr wohl? Sie fand es sehr unterhaltend, und es machte ihr Spaß… Doch was stehen wir hier noch länger? Ich halte es für unnötig, noch nasser zu werden. Der Regen beginnt schon wieder.«
Sie wandte sich um und suchte Veronika. Als sie die Magd mit mürrischem Gesichte abseits stehen sah, meinte sie spöttisch:
»Guten Tag, mein Kind, wie geht es dir? Einstweilen, bis du mich nach meinem Befinden fragst, holst du wohl eine Flasche für den Martin herauf, nicht wahr?… Wir haben unser Gepäck nicht bei uns, Malivoire bringt es morgen zeitig.«
Sie unterbrach sich und lief mit bestürztem Gesicht wieder zum Wagen zurück.
»Meine Reisetasche?… O diese Angst! Ich glaubte schon, sie wäre unterwegs aus dem Wagen gefallen.«
Es war eine große, schwarze, durch den vielen Gebrauch an den Ecken bereits abgenützte Tasche, die sie dem Sohne durchaus nicht anvertrauen wollte. Endlich waren alle auf dem Wege zum Hause, als ihnen ein neuer Windstoß dicht vor der Tür den Atem benahm und sie zum Verweilen zwang. Die noch immer mit neugieriger Miene dort hockende Katze sah, wie sie gegen den Wind ankämpften. Frau Chanteau wollte wissen, ob Minouche sich während ihrer Abwesenheit gut aufgeführt habe. Der Name Minouche ließ abermals ein Lächeln um den ernsten Mund Paulines spielen. Sie bückte sich, streichelte das Tier, das sich auch sofort an ihrem Kleide rieb und dabei den Schwanz in die Luft streckte. Mathieu bellte von neuem heftig und begleitete so die Rückkehr zum heimischen Herde, während er die Familie die Stufen hinaufsteigen und sich im Vorflure endlich in Sicherheit bringen sah.
»Ah, hier ist es gut sein«, sagte die Mutter. »Ich glaubte schon, wir würden nie nach Hause kommen. Ja, Mathieu, du bist ein guter Hund, aber jetzt laß uns endlich in Frieden. Ich bitte dich, Lazare, bring ihn zum Schweigen: meine Ohren sind schon halb taub!«
Der Hund blieb aber bei seinem Gebell, daher vollzog sich der Einzug der Chanteau unter dieser fröhlichen Musik. Sie schoben Pauline, das neue Kind des Hauses, vor sich her; hinterher kam der unermüdlich kläffende Mathieu, dann Minouche, deren nervöses Fell bei diesem schallenden Lärm unaufhörlich zusammenzuckte.
Martin hatte inzwischen in der Küche zwei Gläser rasch nacheinander hinter die Binde gegossen. Sein Holzfuß klapperte auf dem Fußboden, als er allen einen guten Abend zuschreiend, von dannen humpelte. Veronika hatte ihre inzwischen kalt gewordene Hammelkeule wieder ans Feuer geschoben. Sie erschien jetzt, um zu fragen:
»Wird gegessen?«
»Ich glaube wohl, denn es ist schon sieben Uhr«, antwortete Chanteau. »Wir werden aber warten müssen, mein Kind, bis meine Frau und die Kleine sich ein wenig umgekleidet haben.«
»Paulines Koffer ist noch nicht hier«, warf Frau Chanteau ein. »Zum Glück sind wir unten trocken geblieben… Nimm deinen Hut und deinen Mantel ab, mein Herz … So hilf ihr doch, Veronika … Ziehe ihr auch die Schuhe aus, ja? … Ich habe alles was du brauchst.«
Die Magd mußte vor dem Kinde niederknien, das sich gesetzt hatte. Währenddessen holte die alte Dame aus der Reisetasche ein Paar Filzschuhe hervor, die sie selbst Pauline an die Füße steckte. Dann ließ auch sie sich die Schuhe ausziehen und tauchte abermals die Hand in den Reisesack, die mit einem Paar Schlurren für sie wieder hervorkam.
»Ich kann also auftragen?« fragte nochmals Veronika.
»Sofort… Komm in die Küche, Pauline, um dir das Gesicht und die Hände zu waschen… Wir sind schon halbtot vor Hunger, später werden wir uns gründlich reinigen.«
Pauline erschien als erste wieder im Zimmer, während sie ihre Tante noch mit der Nase in einer Schüssel zurückgelassen hatte. Chanteau hatte seinen Platz vor dem Feuer in der Tiefe seines Lehnsessels aus gelbem Plüsch wieder eingenommen. Er rieb sich unwillkürlich die Beine, denn er war in beständiger Furcht vor einem neuen Anfall, während Lazare am Tische stand, auf dem seit länger als einer Stunde für vier Personen gedeckt war und Brot für die Gesellschaft absäbelte. Die beiden Männer lächelten etwas verlegen das Kind an, ohne ein Wort für dasselbe zu finden. Pauline sah sich gelassen in dem mit Nußholz-Möbeln ausgestatteten Zimmer um. Sie blickte vom Büfett und dem halben Dutzend Stühlen zur grünkupfernen Hängelampe hinauf. Es fesselten sie besonders fünf eingerahmte Bilder, welche die Jahreszeiten und eine Ansicht des Vesuvs darstellten und sich von der kastanienfarbenen Wandtapete abhoben. Die nachgemachte, von kreidigen Rissen durchzogene Täfelung von gemalter Eiche, der von alten Fettflecken beschmutzte Fußboden, die Öde dieses einsamen Familienzimmers ließ sie den schönen marmornen Wurstladen vermissen, den sie am Abend vorher verlassen hatte. Ihre Augen trübten sich, sie schien für einen Augenblick die unter der Gemütlichkeit der für sie neuen Umgebung verborgene, dumpfe Verbitterung zu ahnen. Nachdem sich ihre Blicke noch für einen in vergoldetem Holzgehäuse steckenden, sehr alten Barometer erwärmt hatten, blieben sie auf einem merkwürdigen Dinge in einem Glaskasten haften, dessen Kanten von schmalen Streifen Papiers zusammengehalten waren. Es nahm den ganzen Kaminsims ein und sah aus wie ein Spielzeug, wie eine hölzerne Brücke im kleinen, aber wie eine Brücke von außerordentlich verwickeltem Gebälk.
»Das hat dein Großonkel gemacht«, erklärte Chanteau, der sich freute, einen Gesprächsstoff gefunden zu haben. »Ja, mein Vater hat als Zimmermann angefangen … Ich habe sein Meisterstück stets in Ehren gehalten.«
Er errötete nicht über seine Abstammung. Frau Chanteau litt die Brücke auf dem Kamine trotz ihres Ärgers beim Anblick dieser Platz raubenden Merkwürdigkeit, die sie stets an ihre Ehe mit dem Sohne eines Arbeiters erinnerte. Die Kleine aber hörte schon nicht mehr auf ihren Onkel: durch das Fenster hatte sie soeben den unendlichen Horizont erblickt. Sie schritt flink durch das Zimmer und stellte sich hinter die Scheiben, deren Musselinvorhänge mit Hilfe von baumwollenen Spangen halb emporgezogen waren. Seit ihrer Abreise aus Paris nahm das Meer ihre Gedanken beständig in Anspruch. Sie träumte von ihm, sie bestürmte im Eisenbahnwagen die Tante mit ewigen Fragen und wollte beim Anblick eines jeden Abhanges wissen, ob sich das Meer hinter diesen Bergen befinde. Am Gestade von Arromanches endlich hatte sie sprachlos, mit weit aufgerissenen Augen, das Herz von einem tiefen Seufzer geschwellt, dagesessen; von Arromanches nach Bonneville hatte sie trotz des Windes alle Minuten den Kopf zum Wagen hinausgesteckt, um das ihnen folgende Meer zu erblicken. Noch immer war das Meer da, es wird immer da bleiben wie etwas ihr Gehörendes. Langsam, mit einem einzigen Blicke schien sie von ihm Besitz zu nehmen.
Die Nacht sank vom bleichen Himmel hernieder, an dem die Windstöße die zügellos dahin jagenden Wolken peitschten. Man unterschied inmitten der wachsenden Finsternis nichts als den blassen Streif der steigenden Flut. Es war ein weißer, stets sich ausbreitender Gischt, eine Folge von auf- und niederwogenden Feldern, die im sanften, wiegenden Dahingleiten alles mit Seetang überschwemmten und die Felsplatten überfluteten. In der Ferne aber war das Gebrüll der Wogen gewachsen, ungeheure Kämme krausten sich auf und ein tödlich-trauriges Dunkel lagerte am Fuße der Küstenfelsen auf dem verlassenen, hinter seinen Türen verrammelten Bonneville, während die auf der Höhe der Riesbänke zurückgelassenen Boote wie die Leichname großer, gestrandeter Fische dalagen. Der Regen tauchte das Dorf in einen rauchigen Nebel, nur die Kirche hob sich noch von einer fahlen Wolkenschicht in scharfen Umrissen ab.
Pauline sagte nichts. Ihr kleines Herz war wieder schwer; sie unterdrückte den Atem und seufzte tief, ihr ganzer Odem schien über ihre Lippen zu entweichen.
»Nicht wahr, ein bißchen breiter als die Seine ist das da?« sagte Lazare, der soeben hinter sie getreten war.
Dieses kleine Ding überraschte ihn immer mehr. Seit sie da war, hatte ihn die Zaghaftigkeit eines großen linkischen Jungen befallen.
»Oh ja!« antwortete sie sehr leise, ohne den Kopf zu wenden.
Er wollte sie schon duzen, doch besann er sich eines Besseren.
»Erschreckt Sie das nicht?«
Jetzt sah sie ihn mit erstaunter Miene an.
»Nein, warum? … Ich bin gewiß, daß das Wasser nicht bis hierher steigen wird.«
»Man kann es nicht wissen«, sagte er, einem Verlangen sie zu sticheln nachgebend. »Manchmal steigt das Wasser bis über die Kirche.«
Sie lachte hell auf. Ihr sonst bedächtiges Persönchen überließ sich einem Ausbruch geräuschvoller, gesunder Heiterkeit, dem Frohsinn einer vernünftig denkenden, über jede Ungereimtheit sich belustigenden Person. Sie war es, die zuerst zu dem jungen Menschen »du« sagte und wie zum Spielen seine Hände ergriff.
»Du hältst mich wohl für dumm, Vetter? … Würdest du hier bleiben, wenn das Wasser über die Kirche ginge?«
Da lachte Lazare ebenfalls und drückte die Hände des Kindes; beide waren von jetzt an gute Kameraden. Frau Chanteau kehrte gerade bei diesen Heiterkeitsausbrüchen in die Stube zurück. Sie schien glücklich und sagte, sich die Hände trocknend:
»Die Bekanntschaft ist gemacht … Ich dachte es mir schon, daß ihr beide euch verstehen würdet.«
»Soll ich auftragen?« fragte Veronika auf der Schwelle zur Küche.
»Ja, ja, mein Kind. Nur wäre es gut, wenn du vorher die Lampe anzündetest. Man sieht nichts mehr.«
Die Nacht sank in der Tat so schnell hernieder, daß das Eßzimmer nur noch von dem roten Widerschein des Koks erleuchtet war. Das bedingte eine weitere Verzögerung. Endlich zog die Köchin die Lampe hernieder, und das Tischzeug erschien unter der Runde der lebhaften Helle. Jedermann nahm seinen Platz ein, Pauline zwischen dem Onkel und dem Vetter gegenüber der Tante. Plötzlich aber erhob sich diese noch einmal mit der Lebhaftigkeit einer alten, mageren Frau, die nicht stillsitzen kann.
»Wo ist meine Reisetasche? … Warte, mein Schatz, ich will dir deinen Becher geben… Nimm das Glas weg, Veronika. Das Kind ist an seinen Becher gewöhnt.«
Sie zog einen schon verbeulten silbernen Becher hervor, den sie mit ihrem Mundtuche reinigte und vor Pauline hinstellte. Dann behielt sie die Reisetasche hinter sich auf einem Stuhle. Die Köchin reichte eine Nudelsuppe, wobei sie in ihrer mürrischen Art die Bemerkung machte, daß die Suppe viel zu lange gekocht habe. Niemand wagte sich zu beklagen: man hatte großen Hunger, die Brühe zischte in den Löffeln. Dann kam das Suppenfleisch. Chanteau, ein großer Feinschmecker, berührte es kaum und sparte seine Eßlust für die Hammelkeule auf. Als aber diese auf dem Tische erschien, war die Entrüstung allgemein. Das war ausgetrocknetes Leder, nicht zu genießen.
»Ich weiß es wohl«, sagte Veronika gelassen. »Man hätte das Essen nicht warten lassen sollen.«
Pauline zerlegte ihr Fleisch vergnügt in kleine Stückchen und schluckte es dessenungeachtet. Lazare wußte überhaupt nie, was er auf dem Teller hatte; er hätte selbst Brotschnitten als Geflügelragout verzehrt. Chanteau dagegen betrachtete die Hammelkeule mit düsterem Blicke.
»Was hast du außerdem noch, Veronika?«
»Gebratene Kartoffeln, Herr.«
Er machte eine verzweifelte Gebärde und lehnte sich in seinen Lehnstuhl zurück.
»Wenn der Herr will, kann ich das Rindfleisch wiederbringen«, meinte die Magd.
Er aber schüttelte mit einer trübseligen Bewegung den Kopf. Ebenso gern trockenes Brot wie Suppenfleisch. Mein Gott, welche Mahlzeit! Hatte das schlechte Wetter doch selbst das Fischgericht zu Wasser werden lassen! Frau Chanteau, eine schwache Esserin, sah ihn mitleidig an.
»Armer Mann,« sagte sie mit einem Male, »du tust mir leid… Ich hatte ein Geschenk für morgen; doch da heute abend Hungersnot herrscht … «
Sie hatte ihre Reisetasche abermals geöffnet und zog eine Dose mit Gänseleberpastete hervor. Die Augen Chanteaus leuchteten, Gänseleberpastete! Verbotene Frucht! Eine wonnevolle Leckerei, die der Arzt durchaus verwehrte!
»Doch du weißt,« fuhr seine Frau fort, »ich erlaube dir nur eine Schnitte… Sei vernünftig, oder du bekommst nie wieder welche.«
Er hatte das Näpfchen ergriffen und nahm sich mit zitternder Hand davon. In dieser Weise fanden oft fürchterliche Kämpfe statt zwischen dem Entsetzen vor einem neuen Anfall und der Leidenschaft seiner Feinschmeckerei; fast immer war letztere die Siegerin. Umso schlimmer! Es schmecke zu gut, er wolle lieber Schmerzen leiden!
Veronika, die ihn ein mächtiges Stück hatte abschneiden sehen, kehrte in ihre Küche zurück und brummte:
»Schon gut, das wird wieder ein Geheul sein!«
Diese Redensart kam ihr ganz natürlich in den Mund, die Herrschaft hatte sie sich gefallen lassen, weil sie das so offen sagte. Der Herr heulte, wenn er einen Anfall hatte; es war wirklich ganz so, daß man nicht daran dachte, sie an die schuldige Achtung zu erinnern.
Das Ende der Mahlzeit war sehr heiter. Lazare entwand scherzend die Dose den Händen seines Vaters. Als der Nachtisch erschien, Käse und Zwieback, gab das plötzliche Auftauchen von Mathieu Anlaß zu großem Vergnügtsein. Bis dahin hatte er irgendwo unter dem Tische geschlafen. Das Erscheinen der Zwiebäcke hatte ihn soeben munter gemacht, er schien sie im Schlafe zu wittern; alle Abend, genau in diesem Augenblick, schüttelte er sich; er machte seine Runde und suchte das Wohlwollen der Tischgenossen in ihren Gesichtern zu lesen. Gewöhnlich war Lazare der am schnellsten zu Erweichende. An diesem Abend aber blickte Mathieu bei seinem zweiten Rundgange Pauline mit seinen guten, menschlichen Augen ständig an, legte dann, weil er in ihr eine große Freundin der Tiere und Menschen ahnte, seinen mächtigen Kopf auf das kleine Knie des Kindes, ohne seine flehenden Augen von ihr zu wenden.
»Oh! dieser Bettler!« sagte Frau Chanteau. »Sachte, Mathieu, willst du wohl nicht so wild auf das Fressen sein!«
Der Hund hatte zuschnappend das Stück Zwieback geschluckt, das ihm Pauline reichte; er legte seinen Kopf von neuem auf das kleine Knie und bat um ein anderes Stück, die Augen beständig auf die seiner neuen Freundin gerichtet. Sie lachte, küßte ihn und fand ihn höchst drollig mit seinen niedergeklappten Ohren, einem schwarzen Male über dem linken Auge, dem einzigen Fleck auf seinem weißen, krausen, langhaarigen Fell. Es ereignete sich indessen ein Zwischenfall. Die eifersüchtige Minouche sprang leichtfüßig auf den Rand des Tisches und stieß schnurrend, mit geschmeidigem Rückgrat und der Zierlichkeit einer jungen Ziege an das Kinn der Kleinen mit dem Kopfe. Es war das ihre Art sich anzuschmeicheln, man fühlte ihre kalte Nase und das Streifen ihrer spitzen Zähne, während sie wie ein Teig knetender Bäckergeselle auf ihren Pfoten tanzte. Pauline war zwischen den beiden Tieren geradezu im siebenten Himmel; die Katze zur Linken, den Hund zur Rechten, von ihnen frech ausgebeutet, bis ihr ganzer Nachtisch an sie verteilt war.
»Schicke sie weg«, sagte ihre Tante. »Sie werden dir nichts übrig lassen.«
»Was tut es?« antwortete sie schlicht, in ihrem Glücke alles wegzugeben.
Man hatte das Mahl beendet. Veronika nahm die Gedecke fort. Die beiden Tiere zogen ab, als sie den Tisch leer sahen, ohne »Danke« zu sagen, indem sie sich ein letztes Mal beleckten.
Pauline war aufgestanden und stellte sich an das Fenster; sie versuchte die Dinge draußen zu erkennen. Seit der Suppe sah sie dieses Fenster sich verdunkeln und nach und nach schwarz wie die Tinte werden. Jetzt stand draußen eine undurchdringliche Wand, eine Masse von Finsternis, in der alles untergegangen war: der Himmel, das Wasser, das Dorf, selbst die Kirche. Ohne über die Neckereien ihres Vetters zu erschrecken, suchte sie das Meer; sie war von dem Verlangen gequält, zu wissen, bis wohin das Wasser steigen werde; sie hörte nur das Gebrause wachsen, eine laute ungeheuerliche Stimme, deren beständiges Drohen durch das Geheul des Windes und das Prasseln des Platzregens drang und mit jeder Minute anschwoll. Kein Schimmer mehr, nicht einmal das Weiße des Schaumes in diesem Dunkel; nur die vom Sturme gepeitschten Wogen inmitten dieses Nichts.
»Alle Wetter!« sagte Chanteau. »Die Flut kommt steif heran. Und sie hat noch zwei Stunden zu steigen.«
»Wenn der Wind von Norden wehte,« erklärte Lazare, »würde Bonneville elend daran sein, glaube ich. Zum Glück faßt er uns von der Seite.«
Die Kleine hatte sich umgedreht und hörte ihnen mit großen, von beunruhigtem Mitleid erfüllten Augen zu.
»Pah!« sagte Frau Chanteau, »wir sind in Sicherheit, mögen die andern sehen, wie sie durchkommen; ein jeder hat sein eigenes Häufchen Unglück. Sage, Herzchen, willst du eine Tasse recht heißen Tee? Und dann gehen wir schlafen.«
Veronika hatte über den abgedeckten Tisch eine alte, großgeblümte, rote Decke geworfen, an der die Familie ihre Abende zubrachte. Ein jeder nahm seinen Platz wieder ein. Lazare war einen Augenblick hinausgegangen und mit einem Tintenfaß, einer Feder und einer ganzen Handvoll Papier wiedergekommen. Er setzte sich unter die Lampe und begann Noten abzuschreiben. Frau Chanteau, deren zärtliche Blicke seit ihrer Heimkehr den Sohn nicht mehr verließen, wurde plötzlich sehr barsch.
»Bist du wieder bei deinen Noten? Kannst du uns nicht einmal am Tage meiner Heimkehr einen Abend schenken?«
»Aber, Mama, ich gehe doch nicht fort, ich bleibe bei dir… Du weißt sehr gut, daß das Abschreiben mich nicht an der Unterhaltung hindert. Sage mir etwas und ich werde dir antworten.«
Damit versenkte er sich in seine Arbeit, während er zugleich eine Hälfte des Tisches mit seinen Papieren bedeckte. Chanteau hatte sich gemütlich in seinem Lehnstuhl ausgestreckt und ließ die Hände wie entkräftet ruhen. Mathieu schlief vor dem Feuer, während Minouche mit einem Satze wieder auf die Decke gesprungen war und großen Putz machte; mit einem Bein in der Luft leckte sie sich vorsichtig das Haar am Bauche. Eine wohltuende Traulichkeit schien von der kupfernen Hängelampe niederzuströmen, und bald konnte Pauline, die mit halbgeschlossenen Augen ihrer neuen Familie zulächelte, von Mattigkeit überwältigt, von der Wärme gelähmt, dem Schlaf nicht widerstehen. Sie ließ ihren Kopf niedergleiten und schlummerte in der Höhlung ihres gekrümmten Armes unter der ruhigen Helle der Lampe ein. Ihre feinen Augenwimpern glichen einem über ihren Augen gezogenen Seidenschleier, ein leises, regelmäßiges Atmen entströmte ihren Lippen.
»Sie kann sich nicht länger halten«, sagte Frau Chanteau und dämpfte die Stimme. »Wir werden sie wecken, daß sie ihren Tee trinkt, und bringen sie dann zu Bett.«
Es trat jetzt tiefe Stille ein. Im Brausen des Sturmes hörte man nur die Feder Lazares. Es war ein tiefer Friede, die Schlafsucht der alten Gewohnheiten, das allabendlich an derselben Stelle wiedergekäute Leben. Lange schauten sich Vater und Mutter an, ohne etwas zu sagen. Endlich fragte Chanteau zögernd:
»Wird Davoine in Caen einen guten Abschluß machen?«
Sie zuckte wütend die Achseln.
»Jawohl, ja, einen guten Abschluß… Sagte ich dir nicht, der läßt dich hineinziehen!?«
Da die Kleine jetzt schlief, konnte man plaudern. Sie sprachen leise. Sie wollten sich zuerst nur kurz die Neuigkeiten mitteilen. Aber die Leidenschaft riß sie fort, nach und nach entrollten sich alle Sorgen dieses Hauses.
Bei dem Tode seines Vaters, des alten Zimmermannes, der seinen Handel mit nordischem Holze mit den kühnen Zügen eines abenteuerlichen Kopfes betrieb, hatte Chanteau ein stark belastetes Geschäftshaus übernommen. Wenig betriebsam und von einer nur aus Erfahrung bestehenden Klugheit, hatte er sich begnügt, durch gute Ordnung die Lage zu retten und sich auf gewisse Einkünfte hin anständig durchzuschlagen. Der einzige Roman seines Lebens war seine Heirat; er nahm eine Erzieherin zur Frau, der er in einer befreundeten Familie begegnet war. Eugenie de la Vignière, eine Waise von ruinierten Krautjunkern aus dem Cotentin, rechnete darauf, seinem Herzen ihren Ehrgeiz einflößen zu können. Er aber, unvollständig erzogen und erst spät in eine Schule geschickt, bebte vor weitläufigen Unternehmungen zurück und setzte die Schwerfälligkeit seiner Natur den herrschsüchtigen Bestrebungen seiner Gattin entgegen. Als ihnen ein Sohn geboren war, übertrug jene auf dieses Kind ihre Hoffnungen auf eine hohe Glücksstellung; sie schickte ihn auf das Gymnasium und ließ ihn selbst des Abends unter ihrer Aufsicht arbeiten. Ein Unglück aber sollte ihre Berechnungen umstoßen. Chanteau, der seit seinem vierzigsten Jahre an der Gicht litt, bekam so heftige Anfälle, daß er von dem Verkaufe des Hauses sprach. Das bedeutete die Mittelmäßigkeit, das Verzehren der kleinen Ersparnisse in unbemerkter Einsamkeit; es bedeutete, daß das Kind später in einen Beruf geworfen werde, ohne den Rückhalt der ersten zwanzigtausend Frankenrente, die sie für den Knaben erträumt hatte.
Frau Chanteau wollte sich wenigstens mit dem Verkauf des Hauses beschäftigen. Der Gewinn aus dem Geschäft konnte an zehntausend Franken betragen, von denen das Paar auf großem Fuße lebte, denn die Frau fand Geschmack an Empfängen. Sie stöberte einen gewissen Davoine auf und dachte folgenden Abschluß aus: Davoine kaufte das Holzgeschäft um hunderttausend Franken, von denen er nur fünfzigtausend auszahlte; die Chanteaus wurden, indem sie die zweiten fünfzigtausend stehen ließen, seine Geschäftsteilnehmer und bezogen die Hälfte des Geschäftsgewinnes. Dieser Davoine schien ein Mann von unternehmendem Verstande. Selbst zugegeben, daß das Haus nichts darüber hinaus abwarf, waren fünftausend Franken immer gesichert, die zuzüglich der dreitausend aus den auf Hypotheken sichergestellten fünfzigtausend, eine Gesamtrente von achttausend Franken ergaben. Mit diesen würde man sich gedulden, man würde die Erfolge des Sohnes abwarten können, der sie aus ihrem mittelmäßigen Leben herausziehen sollte.
Die Angelegenheit wurde auch so geordnet. Chanteau hatte gerade zwei Jahre vorher am Strande des Meeres in Bonneville ein Haus erstanden, einen Gelegenheitskauf aus dem Zusammenbruche eines zahlungsunfähigen Kunden gerettet. Anstatt es wieder zu verkaufen, wie Frau Chanteau es einen Augenblick beabsichtigt, beschloß sie, sich dorthin zurückzuziehen, wenigstens bis zu den ersten Erfolgen Lazares. Auf ihre Empfänge zu verzichten, sich in ein verlorenes Nest zu verkriechen, bedeutete für sie einen Selbstmord; aber sie trat ihr Haus völlig an Dovoine ab und hätte anderweitig mieten müssen. Es kam ihr der Mut, Ersparnisse zu machen, in dem verbohrten Gedanken, später eine siegreiche Rückkehr nach Caen in Szene zu setzen, wenn ihr Sohn dort eine große Stellung einnehmen werde. Chanteau stimmte allem bei. Seine Gicht werde sich in der Nähe des Meeres legen; überdies hatten von drei zu Rate gezogenen Ärzten zwei die Liebenswürdigkeit zu erklären, daß der Seewind das allgemeine Befinden bedeutend stärken werde. Eines Morgens im Mai ließen denn die Chanteaus Lazare, der damals vierzehn Jahre zählte, in dem Gymnasium und reisten ab, um sich endgültig in Bonneville niederzulassen.
Seit dieser heldenhaften Losreißung waren fünf Jahre verflossen, und die Lage der Familie wurde immer schlimmer. Davoine ließ sich in große Spekulationen ein und behauptete: er brauche stets neue Vorschüsse; er wagte den Gewinn von neuem, so daß die Abschlüsse fast immer mit Verlusten endeten. In Bonneville war man jetzt auf die dreitausend Franken Rente zum Leben angewiesen, und zwar so kümmerlich, daß man das Pferd hatte verkaufen müssen und Veronika selbst den Küchengarten bearbeitete.
»Sieh, Eugenie,« wagte Chanteau zu sagen, »wenn man mich da hineingelegt hat, ist es auch ein wenig dein Verschulden.«
Sie aber lehnte diese Verantwortlichkeit ab und vergaß gern, daß die Verbindung mit Davoine ihr Werk war.
»Wie? Meine Schuld?« antwortete sie mit trockenem Tone. »Bin ich etwa krank?… Wärest du nicht krank gewesen, könnten wir vielleicht Millionäre sein.«
Sooft die Bitterkeit seiner Frau in dieser Weise überschäumte, senkte er verlegen den Kopf und schämte sich, daß in seine Knochen der Feind der Familie sich eingenistet hatte.
»Man muß abwarten,« sagte er leise, »Davoine bereitet seine großen Züge mit Sicherheit vor. Wenn das Tannenholz steigt, machen wir ein Vermögen.«
»Und was dann?« unterbrach Lazare, ohne mit dem Abschreiben der Noten aufzuhören. »Wir haben ja doch zu leben. Ihr quält euch mit Unrecht. Ich für mein Teil pfeife auf das Geld.«
Frau Chanteau zuckte ein zweites Mal mit den Schultern.
»Du tätest gut, etwas weniger darüber zu spotten und deine Zeit nicht mit Dummheiten zu verlieren.«
Doch war sie es, die ihm das Klavierspielen beigebracht hatte! Heute erbitterte sie bereits der bloße Anblick einer Partitur. Ihre letzte Hoffnung brach zusammen: dieser Sohn, den sie als Präfekten oder Gerichtspräsidenten sich geträumt hatte, sprach davon, Opern zu schreiben, und sie sah ihn bereits, wie ehedem sich selbst, später im Schmutz der Straßen dem Stundengeben nachlaufen.
»Hier ist übrigens eine Aufstellung über die drei letzten Monate, die Davoine mir mitgegeben hat«, begann sie abermals… »Wenn das in dieser Weise fortgeht, werden wir schließlich im Juli seine Schuldner sein.«
Sie hatte ihre Reisetasche auf den Tisch gestellt und zog ein Papier hervor, das sie Chanteau reichte. Er mußte es nehmen, drehte es herum und legte es schließlich vor sich hin, ohne es zu öffnen. Veronika brachte jetzt den Tee. Neben der Zuckerdose kniff Minouche, die ihre Pfoten eingezogen hatte, scheinheilig die Äuglein zusammen; Mathieu schnarchte wie ein Mensch vor dem Kaminfeuer. Die Stimme des Meeres grollte draußen weiter und begleitete wie ein fürchterlicher Baß die kleinen friedlichen Geräusche dieses schlaftrunkenen Zimmers.
»Wie wäre es, wenn du sie wecktest, Mama?« sagte Lazare, »sie schläft gewiß nicht sehr bequem.«
»Ja, ja«, flüsterte Frau Chanteau nachdenklich und richtete die Augen auf Pauline.
Alle drei betrachteten das schlummernde Kind. Sein Atem ging noch immer ruhig, seine bleichen Wangen und der rosige Mund nahmen in der Helle der Lampe die starre Lieblichkeit eines Blumenstraußes an. Nur ihre vom Winde zerzausten kastanienbraunen Haare warfen einen Schatten über ihre zarte Stirn. Die Gedanken der Frau Chanteau kehrten inmitten der gehabten Verdrießlichkeiten nach Paris zurück, und sie war selber erstaunt über die Wärme, mit der sie, von einer unbewußten Achtung für ein reiches Mündel erfaßt, die Vormundschaft annahm; im übrigen aber erfüllte sie eine strenge Rechtlichkeit, und sie war ohne jeden Hintergedanken betreffs des Vermögens, dessen Hüterin sie werden sollte.
»Als ich in den Laden trat,« begann sie langsam zu erzählen, »hatte sie ein kurzes, schwarzes Kleid an; sie umarmte mich heftig schluchzend… Es war ein sehr schöner Laden, ein Wurstgeschäft ganz von Marmor und Spiegelglas, gerade den Hallen gegenüber… Ich fand dort eine aufgeweckte Person, eine Magd, nicht größer als ein Stiefel, aber frisch und rot; sie hatte den Anwalt benachrichtigt, die Siegel anlegen lassen, und verkaufte die Blut- und Bratwürste ruhig weiter. Adele hat mir auch vom Tode unseres armen Vetters Quenu erzählt. Seit dem Verlust seiner Frau Lisa vor sechs Monaten würgte ihn das Blut; er führte stets die Hand an den Hals, als wolle er sich die Binde abreißen; eines Abends schließlich fand man ihn mit blauem Gesicht, die Nase in einer Schmalzschüssel. Sein Oheim Gardelle war auf diese Weise gestorben.«
Sie schwieg, und wieder war alles still. Über das schlafende Gesicht Paulines huschte im Traum der flüchtige Schimmer eines Lächelns.
»Mit der Vollmacht ist alles glatt gegangen?« fragte Chanteau.
»Sehr gut… Aber dein Anwalt hatte ganz recht, daß er den Namen des Bevollmächtigten unausgefüllt ließ, denn, wie es scheint, würde ich nicht an deine Stelle treten können: die Frauen sind von diesen Dingen ausgeschlossen… Wie ich dir schrieb, habe ich mich sofort nach meiner Ankunft mit dem Pariser Notar verständigt, der dir einen Auszug des Testaments geschickt hatte, laut welchem du zum Vormunde ernannt warst. Er hat sogleich die Vollmacht auf den Namen seines Bureauvorstehers ausgestellt, was, wie er mir sagte, häufig geschieht. So haben wir vorgehen können… Bei dem Friedensrichter habe ich als Familienrat drei Verwandte von Seiten Lisas, zwei junge Vettern, Octave Mouret, und Claude Lantier, ferner einen Vetter durch Verschwägerung, Herrn Rambaud, der in Marseille wohnt, angegeben; sodann nahm ich von unserer Seite, der Seite der Quenu, die Neffen Naudet, Liardin und Delorme. Der Familienrat ist, wie du siehst, sehr angemessen; wir werden mit ihm durchsetzen können, was wir wollen, um das Glück des Kindes zu sichern… In der ersten Sitzung ernannten sie dann den Gegenvormund, den ich gezwungenerweise unter den Verwandten Lisas gewählt hatte, Herrn Saccard… «
»Still! sie wacht auf« – unterbrach Lazare.
Pauline schlug in der Tat die Augen weit auf. Ohne sich zu rühren, sah sie erstaunt die plaudernden Menschen an; dann ließ sie mit einem schlaftrunkenen Lächeln die Augen wieder zufallen; und ihr unbewegliches Gesicht nahm von neuem die milchige Durchsichtigkeit der Kamelie an.
»Ist dieser Saccard nicht der Spekulant?« fragte Chanteau.
»Ja,« erwiderte seine Frau, »ich habe ihn gesehen, wir haben zusammen geplaudert. Ein reizender Mann… Er hat so viele Geschäfte im Kopfe, daß er mich gleich aufmerksam machte, auf seine Mithilfe sei nicht zu rechnen… Du begreifst, wir haben niemanden nötig. Wenn wir die Kleine zu uns nehmen, so nehmen wir sie ganz, nicht wahr? Ich liebe es nicht, daß man bei uns herumschnüffelt… Das übrige war schnell erledigt. Deine Vollmacht enthielt zum Glück alle notwendigen Befugnisse. Man entfernte die Siegel, nahm den Vermögensbestand auf und verkaufte das Wurstgeschäft aufs Meistgebot. Ein wahrer Glücksfall! Zwei rasende Bewerber, neunzigtausend Franken bar! Der Anwalt hatte bereits sechzig tausend Franken in Staatspapieren in einem Möbel gefunden. Ich habe ihn ersucht, weitere Papiere zu kaufen, und so haben wir hundertfünfzigtausend Franken in sicheren Werten, die ich zu meiner Freude gleich mitbringen konnte, nachdem ich den Bureauvorsteher von der Vollmacht entbunden und ihm die Quittung gegeben hatte, um die ich dich mit umgehender Post ersuchte… Halt, seht euch das an!«
Sie hatte abermals die Hand in die Reisetasche gesteckt und holte jetzt ein unfangreiches Paket hervor, das Paket der Wertpapiere, das zwischen zwei Kartondeckel eines alten Geschäftsbuches des Wurstladens geschnürt war, dessen Blätter ausgerissen waren. Der grün marmorierte Umschlag war mit Fettflecken bespritzt. Vater und Sohn beäugelten dieses Vermögen, das auf die abgenutzte Decke ihres Tisches niederfiel.
»Der Tee wird kalt, Mama«, sagte Lazare und setzte die Feder ab. »Ich gieße ein.«
Er war aufgestanden und füllte die Tassen. Die Mutter hatte nicht geantwortet, ihre Augen waren fest auf die Wertpapiere gerichtet.
»Natürlich habe ich«, fuhr sie mit langsamer Stimme fort, »in dem letzten von mir veranlaßten Familienrate die Entschädigung meiner Reisekosten nachgesucht, und man hat die Pension für die Kleine mit achthundert Franken angesetzt … Wir sind nicht so reich wie sie, können ihr also kein Gnadenbrot geben. Keiner von uns möchte von diesem Kinde Nutzen ziehen wollen, aber es fällt uns schwer, von dem Unseren zuzuschießen. Man wird die Zinsen ihrer Renten zurücklegen und von heute bis zu ihrer Großjährigkeit das Kapital fast verdoppeln … Mein Gott! wir erfüllen nur unsere Pflicht. Man muß den Toten gehorchen. Wenn wir noch vom Unseren zuschießen, gut, so bringt uns das vielleicht Glück, das wir sehr gebrauchen können. Das arme Herzchen war so erschüttert und schluchzte so stark, als es seine Magd verließ! Es soll sich glücklich bei uns fühlen.«
Die beiden Männer wurden von Rührung erfaßt.
»Ich werde ihr gewiß nichts tun«, sagte Chanteau.
»Sie ist entzückend,« fügte Lazare hinzu, »ich liebe sie schon sehr.«
Mathieu aber, der in seinem Schlafe den Tee gerochen, hatte sich geschüttelt und seinen großen Kopf abermals auf den Tischrand gelegt. Minouche streckte sich ebenfalls und krümmte gähnend den Rücken. Es war ein allgemeines Erwachen; die Katze reckte den Hals, um das Paket in dem fettigen Kartondeckel zu beriechen. Als die Chanteaus ihre Blicke Pauline zuwandten, sahen sie ihre Augen offen und auf die Papiere, auf dieses alte, zerlumpte, hier sich wiederfindende Geschäftsbuch gerichtet.
»Sie weiß sehr gut, was darin ist«, hob Frau Chanteau an. »Nicht wahr, mein Schatz, ich habe es dir in Paris gezeigt … Es ist die Hinterlassenschaft deiner armen Eltern für dich.«
Tränen rollten über die Backen des kleinen Mädchens. So kehrte zuweilen sprunghaft ihr Kummer zurück, wie plötzliche Regengüsse im Frühjahr. Sie lächelte aber bereits inmitten ihrer Tränen, sie belustigte sich über Minouche, die, nachdem sie lange an den Wertpapieren geschnüffelt, wahrscheinlich durch den Geruch angelockt, wieder Teig zu kneten, zu schnurren und den Ecken des Buches starke Kopfstöße zu geben begann.
»Minouche, willst du das wohl lassen!« schrie Frau Chanteau. »Seit wann spielt man mit dem Gelde!«
Chanteau lachte, Lazare ebenfalls. Vom Rande des Tisches aus verschlang Mathieu in höchster Erregung mit seinen flammenden Augen die Papiere, die er wahrscheinlich für eine Leckerei hielt, und kläffte die Katze an. Die ganze Familie lachte laut. Pauline, von diesem Spiele entzückt, hatte Minouche in die Arme genommen und wiegte und herzte sie wie eine Puppe.
Frau Chanteau, die ein abermaliges Einschlafen des Kindes befürchtete, ließ es sofort seinen Tee trinken. Dann rief sie Veronika.
»Gib uns die Leuchter … Man plaudert weiter, und an das Zubettgehen wird nicht gedacht. Schon wieder zehn Uhr! Und ich schlief schon beim Essen ein!«
Aber eine Männerstimme wurde gerade in der Küche laut. Sie fragte die Magd, als diese vier angezündete Wachsstöcke hereinbrachte:
»Mit wem sprichst du?«
»Es ist Prouane … Er kommt dem Herrn melden, daß es unten nicht gut steht. Es scheint, die Flut zertrümmert alles.«
Chanteau hatte das Bürgermeisteramt von Bonneville annehmen müssen und Prouane, der bei dem Abbé Horteur als Kirchendiener tätig war, bekleidete außerdem den Posten des Amtsschreibers. Er hatte in der Kriegsflotte den Unteroffiziersgrad erreicht und schrieb wie ein Schulmeister. Als man ihm zurief, er solle nähertreten, erschien er mit der leinenen Mütze in der Hand und vom Wasser triefenden Kleidern und Stiefeln.
»Was gibt es, Prouane?«
»Verdammt, Herr, diesmal ist mit dem Hause des Cuche aufgeräumt worden. Wenn das so weiter geht, kommt das von Gonin an die Reihe. Wir waren alle da, Tournal, Houtelard, ich und die anderen. Aber was wollen Sie? Man kann gegen diese verdammte See nichts ausrichten. Sie reißt uns jedes Jahr ein Stück Land fort.«
Es trat Schweigen ein. Die vier Wachsstöcke brannten mit hohen Flammen, und man hörte das Meer, das verdammte Meer, gegen das Gestade donnern. Das schallte wie die Entladung einer Riesenartillerie, wie schwere und regelmäßige Kanonenschüsse inmitten des prasselnden Geräusches der auf die Felsen geschleuderten Kieselsteine, was einem fortgesetzten Knattern von Flintensalven glich. Und in diesen Lärm warf der Wind sein klagendes Geheul, der Regen verdoppelte sich für Augenblicke, er schien die Mauern mit einem Bleihagel zu überschütten.
»Das ist das Ende der Welt«, murmelte Frau Chanteau. »Und wohin haben sich die Cuches geflüchtet?«
»Man wird sie irgendwo unterbringen müssen«, antwortete Prouane. »Sie warten inzwischen bei den Gonins … Der kleine Dreijährige aufgeweicht wie eine Suppe! Die Mutter im Unterrock zeigte, mit Respekt zu sagen, alles, was sie hatte, und der Vater, dem der Kopf halb durch einen Balken gespalten war, verbohrte sich auf die Rettung ihrer armseligen Habe!«
Pauline hatte den Tisch verlassen. Sie ging wieder an das Fenster und lauschte mit dem Ernste einer erwachsenen Person. Ihr Gesicht drückte eine tief betrübte Güte, eine aufrichtige Teilnahme aus, die ihre dicken Lippen erzittern ließ.
»Oh, Tante, diese armen Leute«, sagte sie.
Ihre Blicke wanderten hinaus in den schwarzen Schlund, zu dem die Finsternis sich verdichtet hatte. Man spürte, daß das Meer bis an die Landstraße vorgedrungen war, daß es dort aufgebläht und heulend stand; aber man sah es trotzdem nicht mehr, es schien mit Strömen von Tinte das kleine Dorf, die Uferfelsen, den ganzen Horizont überflutet zu haben. Das war für das Kind eine schmerzliche Überraschung. Dieses Wasser war ihr so schön erschienen und warf sich jetzt auf das Land!
»Ich komme mit euch, Prouane«, rief Lazare. »Vielleicht gibt es etwas zu tun.«
»O ja, Vetter«, sagte Pauline leise, und ihre Augen leuchteten.
Der Mann aber schüttelte den Kopf.
»Es lohnt sich nicht der Mühe, Herr Lazare. Sie können nicht mehr tun als die Kameraden. Wir stehen da und schauen zu, wie das Meer uns nach seinem Belieben vernichtet, und wenn es ihm nicht mehr gefällt, können wir uns noch bei ihm bedanken … Ich habe den Herrn Bürgermeister nur in Kenntnis setzen wollen.«
Jetzt ärgerte sich Chanteau, den dieses Trauerspiel langweilte, das ihm die Nacht verdarb und mit dem er sich am folgenden Tage zu beschäftigen hatte.
»Man kann sich aber auch kaum ein so dumm gebautes Dorf vorstellen«, rief er. »Ihr habt euch in die Wellen gedrängt und erstaunlich ist es wirklich nicht, wenn das gierige Meer euch eure Häuser eins nach dem anderen auffrißt … Warum bleibt ihr in dem Loche? Man geht einfach.«
»Wohin denn?« fragte Prouane, der mit entsetzter Miene zuhörte. Man ist nun einmal hier und bleibt hier … Irgendwo muß man doch sein.«
»Das ist wahr«, schloß Frau Chanteau. »Hier oder dort: man ist überall schlecht daran … Wir gehen hinauf, um uns schlafen zu legen. Guten Abend! Morgen ist klares Wetter.«
Der Mann verabschiedete sich und ging, und man hörte Veronika die Riegel hinter ihm zuschieben. Jeder nahm einen Wachsstock, man liebkoste noch einmal Mathieu und die Minouche, die beide in der Küche schliefen. Lazare hatte seine Noten zusammengerafft, während Frau Chanteau die Wertpapiere im alten Buchdeckel unter ihren Arm preßte. Sie nahm den Rechnungsausweis von Davoine, den ihr Mann vergessen hatte, ebenfalls vom Tische. Dieses Papier zerriß ihr das Herz, man brauchte es nicht überall herumliegen lassen.
»Wir gehen nach oben, Veronika«, rief sie. »Du wirst doch nicht so spät noch herumlaufen?«
Als von der Küche her nur ein Grunzen als Erwiderung klang, setzte sie leiser hinzu:
»Was hat sie denn? Es ist doch kein zu entwöhnendes Kind, das ich ihr ins Haus bringe.«
»Kümmere dich nicht um sie,« sagte Chanteau, »du weißt, sie hat ihre Grillen. Sind wir alle vier hier? Gute Nacht also.«
Er schlief zu ebener Erde an der anderen Seite des Flurs in dem ehemaligen Salon, der zum Schlafzimmer umgewandelt war. So konnte man ihn, wenn er gerade einen Anfall hatte, mit seinem Lehnstuhl bequem an den Tisch oder auf die Terrasse rollen. Er öffnete seine Tür, verweilte aber noch einen Augenblick mit den eingeschlafenen, schon von der dumpfen Annäherung eines Anfalles bedrohten Beinen, welche die Steifheit seiner Gelenke ihm seit dem Abende vorher ankündigte. Das Naschen von der Gänseleberpastete war entschieden ein großer Fehler gewesen. Diese jetzt zur Gewißheit gewordene Tatsache brachte ihn zur Verzweiflung.
»Gute Nacht«, wiederholte er mit kläglicher Stimme. »Ihr schlaft stets … Gute Nacht, mein Herzchen. Ruhe dich gut aus, in deinem Alter kann man das noch.«
»Gute Nacht, Onkel«, sagte ihrerseits Pauline und umarmte ihn.
Die Tür schloß sich. Frau Chanteau ließ die Kleine vorausgehen. Lazare folgte ihnen.
»Mich wird man jedenfalls heute Abend nicht einzuwiegen brauchen«, erklärte die alte Dame. »Auch bringt mir dieser Lärm Schlaf, er ist mir durchaus nicht unangenehm. In Paris fehlte mir diese Erschütterung in meinem Bette.«
Alle drei langten in dem ersten Stockwerke an. Pauline, die ihren Wachsstock hübsch gerade hielt, belustigte sich über diesen Gänsemarsch, jeder mit dem Lichte in der Hand, dessen Schein die Schatten tanzen ließ. Als sie auf dem Absatze zögernd stehen blieb, da sie nicht wußte, wohin die Tante sie führte, schob diese sie sanft vorwärts.
»Geh gerade aus … Das ist ein Fremdenzimmer, gegenüber das meine. Komm einen Augenblick herein, ich will es dir zeigen.«
Es war ein mit gelbem, grünbemustertem Leinen ausgeschlagenes Gemach mit schlichten Mahagonimöbeln: einem Bette, einem Kleiderschrank, einem Schreibsekretär. Ein runder Tisch war in der Mitte auf einen roten Teppich gestellt. Als Frau Chanteau mit ihrem Wachslichte in alle Ecken und Winkel geleuchtet hatte, näherte sie sich dem Schreibsekretär, dessen Deckel sie aufklappte.
»Sieh«, sagte sie.
Sie hatte eine der kleinen Schiebladen geöffnet und legte aufseufzend den vernichtenden Ausweis von Davoine hinein. Dann räumte sie ein anderes Schiebfach darüber aus, zog es hervor und schüttelte es, um alle Krümchen herausfallen zu lassen. Während sie sich anschickte, vor dem zuschauenden Kinde die Wertpapiere dort hineinzutun, sagte sie:
»Du siehst, ich lege sie hier hinein; dort ruhen sie ganz abgesondert … Willst du selbst sie hineinlegen?«
»O, Tante, das ist nicht der Mühe wert.«
Aber schon hatte sie das alte Geschäftsbuch in der Hand und mußte es tief hinten in das Schiebfach stecken, während Lazare mit erhobenem Wachslicht das Innere des Möbels beleuchtete.
»Jetzt bist du sicher,« fuhr Frau Chanteau fort, »und sei ruhig, eher würde man daneben Hungers sterben. Erinnere dich, die erste Schieblade links. Die Papiere kommen erst an dem Tage wieder heraus, an welchem du ein so großes Mädchen bist, daß du selbst sie dir zurückholen kannst … Gelt, Minouche, wird sie dir hier innen nicht auffressen.«
Der Gedanke, daß Minouche den Schreibsekretär öffnen und die Papiere auffressen könnte, ließ das Kind laut auflachen. Seine kurze Verlegenheit war verschwunden, es spielte mit Lazare, der zu ihrer Belustigung wie die Katze schnurrte und so tat, als ob er das Schiebfach angreife. Er lachte ebenfalls herzlich. Seine Mutter aber hatte feierlich die Platte zugeklappt und verschloß sie doppelt mit energischer Handbewegung.
»Das wäre getan«, sagte sie. »Mache keine Dummheiten, Lazare. Jetzt will ich hinaufgehen und sehen, ob nichts fehlt.«
Alle drei kehrten im Gänsemarsch wieder auf die Treppe zurück. Im zweiten Stock hatte Pauline von neuem zögernd, die Tür links geöffnet, als ihre Tante ihr zurief:
»Nein, nein, nicht auf dieser Seite. Das ist das Zimmer deines Vetters; deine Stube befindet sich gegenüber.«
Pauline war stehen geblieben, angelockt durch die Größe des Raumes und das speicherartige Durcheinander der ihn füllenden Gegenstände; da waren ein Klavier, ein Schlafsofa, ein riesiger Tisch, Bücher und Bilder. Endlich stieß sie die andere Tür auf und war entzückt, obwohl ihr Zimmer ihr, im Vergleich zu dem anderen, ganz klein erschien. Die Tapeten hatten einen ungetönten Grund mit eingestreuten blauen Rosen. Es standen dort ein eisernes Bettgestell mit Musselinvorhängen, ein Toilettetisch, eine Kommode und drei Stühle.
»Es fehlt nichts,« sagte Frau Chanteau; »Wasser, Zucker, Handtücher, Seife, alles da… Schlafe ungestört. Veronika liegt in einer Kammer nebenan. Wenn du dich fürchtest, brauchst du nur an die Mauer zu klopfen.«
»Dann bin auch ich noch da«, erklärte Lazare. »Wenn ein Gespenst erscheint, komme ich mit meinem großen Säbel.«
Die Türen der beiden gegenüber gelegenen Zimmer waren offen geblieben, Pauline ließ ihre Blicke von dem einen zum andern gleiten.
»Es gibt keine Gespenster«, sagte sie mit heiterer Miene. »Ein Säbel ist gut gegen die Diebe. Gute Nacht, Tante. Gute Nacht, Vetter.«
»Gute Nacht, Schätzchen… Wirst du dich auskleiden können?«
»0 ja, ja… Ich bin kein kleines Mädchen mehr. In Paris machte ich alles allein.«
Sie umarmten sich. Frau Chanteau sagte ihr noch beim Hinausgehen, sie könne die Tür von innen abschließen. Aber schon stand das Kind am Fenster, es brannte vor Begierde zu sehen, ob es eine Aussicht auf das Meer habe. Der Regen rieselte mit solcher Heftigkeit an den Scheiben hernieder, daß Pauline nicht zu öffnen wagte. Es war sehr dunkel, aber es beglückte sie, das Meer zu ihren Füßen sich brechen zu hören. Dann machte sie trotz der Müdigkeit, die sie fast im Stehen einschlafen ließ, die Runde durch das Zimmer und besah die Möbel. Der Gedanke, daß sie nunmehr eine Stube für sich habe, einen von den anderen getrennten Raum, in dem sie sich einschließen konnte, erfüllte sie mit dem Stolze, schon eine erwachsene Person zu sein. Als sie jedoch den Schlüssel umdrehen wollte, ihr Kleid schon ausgezogen hatte und im kurzen Unterrocke dastand, zögerte sie, von einem Unbehagen gepackt. Wohin konnte sie sich retten, wenn sie jemanden sah? Es überlief sie ein Schauder, und sie öffnete nochmals die Tür. Gegenüber, in der Mitte des eigenen Zimmers, stand noch Lazare und schaute sie an.
»Was gibt es?« fragte er. »Brauchst du etwas?«
Sie wurde tief rot, wollte erst eine Ausrede machen, dann aber gab sie ihrem Offenheitsdrange nach.
»Nein, nein. Ich habe Furcht, wenn die Türen mit Schlüsseln verschlossen sind. Ich will mich deshalb lieber nicht einschließen, verstehst du, und wenn ich klopfe, gilt es dir, damit du kommst… Du, hörst du, nicht das Mädchen.«
Er war näher gekommen, angezogen durch den Reiz des schlichten und zärtlichen Kindes.
»Gute Nacht«, wiederholte er und öffnete die Arme.
Sie warf sich an seinen Hals und umschlang ihn mit ihren dünnen Ärmchen, ohne sich um ihre Nacktheit eines kleinen unreifen Mädchens zu kümmern.
»Gute Nacht, Vetter.«
Fünf Minuten später hatte sie tapfer ihr Wachslicht ausgelöscht und sich tief in ihrem Bette hinter den Musselinvorhängen zusammengerollt. Vor Ermüdung verfiel sie in einen langen traumlosen Schlaf. Zuerst hörte sie noch Veronika mit rücksichtslosem Geräusch heraufstampfen und ihre Möbel in einer Weise rücken, daß jeder aufwachen mußte. Dann vernahm sie nur den grollenden Donner des Sturmes, der nicht nachlassende Regen schlug auf das Schieferdach, der Wind rüttelte an den Fenstern und heulte unter den Türen; noch eine volle Stunde dauerte die Kanonade, erschütterte sie jede aufklatschende Woge mit einem tiefen, dumpfen Stoße. Es war ihr, als ob das in Ruhe und Schweigen versunkene Haus wie ein Schiff im Wasser davongetragen werde. Sie verspürte jetzt eine angenehme, feuchte Wärme, ihr schwankender Gedankengang wandte sich in hilfsbereitem Mitleid zu den armen Leuten, die das Meer dort unten aus ihrem Obdache jagte. Dann versank alles; sie schlief ein.
Kapitel2
Schon von der ersten Woche an brachte Paulinens Anwesenheit Frohsinn in das Haus. Ihr ungestörter Frohsinn, ihr stilles Lächeln beruhigten die dumpfe Erbitterung, in der Chanteaus lebten. Der Vater hatte eine Krankenwärterin gefunden, die Mutter war glücklich, daß der Sohn jetzt mehr zu Hause blieb. Nur Veronika fuhr fort zu murren. Es schien, als gäben die in dem Sekretär verschlossenen hundertfünfzigtausend Franken der Familie ein reicheres Aussehen, obgleich man nicht daran rührte. Ein neues Band war geknüpft, und es erwuchs inmitten ihres Ruins eine Hoffnung, ohne daß man genau hätte sagen können, was für eine.
In der Nacht des übernächsten Tages war der Gichtanfall, dessen Kommen Chanteau gefühlt hatte, zum Ausbruch gekommen. Bereits seit einer Woche verspürte er Prickeln in den Gelenken, Frostschauer, die seine Glieder schüttelten, eine unüberwindliche Abneigung vor jeder Bewegung. Er hatte sich am Abend trotzdem ruhiger zu Bette gelegt, als gegen drei Uhr morgens sich der Schmerz in der Zehe des linken Fußes einstellte. Er sprang dann in die Ferse und bemächtigte sich schließlich des Fußknöchels. Bis Tagesanbruch klagte er nur leise und schwitzte unter seinen Decken, um niemanden zu stören. Seine Anfälle waren das Entsetzen des Hauses. Er wartete bis zum letzten Augenblick, jemanden zu rufen, weil er sich schämte, wieder angefallen zu sein, und im voraus über die verboste Aufnahme in Verzweiflung war, die man seinem Leiden wieder angedeihen lasse. Als Veronika indessen gegen acht Uhr an seiner Tür vorüberging, konnte er einen Schrei nicht zurückhalten, den ihm ein heftigeres Stechen entrang.
»Da haben wir's«, brummte die Magd. »Er heult richtig schon wieder.«
Sie war hineingegangen, sah ihn wimmernd den Kopf hin- und herdrehen und fand nur die Trostworte:
»Die Gnädige wird erfreut sein!«
In der Tat ließ Frau Chanteau, als sie hereintrat, die Arme mit einer Bewegung erbitterter Entmutigung sinken.
»Abermals! Ich komme kaum, und schon fängt es wieder an.«
Sie nährte gegen diese Gicht einen fünfzehnjährigen Groll. Sie verfluchte diese Elende wie eine Feindin, diese Schurkin, die ihr Leben verdorben, ihren Sohn ruiniert und ihren Ehrgeiz getötet habe. Hätten sie sich, wäre die Gicht nicht gewesen, in dieses weltverlorene Dorf verbannt? Trotz ihres guten Herzens stand sie den Anfällen zitternd und feindselig gegenüber; sie bezeichnete sich selbst als ungeschickt und nicht tauglich zu seiner Pflege.
»Mein Gott! Wie ich leide!« stammelte der arme Mann. »Ich fühle es, der Anfall wird stärker werden als der letzte … Bleibe nicht hier, es macht dich das mißmutig; aber schicke sogleich zum Doktor Cazenove.«
Von dem Augenblicke an stand das ganze Haus auf dem Kopfe. Lazare war nach Arromanches gegangen, obgleich die Familie keine große Hoffnung mehr in die Ärzte setzte. Chanteau hatte es schon seit fünfzehn Jahren mit allen nur möglichen Arzneien versucht, aber mit jedem neuen Versuche ward das Übel schlimmer. Zuerst schwach und selten, hätten sich die Anfälle bald vermehrt und an Heftigkeit zugenommen. Heute befielen sie bereits die beiden Füße, selbst ein Knie war bedroht. Der Kranke hatte schon dreimal die Heilmethode gewechselt, sein armer Körper war zu einem Versuchsfelde geworden, auf dem sich die Reklamemittel Schlachten lieferten. Nachdem man ihm zuerst reichlich zur Ader gelassen hatte, ließ man ihn darauf unvernünftig abführen, und jetzt stopfte man ihn mit Colchicum und Lithium voll. Durch die Entkräftung des verschlechterten Blutes und der geschwächten Organe verwandelte sich auch nach und nach seine akute Gicht in eine chronische. Die lokalen Behandlungen waren von keinem besseren Erfolg begleitet, die Blutegel hatten die Gelenke steif gemacht, das Opium verlängerte die Anfälle, und die Zugpflaster verursachten leichte Geschwüre. Wiesbaden und Karlsbad brachten nicht die geringste Wirkung, ein Aufenthalt in Vichy hatte ihn fast getötet.
»Mein Gott! Wie ich leide!« wiederholte Chanteau, »mir ist, als fräßen mir Hunde den Fuß ab.«
Von einer angstvollen Aufregung erfaßt, drehte er in der Hoffnung, sich durch eine veränderte Lage Erleichterung verschaffen zu können, das Bein hin und her. Bald stieß er in der Raserei des Schmerzes ein ununterbrochenes Geheul aus. Er verspürte Schüttelfröste und Fieber; ein brennender Durst verzehrte ihn.
Währenddem glitt Pauline in das Zimmer. Vor dem Bette stehend, sah sie ihren Onkel mit ernster Miene, ohne zu weinen an. Frau Chanteau verlor, von dem Geschrei nervös gemacht, den Kopf. Veronika hatte die Bettdecke, deren Last der Kranke nicht mehr ertragen konnte, zurechtlegen wollen. Als sie ihm aber mit ihren Männerhänden nahte, hatte er noch lauter zu schreien begonnen und ihr verboten, ihn zu berühren. Sie war sein Schrecken; er beschuldigte sie, daß sie ihn wie ein Bündel unsauberer Wäsche schüttele.
»Dann ruf en Sie mich nicht, Herr«, sagte sie und stürmte wütend hinaus. »Wenn man die Leute zurückstößt, mag man sich eben allein pflegen.«
Pauline hatte sich langsam genähert und mit ihren Kinderhänden die Bettdecke leicht und geschickt aufgenommen. Er empfand eine flüchtige Erleichterung und nahm ihre Dienstleistungen an.
»Danke, liebe Kleine … Halt, die Falte dort. Sie wiegt fünfhundert Pfund! Oh! Nicht so schnell! Du hast mir Furcht gemacht.«
Der Schmerz begann übrigens heftiger zu werden. Als seine Frau sich im Zimmer zu schaffen machte, die Fenstervorhänge zusammenzog, zurückkam um eine Tasse auf den Nachttisch zu stellen, wurde er noch aufgeregter.
»Ich bitte dich, lauf nicht umher, du läßt alles erzittern … Bei jedem deiner Schritte meine ich einen Schlag mit dem Hammer zu erhalten.«
Sie versuchte nicht einmal eine Entschuldigung und ihn zufrieden zu stellen. Es nahm stets dieses Ende. Man ließ ihn allein mit seinem Leiden.«
»Komm, Pauline«, sagte sie ruhig. »Du siehst, dein Onkel kann uns nicht um sich dulden.«
Pauline blieb aber. Sie trat so leicht auf, daß ihre Füßchen kaum den Fußboden streiften. Von diesem Augenblicke an blieb sie bei dem Kranken; er litt keinen anderen in seinem Zimmer. Wie er sagte, hätte er am liebsten von einem Hauche bedient sein mögen. Sie hatte das Verständnis, das Leiden zu erraten und zu lindern; sie kam seinen Wünschen zuvor und regelte das Tageslicht oder reichte ihm die Tassen Griesschleim, die Veronika bis an die Tür brachte. Den armen Mann beruhigte vor allem, daß er Pauline fortwährend artig und regungslos auf dem Rande eines Stuhles vor sich sitzen sah, mit ihren großen teilnehmenden Augen, die ihn nicht verließen. Er versuchte, sich durch die Erzählung seiner Leiden zu zerstreuen.
»Siehst du, in diesem Augenblick ist es, als wenn mir ein schartiges Messer die Fußknochen aus dem Gelenke schneide, und ich möchte schwören, daß man mir zu gleicher Zeit lauwarmes Wasser über die Haut gießt.«
Dann nahm der Schmerz eine andere Gestalt an: man binde ihm die Gelenke mit Eisendraht, man spanne seine Muskel bis zum Springen, ähnlich wie Violinsaiten. Pauline hörte mit freundlicher Miene zu, schien alles zu verstehen, fürchtete sich nicht vor dem Geheul seiner Klagen und war einzig auf seine Heilung bedacht. Sie war sogar heiter, und es gelang ihr auch, ihn zwischen einem Gestöhn und dem anderen zum Lachen zu bringen.
Als endlich Doktor Cazenove kam, war er ganz erstaunt und drückte einen schallenden Kuß auf die Haare der kleinen Krankenpflegerin. Er war ein Mann von vierundfünfzig Jahren, hager und kräftig; er hatte sich nach dreißigjährigem Dienst in der Marine nach Arromanches zurückgezogen, wo ein Oheim ihm ein Haus hinterlassen. Seitdem er Frau Chanteau von einer bedenklichen Verstauchung geheilt, war er der Freund der Familie geworden.
»Also immer noch das Alte«, sagte er. »Ich bin gekommen, Ihnen die Hand zu drücken; ich kann nicht mehr tun als dieses Kind, müssen Sie wissen. Wenn man die Gicht geerbt und die Fünfzig überschritten hat, mein Lieber, muß man Trauer anlegen. Bedenken Sie ferner, daß Sie sich mit einer Unlast von Medizinen den Rest gegeben haben … Sie kennen das einzige Mittel: Geduld und Flanell.«
Er trug gern eine große Ungläubigkeit zur Schau. Während dreißig Jahre hatte er soviel Kranke in allen Klimaten und in allen möglichen Arten von Verfaulungen sterben sehen, daß er im Grunde sehr bescheiden geworden war; er zog, sooft er konnte, vor, die Natur walten zu lassen. Trotzdem untersuchte er die geschwollene Zehe, deren glänzende Haut dunkelrot war; er ging zu dem von der Entzündung ergriffenen Knie über und stellte das Vorhandensein einer harten, weißen kleinen Perle am Rande des rechten Ohres fest.