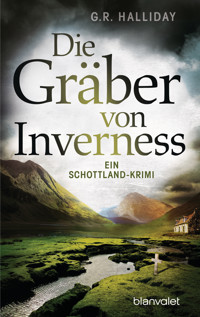8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Monica Kennedy
- Sprache: Deutsch
Eine verschollene Jacht, eine mysteriöse Passagierin, die wiederkehrt, und eine Stadt voller Geheimnisse ... – ein neuer spannender Fall für DI Monica Kennedy!
Eine Frau steht knietief in einem See, die Arme ausgestreckt. Ihre einzigen Worte: Emily Hurst. Vor fünf Jahren stach eine Jacht in See, an Bord eine Frau, die niemand kannte: Emily. Die Jungfernfahrt sollte ein Fest werden für alle, die beim Bau der Jacht geholfen hatten. Doch dann brach der Kontakt ab. Die Explorer wurde nie wieder gesehen. Während DI Monica Kennedy versucht, die mysteriöse Frau zu identifizieren, sind die Bewohner der Kleinstadt Fort William entschlossen, endlich die Wahrheit aufzudecken: Was geschah damals mit der Explorer? Irgendjemand weiß etwas, doch niemand will reden …
Sie wollen noch mehr Inverness? Dann entdecken Sie auch die anderen Bücher der Monica-Kennedy-Reihe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Eine Frau steht knietief in einem See, die Arme ausgestreckt. Ihre einzigen Worte: Emily Hurst. Vor fünf Jahren stach eine Jacht in See, an Bord eine Frau, die niemand kannte: Emily. Die Jungfernfahrt sollte ein Fest werden für alle, die beim Bau der Jacht geholfen hatten. Doch dann brach der Kontakt ab. Die Explorer wurde nie wieder gesehen. Während DI Monica Kennedy versucht, die mysteriöse Frau zu identifizieren, sind die Bewohner der Kleinstadt Fort William entschlossen, endlich die Wahrheit aufzudecken: Was geschah damals mit der Explorer? Irgendjemand weiß etwas, doch niemand will reden …
Autor
G. R. Halliday wurde in Edinburgh geboren und wuchs in der Nähe von Stirling, Schottland, auf. Die Leidenschaft für ausgeklügelte Kriminalfälle hat er von seinem Vater, der Bücher über True Crime und mysteriöse Phänomene schrieb. Einige dieser Geschichten wurden zur Inspirationsquelle für seine eigenen Romane. Heute lebt er mit seiner Lebensgefährtin und einer Bande halbwilder Katzen in der Nähe von Inverness in den schottischen Highlands.
Von G. R. Halliday bereits erschienen
Die Toten von Inverness · Die dunklen Wasser von Inverness · Die Gräber von Inverness · Die Leichen von Inverness
G. R. Halliday
Die Leichen von Inverness
Ein Schottland-Krimi
Deutsch von Bettina Spangler
Die Bibelzitate Psalm 107, 23–25 und Mt 25, 35–36 stammen aus der Lutherbibel aus dem Jahr 1912.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originaltitel: THEPASSENGER
Copyright © 2025 by G. R. Halliday
Published by Arrangement with HIGHLANDNOIRLIMITED
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de
StH · Herstellung: DiMo
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-30467-6V002
www.blanvalet.de
1
Sonntag, 16. April 2017
Als man sich hinter vorgehaltener Hand die ersten Gerüchte über eine Fremde zuraunte, die wie aus dem Nichts aufgetaucht sei, musste Patrick McDonald unwillkürlich an die Ereignisse von damals denken. Wie er an jenem Vormittag am Pier von Fort William stand und auf den Loch Linnhe hinausstarrte. Er hasste das Meer, das Geschrei der Möwen, den durchdringenden Gestank nach Fisch. Während er aufs Wasser blickte, ging ihm mit einem Mal auf, dass es vor allem die darunterliegende Tiefe war, die er so verabscheute, diese grenzenlose Leere. Die Vorstellung, wie weit es dort hinabging, empfand er als beängstigend, denn wer wusste schon, wie weit genau? Und wer hätte sagen können, was sich da unten alles verbarg?
Ausgelassenes Gelächter schallte von der Jacht zu ihm herüber, und er hob den Kopf. Der Anblick des Bootes erinnerte ihn daran, dass er einen Job zu erledigen hatte. Selbst Patrick, für den es keinen wesentlichen Unterschied machte, ob er nun ein Boot betrat oder sich gleich in die Abgründe des Meeres stürzte, musste neidlos zugeben, dass die Explorer das Musterexemplar einer Superjacht war, absolut beeindruckend. Mit seinen neunzig Metern Länge wirkte das elegante Schiff in Weiß und Eisblau so kraftvoll, als könne es alles durchdringen, Meer, Fels, Eisberge. Es maß zwölf Meter an seiner breitesten Stelle, verfügte über sechzehn Schlafplätze und schaffte eine Maximalgeschwindigkeit von vierzehn Knoten. Der Punkt aber, der alle Welt in helle Aufregung versetzte, waren die horrenden Baukosten, die sich dem Hörensagen nach auf hundertfünfzig Millionen Pfund beliefen. Patrick war bewusst, dass er all diese Daten und Fachbegriffe noch einmal würde überprüfen müssen, bevor er seinen Artikel für den Fort WilliamAdvertiser zu Ende schrieb und einreichte.
Er sah am hölzernen Anleger entlang zu den versammelten Schaulustigen, die das Spektakel mit neidvollen Blicken vom Geländer des Piers aus beobachteten, und weiter zu den Passagieren. Das Boarding war so gut wie abgeschlossen. Patrick schätzte sie auf rund zwanzig Personen, die sich über das Vorderdeck verteilt hatten. Hinter ihnen erstreckte sich der lang gezogene See, der nahtlos ins Meer überging und zu dessen beiden Seiten sich steile Bergflanken erhoben, darüber ein makellos blauer Himmel. Der perfekte Tag – und keine Spur von dem ursprünglich vorhergesagten Unwetter. Nach Ansicht von Patrick, der erst kürzlich aus dem Süden Englands hierher in den hohen Norden gezogen war, grenzte dies an der Westküste der schottischen Highlands nahezu an ein Wunder, noch dazu im Frühling.
Wieder schallte lautes Gelächter von der Jacht herüber, als der soeben geöffnete Champagner schäumend überfloss und einer der Passagiere sich auf die Knie begab und so tat, als schlürfe er das perlende Getränk direkt vom Teakdeck. Das Thema Superjachten war für Patrick komplettes Neuland, aber es war nicht zu übersehen, dass die Menschen an Bord mit dieser Sorte Luxus mindestens genauso wenig vertraut waren wie er selbst. Zum einen waren die Leute extrem aufgekratzt, und sie genossen sichtlich ihr Publikum am Pier, dem sie gelegentlich zuwinkten. Und zum anderen kannte Patrick die meisten von ihnen persönlich. Fort William war eine Kleinstadt, wenn man hier wohnte, schloss man ziemlich rasch Bekanntschaft, wenigstens oberflächlich. Der Champagnerschlürfer rappelte sich wieder auf, tat so, als wische er sich den Mund mit dem Handrücken ab, und hob den Arm grüßend in Patricks Richtung. Für den Bruchteil einer Sekunde versteifte er sich, verwundert, dass der Mann ihn so direkt ansah. Dann fiel ihm schlagartig wieder ein, weshalb er eigentlich hier war, und er spürte das Gewicht der Kamera, die um seinen Hals baumelte.
Er winkte zurück, hob das Objektiv und machte ein paar Schnappschüsse von dem breit grinsenden Mann. Archie, der Schrank, so nannten ihn die, mit denen er regelmäßig im Silver Dolphin zechte. Patrick wusste zufällig, dass Archie mit diesem Trip seinen wohlverdienten Start in den Ruhestand feierte. Er hatte viele Jahre, schon seit den Siebzigern, für Thule gearbeitet, jene Firma, die die Jacht gebaut hatte. Patrick tippte auf den Auslöser, wobei sein Magen einen munteren Purzelbaum schlug – denn jetzt stellte er fest, wie sehr es ihn freute, dass er all die Einzelheiten über Archie wusste. Er war froh, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, seine Mitmenschen zu kennen. Es war mehr, als er sich erhofft hatte, als er seine Chance genutzt hatte und von London hierhergezogen war, unmittelbar nach der Trennung von Jessica. Archie winkte ihm noch einmal zu, zeigte auf die Gruppe von Passagieren neben sich und bedeutete ihm, auch von ihnen Fotos zu machen. Natürlich kam Patrick dem Wunsch bereitwillig nach und klickte munter drauflos. Nach und nach machte er weitere bekannte Gesichter aus. Da war Belinda Forbes, die bei Thule die Buchhaltung führte, dann ihre Schwägerin Janice, die immer für einen Plausch zu haben war, wenn er seine Einkäufe in Morrisons Supermarkt erledigte. Außerdem entdeckte er Angus Mitchell, der die Drinks servierte – er war einundzwanzig, nur wenige Jahre jünger als Patrick selbst. Momentan gönnte Angus sich eine Auszeit von der Uni, um auf der Superjacht zu jobben.
Patrick ließ wiederholt den Auslöser klicken, lächelte, winkte. Die Stimmung war ausgelassen. Es herrschte ein fröhliches Miteinander, und das bei strahlendem Sonnenschein. Und auch wenn Patrick das Meer nicht mochte, wünschte er sich insgeheim, er wäre mit an Bord und könnte an der Jungfernfahrt der Explorer teilnehmen.
Von der Jacht her ertönte ein anschwellendes Brummen, gefolgt von lautem Jubel der Passagiere und noch mehr Gelächter. Patrick stutzte kurz, dann wurde ihm bewusst, dass es der Motor war, der zum Leben erwachte. Der Augenblick der Abfahrt rückte näher. Sein Blick schweifte noch einmal über den Anleger. Er machte einige Schnappschüsse von den freudig winkenden Schaulustigen und abschließend noch eine Weitwinkelaufnahme vom Schiff in seiner gesamten Länge. Langsam setzte es sich in Bewegung, weshalb Patrick sich rasch wieder den Leuten auf dem Vorderdeck zuwandte und mehrmals hintereinander auf den Auslöser drückte. Durch die Linse registrierte er die aufgeregten Mienen, auf denen sich Vorfreude abzeichnete.
Blinzelnd justierte er die Schärfe.
Jetzt hatte er ein ihm unbekanntes Gesicht vor der Linse, das einer Frau, die ein wenig abseits vom Rest stand. Sie hatte lange dunkelblonde Haare und trug eine weiße Hose, weiße Bluse, einen Regenmantel und darüber ein kariertes Schultertuch. Aus irgendeinem Grund stach sie aus der Menge hervor. Nachdenklich starrte Patrick durch den Sucher und versuchte, sie einzuordnen. Er drückte den Auslöser. Die Jacht beschleunigte, und ihm kam es mit einem Mal so vor, als würde die Frau sich panisch umsehen. Hatte sie etwas verloren oder auf den letzten Drücker Bedenken? Wieder knipste Patrick ein Foto, dann zögerte er. Es erschien ihm nicht richtig, sie so unverhohlen anzustarren und sie in ihrem aufgelösten Zustand auch noch ungefragt auf den Film zu bannen. Aber er konnte den Blick nicht von ihr lösen. Jetzt war es ihm, als wolle sie ihr Gesicht hinter einem Vorhang aus Haaren verbergen.
Stirnrunzelnd ließ Patrick die Kamera sinken. Er beobachtete, wie die Explorer über den See glitt und im dunklen Wasser eine weiße Spur hinter sich herzog, den Blick auf die Frau geheftet, die immer noch abseits der anderen Passagiere stand und irgendwie beunruhigt wirkte, orientierungslos. Er behielt sie so lange im Auge, bis die Jacht eine Kurve fuhr und sie sich seinem Blick entzog.
Später an diesem Abend, als man das erste Getuschel über das Verschwinden des Schiffes vernahm und die Neuigkeit in den Pubs und Restaurants der Stadt die Runde machte, sich von dort in die Privathaushalte ausbreitete und die Bürger von Fort William fassungslos zurückließ, wurde Patrick sich bewusst, dass ihn der eisige Schauder, der ihn in jenem Moment am Ableger überkommen hatte, seither nicht mehr losgelassen hatte. Und ihm wurde klar, dass ihn das, was die Gerüchte behaupteten, nicht einmal überraschte.
2
Inverness, Samstag, 16. April 2022 – fünf Jahre später
DI Monica Kennedy schwamm die letzten Züge durch das eiskalte Wasser und griff nach der obersten Sprosse der Leiter, um sich auf den Ponton hochzuziehen. Die Wassertemperatur lag bei schätzungsweise drei Grad. Sie war sich nicht sicher, ob das für April kalt war. Im Winter sanken die Temperaturen in den Muirtown Locks unweit ihres Zuhauses in Inverness schnell mal auf null Grad. Deshalb hatte sie schon des Öfteren eine etwa eierschalendicke Schicht Eis durchbrechen müssen, bevor sie sich von der Leiter aus ins Wasser hatte gleiten lassen.
Während Monica zitternd auf der hölzernen Plattform stand und sich mit einem Handtuch trocken rubbelte, sah sie sich um. Seit jenem ersten impulsiven Sprung ins eisige Wasser auf dem Heimweg nach Dienstschluss, irgendwann gegen Ende des ersten Covid-Lockdowns, mit nichts am Leib außer ihrem BH und der Unterhose, rätselte sie, ob das Schwimmen hier überhaupt erlaubt war. Und jedes Mal erwartete sie, dass jemand vom Hafenbüro aufkreuzte und ihr erklärte, wie riskant das sei und deshalb auch strengstens untersagt. Aber in den ganzen achtzehn Monaten war nichts dergleichen geschehen. Ihr Blick landete auf vereinzelten Spaziergängern, die auf dem Fußweg entlang des Kanals ihre Hunde Gassi führten. Außerdem entdeckte sie einen Segler, der auf einem der Boote hockte und irgendeine dampfende Flüssigkeit aus einem Becher schlürfte. Nun, es sah nicht danach aus, als würde es heute zu einer solchen Ermahnung kommen.
Monica ließ den Blick über die vielen Boote im Hafen schweifen, in erster Linie Motorjachten. Aus Kindertagen erinnerte sie sich daran, dass größere Schiffe und Jachten an den Docks auf der anderen Seite der Stadt an- und abgelegt hatten, unweit vom Haus ihrer Mum. Die Boote hier lagen direkt am Startpunkt des Caledonian Canal vertäut. Diese künstliche Wasserstraße führte von Inverness im Nordosten der Highlands über Loch Ness, Loch Oich, Loch Lochy und eine Reihe weiterer Kanäle bis hinüber nach Fort William an der Westküste. Und von dort, so wusste Monica, ging es über den Loch Linnhe letztlich hinaus auf die Weiten des Nordatlantischen Ozeans.
Ein frischer Wind fegte über das Wasser und kräuselte die Oberfläche. Fröstelnd wickelte sie sich in das Handtuch, ging in die Hocke und wühlte im Haufen ihrer Kleidung, auf der Suche nach dem elektronischen Thermometer, das in ihrer Hosentasche steckte. Als sie es gefunden hatte, schaltete sie es an und beugte sich über den Rand der Plattform, um es ins Wasser zu tauchen. Ganze viereinhalb Grad. Eine Enttäuschung. Monica fand es erfreulicher, wenn sich die Temperatur als kälter herausstellte als geschätzt. Sie trocknete die Spitze des Thermometers am Handtuch ab, sah hinunter in das vom Torf dunkle Wasser und überließ sich ihrer Urangst, die sie beim Schwimmen erstaunlich gut in Schach zu halten vermochte: nämlich die, dass etwas aus diesen Tiefen emportauchen könnte. Ein Ungeheuer, das sein Maul weit aufriss und nach ihr schnappte, sie in diese Schwärze hinabzerrte und mit Haut und Haaren verschlang.
Monica wandte sich ab, um ihre Kleider aufzusammeln, und machte sich auf den Weg zu der Stelle, an der sie ihren Volvo geparkt hatte. Dabei murmelte sie leise vor sich hin: »Noch mal Glück gehabt heute.«
Nach einer heißen Dusche trocknete Monica sich ab und schlüpfte in ihre Jeans und den dicken Wollpullover mit Zopfstrickmuster. Es war niemand zu Hause, der auf sie wartete, abgesehen von einer einsamen Kiste mit Spielzeug und Kinderbüchern mitten im Wohnzimmer. Ihre Tochter Lucy war zu ihrer ersten Übernachtungsparty bei einer Freundin eingeladen – einer Geburtstagsfeier mit zehn anderen Kindern, die gleich zwei Tage und Nächte lang ging. Die Eltern des Geburtstagskindes mussten Masochisten sein, dass sie sich so etwas antaten. Lucy war neun, was Monicas Online-Recherchen zufolge ein gutes Alter für eine erste Übernachtungsparty war. Sie fragte sich, wie ihre Tochter wohl damit klarkam, und hatte am vorangegangenen Abend bereits fest mit einem Anruf gerechnet, weil Lucy nach Hause wolle. Einem Impuls folgend, überprüfte sie ihr Handy, für den Fall, dass sie während des Schwimmens einen Anruf verpasst hätte. Nichts. Aber wenn sie Heimweh hätte, hätte sie sich doch sicher gleich am ersten Abend gemeldet?
Monica stellte die Kaffeemaschine an. Es war nichts Ungewöhnliches, dass sie allein war – ihre Mum Angela nahm Lucy öfter zu sich, wenn sie selbst bis über die Ohren in Arbeit steckte. Aber dass sie das gesamte Wochenende freihatte und ihre Tochter nicht da war, war neu. Ein kleiner Ausblick auf die Zukunft.
»Genau wie in den guten alten Zeiten«, murmelte Monica. Sie streckte den Rücken und vernahm ein leises Knacken. Ob das der Kälte oder ihrem Alter zuzuschreiben war? Erinnerungen an ihren Dad, wie er über Rückenschmerzen klagte, wurden wach. Er war groß gewesen, größer als Monica, die selbst fast eins neunzig maß. Er war stolz auf seine imposante Statur gewesen. »Long« John Kennedy, so hatten ihn alle genannt. Aber Monica, mit ihrem blassen Teint und den dunklen Haaren, glich eher einem Ghul oder einem Junkie, je nachdem, wen man fragte. Obwohl sie das alles längst gewohnt sein müsste, denn schon in frühester Kindheit, als sie durch ihr ungewöhnliches Äußeres und ihren scharfen Verstand aufgefallen war und keine Brüder oder Schwestern hatte vorweisen können, die sie beschützt hätten, war sie ein beliebtes Mobbingopfer gewesen. Was zur Folge hatte, dass sie sich immer mehr in sich selbst zurückgezogen und den Großteil ihrer Freizeit allein verbracht hatte. Sie hatte sich ganz auf das Schulische konzentriert, denn gute Leistungen waren immerhin etwas gewesen, worauf sie einen Einfluss gehabt hatte. Ihre Zeugnisse waren gespickt gewesen mit Einsen, und als es an die Wahl einer Universität gegangen war, hatte sie freie Auswahl gehabt. Doch statt zu studieren, hatte sie unmittelbar nach ihrem Abschluss die Polizeischule besucht. Sie hatte sich eingeredet, damit einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Aber war das wirklich der eigentliche Grund gewesen? Oder hatte sie nur Eindruck bei ihrem Dad schinden wollen? Er hatte als Gefängniswärter gearbeitet und hohes Ansehen genossen. Zur damaligen Zeit war er ihr großes Idol gewesen. Obwohl damit dann schlagartig Schluss gewesen war. Aber das war eine andere Geschichte.
Monica langte nach ihrem Smartphone und verbannte die Erinnerungen tief in ihr Bewusstsein. Während die Kaffeemaschine vorheizte, scrollte sie durch ihren Newsfeed. Las eine Story über einen Promi, der vorgab, Krebs mithilfe von veganer Ernährung, frischer Luft und viel Sonnenlicht heilen zu können. Ein amerikanischer Politiker prophezeite den Weltuntergang. Monica sah sich einige von den Kommentaren an und ertappte sich dabei, wie sie an Henry dachte. Er war ein verdammt gewiefter Hacker, sie kannte ihn von einem früheren Fall. Damals hatte er versucht, in die Datenbank der NASA einzudringen, überzeugt, er würde dort auf Beweise für eine Alien-Landung stoßen. Stattdessen hätte man ihn um ein Haar an die USA ausgeliefert, wo er sich einer behördlichen Anklage stellen sollte. Waren die Menschen immer schon so leichtgläubig gewesen? Oder hatte die Digitalisierung das alles auf die Spitze getrieben?
Das Lämpchen an der Kaffeemaschine wechselte von Rot auf Grün. Monica beugte sich über den Tresen, um Milch aufzuschäumen, dann drückte sie auf den Knopf, um einen einfachen Espresso rauszulassen. Sie sah zu, wie duftender Kaffee aus der Düse in die kleine Tasse floss, und kippte den Inhalt in den Becher mit dem Milchschaum. Es war ihre laienhafte Version eines Flat White. Vorsichtig trank sie davon. Verdammt lecker, besser als so manches Getränk, für das sie in Cafés viel Geld hingeblättert hatte. Das durfte sie aber auch erwarten, immerhin hatte die Maschine fast vierhundert Pfund gekostet. Sie war schon kurz davor gewesen, sich eine Kapselmaschine zuzulegen, als ihr Ex-Partner, DC Connor Crawford, sie zu der Breville überredet hatte. Praktisch sein letzter bedeutsamer Beitrag zu ihrem Leben, bevor er vor knapp drei Jahren öffentlich in Ungnade gefallen und in den uniformierten Streifendienst zurückgekehrt war. Damals war er nach Fort William versetzt worden. Aus dem Auge, aus dem Sinn, zumindest was ihren Boss, Fred Hately, anging, der erst kürzlich zum Chief Superintendent befördert worden war. Das Letzte, was Monica von Crawford gehört hatte, war, dass man ihm endlich seine Versetzung von Fort William ins großstädtische und aufregendere Glasgow bewilligt hatte, was schon lange sein Wunsch gewesen war.
Auf dem Tresen klingelte ihr Telefon, und die Egoistin in ihr wünschte sich, es wäre Lucy, die nach Hause kommen wollte. Sie könnten sich zusammen einen Film ansehen, vielleicht einen gemütlichen Spaziergang machen und sich bei McDonald’s, Lucys Lieblingsrestaurant, etwas zu essen holen.
»Guten Morgen, DI Kennedy. Genießen Sie Ihr Wochenende?«
Monica kannte Hately inzwischen gut genug, um zu wissen, dass er nicht ernsthaft an einer Antwort interessiert war. Trotzdem sagte sie: »War gerade schwimmen, draußen am Kanal.« Sie merkte, wie stolz sie auf dieses Zeichen einer gesunden Lebensweise war. »Viereinhalb Grad heute Morgen. Die wärmste Temperatur, die wir diese Woche hatten.«
»Genau richtig«, gab Hately zurück und fügte der Vollständigkeit halber hinzu: »Ein guter Start in den Tag, und es hilft, das Gewicht zu halten.« Monica dachte an das ordentlich frisierte Haar ihres Chefs, die gepflegte Haut, die straffe Figur und die gut geschnittenen Anzüge, die er trug. Er kannte sich aus damit, wie man »das Gewicht hielt«.
»Wir haben eine Meldung bekommen.« Monica registrierte sofort die Anspannung in seiner Stimme. »Sagt Ihnen der Name Emily Hurst etwas?«
3
Samstag, 16. April 2022, einige Stunden zuvor
Es war Dr. Gladys Mitchell, die die Frau als Erste sah. Mitchell bildete die Spitze der Wandergruppe, die anderen vier Mitglieder liefen auf dem schmalen Pfad im Gänsemarsch hinter ihr. Es war auf den Tag genau fünf Jahre her, seit die Explorer von Fort William aus in See gestochen war. Der geplante Kurs der Jacht hatte sie erst in westliche Richtung und dann weiter gen Norden um die Inseln Barra, North und South Uist herumgeführt, bevor sie am darauffolgenden Tag in den Hafen hatte zurückkehren sollen. Nur dass das Boot von einem Moment zum nächsten vom Radar verschwunden war, wie von den Wellen des Atlantiks verschluckt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen hatte man es nie gefunden, seither lag es irgendwo dort unten am Grund des Meeres. Keine Spur davon, genauso wenig wie von den Passagieren und der Crew. Auch Dr. Mitchells Sohn Angus war darunter gewesen, er war damals gerade einmal einundzwanzig gewesen und hatte als Kellner und Deckhelfer auf der Explorer angeheuert. Mittlerweile hätte er sehr wahrscheinlich seinen Uniabschluss in der Tasche und wäre vielleicht …
Dr. Mitchell setzte ihren Grübeleien ein Ende. Sie führten zu nichts. Außerdem hatte das Unglück andere sehr viel härter getroffen als sie, wie sie sich immer wieder einredete. Die Ärztin warf einen kurzen Blick über die Schulter zu Julia Donald, die unmittelbar hinter ihr ging. Julia hatte ihre Schwester und ihre beiden besten Freundinnen verloren. Die anderen drei Mitglieder ihrer Wandergruppe hatten alle mindestens einen Familienangehörigen oder einen befreundeten Menschen zu beklagen. Ihre gesamte Gemeinde hatte tiefe Narben davongetragen. Manchmal kam es Dr. Mitchell so vor, als stünden sämtliche Patienten, die ihre Praxis betraten, in irgendeiner Beziehung zu einer der vermissten Personen. Sie tat alles, um ihnen ihr Leid zu erleichtern – mit Antidepressiva oder angstunterdrückenden Medikamenten bei den einen, mit Gesprächen bei den anderen. Letztere waren die kniffligeren Fälle: Denn irgendwann war alles gesagt, ein Gefühl der Lähmung setzte ein, zusätzlich verschärft durch zwei Jahre Covid-Lockdown und Isolation, die zur Einsamkeit der Trauernden hinzukamen. Aus diesem Grund hatte sie diese Gruppe ins Leben gerufen, und deshalb waren sie exakt am Jahrestag des Unglücks zu einer Wanderung zum Gipfel des Ladhar Bheinn aufgebrochen, einem eher entlegenen Berg auf der Knoydart-Halbinsel. Durch die sportliche Betätigung vermieden sie die endlosen Gespräche, die sich ohnehin nur im Kreis drehten, ebenso wie die vielen nicht zu beantwortenden Fragen.
Dr. Mitchell sog die frische kühle Frühlingsluft tief in ihre Lunge. Ein strahlend blauer Himmel spannte sich über ihnen, schroffe Bergflanken erstreckten sich bis hinunter in die weite Moorebene, am Horizont die zerklüftete Isle of Skye, daneben die kleineren Inseln Rum, Eigg, Muck und Canna und dazwischen der glitzernde Ozean. Angus hatte das Meer geliebt, seit er mit drei Jahren bei einem sommerlichen Strandausflug das erste Mal darin herumgeplanscht hatte. Das war ein Riesenspaß gewesen.
»Das Wasser im See soll sehr grün sein.« Dr. Mitchell drehte sich über die Schulter zu Julia um, von der die Bemerkung kam, gerade als sie um eine Kurve bogen und den berühmten Green Lochan endlich vor sich hatten. Die Frau lächelte. »Angeblich waschen die Feen ihre Kleider darin.«
Dr. Mitchell rang sich ein Lächeln ab und blickte wieder auf den Weg vor sich. Plötzlich verspürte sie beinahe so etwas wie Vorfreude. »Ja klar, was sonst …«
Sie verstummte, als sie eine fremde Frau am Ufer stehen sah. Diese trug eine verdreckte weiße Hose, eine weiße Bluse, einen Regenmantel und ein Schultertuch. Das eigentlich Seltsame an ihr aber war, wie sie dort stand. Vollkommen regungslos, die Arme zur Seite gestreckt, in einer Art Kreuzigungspose.
Im Näherkommen stellte Dr. Mitchell fest, dass die Frau in Wirklichkeit im See stand, bis zu den Knien im seichten Wasser. Es war sonderbar, aber ihre erste Reaktion war Unmut, ein Gefühl, das sie als sonst sehr einfühlsame Ärztin für Allgemeinmedizin eigentlich nur selten überkam. Sie sah sich um, ließ den Blick über die menschenleere Landschaft schweifen, erwartete irgendwo ein Publikum, das sich über sie lustig machte. War das ein schlechter Scherz, den jemand mit ihnen veranstaltete? Hielt sich da einer für besonders komisch?
Sie begab sich noch näher an die Frau heran und registrierte den Schleier langer blonder Haare, der ihr Gesicht verhüllte, sah ihre bleichen Hände und Unterarme, die aus den Ärmeln ihres Mantels hervorragten. Die Fremde war klapperdürr und schlotterte vor Kälte. Sie braucht Hilfe, schoss es Dr. Mitchell durch den Kopf. Sofort waren ihre Instinkte hellwach, und sie eilte über den steinigen Pfad auf sie zu. Als sie nur noch wenige Schritte von der Frau entfernt war, blieb sie wie angewurzelt stehen. Völlig entgeistert starrte sie zu der Fremden im Wasser, einen dicken Kloß im Hals und mit klopfendem Herzen. Das kann nicht sein.
»Wie heißen Sie? Woher kommen Sie?« Diese Worte stammten von Julia, die die Frau jetzt mit unsicherer Stimme ansprach. Offenbar hatte sie die Verbindung ebenfalls hergestellt. Wie hätte es ihr auch entgehen sollen? Wie hätte irgendeine von ihnen es übersehen können? Die Frau hielt den Rücken kerzengerade, ihr Atem bildete weiße Wölkchen vor ihrem Mund. Dr. Mitchell kniff die Augen leicht zusammen und bemerkte an der linken Hand der Frau eine Spinne, die ihr über die Finger krabbelte. Sie wirkte gebrechlich, irgendwie fehl am Platz, wie aus der Zeit gefallen. Als stünde sie schon seit Jahren, Jahrtausenden hier, um auf sie zu warten.
Du musst zu ihr gehen, du musst ihr helfen. Dr. Mitchells innere Stimme war hartnäckig, und trotzdem war sie wie gelähmt. Das kann nicht sein, es ist unmöglich. Schließlich schluckte sie gegen ihre staubtrockene Kehle an und stammelte: »Ich bin Ärztin. Ich kann Ihnen helfen.«
Die Frau schien sie zu hören, denn sie hob nun ganz leicht den Kopf. Ihre Augen waren immer noch hinter dem Vorhang ihrer Haare verborgen, aber Dr. Mitchell sah jetzt die feine Linie ihres Mundes, die fettig glänzende Haut ihrer Nase.
»Sollen wir …« Doch bevor Julia den Satz zu Ende bringen konnte, bewegten sich die Lippen der Frau. Anfangs war es nur ein kaum hörbares Flüstern, aus dem sich nach und nach einzelne Silben herausschälten. Es waren immer dieselben beiden Worte, die sie ununterbrochen wiederholte.
»Emily Hurst, Emily Hurst, Emily Hurst …«
4
Auf der digitalen Tafel am Straßenrand war zu lesen: WILLKOMMENINFORTWILLIAM – 10 Grad Celsius.
DC Maria Khan, die auf dem Beifahrersitz neben Monica saß, spähte zum Seitenfenster hinaus und betrachtete die tristen kleinen Häuser entlang der Straße. Der Himmel über dem Vorort war düster und bedeckt. Jenseits der Siedlung, das wusste Monica von einem früheren Besuch, ragte der Ben Nevis empor, der höchste Berg des gesamten Vereinigten Königreichs. In der Gegenrichtung lagen der Loch Linnhe und noch mehr Berge, die sich dahinter steil in den Himmel reckten. Heute aber verlor sich all das im Grau der tief hängenden Wolken.
»Es kann unmöglich sein, oder? Das kann doch nicht wirklich sie sein?«, sprach Khan leise vor sich hin, mehr zu sich selbst als zu ihrer Chefin. Zumindest gewann Monica diesen Eindruck, denn während der Fahrt von Inverness hierher hatten sie sich bereits lang und breit über das Schiffsunglück unterhalten. Die Geschichte der Explorer war in ganz Schottland bekannt. Seit dem mysteriösen Verschwinden der Jacht hatte unter Internet-Schnüfflern und Fans von ungelösten Verbrechen und Unglücksfällen vor allem ein Detail das Interesse wachgehalten – nämlich der »Schrei der Passagierin«. Der geheimnisvolle Titel nahm Bezug auf ein Foto, das zum traurigen Symbol der Tragödie geworden war und sich zum meistdiskutierten Bestandteil der Story entwickelt hatte. Der Fokus der Aufnahme lag auf der sorgenvollen Miene einer Frau, die aus der Schar der strahlenden Passagiere ringsum hervorstach. Der Grund für ihre Besorgnis war ein Mysterium für sich, zumal niemand wusste, wer diese Frau, die in der Passagierliste als Emily Hurst gelistet wurde, eigentlich war. Es hatten sich nie Freunde oder Familienangehörige gemeldet, um sie offiziell zu identifizieren, weder Arbeitskolleginnen oder -kollegen noch Bekannte. Kein Mensch.
Monica nahm den Fuß vom Gaspedal, weil die Geschwindigkeit innerorts beschränkt war. Regen spritzte von dem vorausfahrenden Fahrzeug auf die Windschutzscheibe. Khan hatte vollkommen recht. Es konnte sich unmöglich um Emily Hurst handeln. Nicht nach ganzen fünf Jahren. Nicht auf halber Strecke einen abgeschiedenen Berg hinauf, mitten im Nirgendwo.
»Wir können nicht mit Sicherheit ausschließen, dass sie es ist«, gab Monica zögernd zurück. In erster Linie, um ihrer Rolle als Detective gerecht zu werden: Von nichts ausgehen, alles infrage stellen, so sollte ihr Grundsatz lauten, und der war ihr zur zweiten Natur geworden. »Bislang lässt sich nichts mit absoluter Gewissheit sagen.«
Erst als sie den Wagen auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus abgestellt hatten und ausgestiegen waren, registrierte Monica DC Maria Khans Kleidung: Sie trug einen langen Mantel aus Kunstpelz, dazu schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe, eine schwarze Basecap und Make-up. Ein deutlicher Verstoß gegen die Verordnung der Polizei Schottland zu Uniformen und äußerer Erscheinung, Absatz 6.1.6: Beamten ist es gestattet, Businesskleidung zu tragen, sofern es den Aufgaben angemessen ist. Wer hätte gedacht, dass ein Pelzmantel aus Kunstfell und eine Baseballkappe als Businesskleidung durchgehen konnten? Alle anderen Kolleginnen und Kollegen in unangemessener Kleidung hätte Monica auf der Stelle zum Umziehen nach Hause geschickt. Aber bei Khan machte sie eine Ausnahme, warum, wusste sie selbst nicht so genau. In den Jahren, seit ihr Vorgesetzter DC Connor Crawford von ihrem Ermittlerteam abgezogen hatte, hatte Monica eng mit Khan zusammengearbeitet. Dabei hatte sie erfahren, dass ihre Kollegin in Stirling aufgewachsen war, siebenunddreißig Jahre alt war und damit zehn Jahre jünger als Monica selbst, einen angenehm schrägen Sinn für Humor hatte, gern ins Theater und ins Kino ging und früher irgendwas mit Medien gemacht hatte, bevor sie sich beruflich neu orientiert und umgeschult hatte. Das war mehr oder weniger die Faktenlage, und das reichte Monica vollkommen aus. Sie war nie die Sorte Vorgesetzte gewesen, die sich gern mit ihren Mitarbeitern anfreundete. Lieber wahrte sie eine gewisse Distanz.
»Sind die von der Presse?«, fragte Khan und deutete auf eine größere Schar von Menschen, die vor dem Eingang des Krankenhauses herumstanden. Das riesige Gebäude erinnerte an ein Hotel in den Alpen, wenngleich ein recht heruntergekommenes aus den Siebzigern. »Vielleicht ist das mit der Frau schon zu denen durchgedrungen.« Monica sah zu, wie Khan den Sitz ihrer Kappe korrigierte, wobei der Wind ein paar pechschwarze Haarsträhnen hochwehte; auch das Kunstfell aus Acryl zitterte im Wind. Dabei wurde ihr eines klar: Man sah, dass ihrer Kollegin das Thema Kleidung wichtig war, auch wenn man sonst nicht viel über sie wusste.
Monica schob den Gedanken beiseite und wechselte in den Detective-Modus. Sie kniff die Augen leicht zusammen und musterte die Wartenden, von denen mittlerweile einige zu ihnen herübersahen.
»Gute Nachrichten verbreiten sich schnell«, murmelte sie leise vor sich hin. Allerdings fiel ihr dann auf, dass die üblichen Paraphernalien der Pressemeute fehlten, keine Kameras, keine Mikros, keine Spur von der brodelnden Energie, die mit der wilden Jagd nach der nächsten heißen Story einherging. Stattdessen wirkten diese Menschen seltsam still, sodass sie Monica viel mehr an eine Gruppe Trauernder bei einer Beerdigung erinnerten.
Wie aufs Stichwort setzte ein heftiger Regenguss ein, der auf den bereits nassen Asphalt herunterprasselte, als Monica und Khan den Parkplatz überquerten. Eine kleine Gedächtnisauffrischung, wie nah das Meer war, als hätte es das noch gebraucht. Vor dem Eingang hatten sich bei näherer Betrachtung ungefähr zwanzig Personen versammelt, einige von ihnen mit Regenschirmen, andere, denen der Regen unerbittlich ins Gesicht klatschte, in Goretex- oder Wachsjacken.
»Hey, Sie sind doch diese Polizistin, stimmt’s?«, rief jemand. In einer Sache konnte Monica sich sicher sein: Sie fiel auf. Und nachdem sie seit ihrer Rückkehr in den Norden nun schon in mehreren aufsehenerregenden Fällen im Gebiet der Highlands ermittelt hatte, war sie daran gewohnt, dass man sie erkannte. Der Mann, der sie angesprochen hatte, fuhr fort: »Ich bin Giles Forbes, das hier sind Caroline Handler und ihr Sohn Colm.« Dabei deutete er auf eine Frau mit kurz geschnittenen blonden Haaren und einen Jungen im Teenageralter, der direkt neben ihr stand. »Das sind Brian Corcoran und Douglas Mac Andrew«, sprach er weiter und wies auf zwei Männer, einer von ihnen in den Vierzigern und mit Bart, der andere mit einem Hut auf dem Kopf, von dessen breiter Krempe der Regen herabtropfte. Monica nickte und versuchte krampfhaft, sich die Namen einzuprägen, während sie die Gesichter musterte. »Wir sind Freunde und Familienangehörige von einigen der Vermissten der Explorer.« Monica war sich nicht sicher, was sie erwartet hatte, aber diese Menschen wirkten alle relativ normal. Es waren ganz gewöhnliche Leute, mit Ausnahme des Schicksals, das sie teilten. Forbes fuhr fort: »Wir müssen unbedingt wissen, ob sie es ist. Könnte es sich wirklich um diese Emily Hurst handeln?«
Monica räusperte sich. »Nun, ich verstehe gut, wie schwer das für Sie alle sein muss. Wir hoffen natürlich, die Frau möglichst schnell zu identifizieren. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.«
Als Giles Forbes nickte, sah Monica flüchtig etwas in seinen Augen aufblitzen. Es war Hoffnung, wie ihr nach kurzer Überlegung klar wurde. Etwas, das innerhalb einer Gruppe von Trauernden ihrer Erfahrung nach großes Konfliktpotenzial barg.
Im Innern des Gebäudes herrschte absolute Ruhe, in der Luft hing der Geruch von Reinigungsmitteln und Großküche. Monica und Khan setzten die vorgeschriebenen FFP2-Masken auf, und nach kurzem Warten wurden sie von einer Krankenschwester begrüßt. Diese hatte die Arme verschränkt und trat nervös von einem Bein aufs andere. Monica spähte verstohlen auf das Namensschild an ihrer Brust: Isbeal Chisholm. Die Stirn der Frau war in tiefe Falten gelegt: »Sie sind hier, um … sie zu sehen, stimmt’s?« Monica bestätigte dies, worauf die Krankenschwester fortfuhr: »Sie ist gerade oben im Arztzimmer. Sie kommen besser mit rauf.« Allerdings machte sie keine Anstalten, sich von der Stelle zu bewegen, und Monica wurde das seltsame Gefühl nicht los, dass Isbeal Chisholm sie am liebsten wieder hinaus in den Regen gescheucht hätte, zu der Gruppe von Hinterbliebenen, die die Hoffnung hierhergetrieben hatte.
»Gibt es ein Problem?«
»Oh, nein, natürlich nicht. Davon hat diese Stadt ohnehin genug«, murmelte sie, als sie sich schließlich doch umdrehte und mit quietschenden Sohlen über das Linoleum vorauseilte. »Kaum kehrt man halbwegs zur Normalität zurück, dreht sich wieder alles um dieses verdammte Boot. Aber kein Problem, nein.« Vor dem Aufzug trat die Frau beiseite und bedeutete Monica und Khan, einzusteigen. »Zweiter Stock und dann links.«
»Es muss schwer gewesen sein für die Gemeinde«, sagte Monica, während Khan auf die Taste mit der Zwei drückte.
»Das kann man wohl sagen«, gab die Schwester zurück, die Arme wieder fest vor der Brust verschränkt. »Mein Ehemann hat früher kleine Spritztouren mit seinem kleinen Boot veranstaltet, jetzt fährt er wieder Taxi. War schlimm genug, mit dieser Pandemie und allem, aber wer macht schon gern eine lustige Rundfahrt übers Meer, nach allem, was passiert ist?« Bevor die Fahrstuhltür hinter ihnen zuglitt, schickte sie noch hinterher: »Abgesehen von einer Handvoll Spinner, die völlig besessen sind von dieser verdammten Jacht.«
Im zweiten Stock empfing sie in einer Art Vorhalle ein Mann um die vierzig, mit dunklen Haaren, einem Stethoskop um den Hals, in grünen OP-Klamotten und mit Maske. Er stellte sich ihnen als Dr. Richard Lambert vor. Das war nach zwei Jahrzehnten im Polizeidienst auch für Monica neu: Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie je ein Krankenhaus besucht und ein Arzt sie bereits erwartet hätte. Normalerweise musste man die Verantwortlichen in irgendwelchen Patientenzimmern mitten während der Visite abfangen, oft nach stundenlangem Warten.
»Sie sind hier wegen … dieser Unbekannten?«
»Wie ist ihr Zustand?«
»Stabil. Etwas dehydriert und leicht unterkühlt, aber insgesamt ist sie okay«, gab Dr. Lambert zurück. Als Nächstes drehte er sich um und schritt durch eine Flügeltür. »Sie kommen besser mit und machen sich Ihr eigenes Bild.«
Monica und Khan folgten dem Arzt einen langen Flur entlang, durch zwei Stationen, in denen es hoch herging, und dann durch eine weitere Flügeltür in einen etwas ruhigeren Korridor.
»Wie steht es um ihre psychische Verfassung?«, erkundigte sich Monica, als der Arzt schließlich stehen blieb.
Lambert zuckte mit der Schulter und spähte den Flur hinunter zu einem einsamen uniformierten Polizeibeamten, der vor einer Tür saß und Wache hielt. »Nun, ich bin kein Psychiater. Sie spricht nicht.«
»Gar nicht? Uns hat man erzählt, sie soll …«
»Sie sagte immerzu diesen Namen, ja, Emily Hurst«, fiel Dr. Lambert ihr ins Wort und stieß ein seltsames trockenes Lachen aus. »Aber als man sie aus dem Wasser holte, war schlagartig Schluss damit. Seither hat sie kein Wort mehr gesprochen.«
»Und, was glauben Sie, könnte sie es sein? Emily Hurst?« Monica war sich selbst nicht sicher, was diese Frage bringen sollte.
»Selbstverständlich nicht«, gab Lambert knapp zurück, wieder begleitet von diesem hohlen Lachen. »Nun, diejenigen, die sie gefunden haben, halten es durchaus für möglich. Aber meiner Meinung nach ist es unrealistisch. Es ist immerhin fünf Jahre her.« Lambert eilte weiter über den Flur, stieß die Tür neben dem uniformierten Beamten auf und wiederholte noch einmal: »Ja, fünf Jahre ist das jetzt her.«
Draußen am Himmel musste die tief stehende Sonne die Wolkendecke durchbrochen haben, denn jetzt strahlte sie ins Zimmer und flutete es mit einer Helligkeit, die nicht von dieser Welt zu stammen schien. Als wäre der Raum ein Filmset und entsprechend ausgeleuchtet – oder eine Art Huldigungsstätte.
Die Frau saß aufrecht im Bett, und das hereinströmende Sonnenlicht warf lange Schatten über das zerknitterte Bettzeug, um ihre Hände herum, die vor ihr auf der Bettdecke ruhten, und über ihr Gesicht. Monica ging langsam auf sie zu. Sie schätzte die Unbekannte auf Ende dreißig, Anfang vierzig. Ihre Haare gingen ins Blonde, sie trug keine Maske, und Monica fiel auf, wie schmal ihr Gesicht war, die Nase scharf geschnitten, mit leichten Sorgenfalten um die Mundwinkel und die Augen, ein paar feine blonde Härchen am Kinn. Trotz des locker sitzenden Krankenhausnachthemds konnte Monica unschwer erkennen, dass sie klapperdürr war, ihre Schulterknochen zeichneten sich spitz unter dem dünnen Stoff ab.
Monica stellte sich der Frau vor und beobachtete dabei ihr Gesicht. Sie zeigte keinerlei Regung, sondern starrte nur mit weit aufgerissenen Augen vor sich hin, als wäre an der kahlen Wand vor ihr irgendeine fesselnde Projektion zu sehen.
»Können Sie mich hören?«, fragte Monica behutsam. Sie streckte die Hand aus und berührte die Frau am Handrücken. Obwohl sie so extrem dünn war, fühlte sie sich überraschend warm an. Monica drückte die Hand sanft, und für einen Sekundenbruchteil glaubte sie, so etwas wie Erkennen aufflackern zu sehen: Jedenfalls zuckte ein Muskel neben dem rechten Auge der Frau. »Können Sie mir Ihren Namen nennen?« Die Miene der Frau blieb unverändert ausdruckslos. »Erinnern Sie sich, wie Sie auf diesen Berg gelangt sind?« Immer noch keine Regung.
»Wir haben bereits alles versucht«, bemerkte Dr. Lambert, der zwischen Tür und Bett stehen geblieben war. »Sie hat seit heute Morgen am See auf keine einzige Frage reagiert.«
Monica warf einen Blick über die Schulter zu dem Arzt. »Haben Sie etwas dagegen, wenn ich ein Foto von ihr mache?« Ihrer Erfahrung nach hielten Ärzte sich in solchen Fällen an ihre medizinische Schweigepflicht und nahmen ihre Patienten in Schutz. Normalerweise.
»Ich wüsste nicht, dass etwas dagegenspräche«, gab Lambert zurück und klang sogar, als wäre er froh darüber. »Die Menschen im Ort wollen wissen, wer sie ist. Wir sollten alles tun, um ihre Identität möglichst schnell aufzuklären.«
Monica fischte ihr Handy aus der Tasche ihres Tweedmantels und aktivierte die Kamera-App. Doch dann kam ihr spontan eine andere Idee. Sie öffnete den Internet-Browser, um nach dem Foto mit dem Titel »Der Schrei der Passagierin« zu suchen. Als sie fündig geworden war, hielt sie es neben das Gesicht der Frau und kam sich vor wie eine sensationslüsterne Besucherin bei einer viktorianischen Freakshow.
Das Foto wirkte so verstörend wie am ersten Tag: Emily Hursts Gesicht, mit großen schreckgeweiteten Augen, als hätte sie ein Gespenst gesehen, den Mund vor Entsetzen weit aufgerissen. Der Kontrast zu den freudestrahlenden Mienen um sie herum ließ das Ganze umso eigenartiger wirken. Aber jetzt, wo sie es im direkten Vergleich zu der Frau vor ihr betrachtete, schien es ihr richtiggehend surreal, beinahe schaurig. Die feinen Härchen in Monicas Nacken richteten sich auf, und ein Schauder wanderte ihre Wirbelsäule empor und breitete sich bis in ihre verspannten Schultern aus. Die Ähnlichkeit war wirklich verblüffend. Es war zweifellos möglich, dass es sich bei dieser Frau um Emily Hurst handelte.
Monica sah verstohlen zu Khan, die ihr mit einem tiefgründigen Blick diesen Schluss bestätigte. Offensichtlich dachte sie das Gleiche.
»Ich mache nur kurz ein Foto von Ihnen«, sagte Monica mit schwerer Zunge. »Wir werden schon herausfinden, wohin Sie gehören.«
Die Frau starrte sie an, ihre Miene wie versteinert. Die Sonne verzog sich wieder, der Raum war nun in das allgegenwärtige trübe Grau getaucht. Monica richtete das Display ihres Handys auf das Gesicht der Frau, zoomte möglichst nahe heran und drückte auf den Auslöser.
5
Als sie das Krankenhaus verließen und den Parkplatz ansteuerten, lief DC Maria Khan einige Schritte hinter Monica. Sie musterte den lang gestreckten Rücken ihrer Chefin in dem grauen Tweedmantel. Ihr Blick war fest geradeaus gerichtet, als sie sich zwischen den Familienangehörigen der Verschollenen hindurchschlängelten. Fast, als nehme sie die Menschen nicht wahr. Khan selbst spähte verstohlen nach rechts und links zu den Versammelten. Die Trauer und der Schmerz der Ungewissheit hatten über die vielen Jahre, die seit der Tragödie verstrichen waren, bleibende Spuren in den Gesichtern hinterlassen. Khan wusste genau, wie es war. Sie warf den Umstehenden ein, wie sie hoffte, aufmunterndes Lächeln zu und eilte hinter ihrer Vorgesetzten her, wobei der schwere dicke Kunstpelzmantel ihr binnen kürzester Zeit einen feinen Schweißfilm auf den Rücken trieb.
Beim Wagen angekommen, stieg sie auf der Beifahrerseite ein. »Also, das war ja mal eine unheimliche Begegnung. Fast, als sehe man ein Gespenst, nur dass es am Leben ist. Das macht es irgendwie nicht besser. Hätten wir nicht etwas sagen sollen? Zu den Familien? Oder sollen wir später noch mal mit einem DNA-Testkit vorbeikommen und ihre Fingerabdrücke nehmen?«
Ihre Vorgesetzte schien sie nicht zu hören. Sie starrte gedankenverloren auf ihr Telefon und betrachtete das Foto, das sie vorhin gemacht hatte. Ihre von einzelnen grauen Strähnen durchzogenen schwarzen Haare hingen ihr wirr ins Gesicht. »Könntest du das bitte an Fisher weiterleiten?«, sagte sie schließlich. Im nächsten Moment vernahm Khan ein Piepsen in ihrer Tasche, als das Foto über AirDrop bei ihr auf dem Handy landete. »Bitte ihn, die Vermisstenfälle der letzten Zeit durchzugehen, Meldungen über Frauen zwischen dreißig und fünfzig, alles, was so eingetrudelt ist. Und dann soll er sich in der Datenbank zeitlich zurückarbeiten.«
Khan zog ihr Handy heraus und öffnete das Foto. Ein Schauder überlief sie, als sie die ausdruckslose Miene und die starr aufgerissenen Augen betrachtete. Hastig ging sie auf Weiterleiten und wählte DS Ben Fishers E-Mail-Adresse aus der Liste ihrer Kontakte aus. Dann begann sie die Anweisungen ihrer Vorgesetzten in eine Nachricht zu tippen. Fisher war einige Jahre jünger als Khan, hatte aber schon weit mehr Dienstjahre auf dem Buckel. Er stellte nie irgendwelche Fragen, zeigte kaum Interesse an seinen Mitmenschen. Genau das schätzte Khan an ihm. Mittlerweile war er für sie fast so was wie ein Freund geworden.
Während sie die Nachricht abschickte, startete ihre Chefin den Motor, und Khan wartete darauf, dass der Wagen sich in Bewegung setzte. Stattdessen hörte sie, wie Monica auf dem Lenkrad herumtrommelte. Khan sah zu ihr auf.
»Warum sollte jemand einfach so auftauchen«, fragte Monica, »quasi wie aus dem Nichts, irgendwo auf halber Strecke einen Berg hinauf?«
»Vielleicht hat ihr jemand geholfen, dort hinaufzugelangen? Ich weiß nicht, vielleicht hat sie ja ein Helikopter abgesetzt?«, schlug Khan vor, merkte aber noch während sie sprach, wie abwegig diese Idee war. So ein Helikopter wäre ja wohl irgendwem aufgefallen, oder nicht?
Ihre Chefin trommelte weiter nachdenklich mit den Fingern. »Würdest du allein an einer Ausflugsfahrt auf einer Luxusjacht teilnehmen?«
»Allein?«, wiederholte Khan und dachte darüber nach. »Nun, ich denke nicht, außer vielleicht, wenn sonst niemand mit an Bord wäre … Wobei, ohne Crew geht es ja wohl nicht, also eher nicht.«
Diesmal schien Monica eingehend über Khans Worte nachzudenken. »Irgendjemand auf diesem Boot muss diese Emily Hurst von damals doch gekannt haben.« Sie betätigte den Scheibenwischer, um die Windschutzscheibe von den dicken Regentropfen zu befreien. Vor dem Eingang drängten sich immer noch die Hinterbliebenen. »Irgendjemand hier muss doch wissen, wer sie ist.« Sie wandte sich Khan zu und sah ihr forschend ins Gesicht. »Wie war noch mal der Name der Initiatorin dieser Wandergruppe? Hately meinte, sie habe ebenfalls eine Verbindung zur Explorer?«
Khan fand Dr. Mitchells Adresse, gab sie bei Google Maps ein und lotste Monica vom Parkplatz herunter nach rechts und ein Stück weiter an einem kleinen Kreisverkehr noch einmal nach rechts. Innerhalb weniger Minuten gelangten sie in die von Bäumen gesäumte Straße, die recht einsam und abgeschieden wirkte. Zu ihrer Linken erblickte Khan die Flanken eines Berges, den sie mithilfe von Google Maps als Ben Nevis identifizierte.
»Warst du schon mal da oben?«, wollte Monica wissen.
»Ich hasse die Berge«, antwortete Khan ohne Zögern. »Ich bleibe viel lieber daheim.« Dann aber fiel ihr die Aussicht vor ihrem Kinderzimmer in Stirling wieder ein, die lang gestreckte Kette der Ochil Hills: magisch und in der Ferne immer zu sehen. Einmal waren sie dorthin gefahren, ihr Dad, Dads Freundin Shay und deren zwei Kinder. Sie hatten am Ufer des Stausees Würstchen gegrillt. Der herrliche Grillduft, die frische Bergluft und das himmlische Fleckchen unmittelbar am Wasser … irgendwie hatten da selbst die mitgebrachten Chips aus der Tüte noch tausendmal besser geschmeckt.
»… Lucy löchert mich immer wieder, wann sie da mal raufdarf. Aber mir kommt er noch zu hoch vor für eine Neunjährige, was meinst du?«
Khan zuckte mit der Schulter. »Also, für mich ist das nichts, aber vielleicht hat sie ja Spaß daran.« Gerade kam am Straßenrand vor ihnen ein Schild in Sicht: NEVISVIEW stand darauf. »Hier rechts abbiegen.«
Monica lenkte den Wagen in die moderne Neubausiedlung und hielt vor der Hausnummer fünf an. Ein Volkswagen stand in der Einfahrt, angeschlossen an eine elektrische Ladestation. Khan stieg aus und betrachtete das riesige Felsenmassiv, das sich hinter dem Bungalow auftürmte, um einiges höher als die Ochils. Feine Dunstschwaden und schmale Streifen von Frühlingsschnee zeichneten sich scharf von der schiefergrauen Bergflanke ab. Sie erinnerte sich an eine Zeitungsmeldung, die sie erst kürzlich gelesen hatte. Darin war es um einen völlig erschöpften und unzureichend ausgerüsteten Wanderer gegangen, den man von einer Stelle knapp unterhalb des Gipfels hatte retten müssen. Möglicherweise war der Berg doch eine Nummer zu groß für eine Neunjährige?
Die Haustür ging auf, und eine Frau schätzungsweise Anfang fünfzig stand im Eingang, sportlich, mit kurzen grauen Haaren, wettergegerbter Haut, in kurzer Hose und einem dünnen Woll-Oberteil. Man sah auf den ersten Blick, dass sie viel Zeit draußen an der frischen Luft verbrachte: Sie war die perfekte Kandidatin für einen Kajak-Urlaub in der Arktis, wofür Khan erst neulich eine Werbung gesehen hatte. In ihrem Magen machte sich ein dumpfes Gefühl bemerkbar: Was hast du hier zu suchen, an einem so wunderschönen Ort?
»Dr. Gladys Mitchell?« Monica marschierte über die Einfahrt auf das Haus zu und zeigte der Ärztin ihre Dienstmarke. Die griff danach und musterte die Marke mit gerunzelter Stirn. Als sie den Blick wieder hob, lag ein freundlicher Ausdruck in ihren Zügen.
»Ich bin froh, dass Sie so schnell kommen konnten. Man hört allerhand darüber, wie überlastet die Polizei heutzutage ist. Uns Ärzten geht es ja ähnlich, aber bei Ihnen muss es noch erheblich schlimmer sein.« Lächelnd reichte sie Monica ihre Dienstmarke zurück und bat sie ins Haus. Der Bungalow wirkte hell und einladend, mit großflächigen Fenstertüren, durch die reichlich Licht in den Wohnraum flutete, das den Parkettboden glänzen ließ. An den Wänden hingen Drucke mit Bergmotiven sowie eine gerahmte Landkarte der westlichen Highlands. Im Wohnzimmer entdeckte Khan neben einem verstaubten Fernseher eine Xbox-Konsole. Ihr Blick blieb daran haften, weil es eine so auffällige Unstimmigkeit im sonstigen Umfeld darstellte.
»Die gehörte meinem Sohn Angus«, erklärte Dr. Mitchell, der Khans verwunderter Blick aufgefallen war. »Ich habe ihn immer gezwungen, hier drinnen zu spielen, damit ich ihn wenigstens ab und an zu Gesicht kriege.« Sie lachte, aber Khan registrierte deutlich die unterschwellige Trauer darin. »Nun ja, ich schätze, es hat funktioniert. Wobei er immer nur auf den Bildschirm gestarrt und seine Freunde angebrüllt hat, mit denen er übers Netz in Verbindung stand …«
»Ihr Sohn war an Bord der Explorer?«, hakte Monica sanft nach. Selbst wenn Khans Vorgesetzte ihren Kopf leicht einzog, überragte sie alles und jeden im Raum. Nicht nur aufgrund ihrer Größe, sondern auch dank ihrer Ausstrahlung. Sie fiel unweigerlich auf, wirkte bisweilen sogar annähernd hässlich, wie ein Zentaur. Und zu anderen Gelegenheiten hätte man sie fast als schön bezeichnen können. Was natürlich nicht unbedingt Sinn ergab.
»Ja, das ist richtig. Er wollte ein Jahr lang als Kellner auf der Jacht jobben. Ein wenig Geld verdienen und sich ein Polster schaffen, bevor es auf die Uni gehen sollte.«
»Tut mir sehr leid«, gab Monica zurück. »Ich kann mir nicht annähernd vorstellen, wie schwer es für Sie sein muss.«
»Nun, ich gehöre noch zu denen, die Glück im Unglück hatten.« Mitchell begab sich zur Spüle, um den Wasserkocher zu füllen. »Andere haben zwei, drei geliebte Menschen verloren, in mehreren Fällen war es der Hauptverdiener einer Familie, Vater oder Mutter von kleinen Kindern. Deren Angehörige muss es sehr viel härter getroffen haben. Und wenigstens ist mein Job sicher«, sagte sie und starrte dabei auf den Wasserkocher.
»Wir sind dran an der Identifizierung dieser Frau. Allerdings wären wir dankbar für jegliche Information zu der Passagierin auf der Jacht, Emily Hurst. Haben Sie vielleicht eine Idee, woher sie kam?«
Mitchell schüttelte hastig den Kopf. »Nein. Niemand kannte sie.«
»Was ist mit der Frau von heute Morgen. Hatten Sie sie schon einmal gesehen?«
»Nein, nur … Na ja, sie sieht natürlich der Emily Hurst auf dem Foto verblüffend ähnlich. Das ist uns allen sofort aufgefallen.«
Khan registrierte eine kaum merkliche Veränderung in Monicas Miene. »Die Wandergruppe, mit der Sie unterwegs waren – sind das auch Angehörige von Leuten, die auf der Explorer waren?«
»Ja. Heute ist der Jahrestag ihres Verschwindens. Am Abend halten wir eine Mahnwache ab, unten am Hafen. Aber tagsüber wollten wir dieses Jahr zur Abwechslung mal etwas unternehmen, das uns auf andere Gedanken bringt«, sagte die Ärztin mit einem gezwungenen Lächeln. »Nun ja, das lief nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten.«
»Wer wusste alles vom Ziel Ihrer Wanderung?«, erkundigte sich Monica.
»Ich bin Admin einer Facebook-Gruppe für die Hinterbliebenen, normalerweise werben wir dort öffentlich für unsere Ausflüge.« Monica nickte Khan zu, die sich sogleich notierte, die einzelnen Gruppenmitglieder ausfindig zu machen.
»Wie viele Mitglieder hat diese Gruppe?«
»Oh, das sind schon ein paar. Hier gibt es viele, die einen geliebten Menschen bei dem Schiffsunglück verloren haben. Das mit der Explorer war eine Tragödie, die uns alle betraf, ein harter Schlag für die gesamte Gemeinde.«
»Hätten Sie vielleicht eine Kontaktliste für uns?«
»Ja, tatsächlich. Ich habe selbst eine angelegt, für den Fall, dass man bei Neuigkeiten zur Explorer schnell mit den Betroffenen in Kontakt treten kann. Und um alles zu teilen, was mit der Stiftung zu tun hat.«
»Mit welcher Stiftung?«
»Frederick Bull-Peterson hat sie ins Leben gerufen. Er wollte die Hinterbliebenen damit unterstützen.«
»Wer ist dieser Bull-Peterson?«
Die Ärztin lupfte überrascht eine Augenbraue. »Er ist Schwede und Eigentümer der Firma, die die Explorer gebaut hat. Er hatte vor, sie für Luxuskreuzfahrten raus auf den Atlantik einzusetzen, zum Beobachten von Delfinen, von Polarlichtern, solche Dinge. Er wollte ein wenig Geld in die örtliche Wirtschaft pumpen. Mit Luxustourismus der besonderen Art.«
»Und dieser Bull-Peterson lebt in Schweden?«
»Nein, er hat sich hier niedergelassen, ist völlig vernarrt in die Highlands. Er besitzt ein riesiges Anwesen nicht weit von Knoydart.« Ein Schatten legte sich über die Züge der Ärztin. »Eigentlich gar nicht so weit von der Stelle entfernt, an der wir heute Vormittag wandern waren.«
»Wo Sie die Frau entdeckt haben?«, hakte Monica nach. Khan brauchte ihr Gesicht nicht zu sehen, um zu wissen, dass sie beide denselben Gedanken hatten: Das klingt alles nach einem verdammt großen Zufall.
»Ja, tatsächlich, aber … nun ja, er besitzt hier in der Gegend sehr viel Land, es ist also nicht unbedingt überraschend. Man könnte eine Nadel blind in die Landkarte stecken, und trotzdem stünden die Chancen gut, dass man dabei eins seiner Grundstücke erwischt.«
»Und was halten die Menschen hier von ihm, dem Eigentümer und Erbauer der Explorer?«
Abermals hob Dr. Mitchell die Augenbrauen. »Nun, eigentlich ist er recht angesehen. Tut alles, um die Angehörigen der verunglückten Passagiere finanziell zu unterstützen. Er hat ein Vermögen ausgegeben, um herauszufinden, was mit der Jacht geschehen ist, nur … leider ohne Erfolg.«
»Es gab keine Ressentiments ihm gegenüber, keine Vorwürfe?«, fragte Monica. »Man hat ihn nicht für das Unglück verantwortlich gemacht?«
»Ich bin mir sicher, dass einige ihm die Schuld zuschreiben wollten, so sind die Menschen nun mal gestrickt«, gab Dr. Mitchell zu. »Aber die eingeleitete Untersuchung zur möglichen Unglücksursache konnte seine Firma entlasten. Man fand keine Hinweise auf menschliches Versagen oder mangelnde Sorgfalt bei der Konstruktion der Jacht.«
Ist bestimmt schwer nachzuweisen, ging es Khan durch den Kopf. Vor allem, wenn von der Jacht jede Spur fehlt.
»Außerdem war er persönlich betroffen«, fuhr Mitchell fort, »jeder wusste das.«
»Persönlich betroffen? Inwiefern?«
»Seine Schwester, Paula Reagan, war unter den Passagieren. Sie ist ebenfalls verschollen.«
»Damals vor fünf Jahren, als die Explorer verschwand … Es muss doch Gerüchte gegeben haben, Geschichten darüber, was mit dem Boot passiert sein könnte? Und Gerede, wer diese Emily Hurst war?«
Zum ersten Mal im Laufe ihres Gesprächs machte Dr. Mitchell den Anschein, als fühlte sie sich unwohl angesichts ihrer Fragen. »Als Ärztin kriegt man so einiges mit, klar, da hört man die wildesten Geschichten.«
»Zum Beispiel?«
Mitchell verschränkte die Arme vor der Brust und schüttelte langsam den Kopf, sodass Khan schon fürchtete, sie würde dichtmachen und die Aussage verweigern. Dann aber sprach sie doch weiter: »Nun, manche behaupteten, Emily Hurst sei eine Banshee gewesen, ein Wesen aus der keltischen Mythologie, das als Vorbote von Tragödien in Erscheinung tritt. Oder dass Bull-Peterson die Jacht zum Sinken gebracht habe, um das Geld von der Versicherung einzustreichen, was meines Erachtens abwegig ist, denn die Summe war im Vergleich zum Wert der Jacht lächerlich gering. Manche redeten sogar davon, er habe das Boot absaufen lassen, um seine Schwester loszuwerden. Hören Sie, ich könnte noch ewig weitermachen, aber …«
»Warum sollte er seine Schwester loswerden wollen?«
Mitchell wandte verlegen den Blick ab. »Ich weiß es wirklich nicht. Es ist schrecklich, was die Menschen so daherreden.«
Khans Gedanke aber war: Nicht so schlimm wie das, was die Leute bereit sind, in ihrer Verzweiflung zutun. Sechs Monate in der Abteilung für Gewaltverbrechen hatten sie ebendas gelehrt.
»Und was ist mit Emily Hurst?«, bohrte Monica weiter. »Es müssen doch Gerüchte kursiert haben, wer sie sein könnte?«
»Wie gesagt, es gab jede Menge Klatsch und Tratsch. Aber unsere Gemeinde ist sehr eng vernetzt. Wenn jemand gewusst hätte, wer diese Frau ist, wäre es an die Öffentlichkeit gedrungen. Es war wirklich so, als wäre sie ein Gespenst, das wie aus dem Nichts auftauchte.«
6
Es dämmerte bereits, als sie ihr Gespräch mit Dr. Mitchell beendeten und am Ufer des Loch Linnhe entlang südwärts durch Fort William fuhren, zum Creag Dubh, einem Hotel, das noch aus der viktorianischen Ära stammte. Nachdem sie beide eingecheckt und ihre Zimmer bezogen hatten, trafen sie sich wieder unten im Restaurant. Monica fiel auf, dass der große Gastraum so gut wie menschenleer war, erstaunlich, wenn man bedachte, dass die Touristensaison bereits in vollem Gange war. Abgesehen von ihnen saß da nur ein einsames Paar mittleren Alters, beide in der gleichen Outdoor-Funktionskleidung. Sie zogen lange Gesichter und wechselten kaum ein Wort. Hatten die beiden vielleicht einen anstrengenden Tag gehabt, weil sie den Ben Nevis bestiegen hatten?, überlegte Monica. Oder war das Schweigen das Resultat einer langen unglücklichen Ehe?
Eine Kellnerin erschien. Auf ihrem Namensschild stand Sophia. Nachdem die junge Frau, die mit polnischem Akzent sprach, ihre Bestellung aufgenommen hatte – Käse-Makkaroni für Monica, einen Cheeseburger für Khan –, blieb sie zögernd an ihrem Tisch stehen, als hätte sie noch etwas Wichtiges loszuwerden. Dr. Mitchell mochte ja eine Abneigung gegen jede Form von Geschwätz haben, aber Monica war froh über Hinweise aus der Bevölkerung. Sie war überzeugt, dass es in dieser Gemeinde jemanden geben musste, der bereit war, über Emily Hurst und die Explorer zu reden und wertvolle Informationen liefern konnte. Vielleicht war Sophia diese Person?
»Leben Sie schon lange hier?«, fragte Monica wie beiläufig.
»Eine ganze Weile, bald sechs Jahre.« Sophia seufzte, als sei es mit den Jahren nicht leichter geworden.
»Erstaunlich ruhig hier für diese Jahreszeit.«
»Früher war in dieser Gegend mehr los, es kamen sehr viele Touristen. Inzwischen sind es nicht mehr ganz so viele, nicht mehr seit dieser Sache mit der Explorer …«
»Waren Sie bereits hier, als das damals passierte?«
Sophia sah sich betreten im Raum um. »Ja, ich war schon da.«
»Es hat sicher viel Gerede gegeben?«
»Oh, ja, die Leute haben eine Menge Tratsch verbreitet, die unterschiedlichsten Erklärungen, was passiert sein könnte.«
»Was zum Beispiel?«
»Das war damals ein harter Schlag, die Leute drehten total am Rad, wissen Sie? Alle suchten verzweifelt nach Antworten, erfanden die wildesten Geschichten …«
»Fällt Ihnen irgendetwas Konkretes ein?«
Sophia sah sich noch einmal im menschenleeren Restaurant um. »Tratsch bringt keinen von ihnen zurück.«