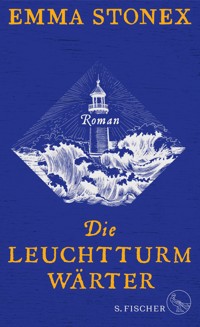
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Männer, die spurlos von einem Leuchtturm verschwinden. Drei Frauen, die ihr Leben lang mit diesem Rätsel kämpfen. In der Silvesternacht verschwinden vor der Küste Cornwalls drei Männer spurlos von einem Leuchtturm. Die Tür ist von innen verschlossen. Der zum Abendessen gedeckte Tisch unberührt. Die Uhren sind stehen geblieben. Zurück bleiben drei Frauen, die auch zwei Jahrzehnte später von dem rätselhaften Geschehen verfolgt werden. Die Tragödie hätte Helen, Jenny und Michelle zusammenbringen sollen, hat sie aber auseinandergerissen. Als sie zum ersten Mal ihre Seite der Geschichte erzählen, kommt ein Leben voller Entbehrungen zutage – des monatelangen Getrenntseins, des Sehnens und Hoffens. Und je tiefer sie hinabtauchen, desto dichter wird das Geflecht aus Geheimnissen und Lügen, Realität und Einbildung. Emma Stonex hat in ihrem Roman »Die Leuchtturmwärter« ein fesselndes Drama über Verlust und Trauer geschaffen – und über die Liebe, die es braucht, um das Licht am Brennen zu halten, wenn alles andere von Dunkelheit verschlungen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Emma Stonex
Die Leuchtturmwärter
Roman
Über dieses Buch
In der Silvesternacht verschwinden vor der Küste Cornwalls drei Männer spurlos von einem Leuchtturm. Die Tür ist von innen verschlossen. Der zum Abendessen gedeckte Tisch unberührt. Die Uhren stehengeblieben. Welch rätselhaftes Schicksal ereilte die Leuchtturmwärter?
Zurück bleiben drei Frauen, die auch zwei Jahrzehnte später von dem rätselhaften Geschehen verfolgt werden. Die Tragödie hätte Helen, Jenny und Michelle zusammenbringen sollen, hat sie aber auseinandergerissen. Als sie zum ersten Mal ihre Seite der Geschichte erzählen, kommt ein Leben voller Entbehrungen zutage – des monatelangen Getrenntseins, des Sehnens und Hoffens. Und je tiefer sie hinabtauchen, desto dichter wird das Geflecht aus Geheimnissen und Lügen, verwischen Verlust und Trauer die Grenze zwischen dem Realen und Imaginierten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Emma Stonex, 1983 in Northamptonshire in England geboren und aufgewachsen, begann ihre Karriere als Lektorin. Mehrere Jahre arbeitete sie erfolgreich in einem großen Verlagshaus, bevor sie ihrem Traum vom Schreiben folgte. Unter Pseudonym veröffentlichte sie mehrere Bücher. »Die Leuchtturmwärter« ist der erste Roman unter ihrem Klarnamen. Schon immer fasziniert von Leuchttürmen, inspirierte sie nicht zuletzt das mysteriöse Verschwinden dreier Leuchtturmwärter in 1900 auf den Flannan Isles in Schottland. Stonex lebt mit ihrem Mann und ihren zwei jungen Töchtern in Bristol.
Eva Kemper, geboren 1972 in Bochum, studierte in Düsseldorf Literaturübersetzen. Neben Junot Díaz‘ ›Das kurze wundersame Leben des Oscar Wao‹ übersetzte sie aus dem Englischen u. a. Werke von Peter Carey, Louis de Bernières, Tom Rob Smith, Martin Millar und Penny Hancock.
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel ›The Lamplighters‹ bei Picador, an imprint of Pan Macmillan, 6 Briset Street, London
© 2021 Emma Stonex
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491274-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für IFTS und KMS
Anmerkung der Autorin
Im Dezember 1900 verschwanden drei Wärter von einem abgelegenen Leuchtturm auf der Insel Eilean Mòr in den Äußeren Hebriden. Sie hießen Thomas Marshall, James Ducal und Donald MacArthur. The Lamplighters wurde von diesem Ereignis inspiriert und in respektvoller Erinnerung daran geschrieben, aber es ist eine fiktionale Geschichte und hat keine Ähnlichkeit mit dem Leben und der Persönlichkeit dieser Männer.
Wir standen im Moment nur reglos da:
Und stumm mit dunkler Ahnung starrten wir,
bevor wir sie weit aufstießen, zur Tür,
um vom Sonnenlicht ins Dunkel einzutreten.
Wilfrid Wilson Gibson, »Flannan Isle«
Zwei verschiedene Männer;
ich bin schon so lange zwei Männer.
Tony Parker, Lighthouse
I1972
1Ablösung
Der Tag ist hell und grau, als Jory die Vorhänge aufzieht, im Radio läuft ein vage bekanntes Lied. Er hört die Nachrichten, es geht um ein Mädchen, das oben im Norden an einer Bushaltestelle verschwunden ist, und trinkt aus einer Tasse braunen Tee. Die arme Mutter ist außer sich – na ja, natürlich. Kurze Haare, kurzer Rock, große Augen, so stellt er sich das Mädchen vor, zitternd in der Kälte, und eine verlassene Haltestelle, an der jemand hätte stehen sollen, winkend oder klatschnass, und der Bus hält an und fährt wieder ab, niemand ahnt etwas, und der Gehweg schimmert im schwarzen Regen.
Das Meer ist ruhig und so spiegelglatt wie oft nach schlechtem Wetter. Er öffnet das Fenster, und die frische Luft wirkt beinahe fest, wie etwas Greifbares, Essbares, das zwischen den Fischercottages knackt wie ein Eiswürfel in einem warmen Getränk. An den Geruch des Meeres kommt nichts heran, nicht annähernd: salzig, sauber, wie Essig aus dem Kühlschrank. Heute ist es geräuschlos. Jory kennt das Meer laut und auch still, wogend und spiegelglatt, er kennt das Meer, in dem das eigene Boot wie der letzte Wimpernschlag der Menschheit wirkt, mit so entschlossenen, grimmigen Wellen, dass man glaubt, woran man nicht glaubt, etwa dass das Meer dieser Ort auf halbem Weg zwischen Himmel und Hölle ist oder zwischen dem, was auch immer dort oben liegt, und dem, was in der Tiefe lauert. Ein Fischer hat ihm einmal gesagt, das Meer habe zwei Gesichter. Man müsse sie annehmen, sagte er zu ihm, das gute wie das böse, und darf keinem von beiden je den Rücken zuwenden.
Heute ist das Meer nach langer Zeit endlich auf ihrer Seite. Heute werden sie es tun.
Er entscheidet, ob das Boot hinausfährt oder nicht. Selbst wenn um neun guter Wind herrscht, heißt das nicht, dass es um zehn auch so ist, und je nachdem, was er im Hafen hat, seien es zum Beispiel einen Meter zwanzig hohe Wellen, kann er schätzen, dass sie beim Turm zwölf Meter haben werden. Was am Ufer ist, ist draußen beim Turm zehnmal mehr.
Der Neuzugang ist um die zwanzig, mit blonden Haaren und dicken Brillengläsern. Seine Augen wirken dadurch klein und unstet; er erinnert Jory an etwas, das in einem Käfig gehalten wird und auf Sägespänen lebt. Er steht auf dem Anlegesteg, das schwappende Wasser hat die ausgefransten Säume seiner Cordschlaghose dunkel gefärbt. Frühmorgens ist es am Kai ruhig, jemand führt seinen Hund spazieren, ein Milchcontainer wird entladen. Die frostige Pause zwischen Weihnachten und Neujahr.
Jory und seine Mannschaft laden die Vorräte des Jungen ein – Kisten in Trident-Rot mit allem Nötigen für zwei Monate, Kleidung und Essen, frisches Fleisch, Obst, richtige Milch statt Milchpulver, eine Zeitung, eine Dose Tee, Golden Virginia – und verzurren die Boxen mit Abdeckplanen. Die Wärter werden sich freuen: In den letzten vier Wochen mussten sie sich wohl mit Doseneintopf begnügen und mit den Nachrichten, die auf der Titelseite der Mail standen, als sich die letzte Ablösung auf den Weg machte.
Im flachen Bereich rülpst das Wasser Seetang aus, es schlürft und schmatzt rund um das Boot. Der Junge steigt mit nassen Turnschuhen ein und klammert sich an die Seiten wie ein Blinder. Unter einem Arm trägt er ein zusammengeschnürtes Päckchen mit Habseligkeiten – Bücher, ein Kassettenrekorder, Kassetten, Dinge, mit denen er sich die Zeit vertreiben kann. Sehr wahrscheinlich ist er ein Student: Heutzutage arbeiten viele Studenten bei Trident. Wahrscheinlich schreibt er Musik, das wird sein Ding sein. Oben in der Laterne sitzen und denken, so lebt es sich gut. Jeder von ihnen braucht irgendwas, das er tun kann, vor allem auf den Türmen draußen im Meer – man kann nicht die ganze Zeit die Treppen rauf und runter rennen. Vor ewigen Zeiten kannte Jory einen Wärter, einen begabten Tüftler, der Flaschenschiffe baute; während seiner gesamten Zeit beschäftigte er sich damit, und am Ende hatte er kleine Kunstwerke. Und dann bekamen sie Fernseher, und dieser Wärter warf alles weg, er schmiss buchstäblich sein ganzes Material und Werkzeug aus dem Fenster ins Meer und hockte danach in jeder freien Minute vor dem Kasten.
»Machen Sie das schon lange?«, fragt der Junge. Jory antwortet Ja, länger als du lebst. »Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen«, sagt er. »Ich warte seit Dienstag. Sie haben mir was im Dorf gesucht, eine richtig schöne Bude, aber nicht so schön, dass ich noch lange bleiben wollte. Jeden Tag habe ich rausgesehen und überlegt, ob wir irgendwann noch ablegen. Was für ein verdammter Sturm. Weiß ehrlich gesagt nicht, wie es da draußen sein wird, wenn noch einer kommt. Die Leute sagen, man hätte keinen Sturm erlebt, wenn man noch keinen auf dem Meer mitgemacht und es sich angefühlt hat, als würde der Turm unter einem zusammenbrechen und weggespült werden.«
Die Neuen wollen immer reden. Sie sind nervös, denkt Jory, wegen der Überfahrt und weil der Wind sich ändern könnte, wegen des Anlegens, wegen der Männer auf dem Turm, weil sie sich fragen, ob sie dazupassen und wie derjenige ist, der das Sagen hat. Es ist noch nicht der Turm des Jungen, vielleicht wird er es auch nie sein. Aushilfswärter kommen und gehen, ein Turm auf dem Festland, der nächste auf einem Felsen, wie eine Flipperkugel werden sie durchs Land geschickt. Jory hat Dutzende von ihnen gesehen, wild darauf anzufangen und beseelt von der romantischen Seite der Arbeit, aber so romantisch ist es nicht. Drei Männer allein in einem Leuchtturm mitten im Meer. Daran ist nichts Besonderes, überhaupt nichts, nur drei Männer und eine Menge Wasser. Nicht jeder hält es gut aus, eingesperrt zu sein. Einsamkeit. Isolation. Eintönigkeit. Kilometerweit nichts als Meer und Meer und Meer. Keine Freunde. Keine Frauen. Nur die beiden anderen, tagein, tagaus, keine Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen, das könnte einen schon völlig verrückt machen.
Es ist nicht ungewöhnlich, Tage oder sogar Wochen auf die Ablösung zu warten. Einmal saß einer seiner Wärter ganze vier Monate da draußen fest, weil die Ablösung nicht eintraf.
»Du gewöhnst dich an das Wetter«, sagt er zu dem Jungen.
»Hoffentlich.«
»Und du bist wahrscheinlich nicht halb so angefressen wie der arme Kerl, der zurück an Land soll.«
Am Heck blicken die Mitglieder seiner Zusatzbesatzung niedergeschlagen aufs Meer hinaus, rauchen und unterhalten sich grummelnd, in ihren feuchten Fingern weichen die Zigaretten auf. Man könnte sie vor einer rauen Seelandschaft malen, mit groben Pinselstrichen in dicken Ölfarben. »Worauf warten wir?«, ruft einer von ihnen. »Sollen die Gezeiten wechseln, bevor wir ablegen?« Der Techniker ist auch bei ihnen, er soll das Funkgerät reparieren. An einem gewöhnlichen Ablösetag hätten sie schon fünfmal mit dem Turm Kontakt gehabt, aber der Sturm hat die Übertragung gestört.
Jory deckt die letzte Kiste ab, startet den Motor, und dann sind sie unterwegs, wie ein Badespielzeug schaukelt und schlingert das Boot durch die flachen Wellen. Auf einem von Muscheln gesprenkelten Felsen zankt sich ein Schwarm Möwen, ein blaues Fangschiff tuckert träge zum Land. Als die Küste schrumpft, wird das Wasser lebhafter, grüne Wellen steigen auf und brechen, die Gischt löst sich auf. Weiter draußen verdunkelt sich alles, das Meer wird khakifarben, der Himmel färbt sich bedrohlich schiefergrau. Wasser stößt und schwappt gegen den Bug, der Meeresschaum bildet Linien und verteilt sich. Den Blick zum Horizont, mit Qualm im Mund, kaut Jory auf einer Selbstgedrehten, die in seiner Tasche plattgedrückt wurde, sich aber gerade noch rauchen lässt. In der Kälte schmerzen seine Ohren. Über ihnen zieht ein weißer Vogel am weiten, tristen Himmel Kreise.
Er kann die Maiden im Dunst ausmachen, ein einsamer Turm, erhaben, distanziert. Sie liegt fünfzehn Seemeilen weit draußen. Wärtern ist es so lieber, wie er weiß; sie sind nicht gern so nahe am Festland, dass sie es vom Sockel aus sehen können und an Zuhause erinnert werden.
Der Junge sitzt mit dem Rücken zu ihr – ein seltsamer Anfang, findet Jory, mit dem Rücken zum Ziel. Er knibbelt an einem Kratzer an seinem Daumen. Sein Gesicht wirkt weich und krank, unerfahren. Aber jeder Seemann muss sich erst einmal Seebeine wachsen lassen.
»Warst du schon mal auf einem Turm, Kleiner?«
»Ich war draußen auf dem Trevose. Dann unten auf St. Catherine.«
»Aber nie auf einem Turm im Meer.«
»Nein, nie auf einem Turm im Meer.«
»Dafür muss man schon die Nerven haben«, sagt Jory. »Und mit anderen gut auskommen können, egal, wie sie sind.«
»Oh, damit komme ich klar.«
»Bestimmt. Dein OW ist ein feiner Kerl, das macht schon was aus.«
»Und die anderen?«
»Habe gehört, bei dem Hilfswärter soll man sich vorsehen. Aber er ist etwa in deinem Alter, ihr werdet euch schon verstehen.«
»Wieso soll man sich vorsehen?«
Jory lächelt über den Gesichtsausdruck des Jungen. »Mach nicht so ein Gesicht. Im Dienst gibt es eine Menge Geschichten, nicht alle sind wahr.«
Das Meer unter ihnen ist aufgewühlt, dunkle Wellen wogen, klatschen und krachen; die Brise frischt auf, jagt über das Wasser, zieht es zu Spitzen und pustet es auseinander. Kraftvolle Gischt zerstiebt am Bug, und die Wellen werden schwer und geheimnisvoll tief. Als Jory ein Junge war und sie oft mit dem Boot von Lymington nach Yarmouth fuhren, spähte er über die Reling an Deck und staunte darüber, wie unauffällig es passierte, ohne dass man es richtig merkte, wie unter dem Meer der Boden absackte und verschwand, und wäre man hineingefallen, wäre es bis zum Grund dreißig Meter in die Tiefe gegangen. Da unten lebten Hornhechte und Glatthaie: fremdartige, aufgedunsene, schimmernde Gebilde mit weichen, tastenden Tentakeln und Augen wie milchige Murmeln.
Der Leuchtturm kommt näher, eine Linie wird zu einem Streifen, ein Streifen zu einem Finger.
»Da ist sie. Die Maiden.«
Jetzt können sie die Spuren des Meeres an ihrem Sockel sehen, die Narbe des ungezügelten Wetters, die sie sich in Jahrzehnten der Herrschaft zugezogen hat. So oft Jory sich auch schon der Königin der Leuchttürme genähert hat, er fühlt sich jedes Mal gleich – gescholten, unbedeutend, vielleicht ein wenig ängstlich. Als fünfzig Meter hohe Säule prächtiger viktorianischer Baukunst ragt die blasse Maiden eindrucksvoll vor dem Horizont auf, ein gleichmütiges Bollwerk für die Sicherheit der Seefahrer.
»Sie gehörte zu den ersten«, sagt Jory. »1893. Zweimal zerstört, bevor ihr Licht endlich entzündet wurde. Es heißt, sie würde bei rauem Wetter wie eine weinende Frau klingen, wenn der Wind zwischen die Felsen fährt.«
Einzelheiten schälen sich aus dem Grau – die Fenster des Leuchtturms, der Betonring des Sockels und der schmale Steigeisengang, der zur Eingangstür führt, die sogenannte Hundeleiter.
»Können sie uns sehen?«
»Jetzt schon.«
Aber als Jory das sagt, sucht er nach der Gestalt, die er auf dem Sockel erwarten würde, nach dem Oberwärter in seiner Marineuniform mit der weißen Schirmmütze, oder dem Wärter, der sie einweist. Bestimmt haben die Männer seit dem Sonnenaufgang das Meer nicht aus den Augen gelassen.
Er mustert den unruhigen Bereich am Fuß des Leuchtturms kritisch und überlegt, wie er am besten vorgehen soll, ob er mit Bug oder Heck voraus anlegen soll, ob er ankern oder das Boot frei treiben lassen soll. Eiskaltes Wasser strömt über ein versunkenes Felslabyrinth; wenn der Wasserspiegel ansteigt, verschwinden die Steine, wenn er absinkt, tauchen sie wie schwarze, glänzende Backenzähne auf. Von allen Türmen ist das Anlegen beim Bishop, beim Wolf und der Maiden besonders schwierig, und wenn Jory wählen sollte, würde er der Maiden die Krone aufsetzen. Einer Seemannslegende zufolge wurde sie auf dem Kiefer eines versteinerten Seeungeheuers errichtet. Dutzende starben bei ihrem Bau, und das Riff hat viele Seeleute getötet, die von ihrer Route abgekommen sind. Sie mag Außenstehende nicht und heißt niemanden willkommen.
Jory wartet immer noch darauf, einen oder zwei Wärter zu entdecken. Ohne jemanden an der Anlegestelle bekommen sie den Jungen nicht von Bord. Bei diesem Wellengang ist er jetzt drei Meter tiefer und gleich drei Meter höher, und wenn er das aus dem Blick verliert, reißt das Seil und sein Mann nimmt ein kaltes Bad. Es ist eine haarige Angelegenheit, aber so ist es bei den Türmen weit draußen. Auf einen Landmenschen wirkt das Meer ziemlich beständig, aber Jory weiß, dass es das nicht ist: Es ist launisch und unberechenbar, und wenn man nicht aufpasst, erwischt es einen.
»Wo sind sie?«
Den Ruf seines Maats hört er wegen des tosenden Wassers kaum.
Jory gibt das Zeichen, auf die andere Seite zu fahren. Der Junge wirkt grünlich um die Nase. Der Techniker auch. Jory sollte sie beruhigen, aber besonders ruhig ist er selbst nicht. In all den Jahren, in denen er zur Maiden gefahren ist, hat er nie die Rückseite des Turms angesteuert.
Der Leuchtturm erhebt sich vor ihnen aus purem Granit. Jory reckt den Hals, um die Eingangstür zu sehen, achtzehn Meter über dem Wasser, solider Rotguss und trotzig geschlossen.
Seine Leute schreien, sie rufen die Wärter und blasen in eine schrille Pfeife. Darüber, noch weiter oben, reckt sich der Turm spitz zulaufend in den Himmel, und der Himmel blickt im Gegenzug auf ihr kleines Gefährt herunter, das wild umhergeworfen wird. Da ist wieder dieser Vogel, der ihnen vom Land an gefolgt ist. Er dreht und dreht seine Kreise und übermittelt eine Botschaft, die sie nicht verstehen. Der Junge beugt sich über die Seite des Boots und gibt sein Frühstück von sich.
Sie steigen auf, sie sinken ab, sie warten und warten.
Jory blickt zum Turm hinauf, der sich massig aus seinem Schatten erhebt, und hört nichts außer den Wellen, die über die Felsen schwappen und spülen, außer dem Krachen und Spritzen des Schaums, und er kann nur an das vermisste Mädchen denken, von dem er morgens im Radio gehört hat, und an die Bushaltestelle, die leere Haltestelle und den unablässig strömenden Regen.
2Rätselhafte Ereignisse auf einem Leuchtturm
Trident House wurde unterrichtet, dass drei Wärter vom Maiden-Rock-Leuchtturm, 28 km südwestlich von Land’s End gelegen, verschollen sind. Bei den Männern handelt es sich um Oberwärter Arthur Black, Wärter William »Bill« Walker und Hilfswärter Vincent Bourne. Ihr Verschwinden wurde gestern Morgen von einem ortsansässigen Bootsführer und seiner Mannschaft entdeckt, die eine Ablösung zum Leuchtturm und Mr Walker ans Festland bringen wollte.
Bisher gibt es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Männer, auch ist keine offizielle Stellungnahme erfolgt. Es wurden Ermittlungen eingeleitet.
3Neun Etagen
Das Anlanden dauert Stunden. Ein Dutzend Männer klettert die Hundeleiter hinauf, auf den Zungen der Geschmack von Salz und Angst, die Ohren gerötet und die Hände blutig und eiskalt.
Sie erreichen die Tür, sie ist von innen abgeschlossen. Eine Stahlplatte, dafür geschaffen, dem tosenden Meer und Orkanwinden standzuhalten, muss jetzt mit Stangen und Muskelkraft aufgebrochen werden.
Danach bekommt einer der Männer das Zittern, bleiches, heftiges Zittern, zum Teil aus Erschöpfung, zum Teil wegen des Unbehagens, das an ihm nagt, seit Jory Martins Ablöseboot ohne die Männer vom Maiden Rock zurückgekommen ist, seit Trident House zu ihnen gesagt hat: »Fahrt da raus.«
Drei von ihnen betreten den Turm. Drinnen ist es dunkel, es riecht muffig und nach verbrauchter Luft, ein typischer Geruch für die Türme auf hoher See mit ihren verrammelten Fenstern. Im Lagerraum gibt es nicht viel zu sehen; sperrige, im Dämmerlicht unkenntliche Gebilde, aufgewickelte Taue, ein Rettungsring, ein umgekehrt aufgehängtes Dingi. Alles ordnungsgemäß.
Das Ölzeug der Wärter hängt in den Schatten wie Fische am Haken. Ihre Namen werden durch einen Durchstieg in der Decke gerufen und schrauben sich die Treppe hinauf:
Arthur. Bill. Vincent. Vince, bist du da? Bill?
Es wirkt gespenstisch, wie ihre lebendigen Stimmen die Stille zerschneiden, eine zähe, obszön laute Stille. Die Männer rechnen nicht mit einer Antwort. Trident hat ihnen erklärt, es sei eine Rettungsmission, aber es ist eine Suche nach Leichen. Niemand glaubt mehr, die Wärter wären entkommen. Die Tür war verschlossen. Sie sind hier, irgendwo im Turm.
Holt sie ohne Aufsehen da runter, hieß es von Trident. Seid diskret. Findet einen Bootsführer, der es für sich behält; vermeidet jeden Wirbel; macht keine Szene; niemand muss etwas davon erfahren. Und seht zu, dass das Leuchtfeuer funktioniert, sorgt um Himmels Willen dafür.
Drei Männer steigen hinauf, einer nach dem anderen. An der Wand der nächsten Etage hängen Zünder und Sprengladungen für die Nebelkanone. Es gibt keine Anzeichen eines Kampfes. Jeder der Männer denkt an Zuhause, an seine Frau, seine Kinder, falls er welche hat, das warme Kaminfeuer und eine Hand auf seinem Rücken: »Langer Tag, Schatz?« Der Turm ist kein Ort, der Familien kennt. Er kennt nur drei Wärter: Drei Wärter, die irgendwo hier tot verborgen sind. Wo werden sie die Leichen finden? In welchem Zustand werden diese Leichen sein?
Sie steigen in den dritten Stock zu den Paraffintanks, dann in den vierten, wo das Öl für den Brenner gelagert wird. Jemand ruft noch einmal, einfach nur, um die provozierende Stille zu durchbrechen. Nichts deutet auf einen überstürzten Aufbruch hin, eine Flucht, nichts lässt vermuten, dass die Wärter diesen Ort verlassen haben.
Vom Öllager aus steigen sie die Treppe hinauf, eine gusseiserne Spirale, die sich an der Innenwand bis zur Laterne hinaufwindet. Das Geländer glänzt. Leuchtturmwärter haben ihre Eigenarten, sie sind von den Feinheiten der Hausarbeit besessen, sie polieren, putzen, wienern; nirgends ist es so sauber wie in einem Leuchtturm. Die Männer suchen auf dem Messing nach Fingerabdrücken und finden keine: Wärter sind so sorgfältig, dass sie das Geländer nie anfassen. Hätte es allerdings einer von ihnen eilig gehabt, wäre einer gefallen oder gestolpert oder wäre nicht er selbst gewesen, weil etwas Schreckliches passiert war … Aber es ist nichts Ungewöhnliches zu entdecken.
Die schweren, verbissenen Schritte der Männer klingen wie unheilvolle Trommelschläge. Schon jetzt sehnen sie sich nach der Sicherheit des Schleppboots und der Verheißung auf festes Land.
Sie kommen in die Küche. Gute dreieinhalb Meter im Durchmesser und mit dem Rohr für das Gewicht in der Mitte. An den Wänden hängen drei Schränke mit ordentlich aufeinandergestapelten Konservendosen: gebackene Bohnen, Dicke Bohnen, Reis, Suppe, Brühwürfel, Frühstücksfleisch, Corned Beef, Essiggurken. Auf der Arbeitsplatte steht ein ungeöffnetes Glas Frankfurter Würstchen, eingequetscht wie Gewebeproben in einem Labor. Neben dem Fenster sind eine Spüle – rotes Ventil für Regenwasser, silbernes für Frischwasser – und eine Spülschüssel, die zum Trocknen auf der Seite steht. Eine verschrumpelte Zwiebel liegt in dem Hohlraum zwischen innerer und äußerer Wand auf einem der Regalbretter, die den Wärtern als Vorratslager dient. Über der Spüle ersetzt ein Spiegelschrank den Badezimmerschrank: Die Männer finden Zahnbürsten, Kämme, ein Fläschchen Old Spice und eines von Tabac. Daneben sind in einer Anrichte Besteck, Teller und Tassen, alles mit der erwarteten Sorgfalt geordnet und verstaut. Die Wanduhr ist um Viertel vor neun stehengeblieben.
»Was ist das …?«, fragt der Mann mit dem Schnurrbart.
Der Tisch ist für eine Mahlzeit gedeckt. Zwei Gedecke, nicht drei – jeweils Messer und Gabel und ein Teller, der fürs Essen bereitsteht. Zwei leere Tassen. Salz und Pfeffer. Eine Tube Senf und ein sauberer Aschenbecher. Die Arbeitsplatte ist aus Resopal, ein Halbmond, der sich an das Gewichtrohr schmiegt; eine Bank und zwei Stühle sind daruntergeschoben, aus einem Stuhl quillt der Schaumstoff, der andere steht schräg, als wäre der Mensch, der darauf gesessen hat, schnell aufgestanden.
Ein anderer Mann, der mit der überkämmten Glatze, sieht im Rayburn nach, falls dort etwas warm gehalten wird, aber der Ofen ist abgekühlt und ohnehin leer. Durch das Fenster können sie das Meer hören, das seufzend gegen die Felsen unten trifft.
»Ich habe keine Ahnung«, sagt er, und das ist weniger eine Antwort als das Eingeständnis einer allgemeinen, ängstlichen Ungewissheit.
Die Männer blicken zur Decke.
In einem Leuchtturm kann man sich nirgendwo verstecken, so sieht es nun einmal aus. In jedem Raum von unten bis oben sind es zwei Schritte bis zum Gewichtrohr und zwei bis zur gegenüberliegenden Seite.
Sie klettern weiter hinauf in den Schlafraum. Drei Bananenkojen bilden die Rundung der Wand nach, bei allen ist der Vorhang geöffnet. Die Betten sind penibel gemacht, die Laken straff gespannt, die Kissen und kamelhaarfarbenen Decken fühlen sich kratzig an. Darüber sind zwei kürzere Kojen für Besucher und eine Leiter nach oben. Unter den Stufen findet sich ein Stauraum mit vorgezogenem Vorhang. Der Mann mit der überkämmten Glatze zieht den Vorhang zurück, hält dabei den Atem an, findet aber nur eine Lederjacke und zwei aufgehängte Hemden.
In der siebten Etage sind sie dreißig Meter über dem Meeresspiegel. Im Wohnraum stehen ein Fernseher und drei verschlissene Ercol-Sessel. Neben dem größten Sessel, der wahrscheinlich dem Oberwärter gehört, steht eine Tasse mit einem Fingerbreit kalten Tee auf dem Boden. Hinter dem Fernseher ragt das Ofenrohr von unten in den Raum. Jetzt könnte der OW zu ihnen hinunterkommen; er war oben in der Laterne und hat den Glühstrumpf gereinigt. Die anderen sind auch da, draußen auf der Galerie. Tut ihnen leid, dass sie nichts gehört haben.
Die Wanduhr hier sagt dasselbe, die Zeit ist stehengeblieben. Viertel vor neun.
Doppeltüren führen in den Betriebsraum im achten Stock. Die toten Männer hätten durchaus hier sein können – der Zwischenraum hätte den Geruch zurückgehalten. Aber wie sie mittlerweile erwarten, finden sie den Raum verlassen vor. Es bleibt nicht mehr viel übrig vom Turm. Nur noch die Laterne. Acht Etagen durchsucht und acht Etagen leer. Also hinauf auf die Spitze, und da ist sie, die Laterne der Maiden, ein riesiger Glühstrumpf umschlossen von Linsen so zart wie Vogelschwingen.
»Das war’s. Sie sind weg.«
Am Horizont ziehen Federwolken heran. Die Brise frischt auf, ändert die Richtung, treibt weiße Kämme über die tanzenden Wellen. Es ist, als wären die Wärter nie hier gewesen. Entweder das, oder als wären sie ganz nach oben geklettert und einfach davongeflogen.
II1992
4Das Rätsel
SCHRIFTSTELLER WIDMET SICH DEM MYSTERIUM VOM MAIDEN ROCK
Autor Dan Sharp widmet sich der Suche nach der Wahrheit über eines der größten maritimen Geheimnisse unserer Zeit. Sharp, dessen Thriller auf hoher See, Im Auge des Sturms, Stille Wasser und Schlachtschiff in Seenot, Bestseller wurden, wuchs an der Küste auf und wird seit langem von dem ungelösten Vermisstenfall inspiriert. Zu seinem ersten Exkurs in den Sachbuchbereich bemerkt er: »Die Geschichte vom Maiden Rock fasziniert mich seit meiner Kindheit. Ich hoffe, dass ich neue Erkenntnisse gewinnen kann, indem ich mit den Menschen spreche, die damals direkt betroffen waren.«
Vor zwanzig Jahren, im Winter 1972, verschwanden drei Wärter aus einem Leuchtturm vor der Küste von Cornwall, einige Kilometer von Land’s End entfernt. Sie hinterließen eine Reihe von Hinweisen: eine von innen verschlossene Zugangstür, zwei Uhren, die zur selben Zeit stehenblieben, und einen gedeckten, aber unbenutzten Tisch. Im Wetterlogbuch des Oberwärters wird ein Sturm beschrieben, der den Turm umkreiste – dabei herrschte klarer Himmel.
Welch rätselhaftes Schicksal hat diese unglücklichen Männer ereilt? Genau dieser Frage geht Sharp nach. Er fügt hinzu: »Dieses Rätsel bietet alles, was das Herz eines Romanautors begehrt – Dramatik, Gefahr auf hoher See. Nur ist es wahr. Ich glaube, dass man jedes Geheimnis aufdecken kann: Man muss nur an den richtigen Orten suchen. Ich bin sicher, dass irgendjemand mehr weiß, als wir ahnen.«
5Helen
Es ist so weit, dachte sie, als sie beobachtete, wie er ein Stückchen die Straße hinunter sein Auto abstellte, einen Morris Minor in Rennwagengrün mit einem Auspuff, der wie eine Tabakpfeife schräg unter dem Heck hing. Helen fragte sich, warum er so eine alte Kiste fuhr. Er musste doch reich sein, wenn die Behauptungen über seine Bücher stimmten und er wirklich ein Bestsellerautor war.
Sie hatte ihn sofort erkannt, obwohl er ihr am Telefon keine Beschreibung gegeben hatte. Vielleicht hätte sie ihn darum bitten sollen, schließlich kann man nie vorsichtig genug sein, wenn man Fremde in sein Haus lässt. Aber das musste er sein. Er trug eine marineblaue Cabanjacke und hatte die Stirn in gelehrte Falten gelegt, als säße er ständig stundenlang über Manuskripte gebeugt, die sich sperrig gaben. Er war jünger, als sie erwartet hätte, noch keine vierzig.
»Verschwinde«, sagte Helen geistesabwesend, als die Tasthaare des Hundes ihre Handfläche berührten; »ich gehe danach mit dir raus.« Sie würde im Wald durch das feuchtkalte Laub mit der Hündin spazieren gehen. Der Gedanke beruhigte sie: Es würde ein Danach geben.
Der Schriftsteller hatte eine Leinentasche bei sich, in der sie lauter Quittungen und Feuerzeuge vermutete; sie konnte sich gut vorstellen, dass er in einem Haus mit ungemachten Betten und schlafenden Katzen auf den Anrichten wohnte. Zum Frühstück gab es Weetabix, etwas aus einer aufgerissenen Pappschachtel, aber weil er keine Milch mehr hatte, musste er einen Schuss Wasser aus dem Hahn nehmen. Eine Kippe, während er über den Maiden Rock nachdachte und alle Fragen aufschrieb, die er stellen wollte.
So viele Jahre später machte sie es immer noch. Sie schätzte die Leute auf den ersten Blick ein, bevor alles andere kam, das war die Messlatte, die sie bei jedem neuen Menschen anlegte. Hatte er jemanden verloren, so wie sie? Begriff er, wie sich das anfühlte? Hatte er einen ähnlichen Weg hinter sich wie sie oder war seiner ganz anders verlaufen und er unvorstellbar weit entfernt? Wahrscheinlich, dachte sie, war es nicht wichtig, ob er jemanden verloren hatte oder nicht: Er war Schriftsteller, er konnte es sich vorstellen.
Allerdings war Helen skeptisch, was das anging: Konnte er sich wirklich das Unvorstellbare vorstellen? Für sie war es ein Gefühl, als würde sie fallen. Schwerelos. Ungläubig. Als würde sie darauf warten, dass jemand sie auffing, doch das geschah nicht, Jahr um Jahr nicht, und es ging weiter so, und sie fiel tiefer, und es gab keine Erkenntnisse, keine Klarheit und keinen Abschluss. Das war ein angesagtes Konzept zurzeit, mit einer Sache abzuschließen – etwa für Leute, deren Beziehung gescheitert war oder denen gekündigt wurde, und sie fand, solche Dinge waren recht klar, mit so etwas konnte man gut abschließen; sie trieben einen nicht über den Abgrund und ließen einen fallen. Aber genau das passierte, wenn sich ein Mensch in Luft auflöste. Ohne Spur, ohne Grund, ohne Hinweis. Was davon konnte sich Dan Sharp, der über Schlachtschiffe und Waffen und Männer schrieb, die sich in Werften um den Verstand tranken, vorstellen?
Sie wünschte, sie könnte sich mit anderen austauschen, denen es ebenso ging, könnte sie erkennen und selbst erkannt werden. Ihren Gesichtern könnte sie den Verlust anmerken, nichts Offensichtliches, eine gewisse Verbitterung oder Resignation, diese Ghule, die sie schon so lange abzuschütteln versucht. Sie würde sagen: »Du weißt es, oder, du weißt es«, und man konnte nur abwarten, was sie im Gegenzug bieten würden, aber wenn das nicht zu ein wenig mehr Güte und Verständnis führen würde, wofür war es dann gut?
Bis dahin schlüpften die Ghule zwischen die Sachen in ihrem Kleiderschrank und ließen sie schaudern, wenn sie sich morgens anzog, oder Helen entdeckte sie, wie sie in der Ecke hockten und sich die Haut von den Daumen zogen. Sie habe keine Gewissheit, sagten die Therapeuten (ihr letzter Besuch bei einem von ihnen lag eine Weile zurück), und Gewissheit war wenigstens ein Millimeter, in den man seine Nägel krallen konnte.
Jetzt war er also hier, und er öffnete gerade das Tor. Er hantierte herum, um es hinter sich zu schließen, weil der Riegel verrostet war. Im Küchenradio lief »Scarborough Fair«; Helen fühlte sich benommen, so wehmütig klangen die Zeilen über Meerschaum und Batisthemden und eher bittere als süße wahre Liebe. Von Zeit zu Zeit kommen ihr wilde Gedanken in den Kopf, über Arthur und die anderen, aber im Großen und Ganzen hat sie gelernt, diese Gedanken in Schach zu halten. Welche Geheimnisse ein Leuchtturm erzählen könnte. Die Geheimnisse der Männer waren unter dem Wasser begraben, so wie Helens.
Helens Erinnerungen an ihren Mann waren nur Bruchstücke, verdorrte Schuppen, die sie umwehten wie Laub, das durch die Küchentür getrieben wurde. Manchmal bekam sie eine zu fassen und konnte sie genauer betrachten, aber meist sah sie nur, wie diese Blätter um ihre Knöchel wehten, und fragte sich, wie in aller Welt sie die Energie aufbringen sollte, sie zusammenzukehren.
Nichts veränderte sich nach einem Verlust. Es wurden noch immer Songs geschrieben. Es wurden Bücher gelesen. Kriege hörten nicht auf. Pärchen stritten sich bei den Einkaufswagen vor Tesco, bevor beide ins Auto stiegen und die Türen zuknallten. Das Leben folgte seinem Kreislauf, wieder und wieder, ohne Mitgefühl. Die Zeit verlief in ihren typischen Rhythmen, diesem Kommen und Gehen, den Anfängen und Enden, bewussten Abfolgen, in denen Dinge festgelegt waren, ohne einen Gedanken an das Pfeifen im Wald am Rande der Stadt. Es begann als ein kurzes Pfeifen, das über trockene Lippen drang. Im Laufe der Jahre verschärfte es sich zu einem hellen, durchgehenden Ton.
Jetzt erklang dieser Ton mit dem Schellen an der Tür. Helen steckte die Hände in die Taschen ihrer Strickjacke und rollte die Flusen darin zwischen den Fingern. Sie mochte das Gefühl, die Flusen unter ihre Nägel zu drücken, diesen Beinaheschmerz.
6Helen
Kommen Sie rein. Bitte, nur herein. Tut mir leid, dass es hier so unordentlich ist. Nett von Ihnen, das zu sagen, aber das ist es wirklich. Kann ich Ihnen einen Tee oder Kaffee anbieten? Tee, sehr schön – Milch und Zucker? Natürlich, heutzutage nimmt jeder Milch und Zucker. Meine Großmutter hat ihren schwarz mit einer Scheibe Zitrone getrunken; das macht man heute kaum noch. Kuchen? Ich fürchte, er ist nicht selbstgebacken.
Sie sind also Schriftsteller, wie faszinierend. Ich habe mich noch nie mit einem Schriftsteller unterhalten. Das ist eine von diesen Sachen, von denen die Leute immer behaupten, sie könnten das auch, oder, ein Buch schreiben. Ich habe selbst schon darüber nachgedacht, aber ich bin keine Schriftstellerin – ich wüsste schon, worüber ich schreiben wollte, aber es ist schwierig, das anderen zu vermitteln, und ich schätze, das ist der Unterschied. Nachdem Arthur gestorben ist, haben alle gesagt, es wäre gut, wenn ich meine Gefühle zu Papier bringen würde, um sie aus dem Kopf zu bekommen. Sie glauben sicher, Sie sind ja selbst kreativ, dass man sich persönlich gereifter fühlt, wenn man etwas Kreatives tut? Jedenfalls habe ich nie etwas geschrieben. Bei allem, was ich hätte schreiben können, hätte ich wahrscheinlich nicht gewollt, dass ein Fremder es liest.
Zwanzig Jahre, meine Güte, kaum zu glauben. Darf ich fragen, warum Sie unsere Geschichte ausgesucht haben? Wenn Sie hoffen, dass mein Mann wie diese Machos in Ihren Büchern war und ich Ihnen was von Missionen und Schiffswracks oder irgendwas erzählen kann, dann muss ich Sie enttäuschen.
Ja, es ist faszinierend, wenn Sie dem Gerede glauben. Ich bin direkt betroffen, ich war ganz nahe dabei, darum sehe ich das anders; aber deshalb müssen Sie kein schlechtes Gewissen haben, nein, wirklich nicht. Es macht mir nichts aus, über Arthur zu reden, dadurch bleibt er bei mir. Würde ich so tun wollen, als wäre es nicht passiert, hätte ich schon vor langer Zeit Probleme bekommen. Man muss sich den Dingen stellen, die man erlebt hat.
Im Laufe der Jahre habe ich alles gehört. Arthur wurde von Außerirdischen entführt. Er wurde von Piraten ermordet. Von Schmugglern erpresst. Er hat die anderen getötet oder sie ihn, und dann sie sich gegenseitig und anschließend sich selbst – wegen einer Frau oder Schulden oder einer angespülten Schatzkiste. Sie wurden von Geistern heimgesucht oder von der Regierung entführt. Von Spionen bedroht oder von Seeschlangen verschlungen. Sie sind verrückt geworden, einer von ihnen oder sie alle. Sie haben ein geheimes Leben geführt, von dem niemand wusste, mit Reichtümern, die auf Plantagen in Südamerika vergraben waren und die man nur durch ein Kreuz auf einer Karte finden konnte. Sie sind nach Timbuktu gesegelt und fanden es dort so schön, dass sie nicht zurückgekommen sind … Als dann vor zwei Jahren dieser Lord Lucan verschwand, sagten einige, er habe Arthur und die anderen auf einer einsamen Insel getroffen, wahrscheinlich mit all den armen Kerlen, die durch das Bermudadreieck geflogen sind. Ich meine, mal ehrlich! Das wäre Ihnen sicher lieber, aber ich fürchte, das ist lächerlich. Wir sind jetzt nicht in Ihrer Welt, wir sind in meiner, und das ist kein Thriller, das ist mein Leben.
Sind fünf Minuten in Ordnung? Wie die Minuten auf der Uhr, wenn Sie sich den Kuchen als Uhr vorstellen, so groß ist das Stück, das ich Ihnen abschneide. Dann geben Sie mir Ihren Teller; hier, bitte. Ich muss sagen, beim Backen habe ich nie den richtigen Dreh herausbekommen. Angeblich ist das ja Frauensache, ich verstehe nur nicht, warum. Arthur konnte so was besser als ich. Wussten Sie, dass sie bei ihrer Ausbildung gelernt haben, Brot zu backen? Man lernt alles Mögliche als Leuchtturmwärter.
Von allen Türmen hat der Bishop den besten Namen, finde ich. Das klingt doch richtig würdevoll. Bischof. So hieß früher auch der Läufer beim Schach, daran erinnert der Name mich, es klingt ruhig und imposant. Arthur konnte extrem gut Schach spielen; ich habe nie gegen ihn gespielt, weil wir beide gewinnen wollten, und wir waren es nicht gewohnt, uns dem anderen geschlagen zu geben. Als Wärter musste er sich für Karten und Spiele begeistern, weil man so viel freie Zeit hat. Es verbindet auch, wenn man eine Partie Cribbage oder Gin Rummy spielt. Und der Tee! Wenn Wärter etwas können, dann Tee trinken. Sie bringen es auf dreißig Tassen am Tag. Auf vielen Türmen galt als einzige Regel, dass jeder, der in der Küche ist, Tee macht.
Auf Leuchttürmen sind ganz normale Leute. Das finden Sie noch heraus, und hoffentlich sind Sie dann nicht enttäuscht. Außenstehende glauben, die Arbeit würde im Verborgenen stattfinden, weil wir ziemlich abgeschottet leben. Sie stellen es sich aufregend vor, mit einem Leuchtturmwärter verheiratet zu sein, weil es so geheimnisvoll ist, aber das ist es nicht. Kurz gesagt, würde ich es so beschreiben, dass man sich darauf einstellen muss, lange getrennt zu sein und kurze, intensive Phasen zusammen zu haben. In diesen intensiven Phasen ist es wie bei weit entfernt lebenden Freunden, die sich treffen, und das kann aufregend, aber auch schwierig sein. Man hat acht Wochen lang alles gemacht, wie man wollte, und dann kommt ein Mann dazu, und er ist plötzlich der Herr im Haus, und man selbst spielt die zweite Geige. Das konnte einen ziemlich aus der Bahn werfen. Das ist keine Ehe nach dem klassischen Muster. Unsere war es mit Sicherheit nicht.
Ob ich das Meer vermisse? Nein, überhaupt nicht. Nach dem, was passiert ist, konnte ich nicht schnell genug wegziehen. Deshalb bin ich hierhin gegangen, in die Stadt. Ich mochte das Meer noch nie. In den Wärtercottages, in denen wir gelebt haben, waren wir davon umgeben, durchs Fenster hat man nichts anderes gesehen, wohin man auch schaute. Manchmal kam man sich vor wie in einem Goldfischglas. Wenn es bei einem Gewitter geblitzt hat, war das ziemlich eindrucksvoll, und die Sonnenuntergänge waren auch hübsch, aber alles in allem ist es ziemlich grau, das Meer, groß und grau und es passiert nicht viel. Wobei es eher grün als grau ist, würde ich sagen, wie Salbei oder Eau-de-Nil. Das bedeutet »Wasser des Nils«, wussten Sie das? Ich dachte immer, es würde »Wasser des Nichts« bedeuten, weil das Meer mir dieses Gefühl gibt, in gewisser Weise, deshalb sehe ich es immer noch so. Wasser des Nichts.
Ich verstehe es heute immer noch nicht besser als an dem Tag, an dem Arthur verschwunden ist. Aber es wird leichter. Die Zeit verschafft ein wenig Abstand, und man kann auf alles, zurückblicken, was einem passiert ist, ohne die Gefühle von damals; diese Gefühle haben sich beruhigt, sie drängen sich nicht mehr so in den Vordergrund wie am Anfang. Es ist seltsam, weil es an manchen Tagen gar nicht so ungewöhnlich wirkt, was sie in diesem Turm gefunden haben – und ich glaube, na ja, dass sie von schwerem Seegang mitgerissen wurden und ertrunken sind. An anderen Tagen wirkt es auf mich so haarsträubend, dass es mir den Atem verschlägt. Zu viele Einzelheiten gehen mir einfach nicht aus dem Kopf, die verschlossene Tür zum Beispiel und die stehengebliebenen Uhren, sie nagen an mir, und wenn ich nachts darüber nachdenke, muss ich mich ermahnen und diese Gedanken verscheuchen. Sonst könnte ich nie schlafen, und ich erinnere mich an den Blick aufs Meer aus unserem Cottage, es wirkt so riesig und leer und gleichgültig, dass ich zur Gesellschaft das Radio anstellen muss.
Ich glaube, dass geschehen ist, was ich Ihnen gerade erklärt habe: Eine Welle ist plötzlich hochgeschlagen und hat sie überrascht. Ockhams Rasiermesser, so heißt es. Das Prinzip, dem zufolge die einfachste Lösung meistens die richtige ist. Steht man vor einem Rätsel, soll man es nicht über die Summe seiner Teile hinaus kompliziert machen.
Arthur ist ertrunken – das ist die einzige realistische Erklärung. Wenn Sie das anders sehen, führt Sie das nur auf abstruse Abwege wie Geisterkram und Verschwörungstheorien und die ganzen unsinnigen Ideen der Leute, von denen ich gerade erzählt habe. Die Leute glauben alles, und wenn sie die Wahl haben, sind ihnen Lügen lieber als die Wahrheit, weil Lügen meistens interessanter sind. Wie gesagt, das Meer ist nicht interessant, nicht, wenn man es jeden Tag sieht. Aber es war das Meer, das sie geholt hat. Daran habe ich keinen Zweifel.
Über diesen Leuchtturm – waren Sie schon mal auf einem auf hoher See? – müssen Sie wissen, dass er ganz allein im Meer steht. Es gibt keine Anlage, keine Insel mit einem bisschen Land darum, auf dem man herumlaufen oder ein Gemüsebeet anlegen oder ein paar Schafe halten kann oder was immer man machen will; es ist auch kein Turm auf dem Festland, wo man nahe bei seiner Familie bleibt, und wenn man nicht im Dienst ist, kann man ins Dorf fahren und normal leben, solange man seine Pflichten erfüllt, wenn der Dienst anfängt. Auf hoher See gibt es nichts als den Turm, die Wärter können also nur im Leuchtturm selbst oder auf dem Sockel sein. Wenn man ein bisschen Bewegung will, könnte man auf dem Sockel im Kreis laufen, aber dabei würde einem ziemlich schnell schwindlig werden.
Oh, stimmt, Entschuldigung: Der Sockel ist die Plattform unter der Eingangstür, er umgibt den Turm wie ein Riesendonut. Er ist etwa fünf bis zehn Meter über dem Wasser, was nach viel klingt, aber wenn man da draußen ist und eine Welle kommt und einen erwischt, hat man keine Chance. Ich habe von Wärtern gehört, die vom Sockel aus angeln oder Vögel beobachten oder ein Buch lesen, um sich die Zeit zu vertreiben. Das hat Arthur bestimmt auch gemacht, er hat immer gerne gelesen; er sagte, die Zeit in einem Leuchtturm sei für ihn die Zeit zum Lernen, deshalb hat er über alle möglichen Themen was mitgenommen, Romane und Biografien und Bücher über den Weltraum. Er hat angefangen, sich für Geologie zu interessieren – für Felsen und Gestein, wissen Sie. Er hat Steine gesammelt und sortiert. Er hat gesagt, so könnte er alles über die verschiedenen Erdzeitalter lernen.
Egal, was man da draußen macht, der Sockel ist der einzige Ort an einem Turm, an dem man ordentlich frische Luft schnappen kann. Man kann nicht einfach den Kopf aus dem Fenster strecken, weil die Wände so dick sind: Sie wurden mit doppelten Fenstern gebaut, wissen Sie, einem inneren und einem äußeren, etwa einen Meter weit auseinander, man müsste also in dem kleinen Zwischenraum sitzen, und ich glaube, das wäre nicht besonders bequem. Man könnte auch auf die Galerie gehen, das ist der Außengang rund um die Laterne, aber da ist nicht viel Platz, und außerdem bräuchte man eine ziemlich lange Angelschnur.
Einer von ihnen, und ich würde nicht raten wollen, wer, aber es könnte Arthur gewesen sein, weil er sich gerne mal zurückgezogen hat, er mochte es, allein zu sein. Er könnte raus auf den Sockel gegangen sein und da gelesen haben, und der Wind war ruhig, Windstärke eins oder zwei vielleicht, und aus dem Nichts schlägt plötzlich eine Welle hoch und reißt ihn mit. Am Meer kann so was passieren. Das lernt man. Am Anfang hat es Arthur einmal am Eddystone erwischt; er war gerade erst ein richtiger Wärter geworden – also Wärter auf einem festen Turm – und wollte draußen seine Wäsche trocknen, als wie aus dem Nichts ein riesiger Brecher kam und ihn von den Füßen gerissen hat. Er hatte Glück, dass sein Kollege da war und ihn festgehalten hat, sonst hätte ich ihn schon Jahre früher verloren. Es hat ihn kalt erwischt, aber ihm ist nichts passiert. Von seiner Wäsche konnte man das nicht behaupten; ich weiß nicht, ob er auch nur ein Teil wiedergesehen hat. Er musste sich Kleidung von den anderen leihen, bis die Ablösung kam.
Aber solche Sachen haben Arthur nicht beunruhigt. Leuchtturmwärter sind nicht gerade gefühlsbetont, sie werden nicht nervös oder grübeln viel. Sonst würde Trident sie nicht anheuern. Arthur hatte nie Angst vor dem Meer, nicht einmal, wenn es gefährlich war. Er hat mir erzählt, dass bei einem Sturm die Gischt von den Wellen bis zum Küchenfenster des Turms spritzen kann – und das sind fünfundzwanzig Meter über dem Wasser –, und die Steine und Felsen rollen gegen das Fundament, so dass der Turm bebt und zittert. Ich hätte Angst gehabt, glaube ich. Aber Arthur nicht; er hatte das Gefühl, das Meer wäre auf seiner Seite.
Wenn er an Land kam, wirkte er manchmal, als würde er sich fehl am Platze fühlen. Wie ein Fisch auf dem Trockenen, das trifft es genau. Er fand sich hier irgendwie nicht zurecht, aber auf dem Meer. Wenn ich mich von ihm verabschiedet habe, bevor er wieder zum Turm gefahren ist, konnte ich ihm ansehen, dass er sich schon auf das Wiedersehen gefreut hat.
Ich weiß nicht genau, wie viele Bücher Sie schon über das Meer veröffentlicht haben, aber eine Geschichte darüber zu schreiben ist nicht dasselbe, wie darüber zu schreiben, wie es wirklich ist. Das Meer richtet sich gegen Sie, wenn Sie nicht vorsichtig sind, es ändert seine Meinung, so schnell wie Sie mit den Fingern schnipsen, und es ist ihm egal, wer Sie sind. Arthur konnte es vorhersagen, daran, wie die Wolken aussahen oder wie der Wind am Fenster geklungen hat, er konnte Ihnen sagen, ob es Windstärke sechs oder sieben war, nur vom Klang her – wenn also ein Mann wie Arthur, der mit solchen Dingen mehr Erfahrung hatte als jeder andere, den ich kenne, überrascht werden konnte, beweist es, dass sich das Meer schnell ändern kann. Vielleicht konnte er noch rufen, und die anderen sind zu ihm gerannt; der Sockel ist rutschig, es herrscht Panik, und es könnte doch leicht passieren, dass alle drei mitgerissen werden.
Die geschlossene Tür ist seltsam, das gebe ich zu. Dazu fällt mir nur ein, dass diese Eingangstüren aus dicken Rotgussplatten sind – das müssen sie sein, um die schweren Brecher auszuhalten – und ganz leicht zuknallen können. Dass sie von innen verriegelt war, gehört zu den Einzelheiten, die mir keine Ruhe lassen. Aber in Leuchttürmen gibt es diese schweren Eisenstangen quer vor der Tür, die sie sichern, deshalb denke ich, die Stangen könnten eingerastet sein, als die Tür zugeschlagen ist, wenn sie genug Wucht hatte …?
Ich weiß es nicht. Wenn Sie den Gedanken dumm finden, überlegen Sie mal, welcher andere Grund Ihnen einfällt, und dann schauen Sie, welcher Ihnen überzeugender erscheint, wenn Sie mitten in der Nacht hin und her überlegen. Die stehengebliebenen Uhren, die verschlossene Tür und der gedeckte Tisch, da kommt man ins Spekulieren, oder? Aber ich sehe das ganz praktisch. Ich bin nicht abergläubisch. Derjenige, der an dem Tag Küchendienst hatte, war wahrscheinlich gerade dabei, den Tisch für die nächste Mahlzeit zu decken: Das Essen wird auf Leuchttürmen sehr wichtig genommen, und Wärter halten sich wie die Kletten an ihre festen Abläufe. Und vielleicht standen nur zwei Gedecke auf dem Tisch, weil er noch nicht dazu gekommen war, das dritte aufzulegen.
Und zwei Uhren, die zur selben Zeit stehenbleiben? Das ist ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Getuschel, das bei jedem Weitersagen verzerrt wird. Irgendein Schlaukopf hat es sich ausgedacht, und eines Tages ist es eine Tatsache, obwohl es nicht stimmt und nur jemand verletzende Dinge erzählt hat, was niemandem hilft.
Ich habe gehofft, Trident würde befinden, dass sie ertrunken sind, um den Familien diese Ungewissheit zu ersparen, aber das haben sie nie getan. Meiner Meinung nach sind sie ertrunken. Ich bin froh, dass ich für mich zu einem Schluss gekommen bin, weil ich das brauche, auch wenn es nie eine offizielle Aussage gab.
Jenny Walker, Bills Frau, würde das nicht so sehen. Ihr ist es lieber, dass es keine Auflösung gibt. Es würde ihr sonst die letzte Chance nehmen, dass Bill zurückkommen könnte. Ich weiß, dass sie nicht zurückkommen. Aber die Menschen gehen mit Situationen um, wie sie wollen. Man kann niemandem vorschreiben, wie er trauern soll, das ist sehr persönlich und privat.
Aber es ist schade. Was uns passiert ist, hätte uns näher zusammenbringen sollen. Uns Frauen. Uns Ehefrauen. Aber ganz im Gegenteil. Ich habe Jenny seit der Gedenkfeier am zehnten Jahrestag nicht mehr gesehen, und selbst da haben wir nicht miteinander gesprochen. Wir sind uns aus dem Weg gegangen. Ich wünschte, es wäre anders, aber so ist es nun mal. Trotzdem versuche ich, es zu ändern. Ich glaube, dass Menschen so etwas miteinander teilen müssen. Wenn etwas so Schlimmes passiert, kann man es nicht allein durchstehen.
Deshalb spreche ich mit Ihnen. Weil Sie gesagt haben, dass Sie die Wahrheit ans Licht bringen wollen – ich auch, glaube ich. Die Wahrheit ist, dass Frauen wichtig füreinander sind. Wichtiger als die Männer, und das werden Sie nicht hören wollen, weil es in diesem Buch genau wie in Ihren anderen Büchern um Männer geht, oder? Männer interessieren sich für Männer.
Aber bei mir ist das anders. Diese drei haben uns drei zurückgelassen, und ich interessiere mich für das, was zurückbleibt. Für das, was wir daraus machen können, wenn es noch möglich ist.
Als Schriftsteller werden Sie sich wahrscheinlich auf die abergläubischen Theorien stürzen. Aber vergessen Sie nicht, dass ich an solche Dinge nicht glaube.
An was für Dinge? Also bitte, Sie sind doch der Schriftsteller, reimen Sie es sich zusammen. Mit den Jahren ist mir klar geworden, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die einen hören in einem dunklen, einsamen Haus ein Knarren und schließen die Fenster, weil es der Wind gewesen sein muss. Und die anderen hören in einem dunklen, einsamen Haus ein Knarren, zünden eine Kerze an und gehen nachsehen.
7
16 Myrtle Rise
West Hill
Bath
Jennifer Walker
Kestle Cottage
Mortehaven
Cornwall
2. Juni 1992
Liebe Jenny,
seit meinem letzten Brief ist einige Zeit vergangen. Auch wenn ich nicht mehr mit einer Antwort von Dir rechne, bleibe ich optimistisch, dass meine Worte gelesen werden. Ich hoffe, ich kann Dein Schweigen so deuten, dass zwischen uns Frieden herrscht – vielleicht hast Du mir sogar verziehen.
Ich wollte Dich wissen lassen, dass ich mit Mr Sharp spreche. Die Entscheidung habe ich mir nicht leichtgemacht. Bisher habe ich genauso wenig wie du mit Außenstehenden darüber gesprochen, was passiert ist. Trident House hat uns Anweisungen gegeben, und wir sind ihnen gefolgt.
Aber ich habe die Geheimnisse satt, Jenny. Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit. Ich werde alt. Ich muss vieles loslassen, Dinge, die ich schweigend ertragen habe, aus vielen Gründen, viele Jahre lang, und jetzt muss ich endlich darüber sprechen. Ich hoffe, Du verstehst das.





























