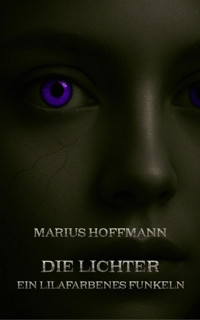
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mary leidet seit Jahren an Depressionen, Albträumen und grausam realen Schlafparalysen. Ihre besten Freunde empfehlen ihr einen mystischen Alternativmediziner, der trotz ihrer Skepsis die letzte Rettung zu sein scheint. Marys Mann Paul –ein Polizist- ist der verstörenden Wahrheit hinter der Krankheit auf der Spur. Doch dann verschwimmen Traum und Realität immer mehr, sodass der wahre Albtraum gerade erst beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marius Hoffmann
Impressum:
Text: Marius Hoffmann
Coverdesign: Marius Hoffmann
Teile der Bildgestaltung wurden mit ChatGPT (OpenAI)
realisiert.
Marius Hoffmann
Am Heidehügel 10
66629 Freisen
MARIUS HOFFMANN
DIE LICHTER
EIN LILAFARBENES FUNKELN
PSYCHOTHRILLER
Über den Autor:
Marius Hoffmann, geboren am 26.07.1996 in St. Wendel, absolvierte 2015 das Abitur in St. Wendel. Danach baute er sich mit dem Schreiben von Werbetexten und SEO-Optimierungen ein zweites Standbein auf. Trotz seines gemäß den Vorurteilen nicht sonderlich abwechslungsreichen Berufs ist ihm seine kreative Ader noch nicht abhandengekommen.
Da Marius Thriller-Romane liebt, hat er sich von diesen inspirieren lassen und will mit seinen Geschichten Spannung, Gänsehaut und nicht zuletzt gute Unterhaltung schenken.
Zitat:
Sie haben versprochen, dass Träume wahr werden können. Doch sie haben vergessen zu erwähnen, dass Albträume auch Träume sind.
Oscar Wild
Prolog
»So, das macht dann 12 Dollar, bitte!«, trällerte Richard fröhlich in seinem Laden zu Paul, der sich in seiner Mittagspause ein satt mit Ei, Bacon, Frischkäse und Avocado belegtes Sandwich gönnte. Er liebte das Zusammenspiel aus sämig-cremiger Avocado und salzig-knusprig gebratenem Speck. Ummantelt von einem außen krossen und innen fluffig gebackenen Ciabatta und der Snack war perfekt für ihn. Eine wahre Symphonie für seinen Gaumen. Dazu gab es einen extra starken, frisch gebrühten Kaffee aus der neuen, eleganten Siebträgermaschine. »Hier hast du 15, behalt den Rest«, entgegnete ihm Paul zwinkernd.
»Wär’ doch nicht nötig, aber danke dir!«, erwiderte Richard, während Paul sofort das eierschalenfarbene Wachspapier, mit dem das Sandwich eingepackt war, aufriss. Genussvoll nahm er mit geschlossenen Augen einen großen Happen vom dem belegten Brot, dessen Kruste dabei lauthals krachte. Nach dem Bissen gesellten sich neben dem Frischkäse auch einige Krümel um Pauls Mund, die beim Kauen regelrecht auf seinem Dreitagebart tanzten. Grinsend formte er mit Zeigefinger und Daumen einen Kreis. »Verdammt lecker wie immer!«, hörte Richard seinen Kumpel schmatzen und erwiderte dessen Grinsen mit einem zufriedenen Lachen. Die beiden waren Kumpel, seit sie denken konnten. Schon von Kindesbeinen an kannten und verstanden sie sich, als wäre es nie anders gewesen. Seit jeher waren sie beste Freunde. Nichts und niemand konnte einen Keil zwischen die beiden Gleichaltrigen treiben. Das zog sich bis zum Erwachsenenalter durch, auch wenn sie beruflich komplett verschiedene Wege gingen.
Paul liebte seinen Job, in dem er mit seinen mittlerweile 27 Jahren schon auf etwas Erfahrung bauen konnte. Er war ein engagierter Polizist in einem kleinen amerikanischen Ort in der weitläufigen, brennend heißen Wüste Nevadas. Nicht gerade die leichteste Umgebung für einen solchen Job, denn die Rahmenbedingungen gestalteten die meisten Einsätze doch schwieriger, als man das vermuten mochte. Vor allem die Hitze spielte sehr oft eine gesteigerte Rolle und erhöhte die Gefahr in vielerlei Hinsicht.
Den kleinen Ort umgab eine träge, aber zugleich mystische und geheimnisvolle Atmosphäre. Dort, in demselben Dorf, besaß sein bester Freund Rich, wie Paul ihn immer nannte, einen kleinen Laden, den er regelmäßig in seiner Mittagspause besuchte, um mit ihm zu quatschen und sich zu stärken. In dem vielseitigen Laden gab es alles, was man im Alltag so gebrauchen konnte und mehr. Von Lebensmitteln für den täglichen Gebrauch über Putzmittel hin zu Heimwerkbedarf war dort wirklich alles vorrätig. Da Rich den Laden von seinem Vater übernahm und früh hinter die Kulissen blicken durfte, lernte er die Abläufe schon als Kind kennen. Bestellen, vorbereiten, packen und einräumen, alles kein Problem für ihn. Im Organisieren der Produkte war er so gut aufgestellt, dass die Regale nie leer blieben. Niemand der Einwohner musste ewig weit durch die Steppe fahren, um für den täglichen Bedarf ausgesorgt zu haben. Rich bezeichnete sein Geschäft selbst als kleinen Wunderladen, weshalb er ihm auch einen treffenden Namen verpasste: Wundertüte. Dementsprechend gut lief der Shop auch, da er von vielen Einwohnern als einzige Möglichkeit gesehen wurde, einkaufen zu gehen und sich zu versorgen. Daher wurde die Wundertüte jeden Tag von Bürgern des Dorfes besucht, die dort ein paar Kleinigkeiten einkauften und sich gerne mit Richard unterhielten. Denn durch seine gesellige Art zog er noch mehr Menschen aus dem Umkreis an.
Da in dem kleinen Örtchen, wo sich gerade einmal 700 Einwohner angesiedelt hatten, nicht viel los war, gab es selten neue Sachen zu berichten. Schließlich geschahen hier wenig nervenaufreibende Dinge. Und wenn dem doch mal so war, dann war der Trubel umso größer. Ungeachtet dessen plauderten Paul und Richard gerne ausgelassen und erzählten sich alles, was in ihrem Leben so passierte. Dabei war es ganz egal, ob es traurige oder lustige, spannende oder lapidare Themen betraf.
Doch Rich war nicht die einzige Person in Pauls Leben, die alles über ihn wusste, ihn in- und auswendig kannte. Da war noch Mary, seine geliebte Ehefrau. Paul und Mary kannten sich bereits aus der Vorschule, waren im Kindergarten in derselben Gruppe. Dann verloren sich die zwei zwischenzeitlich jedoch aus den Augen. Auf einer Party von Richard und Mia, Richs Freundin, trafen sie sich wieder und verliebten sich prompt ineinander. Es war Liebe auf den zweiten Blick. Die Teenager-Liebelei wuchs über sich hinaus und sollte ewig halten. Kein Wunder also, dass Paul, Mary, Rich und Mia eine besondere Freundschaft verband. Die vier waren unzertrennlich und liebten es, immer wieder spannende Abenteuer miteinander zu erleben. Ausflüge und Reisen waren nur ein Teil davon, was sie regelmäßig zusammen unternahmen und dabei jede Menge Spaß hatten.
Mary und Paul führten eine glückliche, liebevolle Ehe. Obwohl die beiden erst 27 Jahre alt waren, zeichnete sich die Verbindung durch ein starkes, unzertrennliches Band aus. Sie lachten und weinten zusammen, gingen durch dick und dünn, sprachen über alles und hatten keinerlei Geheimnisse voreinander. Es war nach außen hin eine perfekte Ehe, eine Liebesbeziehung wie aus dem Bilderbuch, die schöner hätte nicht sein können. Wenn da nicht dieser eine dunkle Fleck in dem Bilderbuch gewesen wäre, der immer größer zu werden drohte. Mary war krank. Aber nicht körperlich. Penetrant psychische Probleme waren es, die sie plagten. Jedoch waren es nicht nur oberflächliche Dinge, die Mary das Nervenkostüm buchstäblich zersägten. Die Probleme waren tiefgreifend, belastend und bedrohlich. Ihre Misere begann schleichend und wurde mit der Zeit immer schlimmer und schlimmer. Das Ganze verkörperte ein undurchdringliches Labyrinth, in dem sich Mary und Paul Tag für Tag mehr verrannten und geradezu wahnsinnig wurden. Einen Ausweg aus diesem komplexen Wirrwarr zu finden, das wurde ohne Frage zunehmend unwahrscheinlicher und schwieriger, gar unmöglich. Die Irrwege und Abzweigungen drohten, sie gänzlich zu verschlingen. Und nie wieder loszulassen. Für Mary war der Fall klar. Ihrer Meinung nach musste es mit ihrem Job zu tun haben. Sie arbeitete im Büro eines ortsansässigen, mittelständischen Industrieunternehmens, das sich mit dem Vertrieb von Klimaanlagen und Kühllösungen für private Haushalte beschäftigte. In der heißen Wüste war das ein durchaus lukratives Geschäft, das kräftig florierte. Es lief gut und eigentlich liebte Mary ihren Job als Disponentin über alles, arbeitete gerne dort. Mit ihrer kreativen und zugleich ordnungsbewussten Ader war sie wie geschaffen dafür. Sie fand immer neue Wege, Kunden zu akquirieren und interne Organisationsstrukturen zu optimieren. Mary war darin ein echtes Naturtalent, besaß aber auch den nötigen Fleiß, um sich selbst immer zu verbessern und weiterzuentwickeln. Trotz der guten Voraussetzungen gab es ein massives Problem: Sie stand zu jeder Zeit unter dauerhaftem, heftigem Leistungsdruck. Ein nicht zu unterschätzender Stressfaktor. Sie musste ein hohes Maß an Leistung bringen, eine Mindestanzahl an Optimierungen dokumentieren. Tag für Tag. Ihr Boss, ein missgünstiger, miesepetriger Opportunist, machte ihr das Leben zur Hölle auf Erden. Er war ein richtiger Kotzbrocken. Ein Blender, wie er im Buche stand. Mary war sein persönlicher Fußabtreter und das Mädchen für alles. Ja, man könnte sagen, sie war seine Leibeigene. Da sie jedoch eine friedliebende Persönlichkeit war, fiel es ihr schwer, sich zu wehren. Daher fraß sie viele Dinge in sich hinein, wollte doch eigentlich nur das Beste für jeden um sich herum. Mary war ein klassischer Ja-Sager, Everybody’s Darling, ein Mensch, der niemandem einen Gefallen ausschlagen konnte und auch nicht wollte. Doch diese Eigenschaft war genau das, was sie so belastete, was sie krank werden ließ. Sie sorgte für jeden um sich herum, jedoch nicht für sich selbst und geriet daher selbst ins Hintertreffen. Immerzu stellte sie ihre Gesundheit hinten an. Eine grob fatale Entscheidung. Noch dazu war es ebendiese Charaktereigenschaft, die ihr Chef gnadenlos und ohne Rücksicht auf Verluste ausnutzte. Der Psychoterror verfolgte sie nach Hause und bedrückte sie schwer. Sie konnte nicht abschalten, war oft in Gedanken versunken. Der Ballast war erdrückend für Mary. Mit der Zeit entstand eine massive Blockade in ihrem Kopf. Natürlich hatte auch ihr eigener Umgang mit den Problemen Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Das äußerte sich unter anderem in depressiven Verstimmungen, aber vor allem und ganz besonders in schweren Albträumen und damit verbundenen Schlafparalysen. Ihr Unterbewusstsein ließ sie nicht in Ruhe und bildete wilde Fantasien und bedrohliche Szenarien aus, die sie jagten, heimsuchten und nicht mehr losließen. Sie rissen Mary noch tiefer in das undurchdringliche Labyrinth aus Verzweiflung, Angst und Horror.
Besonders schlimm für sie waren die Schlafparalysen. Es war ein Zustand zwischen Schlaf und Wachsein. Dabei geschahen grausame, unerträgliche Dinge, während sie bei völligem Bewusstsein war. Allerdings konnte sie sich dabei nicht einmal bewegen. Es war für sie, als wäre sie in einem viel zu realen Horrorfilm gefangen, festgekettet, geknebelt und konnte rein gar nichts dagegen unternehmen. Mary war wach genug, um den Horror direkt zu spüren und zu schläfrig, um sich zu wehren. Eine ernsthafte Katastrophe. Gefangen im eigenen Körper. Keine Rettung in Sicht. Ihre Psyche spielte ihr horrende Streiche, denen sie mit keiner Faser ihres Körpers entrinnen konnte.
Das Tückische an den Paralysen war, dass sie unregelmäßig auftraten. Sie zehrten immens an Marys Nerven. Es war alles so echt, so greifbar nahe in diesen Szenarien, so spürbar, dass Mary oftmals krampfte und kreischend vor Panik wach wurde. Die Unregelmäßigkeit setzte ihr ganz besonders zu, da sie nie wusste, wann die nächste Paralyse eintreten würde. Diese Ungewissheit ließ sie geradezu wahnsinnig werden. Es hätte jederzeit nachts passieren können, dass sie wieder solch grausame Horrorszenarien heimsuchten. Dadurch wurde Mary paranoid. Bisweilen war es unmöglich für sie, einen Ausweg zu finden, der sie aus der Misere herausführte. Ein vernichtendes Urteil. Es war hart für Mary dranzubleiben, die Hoffnung nicht gänzlich wegzuwerfen.
Ihr Mann Paul tat alles in seiner Macht Stehende, um seiner Frau weiterzuhelfen und sie aus dieser misslichen Lage zu befreien. Rich und Mia standen ihren besten Freunden natürlich auch zur Seite. »Egal, was kommt, wir stehen das zusammen durch! Bisher haben wir doch noch alles gemeinsam geschafft!« Diese Phrase prägte die Freundschaft der Gruppe seit jeher. Doch ganz so einfach war das in dieser Situation eben nicht. Eine Eskalation der ganzen Lage war fast schon so sicher wie der Umstand, dass Paul in seiner nächsten Mittagspause Richs Laden wieder besuchen würde.
Kapitel 1
Paul war gerade der Nachtschicht zugeteilt und befand sich auf Streife. Er fuhr gedankenversunken durch die sternenklare Nacht und bewunderte die stille Schönheit der kalten Wüste bei Dunkelheit. Abertausende helle Lichter erstrahlten am Himmel und verleiteten Paul zum Träumen. Seine dunkelbraunen Augen spiegelten das Funkeln der Sterne wider. Gerade noch wollte er nach seinem dampfend heißen Kaffee greifen, der in seinem gräulichen Thermobecher in der Mittelkonsole stand, als er plötzlich aus seiner Träumerei gerissen wurde. Sein Einsatzleiter Frank meldete sich hektisch aus der Zentrale per Funkgerät und gab einen Autounfall durch: »Wagen 4, Paul, bitte kommen, Wagen 4, Paul, bitte kommen!«, wiederholte Frank aufgeregt die Durchsage. Paul griff, als er sich kurz zuvor mit dem heißen Kaffee aus seinem Becher die Hand verbrühte, rasch zum Funkgerät. »Wagen 4 einsatzbereit, was gibt’s?«, erwiderte er energisch.
»Unfall auf der Griffinstraße nahe der Tankstelle, bitte schnellstmöglich hinfahren! Personenschaden ungewiss«, krächzte es aus dem Funkgerät.
»Bin schon unterwegs!«, funkte Paul entschlossen zurück. Mit seiner von der Verbrühung geröteten Hand legte er schnell einen großen Klickschalter um. Dann raste er mit tosenden Sirenen und quietschend durchdrehenden Reifen zur Unfallstelle. Gut für ihn, dass kaum etwas los war auf den Straßen, weshalb er gut durchkam. Retter in der Not, das war sein Ding. Genau für solche Situationen war Paul Polizist geworden. Davon träumte er schon als kleines Kind. Schon früh war er stets hilfsbereit und unterstützte seine Freunde und Familie, wo er nun konnte. Bei dem aktuellen Unfall kam ein Auto von der Straße ab und knallte gegen ein großes Werbeschild, das daraufhin aus den Ankern gerissen wurde und zersplitterte. Die Front des Autos war eingedrückt, Rauch trat aus dem Motorraum aus und ein riesiger, dunkler Ölfleck sammelte sich auf dem Sand. Teile des Metalls der demolierten Motorhaube lagen auf der Fahrbahn umher. Eine gefährliche Situation, die, wenn im späteren Verlauf die Tagessonne knallte, zum Brand führen und weitaus mehr Schaden anrichten könnte. Als Paul an der Unfallstelle ankam, war die Feuerwehr bereits da und kümmerte sich um die Beseitigung des ausgelaufenen Öls, die Bergung von auf der Straße gelandeten Autoteilen und Werbeschildresten. Wildes Treiben und Durcheinander herrschten vor Ort. Einsatzkräfte irrten umher. Die rotblauen Sirenen von Polizei und Feuerwehr erhellten das Dunkel der Nacht. Paul sah sich um, erblickte direkt den Fahrer, dem glücklicherweise nichts Schlimmes passiert war. Der Bruchpilot war alleine im Auto unterwegs gewesen. Nur ein paar Schrammen hatte er erlitten, nichts weiter Tragisches.
Gut, schon einmal kein Personenschaden, dachte Paul sich erleichtert und ging schnellen Schrittes auf den Fahrer zu. Seine schwarzen Schuhe klackten auf dem nachtkalten Asphalt. Der Unfallfahrer lief nur wie ferngesteuert auf und ab, fasste sich mit beiden Händen ständig ungläubig an den Kopf, als hätte er Schmerzen. Dabei wiederholte immer wieder dieselben Worte. Selbst als Paul schon vor ihm stand, hörte er nicht auf, redete weiter wie von Sinnen vor sich hin.
»Der Idiot hat mich überholt, einfach geschnitten und mich in den Graben gedrängt! So ein blöder Vollidiot! So ein Idiot! Und dann haut der einfach ab, ich fasse es nicht, ich fasse es einfach nicht!«, polterte der aufgewühlte, sichtlich erregte Fahrer an der Unfallstelle.
»Hallo, beruhigen Sie sich bitte. Mein Name ist Officer Keller, wie ist ihr Name? Woran können Sie sich erinnern? Wie sah das andere Auto aus, haben Sie das Kennzeichen noch im Kopf? Welche Automarke fuhr der Unfallgegner?«, fragte Paul den Autofahrer akribisch Schritt für Schritt und schrieb alle brauchbaren Eckdaten in seinem Notizbuch auf, um den Unfallflüchtigen zu verfolgen und vor Gericht zu zerren. Paul wollte unbedingt in allen Fällen der Gerechtigkeit Rechnung tragen. Das sah er als seinen Auftrag an sich selbst. Dabei wollte er nie irgendetwas unversucht lassen und seine Erfolgsquoten gaben ihm recht.
Es war ein standardmäßiger Einsatz in einer klirrend kalten Nacht, den Paul in seinem Revier verfolgte, nichts Besonderes. Auch wenn Autounfälle in den Weiten der Wüste hier nicht unbedingt an der Tagesordnung lagen, so wusste er dennoch mit seiner besonnenen Art und seiner Routine, die Autofahrer zu besänftigen und mit ihnen umzugehen. Er regelte solche Fälle mit einer Ruhe und Gelassenheit, die ihresgleichen suchte. Mithilfe seiner akribischen Ader löste er nahezu alle Fälle, die ihm aufgetragen wurden. Der Job des Polizisten war ihm wie auf den Leib geschneidert und er ging voll darin auf. Nicht umsonst war er einer von Franks besten Leuten in der gesamten Inspektion.
Zurück im Büro erfasste Paul alle Daten im gesicherten System des Computers. Eine klar definierte Dokumentation und Berichterstattung der Fälle waren Paul immens wichtig. Dabei war er immer sehr genau, wollte keinerlei Fehler zulassen, damit er selbst oder einer seiner Partner alle Details eines Falls zu einem späteren Zeitpunkt lückenlos nachvollziehen konnte.
»Nicht gerade schlau, in einem solch kleinen Dorf Fahrerflucht zu begehen. Ist ja nicht so, als gäbe es hier tausende Autos. Ich schicke einfach eine kurze Halterabfrage wegen des Kennzeichens ab und schon hab’ ich den blöden Übeltäter!«, freute sich Paul schelmisch und begann schon zu tippen.
So, jetzt noch d-, seine präzisen Gedankengänge wurden von seinem schrill bimmelnden Handy unterbrochen. Es war 4:04 Uhr in der Nacht und Paul wusste direkt, was los war. Betroffen strich er über seine raspelkurzen, aschblonden Haare. »Oh nein, nicht schon wieder…«, seufzte er ernüchtert und mit einer Hand vor seinem Gesicht vor sich hin. Seine Frau Mary rief ihn entgeistert und panisch an: »Sch… Schatz!«, zischte sie fast schon asthmatisch ins Handy. »Da… da war-«
»Ganz ruhig!«, unterbrach Paul seine Frau energisch. »Alles ist gut, es ist alles gut! Du hast nur geträumt, es war nicht real, es war nicht real! Beruhige dich, ich bin da, ich bin da!«, wiederholte er sanft, aber bestimmt seine Ansagen, denn er kannte diese Situation nur zu gut und wusste, was zu tun war. »Ich bleibe noch etwas am Telefon, rede mit mir, schnapp dir Milow, ich muss sowieso gerade noch ein paar Dinge im Büro erledigen, ich bin für dich da!«, sprach er beruhigend auf seine Frau ein.
»D… danke«, stotterte Mary langsam und hörbar entkräftet in das Handy.
»Erzähl mir, was passiert ist. Ich höre dir zu!«, sicherte Paul seiner Frau liebevoll zu. Er wusste, dass das Reden über die bösen Träume es leichter für Mary machen würde. Alles einfach totzuschweigen, kein Wort darüber zu verlieren und die Ängste in sich hineinzufressen, das war alles, aber keine Option.
»Es… es war einfach nur schlimm und beängstigend. I- ich weiß gar nicht, wie ich das… wie ich das beschreiben soll. Da… da war so ein, ein Gefühl, als würde etwas an meinen Beinen nagen, mit fürchterlich spitzen und rasiermesserscharfen Zähnen! Und… und dann platzte da so ein ohrenbetäubendes Quietschen aus der Stille, wie bei einer verstimmten Geige. Das wurde immer lauter, schriller und kam immer näher. Aber alles war so dunkel! Der Schmerz wurde immer intensiver. Es tat so unglaublich weh, ich wollte schreien vor Schmerz, mir die Ohren zuhalten, mich wehren, aber… aber ich konnte einfach nicht…«, flüsterte Mary aufgelöst unter Tränen ins Telefon.
»Und dann, was ist dann passiert?« wollte Paul bemitleidend wissen.
Mit zittriger und weinerlicher Stimme fuhr Mary fort: »Ich… ich konnte mich nicht bewegen, weder meinen Kopf noch meine Beine und habe aber auch rein gar nichts gesehen. Alles war dunkel. So grausam dunkel. Ich konnte nur wie erstarrt im Bett liegen und versuchen, es zu ertragen. Das Ganze ging so lange, bis ich endlich wach werden konnte. Es war, als wäre… als wäre ich gelähmt«, gab Mary resigniert zu und endete ihre Erzählung mit einem tiefen Schluchzer.
»Schatz, es wird alles gut, meine Schicht ist bald zu Ende, ich bin bald bei dir! Halte durch!«, versprach Paul ihr. »Bis dahin, lenk’ dich etwas ab, schau deine Lieblingsserie, mach die Lichter an. Trink einen warmen Tee, das wird dir helfen und guttun! Und vor allem, ruf’ Milow zu dir. Kuschel mit ihm, das wird dich runterbringen, versprochen!«
»Ich werde es versuchen«, seufzte Mary.
Milow war der siebenjährige Golden Retriever des Paares, ein echter Familienhund, wie er im Buche stand. Er spürte, wenn es Mary mal wieder nicht gut ging und suchte automatisch ihre Nähe, um sie zu besänftigen. Man könnte behaupten, dass er ein echter Therapiehund war, ohne jemals eine Ausbildung genossen zu haben. Milow war ein wirklicher Glücksfall für die beiden, denn wenn Paul gerade nicht zu Hause war und Schichtdienst hatte, so stand wenigstens Milow parat, der Marys psychische Abstürze mit seinem flauschigen Fell wenigstens etwas abfedern konnte.
Ein derartiger Anruf war – und das ist das Erschreckende daran - fast schon nichts Besonderes mehr für Paul. Die wiederkehrenden Albträume und gerade solche frappierenden, grauenhaften Schlafparalysen fühlten sich so real an, dass Mary in geradezu überwältigende Panikattacken verfiel und nur Paul ansatzweise fähig war, sie zu beruhigen. Seine Stimme bewirkte etwas in ihr, löste etwas in Mary aus, das sonst keiner konnte. Niemand sonst war in der Lage, Mary in diesen Phasen zu erreichen, zu ihr durchzudringen. Aber selbst Paul änderte leider nichts an der Tatsache, dass die Albträume einfach nicht aufhören wollten und immer wieder und wieder zurückkamen. Wie ein Bumerang waren sie, der Hindernisse problemlos durchbrach und immer wieder zu seinem Besitzer zurückkehrte. Ihn am Kopf traf. Hart am Kopf traf und ausknockte. Und dann wieder Schwung holte.
Die Lage war zum Verzweifeln. Paul wusste schon nicht mehr, was er noch zu Mary sagen sollte, was er noch tun sollte. Er hatte doch schon alles versucht. Seine Worte hatten fast keine Wirkung mehr. Die typischen Floskeln, dass alles gut werden würde, gingen ihm so leicht von den Lippen, fühlten sich doch so katastrophal falsch an. Aber aus reiner Verzweiflung heraus wiederholte er ebendiese Phrasen trotzdem mantraartig, nur um seiner Frau irgendwie etwas sagen zu können, während er überlegte, welche Möglichkeiten sie bisher nicht zusammen ausgeschöpft hatten. Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Nur war dieser Heuhaufen schier unendlich groß für die beiden. Und die Nadel doch so winzig klein. Paul zerbrach sich regelmäßig den Kopf, recherchierte im Internet und wälzte haufenweise Bücher. Und fand rein gar nichts, was hätte helfen können. So viele Dinge hatte er schon versucht und war damit so kläglich gescheitert, dass es ihm langsam, aber sicher die Fantasie zerschlug, wie er irgendwas finden sollte, das seiner Frau wirklich helfen würde. Er drohte genauso an der Situation zu zerbrechen, wie Mary es mittlerweile tat. Ihre Kraft, weiterzumachen und stark zu bleiben, schmolz vor sich hin wie ihre liebste Tafel Schokolade im heißen Sand der erbarmungslosen Wüste.
Dieser Traum, von dem Mary Paul berichtete, war seit langer Zeit wieder so schlimm, so niederschmetternd, dass Paul mit seinem Einsatzleiter Frank sprach, der von dessen Problem und den Umständen zu Hause wusste. Frank war für das Thema sensibilisiert. Frank dahingehend einzuweihen, war mit der Zeit unausweichlich geworden.
Paul wurde nächste Woche eigentlich für die Nachtschicht eingeteilt, wollte aber gerade nach einem solch traumatischen Erlebnis nachts unbedingt bei seiner Frau sein, um ihr wenigstens etwas Halt geben zu können. Koste es, was es wolle, dachte er sich. Also machte er sich auf dem Revier zerstreut, das Gedankenkarussell spinnend, auf den Weg zum Büro seines Chefs. Die alten, fleckigen Holzdielen auf dem Revier knarzten wehmütig. Zwischen den altertümlichen und schweren Wänden bewegte sich das qualvolle Knattern des Holzes im Raum und prallte immer wieder wie ein Gummiball von Seite zu Seite. Die in die Jahre gekommenen Glühbirnen flackerten behäbig. Paul führte das Gespräch mit Frank schon von A bis Z in seinem Kopf. Was könnte ich sagen, wenn…?, geisterte es durch sein Oberstübchen und er spann zig Gesprächsszenarien. Schließlich an der Tür seines Chefs angekommen, atmete er einmal tief durch, klopfte verlegen und zögerlich an der Holztür.
»Herein!«, schallte es mit einer kräftigen, sonoren Stimme aus dem vor ihm liegenden Büro. Paul öffnete vorsichtig die schwere, schleifende Tür. Es kam ihm vor, als würde er einen tonnenschweren, aus massivem Titan bestehenden Tresor öffnen, so schwerfiel es ihm. Nicht, weil er Mary nicht helfen wollte. Es war einfach eine diffuse Situation. Betroffen, mit gesenktem Haupt, trat Paul ein.
»Hey, Frank, hör mal«, er kratzte sich verlegen am Kopf, da es ihm unangenehm war, diese doch sehr privaten Themen auf der Arbeit anzusprechen. Dennoch musste er es tun, denn es führte kein Weg daran vorbei. Schließlich wollte er mit aller Macht für Mary da sein und sie unterstützen. Verzweifelt, aber nicht ohne Hoffnung, sah er Frank mit seinen walnussholzbraunen Augen an.
»Könnte ich vielleicht nächste Woche die Mittagsschicht haben, Frank? Mary geht es nicht gut und… du weißt ja…«
Frank verzog seine Mundwinkel und starrte Paul bohrend an. Er verstand Pauls Situation, konnte sich in seine Lage gut hineinversetzen. Nichtsdestotrotz war er immer noch sein Boss. Außerdem war das hier immer noch die Polizei und kein gewöhnlicher Bürojob. Es war eben alles etwas strenger. Ständig währende Ausnahmen und Schichtschiebereien schlicht und ergreifend nicht möglich und auch nicht gerne gesehen. Genau deshalb konnte er Pauls Anliegen nicht immer Aufmerksamkeit schenken und seine Schichten so anpassen, wie Paul das gerne gehabt hätte und es ihm gerade in seinen Kram passte.
Frank blickte ihn weiterhin einen kurzen Moment lang nachdenklich und ohne weitere mimische Regung an. Dann lehnte er sich auf dem Stuhl zurück, verschränkte die Arme und stützte seinen Kopf auf seiner rechten Faust ab. Schließlich, nachdem Franks Schweigen für Paul wie eine halbe Ewigkeit wirkte, erwiderte er wohlwollend: »In Ordnung, ich werde mich darum kümmern. Aber seht endlich zu, dass ihr das Problem final in den Griff bekommt! Ich kann nicht immer alles deiner Nase nach planen, hörst du?«
Paul fiel ein kleiner Stein vom Herzen, als er etwas erleichtert seinem Chef entgegnete: »Danke, Frank, ja, das machen wir! Danke, versprochen! Du hast etwas gut bei mir!«
Zumindest die nächste Woche nach dieser doch außergewöhnlich schlimmen Nacht konnte Paul bei seiner Frau sein und ihr etwas Halt geben. Das war immerhin ein kleiner Lichtblick in dieser doch sehr dunklen Zeit.
Die Suche nach einer Lösung für Marys Krankheit war eine regelrechte Odyssee. Sie und Paul besuchten bisher sämtliche Ärzte in der weiteren Umgebung. Egal, ob Hausarzt, Internist oder Psychologe, Neurologe oder Radiologe. Niemand von den Fachärzten war auch nur ansatzweise imstande, Mary zu helfen, sie von diesen schrecklichen Hirngespinsten zu erlösen. Jedweder Lösungsansatz wurde von den Albträumen im Keim erstickt. Die zarten Hoffnungspflänzchen wurden mit den übermächtigen Stiefeln der Paralysen zerstampft und auf dem harten Boden der Realität zermalmt. Allen Ärzten erklärte sie hilflos, was geschah, was in ihrem Kopf vorging. Welche regelrechten Traumata sie verfolgten und nicht mehr losließen. Es standen unzählige Gesprächstherapien, Hirnscans, Rehabilitationsmaßnahmen und exotische, neuartige Behandlungsmethoden an. Mary nahm an Studien teil, machte ausnahmslos alles mit, wirklich alles, ließ jede Anwendung über sich ergehen. Aber nichts schien zu wirken. Nichts half ihr. Niemand half ihr. Die Lage war aussichtslos. Ihre Hoffnung war wie ein Mandala. Ein zerrissenes, fast verbranntes Mandala, das durch einen Häcksler gezogen wurde. In unerkenntlichen Fetzen lag es zerstreut auf dem Boden, ohne jede Hoffnung darauf, dass es einmal mehr so schön und so bunt sein würde wie früher.
Kapitel 2
Mary war eigentlich eine Frau, die immer arbeiten wollte, ganz egal, wie schlecht es ihr ging. Sie gab sich immer widerspenstig und kapitulierte nicht vor der Krankheit, ließ nicht nach außen dringen, wie es ihr eigentlich erging. Selbst ihre liebsten Arbeitskollegen ließ sie es nie erfahren. Wie ein Clown mit einer fröhlichen Maske vor der mit tiefen Rissen gezeichneten Oberfläche überspielte sie ihren Zustand immer und immer wieder, bis zu dem Tag, der eine neue Richtung für sie vorgeben sollte.
Zwei Wochen waren nun seit der schlimmen Paralyse vergangen und Paul stand wieder regelmäßig auf dem Plan der Nachtschicht. Leider war er einer der besten Männer, die Frank auf dem Revier hatte und diese mussten nun einmal meistens nachts arbeiten, da die Härtefälle dann doch wahrscheinlicher auftraten als am helllichten Tag. Was Paul aufgrund dessen nicht wusste: Diesen Morgen war Mary nicht zur Arbeit erschienen.
Seine Schicht zog sich etwas länger, da er einige bürokratische Dinge zu klären und zu erledigen hatte. Ihn erreichte in seinem Büro ein Anruf von Marys Arbeitskollegin Josie, die sich nach ihr erkundigte: »Hey, Paul, Josie hier. Was ist denn mit Mary los? Ist sie krank? Sie ist heute Morgen nicht ins Büro gekommen und hat sich aber auch nicht krankgemeldet. Weißt du etwas?« Paul schluckte schwer. Er wurde nervös. »Ähm, nein, nicht wirklich. Sie hat mir nichts gesagt. Ich bin gerade selbst noch auf der Arbeit. Ich werde schnell nach ihr schauen und melde mich dann wieder! Dauert nicht lange, bin schon auf dem Weg!«
»Alles klar, dank-«
Paul würgte Josie am Apparat ab und steckte schnell sein Handy in die Hosentasche. Ohne weiter nachzudenken, raste er direkt nach Hause, um nach Mary zu sehen. Es war äußerst ungewöhnlich, genauer gesagt, war es noch nie vorgekommen, dass Mary sich nicht bei ihm meldete, wenn sie nicht arbeiten ging. Irgendetwas musste gewaltig schiefgelaufen sein.
Was ist bloß geschehen?
Als Paul zu Hause ankam, stand das Auto seiner Frau in dem neben dem fliederfarbenen Haus befindlichen Carport aus Holz. Er wusste, dass es seiner Frau nicht nur schlecht, sondern geradezu elend gehen musste. Paul spürte es. »Da stimmt was nicht, Mist! Ihr wird doch nichts zugestoßen sein…«, schwante Paul Böses, während er in Richtung des eigenen Hauses fuhr und sich nervös an seinem Dreitagebart kratzte. Da er schon die ganze Fahrt lang in Gedanken kratzte, war die Haut am Kinn schon wundgescheuert, was er in seiner Aufregung nicht bemerkte. In Eile stellte er seinen Dienstwagen ab, schlug die Autotür auf, knallte sie hart hinter sich zu. Hektisch rannte er in Richtung Haustür und riss die Eingangstür des Hauses beim Öffnen fast aus den Angeln. Ihm stieg ein verschmorter und stechender Geruch in die Nase. O Gott, dachte er sich.
In einem Bruchteil einer Sekunde wurde Paul panisch. »Schatz?«, brüllte er fieberhaft durch das Haus. Seine Augen flogen ohne zu stoppen durch den Flur, suchend nach einem Zeichen seiner Frau. Mit angsterfüllter Miene rief er: »Wo bist du, ist alles in Ordnung, wo bist du? HALLO?!« Plötzlich nahm er ein Zischen aus der Küche wahr. Losgelöst rannte er stürmisch durch den mit Holzoptik gefliesten Flur. Seine hechelnden, gehetzten Laute hallten im Flur wider. Vorbei ging es am Wohnzimmer über das klackernde Parkett in Richtung des zischenden Geräuschs. Der Geruch wurde schlimmer, aggressiver.
Was ist hier los, verdammt?
Als er in der Küche ankam, verschlug es ihm sofort die Sprache. Sein Hals wurde trocken. So trocken, dass kein Tröpfchen Spucke mehr da war. Kopflos schaute er umher, seine Blicke überschlugen sich. Links von ihm lief die Kaffeemaschine über und die schwarze Brühe verbrannte auf der heißen Wärmeplatte. Es hatten sich bereits pechschwarze Flecken eingebrannt. Auf der Herdplatte nebenan schmolz eine Plastikdose. Die klebrige, mittlerweile matschbraune Masse blubberte wild auf dem Ceranfeld, während ein qualvoll ätzender Geruch den Raum erfüllte. Die scheußlich riechenden Chemikalien darin waren förmlich zu schmecken und legten sich ätzend auf seine Schleimhäute. Reflexartig zog Paul seine dicke Jacke über die Nase, um dem beißenden, künstlichen Gestank zu entkommen. Er rannte wie ferngesteuert zur Herdplatte, schaltete sie schnell aus, riss den Stecker von der Kaffeemaschine aus der Steckdose heraus und hievte die Fenster auf. Schnell packte Paul den Wasserkocher. Ohne zu zögern füllte er ihn randvoll und goss alles über die blähende Masse auf dem Herd. Heißer, giftiger Dampf schoss ihm ins Gesicht, als würde er am Rande eines dampfenden Vulkans stehen. Seine Augen begannen sofort höllisch zu brennen. Tränen schossen ihm aus den Lidern. Das geschah alles innerhalb weniger Sekunden.
Doch wo war Mary? Was zur Hölle war hier geschehen?
Sollte hier eingebrochen worden sein?
Meine arme Mary, wo bist du nur?
Dann fand er endlich seine Frau. In der hintersten Ecke der Küche. »Horror« - Das war die perfekte Beschreibung.
Was um alles in der Welt…
Paul fror auf der Stelle fest. Eiskalt lief es ihm den Rücken hinunter, als hätte er ein Gespenst und nicht seine Frau gesehen. Seine rasende Hektik schlug innerhalb von ein paar Wimpernschlägen in eine leichengleiche Starrheit um. Gänsehaut befiel seinen gesamten Körper. Mary saß mit angewinkelten Beinen verstört wippend auf den kalten, hellgrauen Fliesen. Um sie herum lagen Scherben mehrerer Porzellantassen verteilt. Sie umschloss ihre Beine so gequält, dass Paul die Adern auf den Armen verkrampfen sah. Die blauen Stränge sprengten fast Marys Hautoberfläche. Ihre stahlblauen Augen waren blutunterlaufen, aufgequollen. Die Tränensäcke dick und dunkelblau, unbarmherzig aufgeschwemmt. Ihr aufgerissener, besessener Blick war steif, trüb und leer. Das Weiße in ihren Augen wurde von aggressiv roten, narbenartigen Fasern durchzogen. Sie starrte die kahle Wand an. Mary presste gequält eine leise zischende, hastige Atmung zwischen ihren aufeinander knirschenden Zähnen heraus. Ihre schmalen Lippen zitterten dabei, als hätte das Grauen sie mit seinen kalten Fängen gepackt und ließe sie nicht mehr los.
Plötzlich stoppte sie. Es herrschte Stille. Eine gespenstige Stille. Das Zischen des Kaffees auf der Heizplatte erlosch. Die dampfende Masse auf dem Herd erkaltete. Marys Gesicht war so blass wie ein weißes, sonnengebleichtes Bettlaken, das wochenlang der prallen Hitze der herzlosen Wüste ausgesetzt war. Blutleer und den Schrecken ins Gesicht tätowiert, saß sie da. Ihr langes, engelblondes Haar war zerzaust und kraus. Die Fingernägel, die sich schmerzlich in ihre Hautoberfläche an den Waden drängten, waren brüchig und matt. Getrocknete, krustige Blutreste säumten die brüchigen Reste, die noch an den Fingern hingen. Paul war fassungslos, starr vor Hilflosigkeit und Angst. Er konnte sein Entsetzen nicht in Worte fassen. Nicht einmal einen klaren Gedanken konnte er formulieren. Das war für ihn der bisherige Tiefpunkt von Marys Krankheit. Er stand völlig neben sich, wusste gar nicht, was er tun sollte. Zum Teufel nochmal, was war hier passiert?
Was hast du nur durchgemacht, mein Schatz?
Er brauchte einen Moment, um sich zu sammeln und bis er die ersten Worte fand: »Sch… Schatz? Was… was ist passiert? Erzähl mir, was los ist!«, stotterte er unsicher und leise vor sich hin. Niedergeschlagen faltete er seine Hände vor seiner Nase und dem Mund. Keine Reaktion. Nervös musterte er seine Frau. Wartete auf ein Lebenszeichen. Marys festgefrorenes Starren veränderte sich nicht. Keinerlei Regung war zu sehen. Ihr Gesichtsausdruck war wie in Stein gemeißelt. Ihr starrer Blick klebte weiter an einem fixen Fleck an der weißen Wand. Sie wippte langsam vor und zurück. Wie ein roboterartiges Schaukelpferd. Hin und her. Hin und her. »Mary! Bitte sprich mit mir! Sag etwas!« Pauls Stimme wurde energischer, lauter. Immer noch keine Regung. Verzweiflung machte sich in Paul breit. Verkrampft kratzte er sich an seinem stoppeligen Bart, unter dem die Haut mittlerweile blutig aufgekratzt war. Doch die Schmerzen, die seine harten Nägel auf dem rohen Fleisch erzeugten, spürte er vor Schock nicht mehr. Langsam ging er auf seine Frau zu. Schritt für Schritt, so als wollte er nicht, dass sie es bemerkt. In Zeitlupe setzte er sich zu ihr auf den kalten Boden, mit etwas Abstand, um sie nicht noch mehr zu erschrecken. Was für ein niederschmetternder Anblick. Hätte er seine Gefühlslage in ein Wort fassen müssen, so hätte es der Begriff »Armageddon« ziemlich treffend beschrieben.
Auf einmal merkte er, wie Marys Atmung etwas langsamer wurde. Das kurzatmige Zischen glitt in ein schwermütiges Schnaufen über. Marys Brustkorb bebte wie nach einem Marathonlauf. Vorsichtig und fast schon ängstlich hob Paul seine kräftige Hand und strich ihr behutsam durch das krause Haar. Zart hob er eine Strähne nach der anderen hinter Marys eiskalte, rundliche Ohren, die bläulich angelaufen waren. Ein heftiges Zucken fuhr durch ihren Körper, als sie Pauls Hand an sich spürte. Sie krampfte zusammen, als hätte man ihr unerwartet einen Packen Eis in den Pullover geschüttet. Sie wirkte dennoch weiter geistesabwesend, traumverloren. Pauls Herz schlug ihm bis zum Hals. Er erstarrte für eine Sekunde, nahm seine Hand zurück, ehe er wieder fortfuhr, sie sanft zu streicheln.
Mary, was ist nur geschehen?
Seine Frau war wie in Trance und hatte Paul mit keiner Faser ihres Körpers bemerkt. Zumindest nicht wissentlich. Das Zucken stellte lediglich eine unterbewusste Reaktion dar, einen Reflex. Doch plötzlich stoppte ihr Wippen. Sie wurde starr. Pauls Bewegungen wurden langsamer, sanfter. Er wich etwas zurück, beobachtete jede Bewegung. Mühsam und angestrengt drehte Mary ihren Kopf in Richtung Paul, der innehielt. Marys in Horror getauchter Blick veränderte sich, als sie Paul registrierte. Die aufgerissenen Augen verzogen sich und glitten in schiere Trauer und losgelöste Verzweiflung über. Paul nahm seine Frau vorsichtig in den Arm. Sie senkte ihren Kopf ganz langsam, legte ihn kraftlos auf der starken Schulter ihres Mannes ab und fing plötzlich an, hemmungslos loszubrüllen, gar zu kreischen. Es war, als wäre ein großer Damm gebrochen. Die Tränen strömten in Flutwellen aus ihr heraus. Sie begann zu schluchzen und um Luft zu ringen.
Paul war einerseits erleichtert, dass sie eine Reaktion zeigte, andererseits aber auch schwer getroffen, wegen des besorgniserregenden Zustands seiner Frau. Er wusste, dass Worte hier nicht weiterhelfen würden, dazu war die Situation zu extrem. Als er Marys Kopf sanft an sich drückte, er ihre warmen Tränenströme auf seiner Brust herunterlaufen und sein Hemd durchnässen spürte, übermannte es ihn und auch er konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Ihm war bewusst, dass er jetzt einfach für sie da sein und ihr Halt geben musste. Hohle Phrasen und inhaltloses Geschwätz waren hier und jetzt einfach fehl am Platz. Es brach ihm das Herz, seine geliebte Ehefrau so gebrochen zu sehen, schlicht und ergreifend machtlos zu sein, nichts dagegen unternehmen zu können. Paul fühlte sich, als wäre er mit einem brachialen Vorschlaghammer ohnmächtig geschlagen worden. Als hätte ihm jemand sämtliche Energie geraubt. Seinen Lebenswillen abgesogen. Es war eine katastrophale Situation. Die beiden verharrten.
Nach einer Weile in dieser Position beruhigte sich Mary etwas. Ihre Tränenfluten ebbten ab. Sie rang immer noch um ihre Fassung, als Paul ihr tief in die Augen sah und mitgenommen schluchzte: »Mary, wir müssen Hilfe suchen, es kann so nicht weitergehen!«
Mary wimmerte und entgegnete ihm: »Ich… ich weiß, aber… aber ich hab’ doch schon alles versucht! Wir haben alles Menschenmögliche getan! Es gibt nichts mehr!«
Paul überlegte kurz. Er drückte sie näher an sich heran: »Vielleicht gibt es noch Methoden, die du nicht kennst oder versucht hast. Ich werde mich umhören, wir werden das gemeinsam schaffen! Ich gebe niemals auf und das wirst du auch nicht, hörst du?« Darauf sah Mary ihrem Mann tief in die Augen, ließ einen angestrengten Seufzer voller Verzweiflung heraus und schmiegte sich langsam an seine Brust. Sie saßen noch eine ganze Weile so da.
Kapitel 3
Am nächsten Tag suchte Paul das Internet auf und ab, redete mit seinen Kollegen bei der Polizei, sogar wieder mit seinem Boss Frank. Er suchte überall nach Möglichkeiten, Therapien und Optionen, die Mary und er noch nicht ausgeschöpft hatten. Es war nicht so, als hätten die beiden das nicht schon versucht, aber Paul wollte die Hoffnung einfach nicht aufgeben, dass er irgendetwas übersehen hatte.
Es gibt eine Lösung und ich werde sie finden!
Verbissen dachte er sich, dass es doch irgendetwas geben musste, irgendjemand da sein musste, der Mary helfen konnte. Paul wollte die Situation so nicht für sich akzeptieren. Das konnte er auch einfach nicht. Niemals wollte er Mary wieder derart vorfinden. Schauer fluteten seinen Rücken, wenn er nur daran dachte.
Vertraute Arbeitskollegen empfahlen ihm nur Ärzte, die sie schon aufgesucht hatten. Und aufgrund der Komplexität von Marys Zustand halfen normale Ärzte nicht weiter. Eine solche Krankheit war eben nicht gerade üblich.
Sollte es denn wirklich keinen Ausweg aus diesem gottverdammten Labyrinth geben? War Mary dazu verdammt, diese Qualen ihr gesamtes Leben lang zu ertragen? Nein, das war nicht Pauls Realität und das wollte er auch für Mary nicht. Niemals. Auf keinen Fall. Verzweifelt und niedergeschlagen fuhr Paul in seiner Mittagspause mal wieder zu Rich, dem er von der ganzen Misere und vor allem von Marys schlimmster Nacht überhaupt erzählte. Dort angekommen, setzten sich die beiden ins Hinterzimmer von Richards Laden, um in Ruhe zu quatschen. Das Zimmer, das mit halbgeleerten Kartons, alten Schwerlastregalen und einem in die Jahre gekommenen Schreibtisch ausgestattet war, durfte kaum größer als ein kleines Gäste-WC gewesen sein. Zwei alte Neonröhren, die nervös flackerten, beleuchteten den Raum spärlich. Ganz im Gegensatz zu dem attraktiv gestalteten Laden sah es hier alles andere als einladend aus. Richard nahm auf seinem alten Bürostuhl Platz, dessen Federung qualvoll krachte, als er sich auf die Sitzfläche fallen ließ. Das Olivgrün der Polsterung hatte schon seine besten Zeiten hinter sich und war an einigen Stellen aufgerissen. Paul sackte gegenüber auf einem verblassten, ledrigen Sessel in der hinteren Ecke der Kammer in sich zusammen. Das spröde, erschöpfte Leder war fast so farblos wie Pauls Gesicht.
»Rich, ich weiß wirklich nicht mehr weiter, so schlimm war es noch nie. Das war die Hölle auf Erden, ich sag’s dir. So etwas wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Ich meine, Mia hat dir sicherlich alles erzählt, Mary hat bestimmt schon mit ihr geredet. Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll, habe keine Ahnung. Ich bin komplett überfordert und völlig am Ende«, offenbarte Paul hilflos und gestikulierte dabei wild vor seinem Gesicht herum. »Was soll ich nur tun? Mary geht an der ganzen Sache zugrunde, es wird immer und immer schlimmer! Was ich da erlebt habe letzte Woche, so etwas will ich nie wieder in meinem ganzen Leben mitmachen, nie wieder! Das war an Grausamkeit nicht mehr zu überbieten!« Paul blickte Rich verzweifelt an. Dann vergrub er sein Gesicht in seinen Händen und schüttelte den Kopf unnachgiebig. Die kurze Stille, die nach Pauls Geständnis herrschte, wurde von dem borstigen Schaben seiner Hände auf seinem stoppeligen Bart unterbrochen.
Richard schaute ihn betroffen an und fuhr sich mit einem begleitenden Seufzer durch seine schulterlangen, honigblonden Haare. Einen Moment lang überlegte Rich und klopfte Paul dann auf die Schulter. Eindringlich redete er ihm ins Gewissen: »Ja, Mia hat mir alles erzählt. Echt einfach nur schlimm, was Mary da durchgemacht hat. Aber du weißt ja, wie ich zu der ganzen Sache stehe. Ihr habt schon so viel ausprobiert, aber eine Sache immer noch nicht! Es ist an der Zeit, auch mal neue Wege zu gehen, Paul! Ihr seid in einer ausweglosen Sackgasse gelandet und da geht es nicht weiter, so sehr ihr es auch versucht. Ihr lauft gegen eine unüberwindbare Mauer«, bearbeitete Richard Paul mit Nachdruck und ließ nicht locker. »Du hast recht, aber wenn alles andere nicht geholfen hat, warum dann ausgerechnet das?«, regte Paul skeptisch an und rümpfte dabei ungläubig seine abgerundete Nase.
Richard verzog seine grünlich, wie ein Smaragd schimmernden Augen und neigte seinen Kopf zu Paul: »Gerade deshalb, weil ihr doch schon immer und immer wieder alles versucht habt und es eben nichts gebracht hat. Gerade deshalb! Was habt ihr bitte noch zu verlieren? Versucht es doch wenigstens. Wenn es nicht funktioniert, dann kannst du immer noch weitersuchen! Ich meine, noch schlimmer kann es anscheinend ja nicht werden, oder? Das hast du doch selbst eben zu mir gesagt. Nochmal, was habt ihr noch zu verlieren? Kommt schon, verdammt!«, stellte Rich das Ganze mit fest entschlossenem Blick klar.
»Du hast ja recht, was soll schon noch schiefgehen? Aber ich weiß trotzdem nicht so recht...«, gab Paul resigniert zu.
Richard kniete sich vor seinen Kumpel in die Hocke, der immer noch in dem Sessel zusammengeknautscht kauerte und blickte ihm tief in die Augen, während er eine Hand auf dessen Schulter legte. »Paul, gebt euch einen Ruck, bitte. Ich kann euch so nicht mehr sehen!«
Wovon Richard hier sprach, waren alternative medizinische Methoden, die bisher für Paul und Mary nicht infrage kamen. Auch wenn Paul und Richard vieles gemeinsam hatten, so unterschieden sich die beiden bei gesundheitlichen Fragen doch grundlegend. Richard war der Meinung, dass pflanzliche Mittel und alternative Heilmethoden viel hilfreicher, gesünder und dazu noch effektiver waren als die normalen Tabletten und das Zeug, was man von allen Hausärzten oder den herkömmlichen Medizinern auf diversen Rezepten ausgestellt bekam. Homöopathische Mittel samt ihren Heilkräften, Kräuter und strahlkräftige Minerale überzeugten ihn vollends. Für Paul war das alles nur Schwachsinn, alles Placebo, was er ihm auch immer vorwitzig unter die Nase rieb, denn er sah das grundlegend anders. Daher setzte Paul sein Leben lang auf pharmazeutische Medikamente der Industrie, war der Meinung, dass alternative Methoden keineswegs helfen würden und etwas für Idioten seien. Beide fuhren mit ihren Strategien eigentlich ganz gut, zumindest für sich selbst. Das Problem für Paul und Mary war, dass in dieser Situation, in der sich die beiden befanden, eben nichts half, was von der Pharmaindustrie entwickelt und verkauft wurde. Es blieb also keine andere Möglichkeit als dem ganzen Humbug von Rich, so wie Paul es gerne bezeichnete, eine halbwegs faire Chance zu geben, auch wenn er sich dagegen sträubte.
Nach intensiver Überzeugungsarbeit bekehrte Richard Paul dann dazu, es endlich mit den alternativen Methoden zu versuchen: »Komm schon, ich kann euch so nicht leiden sehen, ihr geht beide kaputt an der Sache, ich will euch noch länger bei mir haben! Mia und ich, wir beide brauchen euch doch! Hört doch endlich mal auf uns, lasst euch helfen!«, beschwor Richard mit einem leichten, wenn auch schmerzlichen Schmunzeln auf den Lippen Paul.
Dieser raffte sich aus seinem Ledersessel, in dem er elendig zusammengesackt war, auf und atmete tief ein. »In Ordnung, ich werde mal mit Mary sprechen, im Prinzip hast du ja recht«, seufzte er mit einem gezwungen aufgesetzten Lächeln. »Was soll schon noch passieren?«
Diese Aussage hatte ihn viel Überwindung gekostet. Er wollte es Mary zuliebe versuchen, weil er die Hoffnung einfach nicht aufgeben wollte, dass es irgendetwas auf dieser gottverdammten Welt geben musste, das ihr helfen könnte. Dennoch, viel Hoffnung steckte er selbst nicht in die ganze Sache. Zu negativ war seine Einstellung in Bezug auf solche Dinge, wenn er auch keinerlei direkte Berührungspunkte mit der Thematik hatte. Seine abgeschottete Einstellung basierte rein auf Vorurteilen, von denen er mehr als überzeugt war. »Na also, geht doch!«, erheiterte Rich seinen Kumpel, holte aus und klopfte ihm mit einem kräftigen Schwung auf die Schulter, sodass Paul ins Stolpern kam. »Du wirst sehen, alles wird gut!« Paul quittierte die Aussage von seinem Kumpel lediglich mit hochgezogenen Augenbrauen und einem Schulterzucken.
Richard empfahl den beiden einen Alternativmediziner, weit abgelegen im Nirgendwo der heißen Wüste, bei dem er schon mit vielen Problemen vorstellig wurde. Bei jedem einzelnen Termin konnte dieser Praktiker ihm weiterhelfen und hatte unkonventionelle Lösungen parat, die Richard gesundheitlich auch für die Zukunft vorbeugen ließen. Der Name des Alternativmediziners war Max und er verstand sein Kompetenzgebiet in der Naturheilkunde. Alles Pflanzliche und Natürliche, alle Minerale und Globuli reichten seiner Meinung nach vollkommen aus, um jegliche Krankheit zu kurieren. Dabei war es ganz egal, welchen Ursprung diese auch haben mochten. Für Max gab es nichts, was nicht durch Mutter Natur behandelt und erfolgreich geheilt werden konnte. Rich und Mia schwärmten regelrecht von diesem Mann und waren vollkommen überzeugt von ihm. Egal, ob sie von Rückenschmerzen geplagt wurden, sie hartnäckige Erkältungen verfolgten oder die beiden psychisch nicht auf der Höhe waren. Dieser Max hatte angeblich stets Ideen und Wege parat, die die Probleme restlos lösten. Doch hatte sich Paul nie richtig mit diesem, nach Richards Meinung, Wunderheiler beschäftigt. Schließlich kam es für Paul nie infrage, zu einem solchen Blender zu gehen. Seine Einstellung zu den Leuten war da ziemlich rigoros. Er konnte und wollte das alles kaum glauben, was Rich ihm da seit Jahren unaufhörlich auftischte. Immer wieder dasselbe Gelaber. Seine Erzählungen waren fast schon penetrant, zu aufdringlich. Diese unglaubhaften Geschichten verstießen gegen Pauls Grundverständnis, wie Dinge funktionierten. Das alles hörte sich für ihn schwer nach an den Haaren herbeigezogenen Ammenmärchen an. Dennoch war es ihm in seiner verzweifelten Lage einen Versuch wert und er redete abends noch mit seiner Frau darüber. Dabei wollte er sich niemals anmerken lassen, dass er kaum Hoffnung in diesen Max steckte. Ganz im Gegenteil, er wollte Mary darin bestärken und wer weiß, vielleicht war dieser eine winzige Hoffnungsfunke wirklich genau der, der Mary helfen und ein reinigendes Feuer entfachen konnte.
Kapitel 4
»Hey, Schatz, bin zu Hause!«, rief Paul nervös, als er nach seiner Schicht daheim zur Tür hineinkam. Schnellen Schrittes huschte er ins warme Wohnzimmer, wo Mary mit einer flauschigen Decke und einer dampfenden Tasse Zitrone-Ingwer-Tee auf der Couch saß. Ihre Füße, über die sie Schafswollsocken gezogen hatte, spitzten unter der Decke hervor. Die wohlige Atmosphäre wurde von dem zarten Knistern des Holzofens untermalt. Mary hatte die große LED-Deckenlampe gedimmt und ein sanftes, warmweißes Licht säumte das gemütlich eingerichtete Wohnzimmer. Neben ihr kauerte Milow zusammengerollt und gut getarnt, schläfrig auf dem unteren Teil der taupefarbenen Decke.
»Wie geht’s dir?«, fragte Paul sie sichtlich angespannt.
»Na ja, so lala, ich habe Angst vor der Nacht«, gab Mary konsterniert und fast lautlos mit der Tasse vor ihrem Gesicht zu. Gerade noch stieg ihr der heiße Dampf des Tees in ihr Gesicht, während sie die Wand anstarrte. Dann drehte sie ihren Kopf in Richtung Paul und sah ihn skeptisch an, verzog dabei ihre schmalen, fast unsichtbar hellen Brauen. Sie klimperte mit ihren brüchigen Nägeln auf der mintfarbenen Tasse herum. »Irgendetwas stimmt doch mit dir nicht, mach mir nichts vor. Was ist los?«
»Mit mir? Ach, nichts. Alles ist gut. Hör’ mal zu«, seufzte Paul und kratzte sich aufgeregt mit seiner rechten Hand hinter seinem Ohr. »Ich war heute Mittag bei Rich und habt etwas mit ihm geplaudert. Ich will mit dir zu Max, du weißt doch, über den haben wir schon öfter geredet, weil Rich und Mia ihn so bewundern und uns immer vollquatschen, wie toll er doch sei.« Mary verdrehte ungläubig ihre Augen und schwenkte ihre buschigen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haare zur Seite. Sie setzte sich auf, legte die flauschige Decke beiseite, sodass Milow fast darunter begraben wurde. Langsam beugte Mary sich vor und stellte die heiße Tasse auf den kleinen, aber massiven Holztisch vor der Couch. »Bitte was? Ist das dein Ernst? Du, gerade du willst mich dahinschleppen?«, fragte sie mit ironischem Unterton Paul und deutete mehrfach mit ihrem ausgestreckten Zeigefinger auf ihren Mann. Dieser setzte sich neben Mary und legte ihr beide Hände auf die Oberschenkel: »Ja, ich weiß, ich bin nicht gerade der größte Fan von solchen Freaks«, gab er zu, während er verständnisvoll nickte und die Mundwinkel verzog.
Da Mary seine Einstellung zu diesen Leuten teilte, aber sie es nicht ganz so extrem sah wie ihr Mann, wurde sie aufmerksam. Sie kniff ihre Augen zusammen und musterte Paul genau. »Aber wie kommst du jetzt darauf, wieso willst du plötzlich mit mir dahin, es hat doch bisher rein garnichts etwas gebracht? Und dann soll Max, ein so ein dahergelaufenerIrrer, wie du ihn gerne nennst, mir helfen?«, fragte sie ihn ratlos. »Wie soll mir denn so einer aus meiner aussichtslosen Situation heraushelfen?«, wollte Mary gerne wissen.
»Nun ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und es kann so einfach nicht weitergehen, das weißt du selbst. Du zerbrichst an der Situation. Wir zerbrechen an dieser Situation. Vor allem kann ich es nicht mehr mit ansehen, wie schlecht es dir dabei geht. Du vegetierst einfach nur noch vor dich hin. Ich hab’ einfach nur Angst um dich, schließlich bist du mein Ein und Alles! Und einen Versuch ist es doch wert. Ich meine, was haben wir denn noch zu verlieren? Schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden. Denk’ nur an deinen letzten Zusammenbruch in der Küche, als ich dich dort gefunden hab’. So etwas will ich nie wieder in meinem ganzen Leben mitmachen und ich bin mir sicher, dass du das auch nicht willst.« Paul sah seine Frau mit einer Mischung aus Hoffnung, Verzweiflung und Sehnsucht an. Sehnsucht danach, dass es eines Tages endlich wieder besser werden und seine Frau endlich ihr Leben wieder genießen können würde. Sie blickte ihm daraufhin eine gefühlte Ewigkeit lang tief in die Augen, ohne dabei etwas zu sagen oder auch nur zu blinzeln. Paul wartete, während er sich beinahe in Marys tiefblauen Augen verlor, sehnsüchtig auf eine Antwort, merkte, wie die Spannung in ihm schier ins Unendliche anstieg. Doch dann endlich erlöste sie ihn und seufzte: »In Ordnung, lass es uns versuchen, wir haben wirklich nichts mehr zu verlieren.« Paul war erleichtert, er freute sich sogar ein wenig und fiel Mary vor Erleichterung in die Arme. Dass er sich eines Tages mal über eine solche Nachricht freuen würde, hätte er sich nie erträumt. Hätte seinem jüngeren Ich das jemals jemand erzählt, wäre er vorsorglich wahrscheinlich zum Psychologen gegangen und hätte sich selbst für komplett wahnsinnig erklärt. Ein bisschen erschrak ihn das selbst. Trotz seiner pessimistischen Einstellung zu Leuten wie Max sah er dennoch ein wenig Hoffnung am Horizont aufblitzen. Er sah einen kleinen Ausweg, der sich am Ende des verzweigten Labyrinths plötzlich auftat, wo vorher nur weitere Irrwege warteten. »Ich habe dabei ein gutes Gefühl, Schatz. Er wird dir helfen, ganz sicher!«, versprach er seiner Frau und drückte ihr einen dicken Schmatzer auf ihre spröden Lippen.
Auch wenn dieser Satz Paul so gar nicht leicht von den Lippen ging, wollte er seiner Frau dennoch Zuversicht schenken. Es ging nicht anders. Er konnte nicht anders. Wenn Mary schon nicht hoffte, so musste er es tun. Für sie. Für die beiden. Für ihren gemeinsamen Weg. Paul wollte sich nicht geschlagen geben, wollte für die beiden die Fahne hochhalten. Und wer weiß, vielleicht konnte Max ihr ja auf einmal wirklich helfen. Schließlich half er Rich ja auch immer weiter. Und bei genauerem Hinsehen konnte das doch wohl nicht alles auf Aberglaube beruhen, oder doch? Er war im Zwiespalt. Paul versuchte, sich selbst einzureden, dass es klappen würde. Er versuchte, sich selbst froh zu reden, sein inneres Ich selbst zu überlisten. Diese Überzeugung wollte er auf seine Frau projizieren. Vielleicht half ihr unterstützend auch etwas der berühmte Placebo-Effekt, wenn Paul nur überzeugend genug wäre. Er musste es auf jeden Fall versuchen. Sie nahmen sich gemeinsam vor, am Tag darauf einen Termin bei Max zu vereinbaren. Als Paul sich abends die Telefonnummer vorsorglich von Rich geben ließ, war dieser glücklich und erzählte Paul, wie stolz er auf die beiden war, dass sie es jetzt wirklich durchziehen und über ihren Schatten springen wollten.
Am nächsten Tag war es so weit. Um die Mittagszeit wollte Mary das erste Mal bei Max anrufen. Paul saß schon ganz ungeduldig neben ihr auf dem Sofa und wackelte mit den Beinen so schnell hin und her, dass der beigefarbene Hochflorteppich hin und her rutschte. Paul hatte nach seiner Nachtschicht nicht geschlafen und definitiv zu viel Kaffee intus. Seine Nervosität war mehr als spürbar. »Du schaffst das, du schaffst das! Los, mach schon!«, lächelte er Mary an. Sie war ebenfalls angespannt, schließlich wusste sie nicht, was sie erwarten würde. Als sich Mary nach einem tiefen, langen Atemzug überwand und zittrig die Handynummer auf ihrem Smartphone eintippte, wurde sie beim Anklingeln im ersten Moment positiv überrascht. Im Hintergrund erklang beim Anruf eine sanfte, zugleich auch mystische Entspannungsmusik. Mary empfand sie als ungewöhnlich, wenngleich auch auf eine seltsame Art und Weise entspannend. Jedenfalls war es irgendwie komisch, Mary konnte sich nicht wirklich festlegen, ob ihr diese Musik gefiel. Eine Symphonie, eine Melodie, gespielt von Panflöte, Akustikgitarre und Fagott, erzielte eine Wirkung in Mary, die sie nicht zuordnen konnte. Verzerrte Molltöne jagten geheimnisvolle, schier unendlich weit entfernte Höhen. Federleichte, verspielte Klänge wurden von spannungsschweren Bässen übertrumpft und eingestampft.
Vielleicht mag die Unsicherheit auch an ihrer grundlegenden Skepsis gegenüber solchen Leuten gelegen haben? Was sollte sie am anderen Ende erwarten? 1000 Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Urplötzlich wurde Mary aus dem Grübeln gerissen. Max meldete sich am anderen Ende des Apparats.
»Hallo, Max hier, wie kann ich dir weiterhelfen, hihi?«, schallte es mit einer fröhlich-optimistischen, fast schon aufdringlich grellen Stimme von der anderen Seite des Hörers her. Mary war erschrocken, da sie aus ihren Gedankenspielen gerissen wurde und erwiderte zögerlich: »Ha… Hallo, Mister, hallo Max, mein Name ist Mary und ich habe…«
»Stopp! Hihi!«, unterbrach Max vorwitzig und energisch Marys Begrüßung. »Ich weiß ganz genau, was dir fehlt!«, behauptete Max selbstsicher am anderen Ende. »Komm einfach nächste Woche Dienstag um 16:00 Uhr bei mir zu Hause vorbei, ich freue mich auf dich, Mary! Bis dann!«
»Ehm, st… stopp, warte mal, aber… woher, woher willst du… Entschuldigung, ich meine, woher wollen Sie…?«, stotterte Mary verwundert und völlig überfordert ins Telefon.
»Vertrau mir, ich erkläre dir dann alles, bis dann, hihi!«, rief Max begeistert in den Apparat zu Mary, legte ohne zu zögern auf und ließ sie ratlos zurück.
Mary behielt das Handy in der Hand, drehte ihren Kopf mit offenstehendem Mund ungläubig in Richtung von Paul und sah ihn verdutzt an. »Was… was war das denn bitte? Hat der noch alle Tassen im Schrank?« Paul war genauso irritiert und wusste im ersten Moment nicht, was er so recht von dieser grotesken Aktion halten sollte. Er saß ebenfalls mit offenem Mund da. Alles, was er im ersten Moment nach dem Telefonat herausbekam, war: »Hmm.« Dann biss er sich auf die Unterlippe und sah Mary nachdenklich an. Ihm fehlten schlicht die Worte. Nach einem kurzen Zögern sagte er zu ihr: »Also, ich weiß ja nicht, irgendwie dubios. Rich wird ihm doch wohl nichts von uns erzählt haben, oder? Nein, das kann nicht sein. Aber wenn Rich so überzeugt von diesem komischen Kauz da ist, muss ja irgendetwas dahinterstecken, oder? Ich rede morgen nochmal mit ihm, ob das bei ihm auch so war. Das hier war nämlich echt schräg und super komisch!«, versprach Paul seiner Frau.
»Ja, tu das bitte! Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ihm einfach von mir erzählt hat, das würde Rich niemals tun«, erwiderte Mary nachdrücklich. »Ich will wissen, worauf ich mich da eingelassen habe, was für ein absolut gruseliger Typ!«
Am Tag darauf fuhr Paul in seiner Pause zum Laden von seinem Kumpel. Richard erspähte ihn schon von innen durch die Glasfront der Wundertüte und winkte ihm fröhlich aufgeweckt durch die Scheibe zu, denn er wusste, dass die beiden Max angerufen hatten. Er war fast noch aufgeregter als die beiden selbst und freute sich, dass seine Freunde die Chance endlich nach so langer Zeit nutzten. Über Jahre hinweg musste er zusammen mit Mia die beiden belämmern, bis sie ihre Freunde endlich an dem Punkt hatten.
Paul erwiderte das Winken nur zaghaft aus dem Polizeiauto heraus. Nachdenklich parkte er den Streifenwagen auf dem groß angelegten Schotterparkplatz vor der Wundertüte und stieg langsam aus. An seinem verträumten Schlendern und dem Kicken von größeren Steinchen erkannte Rich, dass etwas nicht in Ordnung war. Richard sah, dass Paul sichtlich bedrückt dreinschaute und lief zügig in Richtung des Eingangs, öffnete die Ladentür, die das Aufziehen mit einem hellen Klingeln quittierte, für Paul und sah ihn besorgt an. »Hi Kumpel, was ist denn los? Du siehst gar nicht gut aus! Soll ich dir einen Kaffee machen? Geht aufs Haus!«
Paul rümpfte die Nase: »Nein, danke. Du, sag mal, Mary hat gestern das erste Mal bei Max angerufen, hab’ ich dir ja erzählt, und…«
»Hach, ja, ich weiß, was du meinst«, unterbrach ihn Richard direkt, winkte mit einem verschmitzten Grinsen ab und warf seine Haare mit einem Schwung nach hinten.
»Wie, echt jetzt? Du hast doch diesem Max nicht etwa von uns erzählt?«, fragte Paul sichtlich skeptisch seinen besten Freund.
Richard lachte: »Nein, das würde ich doch niemals tun, das weißt du doch!«
»Gut. Dann bin ich ja beruhigt«, entgegnete Paul deutlich erleichtert.
»Aber lass mich raten. Max wusste angeblich direkt, was los ist, ohne dass Mary auch nur ein Sterbenswörtchen erwähnt hat?«, behauptete Richard mit einem Grinsen im Gesicht.
Paul sah ihn konsterniert an: »Ja, genau so war es! Aber woher will er das überhaupt wissen? Was ist das bloß für ein merkwürdiger Kerl? Was stimmt bloß mit dem nicht?« Richard klopfte seinem besten Freund auf die Schulter. »Ach, lasst euch einfach überraschen, glaub mir, er ist es definitiv wert. Macht euch keine Gedanken! Max wird euch da raushelfen und euch ungeahnte Möglichkeiten zeigen.«
»Ich bin gespannt. Wehe, wenn er nicht hilft, dann bist du mir etwas schuldig!«, scherzte Paul mit einem schmerzlichen Lächeln auf den Lippen und kratzte sich dabei verlegen am Hinterkopf. Sein stoppeliges Haar gab dabei ein unangenehm kratziges Geräusch ab.
»Mach dir da mal keine Sorgen, das wird schon«, versicherte Richard. »Ihr werdet mir dankbar sein! Marys Problem wird sich in Luft auflösen!«
In Luft auflösen?
Einfach so?
Das glaub’ ich erst dann, wenn es so weit ist.
Paul grübelte immer noch, es stand schließlich so viel auf dem Spiel. Er befand sich in einem Kokon aus Selbstzweifeln, der ihn einschnürte und ihm die Luft zum Atmen abdrückte. Marys Gesundheit war wirklich in miserablem Zustand und dieser skurrile, irre Typ da sollte der womöglich Einzige sein, der seiner Frau in dieser Situation weiterhelfen könnte? Pauls Gedankenkarussell fand einfach kein Ende, es drehte sich unaufhörlich weiter. Immer schneller und schneller rotierte es. Er führte immer wieder innere Kämpfe gegen sich selbst. War hin- und hergerissen.
Was ist, wenn Max auch nicht hilft? Was, wenn er alles nur schlimmer macht? Was, wenn dieses letzte Aufbäumen von diesem kleinen Hoffnungskeim wieder umsonst ist? Was, wenn ich am kompletten Untergang schuld bin? Das kann ich doch nicht verantworten!
Jede noch so kleine Aufregung in Marys Zustand setzte ihr schwer zu und könnte das Fass endgültig zum Überlaufen bringen. Sie konnte eine weitere Niederlage kaum ertragen. Paul musste sich also nun blind auf Rich und Mia verlassen. Gerade in einer solch prekären Situation war das leichter gesagt als getan. Auch wenn Richard sein bester Freund war und er bisher nie von ihm enttäuscht wurde. Es war nicht so, dass er sich prinzipiell nicht auf Rich verlassen konnte, aber es war die aussichtslose Lage, die das Ganze schier unerträglich machte für Paul. Und die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg war doch so verschwindend gering in seinen Augen.





























