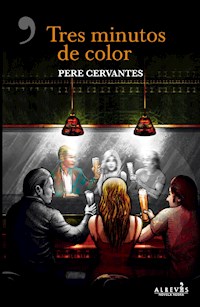6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein verschollener Vater. Ein Bild, das ein lebensgefährliches Geheimnis birgt. Ein kleiner Junge, der Korruption und Verrat zum Trotz niemals aufhört zu hoffen ...
Barcelona, 1945: Der zwölfjährige Nil schlägt sich in der vom Krieg gezeichneten Stadt durch, indem er als Kurier Filmrollen von einem Kino zum nächsten bringt. Manchmal schleicht der Junge sich auch in Vorführungen, um der Stimme seines Vaters zuzuhören – dieser war einst Synchronsprecher, bevor er vor Jahren plötzlich verschwand. Doch eines Tages wird Nil auf seinem Heimweg Zeuge eines Mordes. Er kann nichts mehr für den schwer verletzten Mann tun, dieser steckt ihm jedoch ein Foto zu und flüstert dabei den Namen von Nils Vater. Nil beschließt dem Geheimnis des Fotos auf den Grund zu gehen - und merkt bald, dass er nicht der Einzige auf der Jagd nach Antworten ist …
Eine Hommage an den besonderen Zauber des Kinos, der selbst in den dunkelsten Zeiten einen Ort der Hoffnung und Fantasie erschaffen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Barcelona, 1945: Während sich die Stadt von den Folgen des Kriegs erholt, schlägt sich der zwölfjährige Nil durch, indem er als Kurier Filmrollen von einem Kino zum nächsten bringt. Hin und wieder schleicht er sich in die Vorführungen, um der Stimme seines Vaters zu lauschen, der einst Synchronsprecher war, bevor er vor Jahren verschwand. Doch eines Tages wird Nil auf dem Heimweg Zeuge eines Mordes. Bevor das Opfer seinen Verletzungen erliegt, steckt dieses ihm ein Foto zu und flüstert: »David«. Es ist der Name seines Vaters. Nil beschließt dem Geheimnis des Fotos auf den Grund zu gehen – und merkt bald, dass auch andere auf der Jagd nach Antworten sind …
Autor
Pere Cervantes, geboren 1971 in Barcelona, ist Schriftsteller und Drehbuchautor. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften war er zunächst als Soldat für die UN im Kosovo und die Europäische Union in Bosnien-Herzegowina tätig. Zurück in Spanien, wandte er sich allerdings dem Schreiben zu. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet. »Die Lichter von Barcelona« ist Pere Cervantes’ erster Roman, der ins Deutsche übersetzt wurde.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet
Pere Cervantes
Die Lichter von Barcelona
Roman
Deutsch von Lisa Grüneisen
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »El chico de las bobinas« bei Ediciones Destino, Barcelona.
Die Übersetzung dieses Romans wurde unterstützt durch Acción Cultural Española, AC/E.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2020 by Pere Cervantes
This edition has been published through the agreement with Hanska Literary&Film Agency, Barcelona, Spain.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susanne Kiesow
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotive: akg-images / Paul Almasy; Tomas Rodriguez /Stone / Getty Images
DK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-6412-6900-5V002
www.limes-verlag.de
Erster Teil
1945
1
Barcelona, August 1945
Eine liebende Mutter zieht das Schweigen stets der Wahrheit vor. In diesem Stillschweigen voller Ängste und Hoffnungen befindet sich der Ort, an dem man träumen kann. Es ist ein Ausweg aus der Dunkelheit, eine Zuflucht, um einer trostlosen Kindheit zu entfliehen und sich mit den vom Bürgerkrieg gestohlenen Jahren zu versöhnen.
Als Nil an jenem von Dunst und Feuchtigkeit getränkten Morgen aufwachte, freute er sich auf die versprochene Limonade mit Tarzan und Jane. Der hartnäckige Traum, der ihn seit Jahren verfolgte, war weit weg. Dieser Traum, in dem sein Vater in einer Zelle mit abgeblätterten, blutbespritzten Wänden verzweifelt seinen Namen rief und einen Unbekannten anflehte, ihm nicht länger wehzutun.
In der kleinen, vom ersten Morgenlicht gefluteten Küche brütete seine Mutter Soledad über den Rechnungsbüchern der Schreinerei von Joan Romagosa, die für das klägliche Einkommen verantwortlich war, das ins Haus kam und sie über Wasser hielt. Schwarzhandel, Reparaturarbeiten und andere Geschäfte. Als sie ihren Sohn bemerkte, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Wenn es einen Moment am Tag gab, der ihr ein Lächeln entlockte, dann war es dieser. Als wollte sie einem höheren Wesen dafür danken, dass sie einen weiteren Tag mit ihrem Sohn zusammen sein konnte und er ihr nicht genommen worden war wie die kleine Rosa. Nil küsste seine Mutter mit dem Temperament eines Jungen, der noch nicht zum Mann geworden war, und stürzte sich begeistert auf den Toast, der auf dem Tisch stand.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge.«
Soledad schloss ihren Sohn fest in ihre Arme und öffnete dann die Schublade der Anrichte – das einzige Möbelstück, das noch im Wohnzimmer stand. Die übrigen Möbel hatten sie verheizt, um die Kälte des letzten Winters zu vertreiben. Ein in Packpapier gewickelter Gegenstand von der Größe einer Paellapfanne entlockte dem Kind ein Lächeln.
»Ich weiß, was es ist!«
Als Nil das Geschenk auspacken wollte, bot seine Mutter an, ihm zu helfen, doch der Junge quittierte das Angebot lediglich mit einem missbilligenden Blick. Der Armstumpf, der im Winter unter einem schlackernden Jackenärmel steckte, nun jedoch deutlich zu sehen war, wurde von seinem Besitzer mit stillem Gleichmut getragen. Wieder einmal bewies Nil, wie geschickt er mit seiner rechten Hand war, und wickelte das Geschenk in derselben Zeit aus, die auch seine Mutter dafür gebraucht hätte. Die Filmrolle auf dem Tisch brachte das Gesicht des Jungen zum Strahlen.
»Das hat Bernardo eingefädelt«, sagte Soledad, während sie den Morgenmantel zurechtrückte, den sie zu dieser frühen Stunde immer trug, unabhängig von der Jahreszeit. »Es ist ein verbotener Film, der in Spanien vielleicht nie zu sehen sein wird. Er heißt Der große Diktator.«
»Woher hat er ihn?«
»Das musst du ihn selbst fragen.«
Nil stand vor der Filmrolle, als sein Blick auf den leeren Stuhl fiel, auf dem nur eine Erinnerung saß, eine schmerzliche Abwesenheit. Es war ein Schmerz, der trotz der vergangenen Zeit nicht nachließ. »Wieder ein Geburtstag ohne Papa«, sagte er mit erstickter Stimme. Soledad holte tief Luft. Sie war es leid, ihm nicht sagen zu können, wann sein Vater zurückkam, deshalb beschloss sie zu schweigen. Inzwischen hatte sie sich an ihre eigene Machtlosigkeit gewöhnt, obwohl sie sie immer noch schmerzte.
»Komm jetzt frühstücken.«
Nil gehorchte, nicht ohne vorher mit der rechten Hand über die Filmrolle zu streichen, in der sich Verbotenes verbarg, und sie mit erwartungsvollem Respekt zu betrachten.
»Sollen wir teilen?«, schlug Nil vor, das Toastbrot in der Hand. Sonnenstrahlen fielen durch das Balkonfenster. Die Mutter schüttelte lächelnd den Kopf.
In jenen Jahren litten alle Hunger. Hunger, Angst und Leid waren die Übel, die die ganze Stadt peinigten. Sie stellte ihrem Sohn ein Glas warme, mit Wasser verdünnte Milch hin, dann setzte sie sich ihm gegenüber und betrachtete ihn liebevoll. Sie hatte es ihm nie gesagt, aber Nil wusste, wie gerne sie ihm bei den alltäglichen Dingen zusah, umgeben von dieser Unschuld, die ihr selbst so fremd geworden war.
»Der Señor Romagosa wird von Tag zu Tag älter«, bemerkte Soledad mit müder Stimme. »Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was wir machen sollen, wenn ich ohne Arbeit dastehe, Nil.«
»Ich kann mit der Schule aufhören und als Fahrradkurier für gleich acht Kinos arbeiten«, rief der Junge, während seine Mutter schweigend den Tisch abräumte und niedergeschlagen im Schlafzimmer verschwand, das sie sich teilten.
Es kam für sie nicht infrage, dass ihr Junge für das häusliche Auskommen sorgte. Nil hingegen fand es eine fantastische Idee, nicht nur an den Wochenenden Filmrollen auszuliefern, sondern jeden Tag. Vor allem bräuchte er diese düstere, spießige Klosterschule nicht mehr zu besuchen, wo die Priester nicht grüßten, sondern einem die Hand zum Kuss hinhielten. Nicht wenige Male hätte Nil am liebsten reingebissen. Dieses Ritual, das ihm selbst nur ein Lächeln entlockte, wurde von den Priestern als Geste der Unterwürfigkeit und des Wohlverhaltens aufgefasst, die ihm mehr als einen belehrenden Vortrag über die Herrlichkeit Francos ersparte. Er konnte nicht verstehen, dass Gott seinen Posten verlassen und sie diesem schmächtigen General ausgeliefert hatte, der ihm seinen Vater weggenommen hatte.
»Sie sagen, ich sei einer ihrer besten Kuriere.«
Soledad überhörte die Bemerkung ihres Sohnes und erinnerte ihn noch einmal wie jeden Tag an seine Pflichten, eine Aufzählung, die zu einer Art Ritual geworden war, genau wie die Ermahnungen, die auf das allgemeine Misstrauen zurückzuführen waren, das in der Stadt herrschte: »Sprich nicht mit Fremden und erzähle nicht von deinem Vater. Lass keinen in die Wohnung und bring dich nicht in Schwierigkeiten. Gerede führt immer zu Schwierigkeiten.« Dann trug sie ihm auf, mit dem Bezugsschein zum Lebensmittelladen Breda zu gehen und dann noch zur Schusterei von Jacinto, damit der zum vierten Mal seine Schuhe neu besohlte.
Nur einen Augenblick, nachdem sich Soledad auf den Weg zur Schreinerei gemacht hatte, ließ Bernardo Más, ein guter Nachbar, Freund der Familie und von Beruf Filmvorführer, den Türklopfer mit so viel Schwung fallen, dass dieser noch einmal nachhüpfte, wie sie es als Erkennungszeichen ausgemacht hatten.
»Herzlichen Glückwunsch, mein Junge. Schau mal.« Bernardo trat ein und grinste bis über beide Ohren, während er auf eine rot umkringelte Meldung in der La Vanguardia Española deutete.
Der Krieg in Asien ist vorbei.
»Aber das ist weit weg, Bernardo.«
»Ja. Aber jetzt können sich die Amerikaner wieder um das kümmern, was sie am besten können. Das hier.«
Bernardo zog ein Filmplakat aus der Hosentasche und rollte es auf. Darauf befand sich John Wayne mit Cowboyhut und Revolver in der Hand. Nil betrachtete bewundernd sein Idol und strich über das Plakat.
»Ist er der Beste oder nicht?«, fragte Bernardo.
»Tarzan finde ich noch besser.«
»Also willst du nicht Ringo sehen?«
Der Junge schüttelte den Kopf, als er den Namen des Kinos las, in dem der Film gezeigt wurde.
»Das Coliseum werde ich nie mehr im Leben betreten«, stellte Nil klar, während er sich unter Bernardos mitfühlendem Blick den Armstumpf rieb.
In Bernardos Inneren brodelte eine nur mühsam bezähmte Wut. An so vielen Ecken war Barcelona voller Blut und Leid, und auch wenn die Wunden verheilten, würde er niemals vergessen.
»Das habe ich mir gedacht, Junge. Aber wer hat gesagt, dass wir dort hingehen?« Er zwinkerte ihm mit dem guten Auge zu, dem Auge, das nicht hin und her rollte wie eine wild gewordene Murmel. »Weißt du eigentlich, dass keiner im ganzen Land diesen Film hier hat?«, sagte er schließlich, um der Situation die Spannung zu nehmen, und deutete auf das Geschenk, das auf dem Tisch lag. Nil trat begeistert näher.
Bernardo ging auf die fünfzig zu, war von beeindruckender Statur, hatte breite Schultern und eine tiefe, sonore Stimme, die so gar nicht zu dem gutmütigen Gesichtsausdruck passte, der ihm zusammen mit der wulstigen Unterlippe das Aussehen eines Menschen verlieh, den man gemeinhin eine »gute Seele« nannte. Sommers wie winters trug er stets eine wollene Baskenmütze auf dem kahlen Schädel und rasierte sich nur einmal in der Woche.
Bernardo wohnte ein Stockwerk über Nil und teilte Tisch und Bett mit Paulino Blanch, dem affektierten Platzanweiser aus dem Kino América. Auch Paulino war um die fünfzig, was angesichts der glatten Haut, um die ihn viele Nachbarinnen beneideten, niemand vermutet hätte. Mochte sein, dass sein Gehalt nicht ausreichte, um ein Stück Brot mit Stockfisch zu essen, doch wenn er vorüberging, umwehte ihn stets der unverwechselbare Geruch nach Aftershave der Marke Varon Dandy. Paulino war ein zurückhaltender Mensch, der eine Erziehung genossen hatte, wie sie im Viertel nicht gerade häufig war. Was Bernardo anging, so liebte er Kino und Schnaps gleichermaßen und war von morgens früh bis abends spät in Plauderlaune.
»Was ist mit deinem Versprechen?«, rief ihm Nil nun in Erinnerung.
Bernardo blickte auf, hob fragend die Augenbrauen und forschte in seinem Gedächtnis, doch trotz angestrengten Nachdenkens fand sich dort nichts. Angesichts von Nils enttäuschter Miene war seiner eigenen Miene die Beunruhigung anzusehen.
»Ihr Erwachsenen seid alle gleich«, stellte der Junge verärgert fest.
Bernardo konnte nicht glauben, dass der Junge nicht mit der Aussicht zufrieden war, John Wayne und Der große Diktator zu sehen. Doch dann hellte sich sein Gesicht auf.
»Mal sehen«, schloss er schließlich. »Hat dieser Berg von einem Mann, der die Erde erschüttert, auf die er tritt, jemals ein Versprechen gebrochen?«
Nil schüttelte den Kopf und verkniff sich ein Grinsen, das er aus Stolz nicht offen zeigen wollte.
»Tarzan und Jane, ist es das? Also gut, wir machen es so«, schloss Bernardo. »Ich gehe jetzt zum Kino, um die Vormittagsvorstellung vorzubereiten und Carmina an der Kasse den Morgen zu versüßen, und gegen eins, kurz vorm Mittagessen, kommst du mich abholen. Ich gebe dir mein Wort.«
2
Jene Jahre waren eine Zeit, in der das Treppenhaus die Verlängerung der Familie war und das Viertel ein geschütztes Territorium, aus dem man sich lieber nicht entfernte. Angst und Hoffnung waren zu der Zeit genauso untrennbar miteinander verbunden wie Kinder und Hunger. Die Karte des Stadtviertels umfasste ein Gewirr von Straßen, deren Namen per Dekret geändert worden waren, Spuren eines noch nicht lange zurückliegenden Bürgerkriegs. Die Einwohner des Poble Sec zerrieben sich zwischen Armut und Hoffnung auf Rettung. Der Schuster Jacinto war ein Paradebeispiel für dieses Leben.
Die Türglocke schellte, als Nil die Schusterwerkstatt betrat. Drinnen schlug ihm der stechende Geruch von Leim und Lösungsmittel entgegen. Der Laden maß kaum mehr als zwölf Quadratmeter, und die mit Titelseiten der Sportzeitschrift El Mundo Deportivo beklebten Wände, auf denen die Heldentaten des Fußballclubs von Barcelona gefeiert wurden, verliehen dem Raum etwas Klaustrophobisches. Señora Carmen, eine rundliche Frau mittleren Alters, die seit fünf Jahren Trauer trug, stand schimpfend vor der Ladentheke, die genauso mit Fußballmotiven beklebt war wie der restliche Laden.
»Verteidige das Mädchen nicht, Jacinto, so knackig sie auch sein mag. Was sie getan hat, ist unverzeihlich, da hilft auch kein Gott.«
»Aber Señora Carmen.« Jacinto zwinkerte Nil zu, dem einzigen Zeugen der Auseinandersetzung, und legte den Hammer auf den Tresen. »Reden Sie nicht so vor anderen Kunden. Nachher bekommt es jemand in den falschen Hals.«
»Also geben Sie mir recht?«
Nil sah amüsiert zu, wie sich das schlimmste Klatschweib des Viertels über den größten Witzbold des Viertels aufregte. Er kannte den scherzhaften Ton des Schusters mit dem hageren Gesicht, das durch die krummen Zähne und die vorstehenden Augen, die den riesigen Ohren die Hauptrolle streitig machten, auch nicht schöner wurde. Ein eierförmiger, allmählich kahl werdender Schädel rundete das Gesamtbild ab.
»Klar, Señora Carmen. Natürlich ist es nicht in Ordnung, den toten Vater mitten im Hochsommer fünf Tage im Bett liegen zu lassen, um weiter die Lebensmittelkarte nutzen zu können. Aber Sie könnten ruhig zugeben, dass Ihre Leute uns die Taschen leeren.«
»Was soll das heißen, meine Leute? Das sind unser aller Leute. Oder bist du ein verkappter Kommunist?«
»Wir wollen doch nicht übertreiben, Señora Carmen. Ich gehöre zu den wenigen, die ein paar Monate für die Falangisten gekämpft haben und ein paar für die Republikaner.«
Die Witwe sah aus wie ein Fisch, der einen Köder verschluckt hat.
»Machen Sie nicht so ein Gesicht, gute Frau. Wir haben alle unsere Vergangenheit. Ich sage Ihnen eins: Die einen wie die anderen haben uns ins Elend gestürzt. Und noch was …«
»Ich gehe jetzt besser«, sagte die Frau, als Jacinto mit durchgedrücktem Rücken wie ein Torero hinter dem Tresen hervorgeschossen kam, den Zeigefinger zur Decke erhoben, an der immerhin keine Zeitungsausschnitte klebten.
»Wollen Sie, dass aus der Stadt, die ja auch Ihre Stadt war, ein Armenhaus wird? Mit Menschen, die für ein kohlschwarzes Stück trockenes Brot Schlange stehen, und Wänden, die von verheizten Möbeln geschwärzt sind?«
»Wenn mein Mann noch am Leben wäre, würdest du nicht so mit mir reden, Jacinto.«
»Um wen geht es eigentlich?«, fragte Nil dazwischen, um die Situation zu entspannen.
»Um Delfina, deine schamlose Nachbarin«, entgegnete die Witwe. Ihr Blick wanderte über den Armstumpf des Jungen, dann sah sie wie ertappt weg. »Sie und diese warmen Brüder … tolle Nachbarschaft, die ihr da habt. Deine Mutter ist die einzige Ausnahme. Der alte Falangist hat nämlich auch eine Schraube locker, wieso sollte er sonst einen Taugenichts wie diesen Doktor Fuster bei sich aufnehmen? Und der ist ja wohl tatsächlich ein ausgemachter Kommunist.«
»Und sie haben wirklich den toten Großvater versteckt?«, fragte Nil. »Ich dachte, der Gestank käme von einer Katze, die in den Lichtschacht gefallen ist.«
»Ach was, eine Katze!«, rief Señora Carmen. »Und du treib dich nicht so viel mit diesem Quim herum. Er ist ein Querkopf und lügt wie gedruckt.«
»Erzählen Sie dem Jungen nicht solche Sachen. Sie versuchen nur, sich irgendwie durchzuschlagen, wie alle«, ging Jacinto dazwischen, der sich inzwischen ein wenig beruhigt hatte.
»Nur zu. Und Gott sei diesem armen Mann gnädig, der längst bestattet sein sollte«, erklärte die Witwe, bevor sie sich zum Gehen wandte und sie stehen ließ. »Man ist ein guter Mensch, aber alles hat seine Grenzen. Wenn Delfina nicht bis heute Abend das Bestattungsunternehmen ruft, darf sie sich über nichts wundern.«
Jacinto löste sich vom Tresen, reichte ihr eine Tüte mit einem Paar frisch besohlter Schuhe und nahm von der säuerlich blickenden Witwe ein paar Münzen entgegen. Als die Frau gegangen war, atmete der Schuster tief durch.
»Irgendwann sperren sie mir den Laden zu, aber lieber krepiere ich, als den Mund zu halten«, sagte Jacinto. »Wenn du Quim siehst, sag ihm, sie sollen den Alten begraben, bevor die Grauen aufkreuzen. Wegen ein bisschen Stockfisch, Mehl und Öl buchten die sie sonst noch ein. Der Señora Carmen ist nicht zu trauen. Was brauchst du, Kleiner?«
»Eine Gummihalbsohle.«
Jacinto drehte sich um, bis er das Gesuchte gefunden hatte. Er reichte sie ihm und warf einen Blick auf die Peseten, die ihm die Witwe für seine Arbeit gegeben hatte und die er noch in der Hand hielt.
»Ich lade dich auf eine Limo und einen kleinen Happen ein.«
»Heute ist Samstag, Jacinto. Ich muss noch eine Vormittagsvorstellung im Bretón und eine im Central beliefern.«
»Wir haben euch eure Kindheit gestohlen«, schimpfte der Schuster und schüttelte den Kopf. »Sag mal, gibt’s im Kino Central noch die Studentenglocke? Die auf das baldige Ende des Films hinweist, damit man nicht beim Fummeln erwischt wird?«
»Ich liefere nur die Filmrollen mit dem Rad aus. Von so was weiß ich nichts.«
»Daran tust du gut. Alles zu seiner Zeit. Wenn du erst einmal die Gefilde der Lust betrittst, wird sich die Liste der Dummheiten, die du im Leben begehst, beträchtlich verlängern.«
In diesem Moment ertönte erneut die Türglocke, und Dioni kam herein, im ganzen Viertel nur als der Trauerkloß bekannt, weil er tagaus, tagein den Tod seiner Pepita und vor allem seines Sohnes Martí beweinte, der zum Leidwesen seines Vaters unter den ersten Opfern der Blauen Division gewesen war, die auf Seiten der deutschen Wehrmacht gegen die Sowjetunion gekämpft hatte. Seither bestand Dionis Leben daraus, Barrechas – eine Mischung aus Anis und Moscatel – zu trinken, sich in den Kinos des Viertels einen runterholen zu lassen und die verlorene Sache zu verteidigen.
»Guten Tag allerseits«, grüßte er. »Hast du heute schon die Zeitung gelesen?«
»Geht’s um die vielen Tore, die César in dieser Saison machen wird?«
»Um die Vollstreckungen, die in La Vanguardia veröffentlicht werden«, antwortete Dioni und stellte eine verbeulte Sardinendose der Marke Baltar auf den Tresen, die jetzt als Sammelbüchse diente. »Diesmal hat es Juanillo getroffen, den Gehilfen aus der Schneiderei Modelo.«
»Dieser hässliche, dürre Bursche?«, fragte Jacinto.
»Das sagt der Richtige! Wir unterstützen seine Frau Pepi und die drei Jungs. Einen davon kennst du vielleicht, er ist in deinem Alter«, sagte der Alte, an Nil gewandt.
Der Junge zuckte mit den Schultern.
»Das war’s für heute mit dem Bier und einem Happen«, sagte Jacinto bedauernd, nachdem er die Peseten von der Witwe in die Büchse gesteckt hatte.
»Wo ist er hingerichtet worden?«, erkundigte sich Nil. Er befürchtete, dass diese Nachricht und die immer wiederkehrenden Träume, in denen sein Vater gefoltert wurde, irgendwie miteinander in Verbindung stehen könnten.
»Auf dem Montjuïc«, erklärte der Alte. »Ich muss weiter. Ich will noch zu anderen guten Menschen wie dir, Jacinto.«
»Aber das ist alles für Pepi. Nicht zwischendurch in der Kneipe einkehren!«, mahnte der Schuster, aber der Mann hörte ihn schon nicht mehr.
Der Wind, der die Paralelo hinunterwehte, schlug die Ladentür zu. Ein trauriger Schleier legte sich über Nils Blick.
»Dein Vater ist nicht auf dem Montjuïc«, sagte Jacinto und klopfte ihm auf die Schulter.
»Und wo ist er dann? Weißt du es?«
Diesmal schwieg der Schuster. In diesen Tagen wussten sogar Menschen wie er, wann es an der Zeit war, den Mund zu halten.
An jenem Augustmorgen hängte sich Nil die Tasche mit der Filmrolle von Go West – Die Marxbrothers im wilden Westen um und radelte los, während er davon träumte, dass eines Tages er die Filme in einem der Kinos vorführen würde, die er belieferte. Das Publikum im Central bestand wegen der Nachbarschaft zur Universität größtenteils aus Studenten. Der Fahrradkurier wusste, was ihn erwartete, wenn der Film nicht zur angekündigten Uhrzeit lief. Aber weder die Schlaglöcher in der Calle Aribau noch seine körperlichen Einschränkungen konnten ihn dazu bringen, sich auch nur um eine Minute zu verspäten. Für jemanden mit nur einem Arm war er außergewöhnlich geschickt. Mit den Jahren hatte er gelernt, dass die größten Einschränkungen auf Ängsten beruhten und nicht auf körperlichen Beeinträchtigungen.
Er stellte das Fahrrad in einem kleinen Raum hinter der Kasse des Kino Central ab und ging zu Fuß nach Hause, mit fünf Peseten in der Tasche und dem guten Gefühl, seine Arbeit getan zu haben. Während Nil die Ronda de San Antonio entlangging, dachte er darüber nach, wie er seine Mutter dazu bringen sollte, Delfina auf ihren Vater – Quims Großvater – anzusprechen und dass sie dessen Tod verheimlicht hatte. Es war kein Geheimnis, dass die beiden Frauen sich nicht mochten, aber wenigstens hatte Delfina versucht, mit der ihr eigenen Ungezwungenheit auf Soledad zuzugehen. Nil fand es eine beängstigende Vorstellung, dass man seinen Freund verhaften könne, weil er seinen toten Großvater versteckt hatte, um weiterhin dessen Lebensmittelkarte zu nutzen. Señora Carmen hatte Jacinto gegenüber deutliche Worte gefunden und mit ihrer Drohung nicht hinterm Berg gehalten. Es war kein Geheimnis, dass die wirkliche Gefahr in jenen Zeiten von redseligen Nachbarn ausging.
Nil hatte sich für diesen Samstag einen schönen dreizehnten Geburtstag vorgestellt, dessen größte Aufregung in der Überraschung bestehen würde, die Bernardo für ihn vorbereitet hatte, und den Plänen seiner Mutter, ihm etwas Besonderes zum Abendessen zu kochen. Er bog von der Paralelo in die Calle Poeta Cabañes ein. Vor der Hausnummer sieben angekommen, öffnete er das hölzerne Eingangstor, das von einem Draht zugehalten wurde, als ein Mann aus dem Hausflur gestürzt kam und mit ihm zusammenstieß. Durch den Aufprall stürzte der Junge auf die staubige Straße, ohne genau zu begreifen, wie ihm geschah. Der Mann, der einen grauen Anzug und ein weißes Hemd trug, packte den Jungen an der Brust und hob ihn mühelos hoch. Beim Anblick des Armstumpfs verzog er angewidert das Gesicht. Als ihm bewusst wurde, dass Menschen auf der Straße unterwegs waren, ließ er von dem Jungen ab, richtete seine eisblauen Augen auf ihn und legte den Zeigefinger an die Lippen. Dann fuhr er mit dem Finger in einer unmissverständlichen Geste die Kehle entlang.
Nil nickte verängstigt. Er atmete heftig, sein Puls jagte. Der Kerl sah aus wie Joseph Cotten in dem Film Im Schatten des Zweifels. Bevor er ging, klopfte er sich den Staub vom Revers und schenkte ihm ein Lächeln, das ebenso flüchtig wie vielsagend war. Nil stand in seiner kurzen Hose und dem zerrissenen, mit Erde beschmutzten Hemd da und rührte sich nicht von der Stelle, bis der Mann die Paralelo erreicht hatte und in der Menschenmenge verschwand. Ein abgemagerter schwarzer Kater strich am nackten Knie des Jungen entlang.
Nachdem Nil sich von dem Schreck erholt hatte, trat er in den Hauseingang. Trotz des dämmrigen Lichts konnte er auf dem Treppenabsatz einen Körper erkennen, der regungslos auf dem Boden lag. Er besaß weder die Eleganz des Mannes, der ihm gerade gedroht hatte, noch dessen Lebenskraft. Er trug ein fleckiges Leinenhemd und einen geflochtenen Gürtel, seine Füße waren merkwürdig verdreht. Der eine zeigte zu der abgeblätterten Decke, der andere, an dem der Schuh fehlte, zeigte in die entgegengesetzte Richtung. Als Nil verängstigt näher trat, sah er, dass Schaum aus seinem Mund quoll. Sein Atem war nur noch ein unregelmäßiges Röcheln. Der Junge beschloss, in den dritten Stock hinaufzulaufen und Doktor Fuster zu holen, der sich zwar nicht mehr Arzt nennen durfte, von dem aber jeder in der Nachbarschaft wusste, was er von Beruf war. Doch die Beine gehorchten ihm nicht so, wie er es gewohnt war.
Am schwierigsten war es, über den Körper hinwegzusteigen, ohne den Mann zu streifen, denn die Treppe war eng und besaß kein Geländer. Der Mann hatte eine klaffende Wunde an der Augenbraue und einen Bluterguss an der Schläfe. Nil stützte sich mit der Hand an der Wand ab. Als er den reglosen Kopf des Unbekannten schon überwunden hatte, hielt ihn etwas am Bein fest. Er hätte am liebsten geschrien, trat ein paarmal aus und versuchte, sich von den kalten Fingern des Sterbenden zu befreien. Der Mann gab einen kehligen Laut von sich und hob nun auch den anderen Arm, die Hand zur Faust geballt. Es war nicht das erste Mal, Nil kannte diese Geste von den Kameraden seines Vaters. Plötzlich öffnete sich die Faust, ganz langsam, als würde bei jeder Bewegung ein Knochen brechen. Nil war neugierig, was der Sterbende zwischen den Fingern hielt. Er nahm es ihm ab, wobei er darauf achtete, den Unglücklichen nicht zu berühren.
Es handelte sich um die zerknickte Sammelkarte eines Filmschauspielers. Ein Dandy der damaligen Zeit: Brillantine im Haar, schmales Schnurrbärtchen und grüne Augen, so grün wie der Nadelstreifenanzug, den er trug. Sein Blick war herausfordernd und strahlte Selbstsicherheit aus, und auf seinen Lippen lag ein angedeutetes Lächeln, das ihm etwas Verführerisches verlieh. Unter dem goldgerahmten Porträt standen die Zahl 57 und ein Name: Blas Montjuïc. Nil ging in die Hocke und stellte fest, dass die äußere Erscheinung des Filmstars Lichtjahre von der des unglückseligen Unbekannten entfernt war. Angesichts der ratlosen Miene des Jungen sprach der Mann ein deutlich verständliches Wort aus: »David.« Betroffen richtete sich Nil auf und ging langsam die Treppe hinauf, mit zögernden Schritten, wie sie die Ungewissheit mit sich bringt. Er betastete die Hosentasche mit dem Schlüsselbund. Solange es ihm nicht gelang, das merkwürdige Gefühl loszuwerden, das ihn bei der Erwähnung dieses Namens erfasst hatte, dachte er nicht mehr daran, Doktor Fuster zu holen.
Plötzlich waren Stimmen vom Treppenabsatz zu hören. Die eine klang hart und autoritär. Eine zweite, unterwürfige Stimme erwähnte das Wort »Inspector«. Der Junge, der Angst hatte, von der Polizei mit Fragen bedrängt zu werden, schlich sich leise in die Wohnung. Dort setzte er sich auf den Boden, den Rücken gegen die Tür gelehnt, und versuchte, ruhig zu atmen.
Plötzlich verstummten die Stimmen, und nach einer kurzen Stille, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, hörte er dumpfe Schläge, als würde jemand auf einen Sandsack eindreschen. Nil wollte nicht mit eigenen Augen sehen, was dort unten vor sich ging. Andernfalls wäre er Zeuge geworden, wie der Besitzer der autoritären Stimme mit dem Fuß gegen den Kopf des Schwerverletzten trat. Der Junge klapperte mit den Zähnen, seine Hände waren schweißnass.
In seiner Angst kauerte er sich zusammen und machte sich ganz klein, als könnte er so dieses furchtbare Geräusch ausschalten, das auch in seinem Albtraum immer wieder vorkam. Diesem wiederkehrenden Albtraum, in dem ein dunkler Schatten David Roig folterte, seinen Vater, geflohen am 26. Januar 1939, dem Tag, an dem sich Barcelona in eine verängstigte, traurige Stadt verwandelt hatte, in der Tausende hungernder Seelen verstummten und ihre Träume begruben.
3
Zehn Minuten später herrschte Aufruhr im Treppenhaus. Nil erkannte die ferne Stimme von Delfina, Quims Mutter, mit diesem galicischen Singsang, den sie niemals ganz losgeworden war. Dann hämmerte jemand so heftig gegen die Wohnungstür, dass die Wand bebte. Als der Junge das Wort »Polizei« hörte, öffnete er.
»Ist sonst keiner zu Hause?«, fragte der Mann, dem die unterwürfige Stimme gehörte, die er vorhin gehört hatte.
Nil schüttelte den Kopf.
Dieser Polizist mit dem pockennarbigen Gesicht trug keine Uniform. Dunkler Blouson mit Schuppen auf den Schultern, Krawatte im gleichen Ton und ein graues, schweißfleckiges Hemd. Unter dem Revers war eine Plakette zu erahnen.
»Hast du etwas Auffälliges bemerkt?«, fragte der Polizist, während er unverhohlen auf den Armstumpf des Jungen starrte.
Nil schüttelte erneut den Kopf und hob die Schultern.
»Dass dir ein Arm fehlt, sehe ich, aber hast du auch deine Zunge verschluckt? Los, bring mir mal ein Glas Wasser, bei dieser Hitze kann man ja nicht arbeiten.«
Nil gehorchte und ging in die Küche. Er füllte ein Glas mit Leitungswasser und brachte es dem Polizisten. Die unterwürfige Stimme klang jetzt härter, bestimmter.
»Die mischen immer mehr Chlor rein. Mit wem wohnst du hier, Junge?«
Delfinas erstickter Schrei verriet, dass seine Nachbarin soeben den Toten entdeckt hatte. Durch die halb geöffnete Tür konnte Nil mitverfolgen, was sich im Treppenhaus abspielte.
»Stumm und taub«, konstatierte der Polizist resigniert, während er das Glas ins Spülbecken zurückstellte.
»Mit meiner Mutter«, antwortete Nil schließlich.
»Und die ist arbeiten, richtig?«, stellte der Polizist fest, nachdem er sich umgeschaut hatte.
Der Mann schlurfte beim Gehen, die Daumen im Ledergürtel eingehakt. Was er sah, passte zum Rest des Viertels. Eine stickige Küche, Wände, von denen der Putz abblätterte, und zwei gerahmte Fotografien. Ein kleines Mädchen mit durchdringendem Blick und ein lächelnder Mann. Er studierte das zweite Foto einen Moment lang und stellte es dann an seinen Platz zurück. Die Wohnung roch nach Bleiche, ein Geruch, den der Polizist immer mit Anständigkeit verband. Er ging ohne ein weiteres Wort. Nil sah ihn die Treppe hinaufgehen und folgte ihm in einigem Abstand. Auf dem Treppenabsatz zum zweiten Stock blieb der Junge stehen. Der andere Polizist, der mit der autoritären Stimme, sprach mit Doktor Bonifaci Fuster.
»Guten Tag, Inspector Valiente«, grüßte Fuster mit gesenktem Kopf. Seine Stimme zitterte.
Nil kannte diese Angst nur zu gut. Sie hatte die gesamte Stadt erfasst und einige Menschen ganz besonders. Doktor Fuster war einer von ihnen. Achtunddreißig Jahre alt, Republikaner und Facharzt für den Verdauungstrakt, war er zunächst im Exil in Frankreich und dann in Russland gewesen und hatte spanische Gefangene in den Konzentrationslagern behandelt. Er hatte Krätze, Flöhe und Elend mit jenen geteilt, denen es gelungen war, zu überleben, und war Zeuge von Tod und Demütigungen geworden. Warum versagte einem Mann wie ihm angesichts dieses Inspectors die Stimme? Weshalb verströmte er diesen Geruch nach unterwürfigem Gehorsam?
Valiente ging mit gestrafftem Rücken um Fuster herum und musterte ihn von Kopf bis Fuß. Dann spuckte er ihm auf die Schuhe.
»Du widerst mich an«, sagte der Inspector mit ernster Miene, schloss die Augen und drückte mit den Fingern die Augenbrauen zusammen. »Ich dachte, wir hätten Ratten wie dir den Garaus gemacht.«
Bonifaci Fuster traute sich nicht, etwas zu erwidern.
»Sag mir eines«, flüsterte der Inspector dem Arzt ins Ohr. »Ist das ganze Haus von Republikanern verseucht?«
»Ich wohne erst seit einem Monat hier. Ich kenne praktisch niemanden.« Bonifaci Fuster dachte daran zurück, wie ausgerechnet dieser Inspector ihn nach seiner Ankunft in der Stadt in einer Pension im Barrio Chino identifiziert hatte. Drei zögerliche Antworten und die Schweißperlen auf der Stirn hatten dem Inspector genügt, um die republikanische Vergangenheit dieses Arztes aufzudecken, der nach Armut und Angst roch. Einen Tag später war er in die Kommandantur einbestellt worden, wo Fuster jedoch ohne die Geldsumme erschien, die der Inspector verlangt hatte. Der Entzug der ärztlichen Approbation und das Verbot, seinen Beruf auszuüben, waren die Konsequenzen daraus, dass er nicht auf die Erpressung des Polizisten eingegangen war, der ihm angeboten hatte wegzusehen.
»Dann hast du vermutlich auch nicht gesehen, wer den da ermordet hat«, schloss Valiente und deutete mit dem Kinn in Richtung Treppenhaus.
»Ich bin rausgegangen, weil ich Stimmen hörte, aber gesehen habe ich nichts.«
Inspector Valiente verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht, dass die Unterlippe aufplatzte. Fuster schluckte den metallischen Geschmack seines eigenen Bluts und dann seinen Stolz herunter. Als ihn der zweite Schlag traf, diesmal in die Magengrube, schossen ihm die Tränen in die Augen. Auf dem Boden kniend, die Hände auf die schmerzende Stelle gepresst, begann er zu zittern.
»Mach du mit dem Verhör der Ratte weiter«, befahl Inspector Valiente seinem Kollegen. »Um die galicische Hure von gegenüber habe ich mich schon gekümmert. Die Schlampe war gerade erst aufgestanden. Wie das so ist, wenn man von der Hurerei lebt.«
Der Polizist wartete darauf, dass Fuster aufstand, aber als er sah, dass das mehr Zeit in Anspruch nahm, als er hatte, half er ihm schließlich auf. Der Arzt bedankte sich mit einem schwachen Kopfnicken. Wortlos verschwanden die beiden in der Wohnung. Valiente stieg weiter die Treppe hinauf und blieb vor der Tür von Bernardo und Paulino stehen. Nil ging ebenfalls ein Stockwerk höher. Von dort hatte er bessere Sicht. Der Polizist klingelte Sturm und zog seine Dienstmarke. Die Tür wurde umgehend geöffnet, und Paulino erschien.
»Ja, bitte?«
Valiente stützte sich mit einer Hand am Türrahmen ab und schob Paulino mit der anderen grob beiseite. Dann trat er mit militärischem Schritt in die Wohnung. Der braune Anzug und das beige Hemd waren ihm eine Nummer zu klein, sein stattlicher Bauch drohte mehr als einen Knopf zu sprengen. Valiente war in den Vierzigern, ein Koloss mit kahl geschorenem Schädel, gelblicher Haut und dunklen, rot geränderten Augen unter tiefhängenden Lidern. Mit einer Handbewegung fegte er mehrere Bücher aus einem Regal und schenkte sich ein Glas von dem Wein ein, der neben einem Teller mit Kichererbsen und einem Stück trockenem Brot auf dem Tisch stand.
»Ist noch jemand zu Hause?«, fragte der Inspector, während er sich gierig ein zweites Glas einschenkte.
»Im Moment nicht.«
»Und wen habe ich das Vergnügen noch nicht kennenzulernen?«
»Bernardo Parra, meinen Mitbewohner.«
Der Inspector warf missmutig den Löffel auf den Teller, trat vor Paulino und hob mit einem Finger sein Kinn an.
»Seid ihr Schwuchteln?«
»Verzeihung, Inspector?«, stotterte Paulino.
»Ob ihr vom anderen Ufer seid?«
»Wir kennen uns aus dem Viertel, und bei den Löhnen heutzutage … Sie wissen ja.«
»Ich bin dieses ständige Gejammere leid. Was soll das? Ist es dir vorher besser gegangen? Schau dich doch an.«
Paulino senkte den Blick.
»Man braucht dich nur zu riechen und zu sehen, wie du rasiert bist, dann weiß man, auf welchem Bein du hinkst. Wer außer einer Schwuchtel würde ein lila Hemd mit dazu passenden Leinenschuhen tragen?«
»Nein, Inspector, ich bin nicht …«
Durch die angelehnte Tür hörte Nil eine schallende Ohrfeige. Dann sah er, wie der Teller mit den Kichererbsen an der Wand zerschellte und wie Valiente Paulino am Genick packte und ihn zwang, die auf dem Boden verteilten Reste zu essen. Als der Inspector genug von dem Schauspiel hatte, trat er seinem Opfer mit dem Fuß in die Rippen und schenkte sich ein drittes Glas Wein ein, während Paulino nach Luft rang.
»Der Wein verrät uns, was für eine Person jemand ist«, sagte Valiente. »Und das hier ist purer Essig.«
Valiente schüttete die Flasche über Paulinos Kopf aus und schleuderte sie dann gegen ein mit Büchern gefülltes Regal.
»Vielleicht komme ich später noch mal wieder.«
Als Nil diese vorläufige Verabschiedung hörte, stürzte er die Treppe hinunter, wobei er mehrere Treppenstufen auf einmal nahm. Er schlüpfte zwischen den neugierigen Nachbarn hindurch auf die Straße, ohne einen weiteren Blick auf den reglosen Körper des Mannes zu werfen, der den Namen seines Vaters ausgesprochen hatte, und machte sich auf den Weg zur Schreinerei. Er musste unbedingt verhindern, dass seine Mutter diesem widerlichen Kerl namens Inspector Valiente begegnete.
4
In diesen dunklen Zeiten eröffnete 1940 die Avenida de la Luz, die »Straße des Lichts«, eine unterirdische Ladenpassage im Zentrum Barcelonas, durch die man auch zu den Stationen der katalanischen Eisenbahn aus Richtung Sarrià gelangte. Neben Läden wie der Confiserie Cataluña und diversen Boutiquen, die angesichts des Hungers, der nach dem Bürgerkrieg herrschte, völlig fehl am Platz wirkten, wurde drei Jahre später das Kino Avenida eröffnet. Es war auch als »Palast des Lachens« bekannt, weil auf dem Spielplan jede Menge Komödien standen, etwa mit Stan Laurel und Oliver Hardy oder Abbott und Costello. Bernardo war der Filmvorführer des Kinos, und das seit dem Tag der Eröffnung, an dem als Hommage an Walt Disney Der kleine Lord gezeigt wurde.
»Im Falle eines Stromausfalls keine Rückerstattung«, las Nil auf dem Schild, das die Kassiererin an die Scheibe gehängt hatte. Es hing gleich neben der Liste mit den Eintrittspreisen, die unterschiedlich hoch ausfielen, je nachdem, ob man Parkett oder Loge wählte und ob man an Wochen- oder Feiertagen ins Kino ging. Die billigste Eintrittskarte kostete eine Pesete, die teuerste zwei fünfzig. Eine Frau trat zu Nil und nahm ein Programmheft von einem Stapel auf der Ablage, nicht ohne vorher das besagte Schild zu lesen.
»Wo soll das noch hinführen?«, schimpfte die Frau so laut, dass die Kassiererin sie sicher auch hören konnte. »Sogar im Kino will man uns das Geld aus der Tasche ziehen. Dabei wird doch alle naselang der Strom abgestellt.«
Nil grinste über die zutreffende Bemerkung, als Bernardo erschien. Der Filmvorführer sah ernst aus. Der Junge wusste nicht, wo er anfangen sollte.
»Heute ist etwas Furchtbares im Treppenhaus passiert.«
Bernardo legte ihm eine Hand auf die Schulter und tätschelte seine Wange.
»Ich weiß Bescheid, Nil.«
Ein paar Minuten zuvor war Paulino vorbeigekommen, um ihm zu berichten, was im Treppenhaus passiert war, insbesondere das mit dem Polizeiinspektor.
»Aber dieses Pack wird uns nicht deinen Geburtstag vermiesen. Komm mit.«
»Wohin gehen wir?«, fragte Nil, jetzt schon etwas beruhigter. Die Bürde, die seit seiner Flucht aus dem Haus auf ihm gelastet hatte, fiel von ihm ab.
»Komm einfach mit. Ich finde es übrigens gut, wenn du deinen Armstumpf nicht versteckst.«
Nil schaute ihn prüfend an, um herauszufinden, ob die Bemerkung ernst gemeint war, dann betrachtete er seinen amputierten Arm und straffte sich. Wenn er etwas an Bernardo mochte, dann, dass er ihn nicht wie einen Krüppel behandelte. Er bemerkte bei ihm nie eine Spur von Herablassung.
Sie traten aus dem Untergrund der Avenida de la Luz auf die zentral gelegene Calle Pelayo. Ein violettes Wolkenfeld verhieß eine Atempause von der Hitze. Da Bernardo sich weigerte, die Metro zu benutzen, waren sie über eine halbe Stunde unterwegs. Wenn der Mann aus der Vorführkabine kam, musste er sich die Beine vertreten und den Puls der Stadt fühlen, auch wenn der kurz vorm Stehenbleiben war. Die Narben des Bürgerkriegs waren überschminkt, aber so, wie sich im Laufe der Jahre Falten in die Haut graben, konnte dieses düstere Barcelona seine Mutlosigkeit nicht verbergen. Vor dem Haupteingang von Radio Barcelona in der Calle Caspe durchwühlten ein junger Mann und sein kleiner Sohn die Abfalleimer nach etwas Essbarem. Beide waren abgemagert, trugen zerschlissene Kleidung und hatten starken Ausschlag von der Krätze.
»In dreißig, vierzig Jahren wird es solche Szenen nicht mehr geben.« Bernardo schüttelte heftig den Kopf. Er war fest davon überzeugt, dass die Zukunft ein besserer Ort war. »Unsere Fehler müssen für irgendetwas gut sein.«
Auf Höhe der Hausnummer 201 in der Calle Mallorca erinnerte ein imposantes Glasgebäude daran, dass es auch in dunklen Zeiten stets einen Lichtblick gab. In der Fassade warfen große, ebenerdige Fenster das Spiegelbild der Passanten zurück und schützten gleichzeitig die Beschäftigten vor neugierigen Blicken. Am oberen Abschluss des Gebäudes ragte das Emblem eines Löwenkopfes in einem goldenen Kranz mit dem Wahlspruch ARSGRATIAARTIS in den Himmel.
»Willkommen bei Metro-Goldwyn-Mayer, mein Junge.«
Das war der Löwe, den er so oft im Vorspann der Kinofilme gesehen hatte, und jetzt prangte er an diesem Gebäude dort vor ihm, der Traumfabrik seiner Stadt.
Bernardo grüßte den livrierten Portier, der ihn zwar beim Namen kannte, ihm aber dennoch den Zutritt zum Gebäude verwehrte, indem er ihm mit dem Arm den Weg versperrte. Bernardo schob Nil vor, um die Aufmerksamkeit auf den Armstumpf des Jungen zu richten. Als auch das nicht ausreichte, zog er eine Packung Lucky Strike aus der Tasche.
»Feines Zeug, Gregorio«, sagte Bernardo zu dem Portier. »Danach widern dich die Ideales an. Ich muss mit Miralles sprechen.«
Der Portier trat zur Seite, während er überschlug, wie viel ihm jede einzelne Zigarette beim Verkauf einbringen würde.
Das Gebäude von Metro-Goldwyn-Mayer war eine Sensation dieser Epoche. Das Tageslicht durchflutete die offenen Räume. Angestellte in weißen Hemden und Krawatte eilten geschäftig hin und her, eine Zigarette in der Hand, während andere flink auf Schreibmaschinen einhämmerten. Es war eine Oase amerikanischer Geschäftigkeit in der Stadt. Neben einigen geschlossenen Türen hingen Filmplakate: Captain Courageous, Tarzan und sein Sohn, Night Must Fall, Der Zauberer von Oz und andere mehr. Bernardo und besagter Miralles fielen sich in die Arme. Nachdem sie ein paar Worte gewechselt hatten, sahen die beiden lächelnd zu Nil herüber, der gebannt vor den Filmplakaten und den Fotos der Stars stehen geblieben war. Bei einem davon stockte ihm der Atem. Eingerahmt von Linda Darnell und Victor Mature, grinste ihm Joseph Cotten siegesgewiss entgegen. Nil überlegte, Bernardo von dem Mann zu erzählen, der dem Hitchcock-Schauspieler so ähnlich gesehen hatte, verwarf den Gedanken aber wieder. Letztendlich hatte dieser Kerl nur von ihm verlangt, den Mund zu halten, und das würde er auch tun. Während er in dem Raum umherging, hatte der Junge das unbestimmte Gefühl, schon einmal dort gewesen zu sein. Aber der dunkle Schleier einer Vergangenheit, die von Verlusten geprägt war, machte es ihm unmöglich, sich genauer zu erinnern.
Schließlich ging Miralles, ein beleibter Mann mit rotem Gesicht, der aussah, als bekäme er gleich einen Herzinfarkt, auf den Jungen zu.
»Such dir eines aus«, sagte er, die Daumen unter die Hosenträger geklemmt. Aus der Hose hätte sich Nil zwei Jacken schneidern können.
»Wirklich?«, fragte der Junge.
Miralles nahm das Tarzan-Plakat ab, faltete es sorgfältig und überreichte es ihm.
»Man hat mir gesagt, du wolltest ihn kennenlernen.«
Nil nickte begeistert.
»Kommt mit«, sagte Miralles.
Sie betraten einen großen Raum, der wegen des roten Samts an den Wänden und auf dem Fußboden an einen Kinosaal erinnerte. Er diente als Vorraum zum Synchronisationsstudio, das sich im hinteren Bereich des Gebäudes befand. Nil machte es sich auf einem weißen Ledersofa bequem, ein Möbelstück, das es in seiner kleinen Welt nicht gab. Bernardo und Miralles diskutierten mit einem gut aussehenden jungen Mann im dunklen Anzug. Er hatte das Haar sorgfältig nach hinten gekämmt, seine Stimme klang entschieden.
»Heute geht’s nicht, Miralles. Heute ist nicht der richtige Tag dafür.«
»Ich arbeite seit über zehn Jahren für diese Firma, da werde ich doch wohl erfahren dürfen, warum wir nicht ins Studio können«, protestierte Miralles, ohne auf Bernardos Arm zu achten, der ihm bedeutete, dass es besser wäre, zu schweigen.
»Also gut«, sagte der junge Angestellte seufzend und mit deutlich amerikanischem Akzent. »Aber ich muss Sie um absolutes Stillschweigen bitten.« Bernardo und Miralles nickten nachdrücklich und sahen ihn erwartungsvoll an. »Der Bruder unseres Synchronisationsleiters Pierre Bernier wurde ermordet.«
»Mein Gott«, entfuhr es Miralles. Er wischte sich mit dem Taschentuch über die Stirn.
»Wo ist das passiert?«, fragte Bernardo, der so eine Vorahnung hatte.
»Was interessiert es dich, wo es passiert ist?«, gab Miralles ärgerlich zurück.
»In einem Hauseingang im Poble Sec«, antwortete der junge Mann. »Unser Pierre ist am Boden zerstört. Sie werden sicher verstehen, dass heute nicht der beste Tag ist, um die Studios zu besuchen.«
Bernardo und Miralles nickten erneut, diesmal mit verlorenem Blick. Der junge Mann drückte den beiden kurz die Hand und verabschiedete sich mit einem Kopfnicken.
»Ist er einer von uns oder von den anderen?«, erkundigte sich Bernardo, nachdem der Amerikaner verschwunden war.
»Sagen wir mal so: Er buckelt vor allem, was nach Regime riecht, sympathisiert aber insgeheim mit der dreifarbigen Flagge. Du brauchst dir nur anzuschauen, wer der Leiter der Synchronabteilung ist.«
Pierre Bernier, dachte der Filmvorführer mit einer gewissen Melancholie. Andere Zeiten, ein anderes Leben.
»Schnüffelt die Geheime nicht hier rum?«
»Der Amerikaner ist ein schlauer Fuchs, Metro-Goldwyn-Mayer zahlt pünktlich seine Abgaben. Auch an die Polizei, du verstehst schon.«
Bernardo nickte mehrmals. Er sah bedrückt aus.
»Was ist mit dir los?«, fragte Miralles, als er es bemerkte.
Bernardo machte eine beschwichtigende Handbewegung, als wollte er eine Fliege verscheuchen. Miralles sah zu Nil hinüber.
»Ich habe noch einen Ersatzplan in petto.« Er warf einen Blick auf die Armbanduhr. »Vielleicht sind sie schon fertig. Gib mir fünf Minuten.«
Als Miralles den Raum verlassen hatte, setzte sich Bernardo zu Nil, der lieber schwieg, obwohl er ahnte, dass irgendetwas nicht gut lief. Der Filmvorführer seufzte tief und blätterte dann in einer der Ausgaben von Primer Plano, die auf einem Tisch in der Mitte des Raumes auslagen. Auf dem Titel waren die Schauspieler Fernando Fernán Gómez und Sara Montiel abgebildet. Während Bernardo die wichtigste Zeitschrift des spanischen Kinos durchsah, kam ein Mädchen in Nils Alter durch eine Tür, die bislang verschlossen gewesen war. Sie hatte glattes, dunkles Haar und strahlend grüne Augen, die aufleuchteten, als sie bemerkte, dass sie nicht alleine im Raum war. Sie ließ sich im Schneidersitz auf dem Boden nieder und richtete ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die beiden Unbekannten.
»Hallo, meine Hübsche. Willst du dich zu uns setzen?«, fragte Bernardo und schenkte ihr sein freundlichstes Lächeln, während er seinen Begleiter in die Rippen stieß.
Das Mädchen schüttelte den Kopf und fragte zurück: »Seid ihr Schauspieler?«
Nil und Bernardo lachten bei dem Gedanken.
»Ich bin nämlich beim Film«, verkündete sie.
Nil warf Bernardo einen Seitenblick zu, ohne sich von den grünen Augen ablenken zu lassen, die ihn eindringlich musterten. Das Mädchen trug eine Strickjacke und einen Faltenrock. Die abgetragenen Schuhe verrieten ihre Herkunft, aber die runden Wangen und die strahlende Haut waren der Spiegel einer guten Ernährung. Etwas an ihr verwirrte Nil.
»Ich bin eine der Synchronsprecherinnen im Zauberer von Oz«, verkündete das Mädchen stolz.
»Und wer bist du im Film?«, fragte Nil ungläubig.
»Wenn du sie siehst, wirst du es erraten.«
Bernardo und Nil dachten angestrengt nach, aber keiner von ihnen erinnerte sich, welche Filmfigur mit der honigsüßen Stimme dieses Mädchens sprach. Eine Stimme, die leicht hochnäsig, aber gleichzeitig hypnotisierend klang.
»Was ist mit deinem Arm passiert?«, fragte das Mädchen ganz natürlich.
»Der Krieg«, antwortete Nil kurz angebunden.
»Und was macht ihr hier?«
Bernardo legte die Zeitschrift an ihren Platz zurück, schlug die Beine übereinander und verschränkte die Arme über der Rückenlehne des Sofas.
»Wir besichtigen das Gebäude. Heute ist Nils Geburtstag. Er wird dreizehn«, erklärte er und deutete auf den Jungen, »und gleich wird er Tarzan kennenlernen.«
Nil lief knallrot an und trat Bernardo kräftig auf den Fuß.
»Johnny Weissmüller?«, fragte das Mädchen verwundert.
»Mehr oder weniger«, entgegnete Bernardo. »Und wie heißt du?«
»Lolita«, sagte sie, den Blick fest auf Nil gerichtet. »Wie spät ist es?«
Bernardo hob die Hand, um zu zeigen, dass er keine Uhr besaß. Am Handgelenk waren lediglich vernarbte Spuren früherer Festnahmen zu sehen.
»Ich gehe dann mal zum Ausgang, um auf meinen Großvater zu warten. Er muss gleich kommen.«
Lolita sprang auf, stützte sich mit einem Knie auf dem Sofa ab und beugte sich vor, um den Jungen auf die Wange zu küssen.
»Herzlichen Glückwunsch, Nil.«
Als Lolita gegangen war, musste Bernardo sich vergewissern, dass der Junge keinen Herzanfall erlitten hatte. Zwei kräftige Schläge auf den Rücken sollten ihn in die Realität zurückholen, aber Nil blieb in dem Zauber gefangen, den Lolita verbreitet hatte.
In dem Moment kehrte Miralles in Begleitung einer Frau und eines Mannes zurück. Die beiden waren um die vierzig, ihre Kleidung saß wie angegossen. Kein Vergleich mit den Anzügen, die Bernardo von so mancher Witwe erhielt, die im Gegenzug auf körperliche Zuwendungen des Filmvorführers hoffte.
»Weißt du, wer das ist, Nil?«, fragte Miralles zufrieden, als er den erwartungsvollen Blick des Jungen sah. »Schließ einen Moment die Augen, hör genau zu und stell dir vor, du wärst im Urwald.«
Der Junge gehorchte. Eine samtige, sonore Stimme stellte sich als Jane vor. Ihr Gegenüber sprach mit tieferer Stimme unsicher seinen Namen aus, Tarzan, immer und immer wieder, als fände er Gefallen daran, sich selbst zu hören. Das nächste Wort, das er sagte, war »Unga«. Nil stellte sich mit geschlossenen Augen die Szene vor, in der Tarzan Jane verständlich machte, dass Unga »Essen« bedeutete. Janes Stimme fragte ängstlich, warum er sie an diesen Ort in den Dschungel gebracht habe, aber Tarzan antwortete nur: »Ich Tarzan, du Jane.«
Nil stand lächelnd vom Sofa auf, lehnte sich zurück und richtete den Blick auf einen fiktiven Himmel, wo Johnny Weissmüller mit Maureen O’Sullivan sprach, um durch ihre Stimmen einen Augenblick ihres Lebens mit ihm zu teilen. Plötzlich kam ihm ein Gedanke, der mit einem Federstrich das Lächeln von seinem Gesicht löschte. Von seinem Vater und seiner Schwester war ihm kaum mehr in Erinnerung geblieben als die Fotografien, die er tagtäglich in der Küche sah. Auf beiden blickten sie lächelnd in die Kamera und auf das Leben, nicht wissend, was das Schicksal für sie bereithielt. Abgesehen von diesen Momentaufnahmen verschwammen die Erinnerungen wie eine Tuschezeichnung im Regen. Jeden Abend vor dem Einschlafen versuchte der Junge, sich seinen Vater ins Gedächtnis zu rufen, um gegen das unbarmherzig fortschreitende Vergessen anzukämpfen.
Auch jetzt schloss er die Augen und bat darum, sich an die klare väterliche Stimme erinnern zu können, die er so sehr brauchte. Doch es blieb bei einem vergeblichen Versuch.
5
Sie gingen schweigend den Paseo de Gracia hinunter. Während Nil die Stadt mit den Augen aufsog, ging Bernardo gedankenverloren neben ihm her. Die unerwartete Ermordung von Pierre Berniers Bruder hatte alles auf den Kopf gestellt. Wenn sich die Lage beruhigt hatte, würde er zu Metro-Goldwyn-Mayer zurückkehren und darum bitten, ihm Zugang zu den Archiven zu gewähren. Er wollte Nil unbedingt einen schönen Geburtstag bereiten. Aber wie ihm der junge amerikanische Angestellte bereits gesagt hatte: »Heute ist nicht der richtige Tag.«
Als er über das Vorgefallene nachdachte, machte sich ein ungutes Gefühl in seiner Magengrube breit. Genau wie Bernardo hatte sich auch Pierre Bernier vor einer Weile aus der Organisation zurückgezogen. Der unerwartete Tod seines Bruders konnte viele Geister aus der Vergangenheit anlocken. Nicht einmal Paulino wusste genau, was Bernardo getrieben hatte, bevor die Stadt von der feindlichen Seite eingenommen wurde. Die Aussicht, gemeinsam ein angenehmes Leben zu führen, hatte sein anderes, unangepasstes Ich und den Schmerz über den verlorenen Kampf zum Schweigen gebracht. Jedes Mal, wenn er die Nachricht von der Ermordung eines der ihren erhielt, empfand Bernardo tiefe Scham. Scham darüber, dass er diejenigen im Stich gelassen hatte, die weiterkämpften, um die Situation im Land zu verändern, und dabei wie Nils Vater David auf das verzichteten, was sie am meisten liebten.
Als sie von einem Sommergewitter überrascht wurden, beschlossen sie, sich unter dem Dachgesims eines Gebäudes in der Calle Diputación unterzustellen. Bernardo fischte eine Zigarette aus der Hosentasche und zündete sie an, während er in den sanften Regen hinaussah.
Der Besuch in dieser Kathedrale des Kinos und die Tatsache, dass Bernardo keine Mühen gescheut hatte, um ihm eine Freude zu machen, ließen Nil erneut erwägen, seinen Freund in sein jüngstes Geheimnis einzuweihen. Wenn es jemanden gab, dem er vertrauen konnte, dann ihm. Der Junge beschloss, ihm die Sammelkarte des Schauspielers, die der Sterbende ihm auf der Treppe gegeben hatte, zu zeigen.
»Kennst du den?«, fragte er.
Bernardo nahm die Karte und betrachtete sie genauer. Er schüttelte den Kopf. Aber als er aufblickte, war er in Gedanken versunken und versuchte, dieses Gesicht unterzubringen, das ihm irgendwie bekannt vorkam.
»Woher hast du die?«
»In einer Schürzentasche meiner Mutter gefunden.«
»Du sollst nicht in ihren Sachen rumschnüffeln. Weiß sie davon?« Bernardo machte Anstalten, die Karte in die Hosentasche zu stecken. »Ich werde sehen, was ich über den Kerl rausfinden kann, wenn er dich so interessiert.«
Mit einer für einen Einarmigen erstaunlichen Behändigkeit entriss Nil ihm die Karte. Bernardo hob entschuldigend die Hände.
»Schon gut, schon gut. Ich weiß, wer uns dabei helfen kann, mehr über deine Karte rauszufinden, aber heute ist es schon zu spät.«
Nil sagte nichts. Weiter zu beharren konnte Bernardos grenzenlose Neugier wecken.
»Übrigens«, fuhr der Filmvorführer fort, »heute war Miquel bei mir, der Friseur. Er hat sich beklagt, dass ihm schon wieder die Kinokarten gestohlen wurden, die man ihm immer unter der Tür durchschiebt, dafür, dass er das Programm des Kino Condal auslegt. Du hast wahrscheinlich keine Idee, wer das gewesen sein könnte?«
»Keinen Schimmer«, antwortete Nil.
Der Junge streckte die Hand aus und stellte fest, dass der Regen nachließ.
»Gehen wir weiter?«
Im Handumdrehen hatten sie die Paralelo erreicht – der Name, unter dem die belebte Straße im ganzen Viertel bekannt war. Es wurde als Affront betrachtet, sie bei ihrem neuen Namen Avenida Marqués del Duero zu nennen. Jede Würdigung des Militärs war ein Tiefschlag für die Bewohner des Poble Sec, die auf solche Initiativen allergisch reagierten.
Bernardo bat Nil, einen Moment vor der Schaufensterauslage des Café Español zu warten. Es war Paulinos liebster Aufenthaltsort, vor allem an grauen Tagen wie diesen, an denen die Demütigungen wieder hochkamen und der sensible Mann in eine gefährliche Traurigkeit verfiel. Ein ähnlicher Vorfall wie der, der sich am Vormittag mit Inspector Valiente ereignet hatte, hatte Paulino vor Jahren dazu getrieben, eine ganze Schachtel Tabletten zu schlucken. Dass Paulino seine Niedergeschlagenheit mit Cognac bekämpfte, war in letzter Zeit zur Gewohnheit geworden. Es beunruhigte Bernardo, dass er ihn um diese Uhrzeit nicht im Café antraf, wo er normalerweise angetrunken und voller Begeisterung die übrigen Gäste mit Geschichten aus der Zeit unterhielt, als er neben Estrellita Castro eine kleine Rolle in dem Film Torbellino bekommen hatte. Bernardo besaß noch die Kinozeitschriften, die dem jungen Mann mit den griechischen Gesichtszügen eine vielversprechende Zukunft voraussagten, bevor Jahre später ein einfacher, unbekannter Platzanweiser aus ihm wurde.
Er beschleunigte seine Schritte, ohne Nil weitere Erklärungen zu geben. Als sie in die Calle Poeta Cabañes einbogen, wusste er, dass der Tag noch eine weitere Überraschung für ihn bereithielt. Die Ankunft eines blitzblanken schwarzen Lancia Ardea hatte das ganze Viertel in Aufruhr gebracht. Neugierige Köpfe erschienen auf den Balkonen mit den Kanarienvögeln, den welken Geranien und den verrosteten Geländern. Angst verbreitete sich, als die Beifahrertür geöffnet wurde und Inspector Valiente ausstieg. Zunächst galt seine Aufmerksamkeit dem einarmigen Jungen, doch gleich darauf gebot er Bernardo mit einem lauten, schmerzhaften Schlag gegen die Brust Einhalt.
»Wir kennen deine Vergangenheit, Bernardo. Was hatte der Franzose in diesem Haus zu suchen?«, wollte Valiente von dem Filmvorführer wissen.
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Inspector«, antwortete Bernardo.
Er schob Nil eilig in den Hausflur. Der Junge gehorchte widerspruchslos, aber er zog die Tür nicht ganz zu und wurde so zum Zeugen der weiteren Geschehnisse.
»Komm her.« Valientes Stimme klang streng. Bernardo machte sich auf den ersten Schlag gefasst. »Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge.«
Im Inneren des Lancia tauchte ein Schatten auf, öffnete die Tür und stieß Paulinos geschundenen Körper auf die Straße. Bernardo wollte dem Mann zu Hilfe eilen, dessen Augen hinter den zugeschwollenen Lidern nicht zu erkennen waren. Seine Nase war gebrochen, und aus seinem Mund rannen Blut und Galle. Als Bernardo sich bückte, nutzte Valiente die Gelegenheit, um ihm mit dem Fuß in den Magen zu treten. Der Filmvorführer krümmte sich vor Schmerz.
»Eine Tunte, ein Roter und zu allem Überfluss auch noch vergesslich«, brüllte der Inspector. »Du wirst schon sehen, was du davon hast.«
Auf eine Kopfbewegung von Valiente hin stürzte sich ein grau uniformierter Polizist auf Bernardo und legte ihm Handschellen an. Dann wurde er in den Polizeiwagen gestoßen. Seine einzige Sorge galt der Frage, ob Paulinos regloser Körper noch atmete. So mancher Nachbar stieß Verwünschungen aus, doch als der Inspector herausfordernd aufblickte, herrschte angstvolles Schweigen. Den Kopf gegen die Scheibe des Lancia gelehnt, der in Richtung Kommandantur fuhr, sah Bernardo beruhigt, wie Paulino mithilfe von Nil und weiteren Nachbarn aufstand, die aus ihren Häusern gekommen waren wie Schnecken nach dem Regen.
6
Angesichts des zunehmenden Stimmengewirrs auf der Straße war Soledad schließlich auf den Balkon getreten. Als sie den Wagen der Geheimpolizei entdeckte, gefror ihr das Blut in den Adern. Sie erbleichte, als sie die massige Gestalt von Inspector Valiente bei Nil und Bernardo stehen sah, die gerade das Haus betreten wollten. Dieser abstoßende Polizist und ihr einziger Sohn waren zwei unvereinbare Welten, die nichts miteinander zu tun haben durften. Sie fühlte, wie eine fast vergessene Abneigung gegen diesen widerlichen Kerl in ihr aufstieg. Sie hatte ihn seit dem Tag nicht mehr gesehen, als sie die kleine Rosa für immer verlor. Erneut kehrte die Vergangenheit zurück, um die Gegenwart mit Füßen zu treten. Sie war zu allem bereit, um zu verhindern, dass Nil in seine Fänge geriet. Aber als sie nach draußen kam, war das Auto der Geheimen schon losgefahren und verschwand in Richtung Vía Layetana. Nil war bereits aus dem Hauseingang getreten und rannte zu Paulino. Soledad schloss sich den Leuten an, die dem Verletzten zu Hilfe eilten. Gemeinsam trugen sie ihn in ihre Wohnung.
Obwohl Paulino klapperdürr war, schafften es Mutter und Sohn nicht, ihn noch ein Stockwerk höher zu schleppen. Sie beschlossen, ihn in ihrer Wohnung zu versorgen, ohne zu bedenken, wie sie zu dritt mit nur einem Schlafzimmer leben sollten.
»Er hat zu viele Verletzungen, Mama. Sollten wir nicht Doktor Fuster um Hilfe bitten?«
Soledad hatte Stofflappen in Wasser getaucht und legte sie auf Paulinos zugeschwollene Augen. Als sie ihm das zerrissene Hemd auszogen, entdeckten sie mehrere Schnitte an Brust, Bauch und Rippen sowie Brandwunden von einer Zigarette.
»Da unten steht der Korb mit der Medizin, die ich aus dem Hafen habe.« Soledad deutete in Richtung Gasherd. »Nimm Wasserstoffperoxid und Theobromin. Ich gehe zu Fuster.«
Der Arzt öffnete ängstlich die Tür. Er stützte sich im Türrahmen ab. Seine Hand zitterte selbst dann noch, als er festgestellt hatte, dass es sich um Soledad handelte. Nach einer kurzen, höflichen Begrüßung schilderte sie ihm die Lage. Fuster hatte zunächst Bedenken, konnte aber diesem gewinnenden Lächeln nicht widerstehen, das ihn seit dem ersten Tag in Unruhe versetzte.
»Ich war Arzt bei den Republikanern.«
»Ich weiß.«
Diese Antwort überraschte Fuster. Er wohnte noch nicht lange in diesem Haus und hielt sich für einen zurückhaltenden Menschen, der nicht mit seinem Leben hausieren ging. Aber dass Soledad über seine Vergangenheit Bescheid wusste, gab ihm Anlass zu einer unausgesprochenen Hoffnung.
»Sie wissen, was mir bevorsteht, wenn der Inspector zurückkommt und sieht, dass ich Paulino behandle?«
»Wovor haben Sie Angst? Dass Sie die Zulassung verlieren, die Sie ohnehin längst nicht mehr haben?«
»Dass man mich wieder verhaftet und …«
Soledad ergriff seine Hand und drückte sie mitfühlend. Fuster hätte diese Hand gerne ein Leben lang gehalten. Er nickte, sein Atem ging schneller. Sie gingen ein Stockwerk tiefer und betraten die Wohnung. Trotz seines Hungers achtete der Arzt nicht auf das Brot und das Pökelfleisch, das auf einem Teller auf dem Tisch stand. Der Verletzte lag auf dem Fußboden und stöhnte leise.
Es war fast zehn, als Paulino schließlich auf einem improvisierten Lager aus Handtüchern und Decken in den Schlaf sank. Nil war bereits ohne Abendessen ins Bett gegangen. Das Versprechen seiner Mutter war stillschweigend auf einen besseren Zeitpunkt verschoben worden. Der Junge dachte, dass es schon zu viele Jahre waren, die das Feiern aufgeschoben wurde. Ein weiterer Geburtstag ohne das am sehnsüchtigsten erhoffte Geschenk: die Rückkehr seines Vaters. Der leere Magen und der Kopf voller Sorgen hielten ihn vom Einschlafen ab. Die beängstigenden Drohungen des falschen Joseph Cotten, der tote Mann im Treppenhaus, die brutalen Methoden des Inspectors, Paulinos entstelltes Gesicht – das waren Bilder, die ihn in der drückenden Schwüle der Nacht nicht losließen.
Soledad saß im schwachen Kerzenlicht gegenüber von Doktor Fuster, vor ihnen stand eine Flasche Cognac. Obwohl sie sich immer wieder Luft zufächelte, war ihr Haar makellos frisiert. Es war von undefinierbarer Farbe, ein bisschen wie Champagner. Nil sagte immer, dass seine Mutter aussah wie Lana Turner, die Schauspielerin, deren Frisur immer perfekt saß. Mit ihren fünfunddreißig Jahren konnten weder die abgetragenen Kleider noch das fehlende Make-up ihrer natürlichen Schönheit etwas anhaben, selbst der Krieg hatte sie nicht zerstören können. Nur ein Teil von Soledad war durch das Unglück gebrochen, und das war ihr Blick. Das intensive Blau, das die Blüte ihrer Jugend überstrahlt hatte, war an dem Tag hinter einem Schleier verschwunden, als sie ihre Tochter verlor.
»Was bringt einen Republikaner dazu, bei Pepe Mora zur Untermiete zu wohnen? Der alte Faschist hat eine lose Zunge, seien Sie vorsichtig!«, riet ihm Soledad entschlossen.
»Oft ist die Hölle der beste Ort, um vom Teufel unbemerkt zu bleiben«, entgegnete Fuster, die Brille auf der Nasenspitze. »Ich kümmere mich um seine Magengeschwüre, die ihm das Leben schwer machen, und erhalte im Gegenzug ein Dach über dem Kopf.«
»So ein paar Magengeschwüre erscheinen mir noch zu wenig für diesen Fiesling«, brummte Soledad.
Sofort bereute sie, jemandem etwas Schlechtes gewünscht zu haben. Sie schnalzte entschuldigend mit der Zunge und beschloss, dass es spannender war, mehr über diesen Mann ihr gegenüber zu erfahren.
»Die Zeiten in Russland müssen hart sein gewesen sein.«
»Woher wissen Sie so viel über mich?«
»Eine alleinstehende Frau mit Kind sollte wissen, wer ihre Nachbarn sind, finden Sie nicht?«, fragte sie mit ihrem blauen Blick, der es wert war, auf Zelluloid gebannt zu werden, und in dem doch so viel Unglück mitschwang.
Der Arzt nickte und betrachtete das Porträt von David Roig.