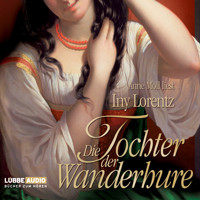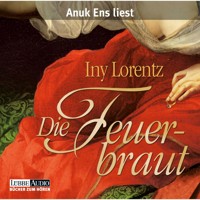9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderapothekerin-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein vergifteter Bürgermeister, Kindesentführung, Brandstiftung und eine Intrige, die es aufzudecken gilt – Der zweite Teil der historischen Familiensaga um die (ehemalige) Wanderapothekerin Klara aus Thüringen ist spannender Krimi und bewegender Historienroman in einem. Die schwangere Klara führt mit ihrem Ehemann Tobias und dem gemeinsamen Sohn mittlerweile ein beschauliches Leben in Königsee in Thüringen. Wie aus heiterem Himmel wird ein Wanderapotheker ihres Schwiegervaters unter dem Verdacht verhaftet, den Rübenheimer Bürgermeister mit einer vergifteten Arznei ermordet zu haben. Als Tobias sich aus ihrer Heimat in Thüringen auf den Weg macht, um dem Beschuldigten beizustehen, wird er als vermeintlicher Erzeuger dieser Arznei ebenfalls verhaftet. Kann Klara ihre Familie und vor allem ihren geliebten Tobias retten? Es scheint kein Zufall gewesen zu sein, dass gerade Klaras Mann verdächtigt wurde. Ihre Familie hat offensichtlich nicht nur die einflussreiche Bürgermeistertochter als Feindin, sondern einen unheimlichen Gegner, der alles daran setzt, sie zu vernichten. Die historische Familiensaga aus Thüringen von Bestseller-Autorenpaar Iny Lorentz, den Erfindern der erfolgreichen Reihe "Die Wanderhure", erzählt die aufregende Geschichte einer Familie aus dem 18. Jahrhundert, deren Name als Experte für Heilkräuter und Arzneien auf dem Spiel steht – und nicht nur das: es geht um Leben und Tod. »Ein Buch, das sich lohnt für jeden Historikfan. Gute Geschichte mit guten Stil und Spannung.« – Lovelybooks.de »Mitreißend!« – Neue Woche Historisches Wissen gepaart mit Spannung und guter Unterhaltung – Lesen Sie auch die anderen historischen Romane von Iny Lorentz! Alle Bände der Familiensaga um die Wanderapothekerin aus Thüringen: - Band 1: Die Wanderapothekerin - Band 2: Die Liebe der Wanderapothekerin - Band 3: Die Entführung der Wanderapothekerin - Band 4: Die Tochter der Wanderapothekerin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 699
Sammlungen
Ähnliche
Iny Lorentz
Die Liebe der Wanderapothekerin
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Die Geschichte der Wanderapothekerin Klara geht weiter!
Die schwangere Klara führt mit ihrem Ehemann Tobias und dem gemeinsamen Sohn mittlerweile ein beschauliches Leben in Königsee. Wie aus heiterem Himmel wird ein Wanderapotheker ihres Schwiegervaters unter dem Verdacht verhaftet, den Rübenheimer Bürgermeister mit einer vergifteten Arznei ermordet zu haben. Als Tobias nach Rübenheim reist, um dem Beschuldigten beizustehen, wird er als vermeintlicher Erzeuger dieser Arznei ebenfalls verhaftet.
Klara muss nun nicht nur das Geschäft zu Hause am Laufen halten, sondern auch die Intrige um die Ermordung des Bürgermeisters aufdecken, wenn sie Tobias retten will. Es ist nämlich kein Zufall, dass der Verdacht auf den Ehemann der ehemaligen Wanderapothekerin gefallen ist. Die Familie hat ohne es zu ahnen Feinde, die nichts unversucht lassen, sie zu vernichten.
Die spannende Fortsetzung der erfolgreichen eBook-Serie von Iny Lorentz!
Inhaltsübersicht
Prolog
1.
Im hintersten Winkel der Gaststube saß ein junger Mann vor einem Becher mit dünnem Bier und einem Napf, der Rübeneintopf enthielt. Auf seinem Tisch knisterte eine dünne Talgkerze, der man kleingeriebene Kräuterstücke beigemischt hatte, um ihren stechenden Geruch zu mildern. Ein paar Tische weiter vorne hingegen brannten echte Wachskerzen und verbreiteten ein warmes Licht, in dem die dort sitzenden Gäste deutlich zu erkennen waren, reiche Kaufleute, die nicht mit jedem Pfennig knausern mussten wie der junge Mann in der Ecke. Eben brachte der Wirt den Händlern einen großen Krug Wein und füllte ihre Gläser. Eine junge Magd servierte ein Tablett mit einem Berg gebratener Schweinerippen und knickste so ehrerbietig, als hätte sie Leute von Stand vor sich.
»Die Welt ist ungerecht«, murmelte der junge Mann und aß einen weiteren Löffel seines Rübeneintopfs. Nach Aussage des Wirtsknechts, der ihm den Napf hingestellt hatte, sollten Fleischstücke darin sein, doch bisher hatte er noch keines entdeckt.
Seufzend trank er einen Schluck Bier. Es schmeckte schal. Neiderfüllt blickte er erneut zu den Männern hinüber, die sich Wein leisten konnten, und hätte seinem Ärger über die Ungerechtigkeit der Welt am liebsten lauthals Luft gemacht. Doch einer wie er hatte das Maul zu halten und seinen Hut zu ziehen, wenn jemand wie die dort des Weges kamen.
»He, Wirtschaft! Ein frisches Bier«, rief er.
Der Wirt und die Magd schauten nicht einmal zu ihm her. Nur der Knecht wandte kurz den Kopf. »Kriegst gleich eins!«, rief er, bediente aber eine Gruppe neu eingetroffener Gäste.
Während der Ärger des jungen Mannes stieg, verdunkelte ein Schatten das aus handtellergroßen Butzenscheiben bestehende Fenster an seinem Tisch. Er blickte hinaus, sah aber nur noch, dass sich jemand abwandte und weiterging. Augenblicke später wurde die Tür geöffnet, und ein weiterer Gast trat ein. Es handelte sich um einen untersetzten Mann Mitte dreißig, der mit Kniehosen aus festem Tuch und einem bis zu den Waden reichenden Rock bekleidet war. An den Füßen trug er derbe Schuhe und auf dem Kopf einen Schlapphut. Dazu hatte er einen großen Tragkorb geschultert. Er sah sich um, wich dem Tisch mit den Kaufleuten aus und kam auf den jungen Mann zu.
»Wenn das nicht Armin Gögel ist! Welch ein Zufall! So trifft man sich wieder.« Lachend stellte er seine Kiepe neben das Traggestell des jungen Mannes und setzte sich zu ihm.
»Na, schon kräftig beim Futtern?«, fragte er gutgelaunt.
Armin verzog das Gesicht. »Rübeneintopf – und zwar der schlechteste, den ich bisher auf meiner Strecke vorgesetzt bekommen habe.«
»Danke für die Warnung, da werde ich mir wohl besser etwas anderes bestellen. He, Wirtschaft! Ist es bei euch Sitte, frisch eingetroffene Gäste verhungern und verdursten zu lassen?«
Auf diesen Ruf hin kam der Wirtsknecht an den Tisch. »Was willst du?«, fragte er unfreundlich.
»Schweinerippen, wie die Herren sie dort essen, und einen Krug Wein.«
Da der Gast ein teures Essen bestellte, wurde die Miene des Knechts auf einmal freundlich. »Aber selbstverständlich, der Herr! Darf es Wein aus Sachsen sein, oder besteht der Herr auf Rheinwein?«
»Vom Rhein!«, antwortete Armins Tischnachbar und lehnte sich gemütlich zurück.
»Bei Gott, Rudi, du musst gute Geschäfte gemacht haben!«, rief Armin neidisch.
»Wie sich’s halt ergibt! Ins Himmelreich mitnehmen kann man’s nicht, und ehe ich es zu Hause dem Steuereintreiber überlasse, gönne ich mir unterwegs eine Kleinigkeit.« Der Mann zog eine Tonpfeife hervor, stopfte sie und zündete sie an der Talgkerze an.
»Weißt du, Armin, ein Weib habe ich nicht mehr. Ist mir vor vier Jahren gestorben, ebenso mein Sohn. Da frage ich mich: Wieso soll ich für andere sparen, wenn ich das Geld ebenso gut für mich ausgeben kann?«, erklärte er und blies Rauchringe gegen die bemalte Holzdecke.
»Du hast es gut!«, seufzte Armin. »Ich hingegen schufte mich ab, bis mir die Schwarte kracht, damit der Herr Laborant noch reicher wird. Es ist eine Ungerechtigkeit, sage ich dir. Rumold Just und sein Sohn sitzen feist und fett in Königsee und zählen ihre Taler, während ich bei einer Hitze, die einem schier das Mark aus den Knochen brennt, oder bei Kälte und Regen durchs Land stapfe und ihre Erzeugnisse an den Mann zu bringen versuche. Selbst die Destillateure haben es besser. Die haben ein Dach über dem Kopf, mischen die Arzneien und kehren am Abend zu Weib und Kind zurück. Ein Buckelapotheker wie ich sieht seine Familie monatelang nicht und besitzt nicht einmal genug Geld, um unterwegs eine Hure stoßen zu können.«
»Sag bloß, du zahlst für ein Weibsstück?«, fragte Rudi lachend. »Armin, dafür sind die Mägde auf den Bauernhöfen da, in denen unsereins übernachtet, und manchmal auch die Bäuerin selbst. Ein junger Bursche wie du hat doch wohl einen strammen Riemen, mit dem er jedes Weib zufriedenstellen kann.«
»Gelegentlich rafft die eine oder andere Magd den Rock. Aber die meisten sind hässlich wie die Sünde und tun’s nur, weil ihnen kein anderer Mann zwischen die Schenkel fährt«, antwortete Armin.
Da der Wirtsknecht gerade den Wein und die gebratenen Schweinerippen brachte, erstarb das Gespräch. Armins Gegenüber trank einen kräftigen Schluck und riss sich dann mehrere Rippen ab. Der Duft des saftigen Bratens ließ Armin das Wasser im Mund zusammenlaufen. Rudi entging das nicht, und er wies mit der fettigen Hand auf das Tablett mit den restlichen Rippenstücken. »Bedien dich! Ist genug da.«
»Wirklich?« Armin wollte es zunächst nicht glauben, griff aber auf eine bejahende Geste des anderen hin zu.
»Das schmeckt schon anders als der Rübeneintopf«, sagte er mit vollem Mund.
»Das will ich meinen!« Rudi lachte, sah dann, dass Armins Becher leer war, und goss ihn mit Wein voll. »Der Tag ist schön, und wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Morgen muss ich westwärts wandern, während dein Weg, wie du gestern sagtest, weiter nach Norden führt.«
»Ich hatte angenommen, du hättest schon heute Morgen den anderen Weg eingeschlagen«, antwortete Armin.
Rudi schüttelte verwundert den Kopf. »Da hast du mich falsch verstanden, mein Guter. Ich sagte, dass ich nicht weiß, welche Straße ich wählen soll, und habe mich entschieden, die zu nehmen, die von hier zu meinem Ziel führt. Allerdings gebe ich zu, dass ich nichts dagegen hatte, dich hier zu treffen. Es war ein angenehmes Gespräch gestern, und das wollte ich gerne fortsetzen.«
Armin zog den Kopf ein, denn am Vorabend hatte er heftig über den Laboranten Rumold Just hergezogen, in dessen Auftrag er als Wanderapotheker unterwegs war. Dann aber kam ihm die Kiste mit Arzneien in den Sinn, die er an diesem Ort übernehmen sollte, und er verzog das Gesicht.
»Ist doch wahr«, murrte er. »Der Herr Laborant hat gut reden, aber ausbaden müssen wir seine Entscheidungen. Verkaufen wir nicht genug, verdienen wir nichts, müssen aber Just alle Essenzen und Salben bezahlen. Er hat immer sein Auskommen, während wir …« Armin brach ab und wies zum Stall hinüber. »An solch kalten, zugigen Orten verbringe ich die meisten Nächte des Jahres! In früheren Zeiten sind die Buckelapotheker mit ihrem Reff von daheim aufgebrochen, und als es leer war, sind sie wieder nach Hause zurückgekehrt. Jetzt aber schicken die Herren Laboranten ihre Arzneien mit Fuhrwerken und Postkutschen voraus, so dass wir einen doppelt so weiten Weg zurücklegen müssen und unser Zuhause kaum mehr zu Gesicht bekommen. Hier in der Poststation wartet die gesamte Füllung eines Reffs auf mich. Dabei habe ich erst gut zwei Drittel der Waren verkauft, mit denen ich von Königsee aufgebrochen bin. Zurücklassen darf ich jedoch nichts, und so wird mein Reff morgen noch weitaus schwerer sein.«
»Bist doch ein strammer Bursche, Mann! So einer wie du trägt das leicht«, warf Rudi ein.
In Armins Gesicht zuckte es. »Du würdest anders reden, wenn du statt deines Korbes mein Reff tragen müsstest!« Nachdenklich musterte er die Kiepe des Mannes. »Womit handelst du eigentlich? Ich habe das gestern nicht mitbekommen.«
»Oh, mal mit diesem, mal mit jenem, wie es sich gerade ergibt«, antwortete Rudi ausweichend. »Aber trink ruhig! Der Weinkrug ist noch halbvoll, und ich will nichts für den Wirt übrig lassen.«
»Wäre schade drum«, fand Armin und schob ihm den Becher hin, damit Rudi einschenken konnte.
2.
Auch wenn der Kiepenhändler sich gebratene Schweinerippen und Wein geleistet hatte, so war er bei der Übernachtung recht sparsam und wählte dieselbe Kammer neben dem Stall, in der auch Armin untergekommen war. Dort stellte er seine Kiepe erneut neben dessen Reff ab und sah zu, wie der junge Buckelapotheker im Schein einer Stalllaterne den Inhalt einer Kiste auspackte und die Flaschen und Schachteln mit viel Ausprobieren und Umpacken auf seinem Traggestell unterbrachte.
»Sind das wirklich alles Arzneien?«, fragte der Mann, der sich als Rudi vorgestellt hatte, nach einer Weile.
Armin nickte. »Allerdings! Und es sind die besten der Welt! Einige Buckelapotheker schleppen sie sogar bis nach Amsterdam. Die verdienen dabei gut, während unsereins durch die Kuhdörfer tingeln und zusehen muss, wo er bleibt. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, muss man sich auch noch mit betrügerischen Heilmittelhändlern herumärgern, die ohne Erlaubnis des Landesherrn umherwandern und schlechte Ware so billig verkaufen, dass die Leute von mir nichts mehr nehmen.«
Da Armin seinen Gesprächspartner bei diesen Worten nicht anschaute, sondern sein Reff füllte, entging ihm, wie dessen Gesicht sich hasserfüllt verzerrte. Rudi hatte sich aber rasch wieder in der Gewalt und lachte. »Diese Leute wollen auch leben!«
»Aber nicht auf meine Kosten!«, rief Armin empört. »Immerhin musste der Laborant gute Taler für das Privileg bezahlen, mit dem ich als Buckelapotheker seine Arzneien auf dieser Strecke verkaufen darf. Andere haben nicht das Recht dazu.«
»Recht muss man auch durchsetzen können!« Diesmal klang Rudi spöttisch, doch Armin achtete nicht darauf.
»In den Städten, in denen gleich Richter und Büttel bei der Hand sind, kann man diese Schurken fangen, doch in den verstreuten Dörfern und einsamen Höfen haben zumeist die Grundherren das Sagen, und deren Macht reicht nicht weiter als bis zu ihrem Grenzpfahl. Einen dieser vermaledeiten Kerle dort zu erwischen, ist fast unmöglich.«
Armin hatte sich in Rage geredet und drohte allen, die seinen Verdienst schmälern könnten, mit der Faust.
Da hielt ihm der Kiepenhändler einen noch fast vollen Krug Wein hin. »Hier, den habe ich mir als Schlummertrunk reichen lassen. Spül damit deinen Ärger hinab und sage dir, dass morgen ein neuer Tag ist, an dem du gut verdienen wirst.«
»Schön wär’s!«, antwortete Armin, nahm den Krug und trank mangels eines Trinkgefäßes direkt daraus.
»Nimm einen guten Zug!«, forderte Rudi ihn auf, schob den schlichten Strohsack in dem primitiven Bettgestell zurecht und legte seinen Mantel über die fadenscheinige Decke.
Armin trank, soviel er konnte, und reichte den Krug zurück. »Das hat gutgetan.«
»So soll es sein!« Der Kiepenhändler setzte nun ebenfalls den Krug an, hielt sich aber beim Trinken zurück und ließ den jungen Mann nicht aus den Augen.
Da Armin nur ein, zwei Becher leichten Bieres am Abend gewohnt war, spürte er rasch die Wirkung des Weines und stolperte über die eigenen Füße, als er sich seinem Lager zuwandte.
Der Kiepenhändler fing ihn gerade noch auf. »Hoppla, nicht so übermütig, mein Freund!«
»Schon gut, Rudi!« Armin spürte eine wohltuende Müdigkeit und entledigte sich seines Rocks und seiner Weste. Bei den Schuhen hatte er mehr Mühe, und als er die Hose ausziehen wollte, kam er aus dem Gleichgewicht und plumpste auf sein Lager. Das Holz krachte zwar, blieb aber heil.
»Hast Glück gehabt!«, spottete Rudi. »Der Wirt hätte dich sonst das ganze Bett samt Stroh bezahlen lassen.«
»Bläst du die Laterne aus?«, fragte Armin schläfrig, ohne auf die Bemerkung einzugehen.
»Mach ich, sobald ich mich ausgezogen habe!« Mit diesen Worten streifte Rudi seinen Rock ab und hängte ihn über seinen Tragkorb. Bis er auch die Weste abgelegt hatte, dauerte es ein wenig, und bei den Schuhen und der Hose ließ er sich noch mehr Zeit. Dabei spähte er immer wieder zu Armin hinüber. Dieser hatte die Augen geschlossen und atmete ganz ruhig.
»Was ich dich noch fragen wollte …«, sagte der Kiepenhändler, erhielt als Antwort aber nur ein paar Schnarchgeräusche. Leise stand er auf und tippte Armin leicht an. Der bewegte kurz den Kopf, drehte sich um, so dass er dem anderen den Rücken zuwandte, und schlief weiter.
Rudi wartete noch einige Augenblicke, dann stellte er die Laterne so hin, dass ihr Schein den Buckelapotheker nicht mehr erreichte, und schlich auf Zehenspitzen zu dessen Reff. Zwar hatte Armin es mit einer Plane aus gewachstem Leinen bedeckt und diese verschnürt, doch der Mann löste die Knoten mit geübter Hand. Er schlug das Wachstuch zurück und nahm eines der Fläschchen aus dem Reff. Nachdem er die Aufschrift gelesen hatte, stellte er es wieder zurück und zog das nächste heraus, studierte dessen Etikett und lächelte zufrieden. Rasch goss er ein gutes Drittel des Inhalts in den Weinkrug, zog eine kleine Tonflasche aus seinem eigenen Korb und füllte das Fläschchen mit dessen Inhalt wieder auf. Nachdem dies geschehen war, stellte er es an seinen Platz zurück und band die Plane genauso fest, wie er es bei Armin gesehen hatte. Nach einem prüfenden Blick auf den jungen Mann legte er sich ins Bett und blies die Talgkerze in der Laterne aus. Dabei musste er an sich halten, um nicht schallend zu lachen. Es war so fürchterlich einfach gewesen, den jungen Buckelapotheker an der Nase herumzuführen.
Zufrieden schloss der Kiepenhändler die Augen und schlief rasch ein, wurde aber bald darauf von Armins weinseligen Schnarchgeräuschen geweckt. Er versetzte dem jungen Burschen einen Rippenstoß, und für einen Augenblick erwachte Armin, drehte sich um und versank wieder in einen unruhigen Schlaf. Da er nun nicht mehr schnarchte, weckte erst der Hahn die beiden Männer.
Armin brauchte an diesem Morgen mehr Zeit als sonst, bis er sich draußen am Brunnen gewaschen hatte und in die Wirtsstube treten konnte. Auf dem Weg dorthin kam ihm Rudi entgegen. Er hatte bereits seine Kiepe geschultert und ließ sich vom Wirtsknecht ein Stück Wurst und eine dicke Scheibe Brot als Wegzehrung reichen.
»Gute Geschäfte! Vielleicht sehen wir uns wieder!«, rief er Armin zu.
»Wahrscheinlich nicht, weil du nach Westen wanderst und ich nach Norden«, antwortete Armin mürrisch. Der Kopf tat ihm weh, und er hätte alles andere lieber getan, als mit dem schweren Reff auf dem Rücken in den sonnigen Tag hinauszuwandern.
»Auf jeden Fall wünsche ich dir Glück!«, antwortete Rudi und verließ grinsend den Hof des Gasthauses.
Armin sah ihm nach und sagte sich, dass er es beim Abendessen bei einem bis zwei Becher Bier belassen sollte. Zwar hatte der Wein am Abend geschmeckt, doch die Nachwirkungen setzten ihm heftig zu.
3.
Die ersten Meilen wurden für Armin zur Qual. Schon bald rann ihm der Schweiß in Strömen übers Gesicht, und er war froh, als er zu einer Quelle kam und seinen brennenden Durst löschen konnte. Wegen seines heftigen Katers brachte er, wenn er an einem Hof oder einer Kate anklopfte, kaum den Mund auf und verkaufte nur wenig.
Er maß einem alten Mütterchen ein paar Lot einer Salbe ab, die gegen das Gliederreißen helfen sollte. Als er dann sein Reff wieder auf den Rücken nehmen wollte, war es so schwer, dass er es kaum hochstemmen konnte.
»Ich hätte nicht so viel Wein saufen sollen«, stöhnte er.
Jammern half jedoch nichts. Er war unvernünftig gewesen und musste nun die Folgen tragen.
Gegen Mittag ging es ihm schließlich etwas besser. Da er jedoch vergessen hatte, sich im Gasthof einen Mundvorrat geben zu lassen, grummelte sein Magen schon bald. Daher war Armin froh, als endlich das nächste Dorf vor ihm auftauchte. An diesem Ort hatte er in den beiden Jahren, die er bereits für Rumold Just als Wanderapotheker tätig war, immer gute Geschäfte getätigt und hoffte, dies auch heuer zu tun. Entsprechend forsch schritt er auf den ersten großen Hof zu und sah sich Augenblicke später zwei riesigen Hunden gegenüber, die ihn geifernd verbellten.
Kurz erwog er, mit seinem Wanderstock nach ihnen zu schlagen, gab diesen Vorsatz aber beim Anblick der scharfen Zähne und kräftigen Kiefer rasch wieder auf.
»Hallo! Ist hier jemand?«, rief er.
Die Hunde kamen näher und schnappten nach ihm. Bevor er oder seine Kleidung Schaden nehmen konnte, tauchte ein altes, verhutzeltes Weiblein auf und rief mit dünner Stimme nach den Tieren.
Zu Armins Verwunderung gehorchten diese sofort und trollten sich. Erleichtert ging er weiter und blieb vor der Frau stehen. »Armin Gögel zu Diensten! Ich komme im Auftrag des Königseer Laboranten Rumold Just und trage für ihn die Arzneien aus.«
»Als ob ich dich nicht kennen würde!«, erwiderte die Alte lachend. »Du bist doch der hübsche Bursche, der schon voriges und vorvoriges Jahr hier war. Letztes Jahr hat mir euer Lebensbalsam gut geholfen, als der Schleim nicht aus meiner Lunge herauswollte. Kannst mir gleich das Doppelte dalassen wie damals.«
Damit brachte sie Armin in Verlegenheit, denn er hatte keine Ahnung, wie viel von diesem Balsam er hier verkauft hatte. »Ich habe auch noch andere gute Arzneien dabei.«
»Weiß ich doch! Komm herein!«
Armin folgte der Alten in den düsteren Hausflur und atmete auf, als sie ihn in die Küche führte und er dort auf die Bäuerin traf.
»Gott zum Gruß, gute Frau! Ich bringe die guten und heilsamen Arzneien des Laboranten Rumold Just!«
»Sei willkommen! Ich brauche so einiges«, erklärte die Bäuerin. »Die Tiegel habe ich schon ausgewaschen. Sie stehen drüben in der Kammer bereit. Mach sie voll!«
»Und was braucht ihr alles?«, fragte Armin und rang sich ein verlegenes Lächeln ab. »Wisst ihr, ich komme zu so vielen und kann mir nicht immer merken, was jeder Einzelne davon kauft.«
Die Bäuerin nannte ihm die Mittel, die sie haben wollte. Erleichtert trat Armin in die Kammer und begann, jede einzelne Arznei abzumessen. Wie schon bei den anderen Höfen, die er an diesem Vormittag aufgesucht hatte, blieb auch diesmal das Fläschchen unberührt, das sein Zimmergenosse am Vorabend mit einer anderen Flüssigkeit aufgefüllt hatte.
Als Armin fertig war, nannte er der Bäuerin die Summe, die er von ihr bekam, und nahm das Geld entgegen. Während er es einsteckte, schnupperte er betont. »Das riecht aber gut!«
»Das ist unser Mittagessen!«, antwortete die Bäuerin mit einer gewissen Abwehr in der Stimme.
Händler und Hausierer, die zuerst kassierten und dann noch etwas zu essen schnorren wollten, mochte sie ganz und gar nicht. Da die Arzneien, die der Wanderapotheker ihr brachte, jedoch zuverlässig halfen, wollte sie nicht geizig erscheinen. Aus diesem Grund schnitt sie ihm ein Stück Brot ab und schmierte etwas Schmalz darauf.
»Hier, du wirst Hunger haben!«, sagte sie, während sie es ihm reichte.
»Möge Gott es dir vergelten!«, antwortete Armin freundlich, obwohl er fand, dass ein Napf Eintopf seinen Magen besser gefüllt hätte. Wenigstens hatte er etwas zu beißen und verließ halbwegs zufrieden den Hof. Die Alte kam mit, um die Hunde zurückzuhalten.
»Hab Dank und bis zum nächsten Jahr«, verabschiedete er sich von ihr.
»So ich da noch leben werde«, antwortete die Alte, und die Worte hallten seltsam unangenehm in den Ohren des jungen Mannes wider.
4.
Vier Tage später erreichte Armin Rübenheim, die größte Stadt auf seiner Strecke. Es war ein sonniger Tag, aber nicht zu warm, und die Torwachen ließen ihn sofort ein. Mit einem fröhlichen Gruß betrat er die Apotheke, bei deren Besitzer er einen guten Teil seiner Arzneien loswerden wollte. An die Begegnung mit dem fremden Kiepenhändler dachte er längst nicht mehr, als er sein Reff absetzte und die Wachstuchplane entfernte.
»Na, Armin, bist wieder wacker auf der Walz?«, fragte der Apotheker lächelnd.
»Ist nun mal mein Gewerbe, Herr Stößel«, antwortete der junge Mann und setzte für sich ein »ob es mir passt oder nicht« hinzu.
»Wovon soll der Mensch leben, wenn nicht von seiner Hände Arbeit? Ein Buckelapotheker wie du hat es gut, weiß man doch, dass dein Laborant gute Ware herstellt. Andere Hausierer tun sich da schwerer. Ist auch viel Gesindel darunter, das die Leute übers Ohr haut und es ehrlichen Handlungsreisenden schwermacht, ihre Sachen zu verkaufen, weil man sie ebenfalls für Betrüger hält«, antwortete der Apotheker.
Bei diesen Worten empfand Armin sogar ein wenig Stolz darauf, ein Buckelapotheker aus Königsee zu sein. »Ist schon wahr, dass ich gute Arzneien bringe! Wir werden aber auch vom Stadtsyndikus von Rudolstadt überwacht, und der ist immerhin der Leibarzt Seiner Hoheit, des Fürsten Ludwig Friedrich.«
»Die Arzneien deines Laboranten sind die besten! Die Kunden reißen sie mir fast aus den Händen. Daher habe ich mir schon gedacht, ich lasse mir von Herrn Just eine Kiste davon mit der Post schicken. Ob die jetzt vom Posthalter zu mir gebracht wird oder in einer Poststation darauf wartet, bis einer von euch Buckelapothekern sie übernimmt und zu mir trägt, bleibt sich gleich.«
Armin kniff die Lippen zusammen. In dieser Apotheke verdiente er am meisten, und wenn Stößel sich die Sachen schicken ließe, würde er ihn als Kunden verlieren und seine Ware nur noch bei Bauern und Kätnern in den Dörfern anbringen. Damit aber würde er all seine Hoffnungen, sich in ein paar Jahren ein Häuschen kaufen und heiraten zu können, begraben müssen.
Der Apotheker bemerkte den Unmut des jungen Mannes nicht, sondern sprach weiter, während er Schachteln und Flaschen öffnete, um sich den Inhalt anzusehen und daran zu riechen.
»Wie geht es dem alten Just? Ich war noch ein Knabe, als er seine Arzneien selbst ausgetragen und in unsere Apotheke gebracht hat. Die wurde zu jener Zeit noch von meinem Vater selig geführt.«
»Selbst als Buckelapotheker zu gehen, hat Rumold Just längst nicht mehr nötig. Sein Sohn Tobias musste dies nie tun«, antwortete Armin seufzend.
»Der Tobias soll, wie ich gehört habe, geheiratet haben«, fuhr der Apotheker fort.
»Wohl, wohl, das stimmt!«
»Muss ein besonderes Mädchen gewesen sein. Ein Apotheker, den ich letztens getroffen habe, erzählte mir, sie wäre selbst als Wanderapothekerin unterwegs gewesen.«
Armin sah Stößel die Neugier an der Nasenspitze an und nickte. »Auch das stimmt! Ist aber schon ein paar Jahre her, damals habe ich noch nicht für Just als Balsamträger gearbeitet. Da ihre Schwiegermutter vor drei Jahren gestorben ist, ist sie jetzt die Hausfrau im Hause Just. Soll ihre Sache gut machen, heißt es, und kann sich jetzt Frau Laborantin nennen, denn Tobias Just hat den größten Teil des Geschäfts von seinem Vater übernommen. Die Leute in Königsee nennen sie aber noch immer die Wanderapothekerin, und es passt auch nicht allen, dass ein bitterarmes Mädchen aus Katzhütte den Sohn des reichen Just heiraten konnte. Andererseits heißt es, sie hätte eine beachtliche Mitgift ins Haus gebracht. Muss wohl stimmen, denn ihre Mutter und ihre Geschwister haben sich in Katzhütte gut eingerichtet. Aber so ist nun einmal das Leben! Der eine findet einen Schatz und der andere nur Katzengold.«
Erneut konnte Armin seinen Neid nicht verbergen. Der Apotheker, der in behaglichen Verhältnissen lebte, lächelte darüber und griff nach dem Fläschchen, zu dessen Inhalt der Kiepenhändler Rudi vor ein paar Tagen etwas hinzugefügt hatte. Als er den Stöpsel abzog und daran schnupperte, zog er die Stirn kraus.
»Das riecht anders als sonst!«
»Wahrscheinlich hat Just eine neue, wirksamere Rezeptur verwendet«, antwortete Armin, der diesen Umstand nicht ernst nahm.
»Wenn du es sagst! Ich brauche das Mittel nämlich dringend. Es ist das Einzige, das unserem Bürgermeister Engstler gegen seine Koliken hilft. Ich werde es ihm gleich bringen.«
Der Apotheker erstand noch etliche andere Arzneien von Armin und musste diesem zuletzt ein erkleckliches Sümmchen bezahlen. »Gib acht, damit es dir die Straßenräuber nicht wegnehmen«, riet er ihm aufgeräumt.
»Ich passe schon auf!«, versicherte Armin ihm.
Er steckte zufrieden das Geld ein, schulterte sein um einiges leichter gewordene Reff und verließ die Apotheke. Sein nächster Weg führte ihn zur Poststation, deren Betreiber ihm jedes Mal ein Gutteil der Mittel abkaufte, die gegen Pferdekrankheiten wirkten. Auch bei diesem verdiente der junge Buckelapotheker so ordentlich, dass er sich guten Gewissens neben seinem Eintopf auch noch zwei Bratwürste und einen großen Krug Bier leisten konnte.
5.
Während Armin in der Gaststube das Essen genoss, verließ der Apotheker seinen Laden und eilte zum Haus des Bürgermeisters Engstler. Er musste nicht einmal klopfen, denn die Tochter des Hausherrn öffnete ihm erleichtert die Tür.
»Gut, dass Ihr kommt, Herr Stößel! Mein Vater wird erneut von üblen Koliken geplagt, und ich weiß mir keinen Rat mehr. Das Mittel, das ich zuletzt von Euch bekommen hatte, habe ich bereits verbraucht. Bei Gott, warum muss Vater all das essen und trinken, von dem er weiß, wie sehr es ihm schadet?«
»Ich habe ihm davon abgeraten, doch auf mich hört er auch nicht«, antwortete der Apotheker.
»Er würde auch nicht auf den Leibarzt unseres Landgrafen hören«, erwiderte die Haustochter mit einem traurigen Lächeln.
»Ihr könnt beruhigt sein, denn ich habe heute das gute Mittel erhalten, das Eurem Herrn Vater immer geholfen hat. Hier ist es, noch besser und stärker als früher.«
Mit diesen Worten reichte Stößel der jungen Frau das Fläschchen.
Sie sah ihn fragend an. »Soll ich ihm dennoch zehn Tropfen geben wie sonst oder weniger?«
Der Apotheker hatte vergessen, Armin danach zu fragen. Da dieser nichts gesagt hatte, nahm er an, dass es genauso wie früher dosiert werden sollte.
»Nehmt ruhig die zehn Tropfen, Jungfer Kathrin. Mehr aber sollten es nicht sein«, riet er der jungen Frau.
»Habt Dank! Lasst Euch von der Köchin einen Becher Bier einschenken. Ich eile derweil zu meinem Vater, um ihn von seinen Leiden zu erlösen.«
Als Kathrin Engstler die Schlafkammer ihres Vaters betrat, lag dieser stöhnend in seinem Bett und versuchte verzweifelt, die Luft, die ihn im Magen und in den Därmen quälte, loszuwerden. Obwohl er immer wieder aufstieß und schwächlich furzte, half es ihm kaum.
»Oh Gott, diese Schmerzen!«, stöhnte er, als seine Tochter hereinkam.
»Fasse dich, Vater! Apotheker Stößel hat eben das Heilmittel gebracht, das dir immer am besten geholfen hat. Ich messe dir gleich zehn Tropfen davon ab.«
»Hoffentlich reicht es diesmal länger als letztes Mal«, murrte ihr Vater und hätte seiner Tochter das Fläschchen am liebsten aus der Hand gerissen, um an die begehrte Arznei zu gelangen.
Die junge Frau maß zehn Tropfen in einem Becher mit Wasser vermischten Weines ab und reichte ihn dem Vater. »Hier! Möge es dich heilen!«
Der Kranke griff gierig nach dem Becher und stürzte den Inhalt mit einem Zug hinunter. Danach stieß er knallend auf und schnaufte erleichtert.
»Wie es aussieht, wirkt es schon«, sagte er zu seiner Tochter und ließ sich in das Kissen zurücksinken.
»Unserem Heiland im Himmel sei Dank!« Die junge Frau schloss kurz die Augen, denn die letzten Stunden waren schrecklich gewesen.
Als sie die Augen wieder öffnete, lag ihr Vater ruhig da, und seine Miene wirkte entspannt.
»So ist es doch gut, nicht wahr?«, fragte sie ihn, erhielt aber keine Antwort.
Verwundert, weil er so schnell eingeschlafen war, brachte sie das Arzneifläschchen in ihre Kammer, damit sie es immer zur Hand hatte, wenn ihr Vater seine Koliken bekam. Dann ging sie in die Küche und teilte dem Apotheker mit, dass sie am nächsten Vormittag zu ihm kommen würde, um die Arznei zu bezahlen.
»Das hat keine Eile, Jungfer Kathrin«, antwortete Stößel, der wusste, dass die Tochter des Bürgermeisters Schulden stets rasch beglich. Er trank sein Bier aus und verabschiedete sich.
Kathrin Engstler kehrte zu der Beschäftigung zurück, die sie wegen der Kolik ihres Vaters hatte unterbrechen müssen, und schüttelte den Kopf über dessen Unvernunft. Er wusste genau, welche Speisen und Getränke seine Schmerzen auslösten, und konnte sie doch nicht meiden.
Gegen Abend kochte sie eine Haferschleimsuppe und machte sich mit der vollen Schüssel und einem Löffel auf den Weg zur Schlafkammer ihres Vaters. Als sie die Tür öffnete, hatte die Dämmerung bereits ihren grauen Schleier ausgebreitet. Verärgert, weil keine der Mägde die Kerze in der Lampe angezündet hatte, stellte Kathrin Engstler die Schüssel ab und kehrte in die Küche zurück, um einen Fidibus zu holen.
Als die Kerze endlich brannte, wandte sie sich lächelnd ihrem Vater zu. »Ich habe dir Suppe gemacht. Sie wird dir …«
Was sie noch sagen wollte, unterblieb, denn der Ratsherr lag mit starrem Blick und verzerrter Miene auf seinem Bett und hatte die Hände in die Zudecke gekrallt. Auf seinen Lippen stand rötlicher Schaum.
»Vater! Was ist?«
Erschrocken eilte Kathrin zu ihm hin und fasste nach seiner rechten Hand. Sie war eiskalt, ebenso seine Stirn. Als sie sich über ihn beugte, um seinen Atemgeräuschen zu lauschen, blieb alles still. Schlagartig wurde ihr klar, dass ihr Vater nicht mehr lebte, und sie wich mit einem gellenden Schrei zurück.
Ein paar Augenblicke später waren die Köchin und zwei Mägde zur Stelle. Erstere schlug entsetzt das Kreuz. »Heiliger Jesus Christus, hilf uns in unserer Not!«
»Vater ist tot!«, flüsterte Kathrin mit blutleeren Lippen. »Dabei sollte die Medizin ihm doch helfen.«
Die Köchin wies auf die Schaumspuren auf den Lippen des Ratsherrn. »Ich würde sagen, er ist vergiftet worden.«
»Aber er hat doch den ganzen Nachmittag nichts zu sich genommen«, wandte Kathrin ein. »Ich habe ihm nur die Medizin gegeben.« Bei ihren eigenen Worten stutzte sie und wies auf die beiden Mägde. »Eine von euch muss sofort zu Apotheker Stößel laufen und ihn herholen! Die andere soll einem Arzt Bescheid geben! Ich will wissen, woran mein Vater gestorben ist. War es diese Arznei, werden die Leute, die das Mittel brachten, dafür bezahlen.«
Während die Mägde das Haus verließen, holte Jungfer Kathrin die Flasche mit dem Mittel gegen Kolik und stellte es auf den kleinen Beistelltisch, auf dem die Haferschleimsuppe inzwischen kalt wurde.
Als Erste kehrte jene Magd zurück, die den Apotheker hatte holen sollen. Stößel trat ins Zimmer und betrachtete den Toten, ohne zu begreifen, was geschehen war.
»Wie es aussieht, hat Eure Medizin meinem Vater den Tod gebracht«, sagte Kathrin Engstler herb.
»Das kann nicht sein! Ich beziehe dieses Mittel seit Jahren von dem Laboranten Just aus Königsee. Sie hat Eurem Vater immer geholfen!« Noch während Stößel es sagte, ergriff er das Fläschchen, zog den Stopfen ab und schnupperte erneut daran.
»Irgendwie riecht es diesmal anders. Der Buckelapotheker meinte, sein Laborant hätte eine neue Rezeptur verwendet!«
Es ging Stößel nicht allein darum, den Verdacht von sich zu weisen, sondern er wollte wissen, weshalb Engstler nach Einnahme dieses Medikaments ums Leben gekommen war. Daher träufelte er ein wenig auf seinen Zeigefinger und leckte daran, spie dann aber sofort aus.
»Das ist doch das Gift der Tollkirsche! Wie kommt Just dazu, es bei seinem Elixier in einer tödlichen Menge zu verwenden?«
»Ihr meint tatsächlich, dieses Mittel hätte meinen Vater umgebracht?« Kathrin schüttelte es. Nie mehr würde sie vergessen können, dass sie selbst ihm dieses Zeug eingegeben hatte.
»Ich würde gerne wissen, was ein Arzt dazu sagt. Mir scheint es, als wäre diese Arznei vergiftet worden!«, rief Stößel empört aus. Auch wenn er persönlich keine Schuld trug, würde etwas an ihm hängenbleiben und ihn Kunden kosten.
Er war froh, als eine Magd Doktor Capracolonus hereinführte, der den Rat der Stadt in medizinischen Dingen beriet.
»Was höre ich? Herr Engstler soll tot sein?«, rief der Arzt, noch während er den Raum betrat.
»Leider ja!«, antwortete der Apotheker und wies anklagend auf die grünlich schimmernde Flasche. »Dieses Medikament hat ihn vergiftet. Ein Buckelapotheker aus Königsee brachte es mir heute gegen Mittag. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es ungeprüft an Jungfer Kathrin weitergegeben habe. Doch ich habe dem Laboranten Just vertraut.«
Der Arzt nahm die Flasche und roch daran. Doch erst, als auch er ein wenig des Inhalts mit der Zunge prüfte, erkannte er die Gefährlichkeit der Essenz.
»Beim Herrgott, mit dem Inhalt dieser Flasche kann man ein Dutzend Leute umbringen! Wie viel habt Ihr Eurem Vater gegeben?«, fragte er Kathrin.
»Zehn Tropfen, wie immer!«
»Das ist für einen einzigen Menschen viel zu viel. Stößel, Ihr sagt, ein Wanderapotheker aus Königsee habe Euch das Mittel gebracht?«
»Nicht nur dieses Mittel, sondern eine ganze Auswahl an Arzneien, die ich bislang gerne und mit Erfolg an meine Kunden weitergegeben habe.«
»Ihr hattet Glück, dass bisher niemand gestorben ist, bei dem man die Schuld diesen angeblichen Arzneien zuweisen konnte. Nichts als schädlicher Humbug, das ganze Zeug! Dies hier ist eine Sache für den Stadtrichter. Ihr solltet Herrn Hüsing holen lassen, Jungfer Kathrin. Das hier war Mord!« Der Arzt nickte der jungen Frau kurz zu und untersuchte den Toten.
»Einwandfrei vergiftet!«, erklärte er anschließend.
Kathrin hatte die Ausführungen des Arztes nicht abgewartet, sondern eine Magd losgeschickt, die nach kurzer Zeit mit dem Stadtrichter im Gefolge zurückkehrte.
»Was sagt Ihr da? Der Bürgermeister ist ermordet worden?« Man hatte den Richter vom Abendbrottisch weggeholt, und nun trauerte er dem Schmorbraten mit Brotklößen nach, die sein Koch für ihn zubereitet hatte. Richard Hüsing vergaß das Essen jedoch, als er von dem Arzt und dem Apotheker die näheren Umstände von Engstlers Tod erfuhr.
»Könnt ihr vor Gericht beschwören, dass der Bürgermeister vergiftet worden ist?«, fragte er, nachdem die beiden Männer ihren Bericht beendet hatten.
»Das können wir!«, erklärte der Arzt und hob den Zeigefinger. »Ich muss unseren verehrten Stadtapotheker Stößel tadeln, dass er sich die angeblichen Heilmittel aus Königsee ohne genauere Prüfung hat aufdrängen lassen. Unser hochverehrtes Stadtoberhaupt, Euer Vater, Jungfer Kathrin, könnte noch leben, wenn Stößel mehr Sorgfalt aufgewandt hätte.«
»Ich habe Herrn Engstler seit vielen Jahren mit diesem Mittel versorgt«, rief der Apotheker verzweifelt. »Bis jetzt hat es immer geholfen. Jungfer Kathrin kann das bezeugen!«
Die Tochter des toten Ratsherrn zögerte. Immerhin hatte Stößel ihr das giftige Medikament gegeben, ohne zu prüfen, ob es etwas taugte. Andererseits war er ein geachteter Bürger dieser Stadt gewesen und hatte nie eine Entscheidung ihres Vaters angezweifelt. Daher meinte sie ausschließen zu können, dass er ihm vorsätzlich hatte schaden wollen. »Die Schuld trägt allein dieser verfluchte Buckelapotheker und dessen Laborant!«, flüsterte sie. »Hätten sie die Mixtur belassen, wie sie war, und sie nicht mutwillig verändert, wäre mein Vater noch am Leben.«
Doktor Capracolonus hob nach Aufmerksamkeit heischend den Arm. »Ich habe immer davor gewarnt, den Mitteln dieser Bauern aus Thüringen zu vertrauen. Es sind ungebildete Kerle, die aus dem Gras ihrer Wiesen angebliche Wundermedizinen zusammenmischen und damit das einfache Volk betrügen. Man sollte den nächsten Buckelapotheker, der in unsere Stadt kommt, verhaften und einsperren, um unsere braven Bürger vor seinem verderblichen Gebräu zu schützen!«
»Diese Kerle gehören an den Galgen!«, stieß Kathrin Engstler aus.
Der Apotheker zog eine zweifelnde Miene, doch er wagte keinen Widerspruch. Jedes Eintreten für die thüringischen Wanderapotheker könnte ihm so ausgelegt werden, als würde er zu diesen halten und den Tod des Bürgermeisters billigen.
Daher rief er: »Der Kerl, der mir dieses Gift verkauft hat, muss noch in der Stadt sein. In den letzten Jahren hat er stets in der Posthalterei übernachtet, weil deren Wirt Heilmittel für die Pferde von ihm kauft.«
»Wenn er noch im Ort ist, werden wir ihn fangen. Ich schicke sofort die Büttel los!« Mit diesen Worten eilte der Stadtrichter davon.
»Gebe Gott, dass der Mann gefangen und bestraft werden kann!«, rief der Arzt und bat Kathrin, ihn zu entschuldigen, weil er einen Patienten aufsuchen müsse.
Auch Stößel verließ das Haus. Die Gewissensbisse, Armin Gögel an die Obrigkeit verraten zu haben, bekämpfte er damit, dass er etlichen Bewohnern, die sonst den verderblichen Arzneien des Buckelapothekers zum Opfer gefallen wären, das Leben gerettet hatte.
6.
Armin Gögel überlegte gerade, ob er sich noch einen zweiten Krug Bier leisten sollte, als mehrere Stadtbüttel in den Schankraum stürmten. Armin beachtete sie nicht, bis sie sich vor seinem Tisch aufbauten und ihre Spieße auf ihn richteten.
»Was soll das?«, fragte er verdattert.
»Du bist des Mordes überführt und verhaftet! Aufstehen, sonst machen wir dir Beine!«, blaffte ihn der Anführer der Büttel an.
»Ich ein Mörder? Seid ihr von Sinnen?«
Bevor Armin noch mehr sagen konnte, packten ihn zwei Häscher und zerrten ihn hoch. Dann banden sie ihm die Hände hinter dem Rücken zusammen und gingen dabei nicht gerade zimperlich mit ihm um.
»Aua, das tut doch weh!«, rief er empört und erntete einen harten Hieb mit dem Schaft eines Spießes.
»Maul halten und mitkommen!«, befahl der Anführer und trat einen Schritt beiseite, damit seine Männer Armin nach draußen schleifen konnten. Er selbst folgte ihnen mit dem guten Gefühl, dass er den gesuchten Verbrecher dem Stadtrichter schnell vorführen konnte.
Der Tod des Bürgermeisters war Richard Hüsing wichtig genug, um auf sein schönes Abendessen zu Hause zu verzichten. Er wartete im Vorraum des Gefängnisses und labte sich gerade an einer Scheibe Brot und einem Stück Wurst, als seine Männer mit dem Gefangenen erschienen. Rasch legte er die angebissene Wurst beiseite, schluckte das, was er noch im Mund hatte, hinunter und maß Armin mit einem strengen Blick.
»Du bist wegen des Verdachts verhaftet worden, den Tod unseres ehrengeachteten Bürgermeisters Emanuel Engstler herbeigeführt zu haben!«
Armin starrte den Richter erschrocken an. »Aber ich kenne diesen Mann doch gar nicht! Ich habe ihn nie gesehen! Wie hätte ich ihn da umbringen können?«
»Er starb durch das angebliche Heilmittel, das du dem ehrenwerten Apotheker Stößel verkauft hast. In Wirklichkeit war es Gift und hätte ausgereicht, mehr als einhundert Menschen zu töten!«
Die Stimme des Richters klang so scharf, dass Armin bereits das Schwert des Henkers über seinem Nacken spürte. Verzweifelt blickte er Hüsing an. »Ich habe diese Arzneien guten Gewissens von dem Laboranten Just in Königsee übernommen. Er und sein Sohn Tobias haben diese Arzneien angemischt. Wenn einer die Schuld trägt, dann sind sie es! Nicht ich!«
»So Gott will, werden auch Rumold Just und sein Sohn für den Tod des Ratsherrn büßen. Du aber hast das Mittel verkauft und bist daher ebenfalls der irdischen Gerechtigkeit verfallen. Bringt ihn weg und sperrt ihn in eine Zelle. Ich werde ihn morgen verhören.«
Nachdem er diesen Befehl erteilt hatte, überlegte der Richter, nach Hause zu gehen und zu sehen, ob sein Abendessen doch noch genießbar war. Sein Pflichtbewusstsein war jedoch stärker, und er nahm Papier und Feder zur Hand. Emanuel Engstlers Tod war eine üble Sache, daher wollte er die fälligen Berichte an den Stadtrat und an Landgraf Karl von Hessen-Kassel, der über die ringsum von Hannoverschem Land umgebene Stadt Rübenheim gebot, noch am gleichen Abend fertigstellen.
Dabei galten seine Gedanken auch dem Laboranten Rumold Just und dessen Sohn Tobias. Es stand für ihn außer Frage, dass die beiden bestraft werden mussten. Deshalb würde er auch einen entsprechenden Brief an die Behörden im Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt senden, zu deren Untertanen Vater und Sohn Just zählten.
Während er seine Berichte verfasste, fragte Hüsing sich besorgt, wie es in seiner Stadt weitergehen würde. Emanuel Engstler war nicht nur mit Abstand der reichste Bürger in Rübenheim gewesen, sondern auch der fast allmächtige Herrscher der Stadt, denn der Rat hatte sich stets seinem Willen gebeugt. Wer würde an Engstlers Stelle treten und die Stadt sowohl gegen die Begehrlichkeiten des Kurfürstentums Hannover verteidigen wie auch gegen die mit Sicherheit erfolgenden Versuche des Landgrafen, die Privilegien, die dieser der Stadt erteilt hatte, wieder zu beschneiden?
Teil 1
Eine schlimme Nachricht
1.
Klara biss die Zähne zusammen, doch die Übelkeit wollte nicht weichen. Aber wenn sie die Kirche verließ, um draußen ihren Magen zu entleeren, würden ihr scheele Blicke folgen und einige ihr sogar nachreden, sie wäre vom Teufel besessen, weil sie den Weihrauch und die Predigt des Pastors nicht vertrüge. Dabei war sie schwanger und wurde von einer besonders üblen Morgenübelkeit geplagt. Ich hätte nicht in die Kirche gehen sollen, dachte sie. Und doch wusste sie, dass auch dies keine Lösung gewesen wäre. In ihrer ersten Schwangerschaft war sie dem Gottesdienst ein paarmal ferngeblieben, und sofort hatten die Schwatzweiber von Königsee sich das Maul darüber zerrissen.
Mit eisernem Willen beherrschte sie ihren Magen, schwitzte aber vor Anstrengung und war froh, als der Pfarrer sein letztes Amen sprach. Klara zwang sich, nicht sofort hinauszustürzen, sondern ließ den alten Frauen den Vortritt.
Eine von ihnen lächelte ihr zu. »Bist ein braves Weib, Justin! Da könnte sich so manch hochfahrende Jungfer ein Beispiel nehmen.«
Klara senkte kurz den Kopf, spürte dabei, dass die Übelkeit abnahm, und atmete auf. Ganz so schlimm wie vor gut drei Jahren, als sie mit dem kleinen Martin schwanger gegangen war, hatte es sie diesmal nicht befallen. Bei dem Gedanken an ihren Sohn lächelte sie. Martin hatte wieder Freude in das Leben ihres Schwiegervaters gebracht, nachdem dessen Ehefrau Magdalena kurz zuvor verstorben war. In sechs Monaten würde er sich über einen weiteren Enkel oder eine Enkelin freuen können.
In Gedanken versunken, hatte Klara kaum bemerkt, dass die Kirche sich geleert hatte. Erst eine Berührung am Arm ließ sie aufblicken. Es war Tobias, ihr Mann.
»Geht es dir nicht gut, mein Schatz?«, fragte er besorgt.
Klara sah ihn lächelnd an. »Vorhin war es quälend, doch jetzt geht es wieder. Ich muss nur an die frische Luft.«
»Dann komm! Vater ist schon draußen.« Tobias bot Klara seinen Arm und führte sie auf den Vorplatz. Dort hatten sich bereits viele Kirchenbesucher eingefunden. Während die meisten Männer dem Wirtshaus zustrebten, standen die Frauen in der Nähe des Portals und tauschten den neuesten Klatsch aus.
»Sollen wir gleich nach Hause gehen?«, fragte Tobias.
Klara schüttelte den Kopf. Sie wusste, dass er noch mit einigen Männern sprechen und hinterher einen Krug Bier in der Schankwirtschaft trinken wollte. Auch fühlte sie sich mittlerweile wieder gut genug, um den Weg allein zu bewältigen. Daher löste sie sich von Tobias und trat zu den anderen Frauen.
Deutlich war eine Trennung zwischen den einzelnen Ständen und Gruppen zu erkennen. Als Schwiegertochter des reichen Laboranten Rumold Just war Klaras Platz bei den wohlhabenden Bürgerinnen und den Ehefrauen der fürstlichen Beamten in Königsee. Während es bei den Weibern der einfacheren Stände recht lebhaft zuging, achteten die bessergestellten Frauen auf die Bedeutung, die ihnen ihre Abstammung und die Familie verliehen.
Klara, die als Tochter eines einfachen Wanderapothekers aufgewachsen war, hätte sich gewünscht, sich zu den Ärmeren gesellen zu können. Bei denen wurde zwar auch gehechelt und gestritten, aber aus ehrlichem Herzen. Stattdessen war sie gezwungen, sich das ebenso gezierte wie vergiftete Gerede der Damen anzuhören.
Während die Frau des Pastors eben über eine Magd des Amtsmanns herzog, die sich durch unsittliches Verhalten einen dicken Bauch geholt habe, blickte Klara zu ihrem Mann hinüber. Noch heute erschien es ihr wie ein Wunder, dass Tobias sich in sie verliebt und die Heirat bei seinen Eltern durchgesetzt hatte. Er war der liebenswerteste Mensch, den sie kannte, sah obendrein noch gut aus und hatte Verständnis für all ihre kleinen und großen Sorgen. Auch mit ihrem Schwiegervater kam sie gut zurecht. Leider hatte er nach dem Tod seiner Frau die Freude am Leben verloren und überließ Tobias die meiste Arbeit bei der Herstellung ihrer Arzneien. Dennoch galt er nach wie vor allen als der Herr im Hause Just. Klara lächelte, denn sie war sich sicher, dass ihr Mann ihm ohne Schwierigkeiten würde nachfolgen können.
Sie hoffte jedoch, dass dieser Tag noch fern war, denn sie lebten alle gut miteinander. Zudem war es nie schön, am Grab eines Menschen stehen zu müssen, den man geliebt hatte. Mit diesem Gedanken wandte sie sich wieder dem Gespräch der Damen zu. Es unterschied sich nicht nur durch die gezierte Sprache und die feinen Spitzen, die darin verteilt wurden, von dem der einfacheren Frauen. Die Ärmeren nahmen es einer Magd nicht übel, wenn sie einen dicken Bauch bekam. Hier aber wetzten die Pharisäerinnen, wie Tobias sie nannte, ihre Schnäbel, und die waren äußerst scharf.
Um der Höflichkeit Genüge zu tun, blieb Klara eine Zeitlang bei den Frauen stehen, dann verabschiedete sie sich erleichtert und strebte dem stattlichen Anwesen ihres Schwiegervaters zu. Dieser war bereits mit Tobias zusammen zum Wirtshaus gegangen, doch die beiden würden rechtzeitig zum Mittagessen zurück sein. Bis dorthin lag einiges an Arbeit vor ihr und der Köchin Kuni.
Ein paar Frauen sahen ihr nach, und nicht alle taten es mit Wohlwollen. »Seht nur, wie stolz sie geht!«, sagte eine Jungfer, die sich vor ein paar Jahren große Hoffnungen gemacht hatte, der schmucke Laborantensohn Tobias Just könnte sie heimführen.
»Dabei ist sie nur die Tochter eines schlichten Buckelapothekers und ist sogar selbst als Wanderapothekerin durch die Lande gezogen«, warf eine zweite Frau ein.
Ihre Nachbarin wollte ebenfalls nicht zurückstehen. »Man muss sich wirklich fragen, was der junge Just an ihr gefunden hat.«
»Wahrscheinlich die Bereitwilligkeit zu gewissen Dingen, die leider Gottes bei Mädchen niederen Standes verbreitet sind«, erwiderte die Frau des Pastors. Sie hatte mehrere Töchter zu versorgen, und da wäre ihr der Sohn eines wohlhabenden Laboranten als Schwiegersohn durchaus willkommen gewesen.
»Es steht schon in der Bibel, dass ihr nicht falsches Zeugnis ablegen sollt über euren Nächsten«, mahnte die alte Frau, der Klara in der Kirche den Vorrang gewährt hatte. »Immerhin hat Klara Just ihr erstes Kind geziemende vierzehn Monate nach ihrer Hochzeit geboren, und ich habe nie eine Klage über sie gehört, dass sie hoffärtig wäre oder jemanden beleidigt hätte. Euer Ehemann«, der Finger der Alten stach auf die Frau des Pastors zu, »nannte sie letztens von der Kanzel ein glänzendes Beispiel christlicher Nächstenliebe, denn sie hat, als das Haus von Matthes in Lichta abgebrannt ist, nicht nur für den armen Mann gespendet, sondern drei von dessen Kindern im Haus ihres Schwiegervaters aufgenommen, bis die neue Kate errichtet war.«
Einige der Frauen freuten sich über die Zurechtweisung der Pfarrersfrau, da diese sich ihrer Meinung nach etwas zu viel auf ihre Stellung einbildete und kaum ein gutes Haar an anderen ließ. Die Pastorenfrau selbst aber wandte sich grußlos ab und strebte erhobenen Hauptes dem Pfarrhaus zu.
2.
Unterdessen hatte Klara das Anwesen ihres Schwiegervaters erreicht und trat in ihre Kammer, um sich umzuziehen. Als sie kurz darauf zur Küche hinunterstieg, wunderte sie sich, Stimmen zu vernehmen. Immerhin war Kuni allein zurückgeblieben, und der kleine Martin spielte draußen im Garten.
Sie öffnete die Küchentür und stieß einen Laut der Überraschung aus. »Martha! Wie schön, dich zu sehen!«
Begeistert umarmte sie ihre Freundin, nahm erst dann den schmerzlichen Ausdruck auf deren Gesicht wahr und sah sie erschrocken an. »Ist etwas Schlimmes geschehen?«
Martha nickte. »Ja! Aber das werde ich dir später erzählen. Zuerst sollten wir zusehen, dass die Brotklöße so werden, wie Tobias und sein Vater sie mögen.«
»Ihr könnt ruhig ein wenig miteinander schwatzen. Martha hat mir genug geholfen, so dass ich jetzt allein zurechtkomme«, erklärte Kuni.
Trotz dieser Worte sah Klara sich in der Küche um, stellte aber fest, dass Kuni recht hatte. Für sie gab es nichts mehr zu tun.
»Dann komm mit!« Sie führte Martha in ihr Nähzimmer. Es war zwar nicht besonders groß, bot aber Platz für einen kleinen Tisch und zwei Stühle. Vor allem aber wagte weder ihr Mann noch ihr Schwiegervater, sie in diesem Raum zu stören.
Klara goss Schlehenwein in einen Becher, stellte ihn vor Martha hin und sah sie auffordernd an. »Was gibt es?«
Zunächst druckste Martha ein wenig herum, hob dann mit einer hilflosen Geste die Hände und brach in Tränen aus. »Es geht um Fritz’ Vater!«
Klara kannte den alten Kircher als einen kleinen Bauern, der sich bislang mühsam über Wasser gehalten hatte. In den letzten Jahren hatte sein Hof nicht zuletzt durch Zukäufe an Land, die er mit Marthas Geld hatte tätigen können, an Wert gewonnen. Da Marthas Ehemann Fritz ein besserer Landwirt war als sein Vater, konnte er seitdem genug erwirtschaften, um seiner Familie ein gutes Auskommen zu bieten.
»Was ist mit ihm?«, fragte sie. »Er ist doch nicht etwa gestorben?«
»Ich wollte, er wäre es!«, rief Martha erregt aus. Sie sah Klara mit wehen Augen an. »Alles hat mit dem Tod meiner Schwiegermutter im letzten Winter angefangen. Am nächsten Tag schon begann Fritz’ Vater, mir nachzustellen. Er sagte mir ins Gesicht, dass er, da ich nach vier Jahren Ehe von seinem Sohn nicht schwanger geworden wäre, wohl selbst für seine Enkel sorgen müsse!«
»Aber das ist doch …« Klara fehlten die Worte.
»Zuerst habe ich es nur für das dumme Gerede eines alten Mannes gehalten und mir nicht viel dabei gedacht. Aber dann bedrängte er mich wieder und wieder. Wenn Fritz nicht in der Nähe war, griff er mir an die Brust oder an den Hintern. Als ich ihm sagte, er solle damit aufhören, weil ich es sonst meinem Mann sagen würde, lachte er mich aus. Er erklärte mir, er wäre der Herr auf dem Hof, und Fritz hätte zu kuschen – und ich ebenfalls!«
Martha rieb sich die Tränen aus den Augen. »Er brachte mich so weit, mich schuldig zu fühlen, weil ich noch kein Kind geboren habe. Daher wollte ich unbedingt von Fritz schwanger werden. Aber es kam nicht dazu. Und dann … dann hat mich der Alte im Stall überfallen, mich auf die Streu gedrückt und mich wie ein Wilder mit Gewalt gerammelt. Er meinte, ich dürfe es Fritz gerne erzählen. Dem würde er sagen, ich hätte mich ihm angeboten, um ein Kind zu bekommen, weil Fritz es ja fast vier Jahre lang nicht geschafft habe, mir eins in den Bauch zu schieben!«
»Hast du es Fritz erzählt?«, fragte Klara.
Ihre Freundin nickte.
»Und?«
»Es gab einen wüsten Streit! Dabei schrie der Alte Fritz an, da er bei mir nicht für Kinder sorgen könne, müsse er das wohl übernehmen. Sollte uns dies nicht passen, könnten wir den Hof verlassen.«
»Der Mann ist verrückt!«, rief Klara erregt aus. »Was hat Fritz daraufhin gesagt?«
»Er hat den Alten zur Rede gestellt, wurde aber von diesem scharf angefahren, und fragte mich zuletzt, ob es denn so schlimm sei, wenn ich seinen Vater das eine oder andere Mal machen lasse. Ich wünschte mir, er hätte mehr Selbstvertrauen, doch er ist zu sehr gewohnt, dem Alten zu gehorchen.«
»Das kann doch nicht wahr sein!«, rief Klara empört. »Wenn Fritz das von dir fordert, ist er ebenfalls verrückt. Ich wusste ja, dass er nicht viel im Kopf hat, aber das hätte ich nicht von ihm erwartet.«
Martha brach in Tränen aus. »Ich doch auch nicht! Auf jeden Fall habe ich ihm erklärt, dass er nicht mehr mein Mann ist, solange er von mir verlangt, die Hure für seinen Vater zu spielen. Dann habe ich mein Bündel gepackt und bin gegangen. Sie wollten mich zwar aufhalten, aber ich bin schneller als die beiden.« Martha zischte bei der Erinnerung an die Szene empört und klammerte sich an Klara. »Ich bitte dich, mir Obdach zu geben, bis ich weiß, wie es weitergehen soll.«
»Du bist meine beste Freundin, und ich lasse dich nicht im Stich.« Klara streichelte Martha sanft übers Haar und sagte sich, dass diese, wäre es ihr damals mit einer Heirat nicht so eilig gewesen, gewiss einen Mann mit einem festeren Charakter als Fritz Kircher gefunden hätte.
»Jetzt bleibst du erst einmal hier. Du kannst Kuni helfen und ein wenig auf Martin achtgeben. Der kleine Racker versetzt mich mit seinen Streichen immer wieder in Angst und Schrecken. Erst gestern habe ich ihn vom Bachufer weggeholt. Er wolle einen Fisch fangen, sagte er.«
»Mit drei Jahren? Da fängt er aber früh an!« Nun lächelte Martha doch, und als sie in sich hineinhorchte, freute sie sich darauf, Klaras Sohn um sich zu haben.
»Du bist so lieb zu mir!«, sagte sie und brach erneut in Tränen aus.
»Du hast so viel für mich getan, da kann ich auch ein wenig für dich tun«, antwortete Klara und wies zur Tür. »Wir sollten jetzt zurück in die Küche. Nun gibt es gewiss etwas für uns zu tun, denn es wird nicht mehr lange dauern, bis Tobias und sein Vater heimkommen.«
»Du wirst ihnen doch nicht sagen, weshalb ich von zu Hause ausgerückt bin?«, fragte Martha besorgt.
Klara schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht! Du hast dich mit deinem Mann gestritten und wirst vorerst nicht zu ihm zurückkehren. Das muss ihnen reichen.«
»Danke!« Erleichtert folgte Martha ihrer Freundin in die Küche und half dort mit, alles für das Mittagessen vorzubereiten.
3.
Es dauerte diesmal etwas länger, bis Rumold und Tobias Just aus dem Gasthof zurückkamen. Beide wirkten ernster als sonst.
»Na, was gibt es Gutes?«, fragte Tobias und begrüßte dann erst Martha. »Du hast es in Katzhütte ohne Klara wohl nicht mehr ausgehalten?«
»Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen?«, fragte Martha besorgt.
Tobias hob begütigend die Hand. »Nein, gewiss nicht!«
»Martha wird etwas länger bei uns bleiben. Es gab Ärger mit ihrem Mann und ihrem Schwiegervater.« Klara wollte so nahe wie möglich an der Wahrheit bleiben, ohne die direkten Gründe zu offenbaren, aus denen ihre Freundin Heim und Hof verlassen hatte.
»Ist schon recht!«, erwiderte Rumold Just. »Ich bin ganz froh, wenn dir jemand unter die Arme greift. Immerhin bist du bereits im vierten Monat, und da solltest du es etwas langsamer angehen lassen.«
»Was? Du bist wieder schwanger?«, rief Martha.
Für einen Augenblick empfand sie Neid. Aber dann umarmte sie Klara stürmisch. »Ich freue mich so für dich!«
»Ich würde dir wünschen, bald auch ein Kleines im Arm zu halten«, antwortete Klara leise.
»Dafür müsste sich einiges ändern. Wer weiß, vielleicht ist mein Schoß trocken und ohne Leben!« Ein Ausdruck des Schmerzes zuckte über Marthas Gesicht und rührte die beiden Männer.
»Sind Fritz und sein Vater zornig auf dich, weil du bislang kein Kind geboren hast?«, fragte Just. »Bei Gott, ich kannte Frauen, die waren zehn Jahre und länger verheiratet, bis das erste Kind kam. Die beiden sollten dir mehr Zeit lassen. Du bist noch nicht einmal fünfundzwanzig Jahre alt!«
»So sehe ich das auch«, stimmte Tobias seinem Vater zu.
»Klara ist jünger als ich und bekommt schon ihr zweites!«, sagte Martha seufzend und fand die Gaben der Welt ungerecht verteilt. Im nächsten Moment schalt sie sich für dieses Gefühl und sagte sich, dass ihre Freundin ihr Glück verdient hatte.
»Es gibt Schweinerippen, Kohl und feine Brotklöße«, erklärte sie und schnupperte. So gut wie in diesem Haus hatten sie auf dem Kircherhof nie gegessen, obwohl sie dort mehr Schweine hielten als Just, der zweimal im Jahr ein Ferkel kaufte und es mästete.
Martha schob auch diesen Gedanken beiseite. Wenn sie eines nicht wollte, so war es, neidisch auf ihre Freundin zu sein. Sie half Klara beim Tischdecken und erhielt sogar einen eigenen Stuhl, so als wäre sie ein gerngesehener Gast. Dabei hätte sie auch mit Kuni in der Küche gegessen. Hauptsache, sie hatte ein Plätzchen gefunden, an dem sie vor den Nachstellungen ihres Schwiegervaters sicher war.
Unterdessen musterte Klara ihren Mann und dessen Vater. Etwas bewegte die beiden, das spürte sie, doch rückte keiner von ihnen mit der Sprache heraus.
»Gab es etwas in der Gastwirtschaft?«, fragte sie daher geradewegs.
Tobias schüttelte den Kopf. »Wie kommst du darauf? Nein, natürlich nicht!«
»Dein Weib kennt dich besser, als du denkst. Bei Magdalena und mir war es genauso. Ihr konnte ich auch nichts vormachen!« Rumold Just wischte sich über die Augen, die verdächtig feucht schimmerten, und stupste seinen Sohn an.
»Sag es Klara! Sie wird sonst keine Ruhe geben.«
»So schlimm bin ich nun auch wieder nicht«, rief Klara.
Ihr Schwiegervater sah sie mit einem schmerzlichen Lächeln an. »Du bist das Beste, was meinem Sohn passieren konnte. Aber nun zu dem, was wir erfahren haben. Im Gasthaus haben wir Herrn Liebmann getroffen, einen Laboranten aus Großbreitenbach.«
Klara hob die Augenbrauen. Großbreitenbach war neben Königsee einer der Ausgangspunkte der Wanderapotheker. Die Kunst, Arzneien aus den Heilpflanzen dieser Gegend zu destillieren, war von dort aus nach Königsee gekommen, wie Klara mittlerweile gelernt hatte. Seitdem gab es einen gewissen Konkurrenzkampf zwischen den Laboranten der beiden Städte, zumal sie auch noch verschiedenen Fürstentümern angehörten. Regierte in diesem mit Friedrich Ludwig der Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt, war es drüben Günther Friedrich Carl von Schwarzburg-Sondershausen. Die Laboranten beider Länder versuchten, einander zu übertreffen, und das machte sich so manch anderer Landesherr zunutze, indem er das Privileg, dort Arzneihandel treiben zu dürfen, wechselweise vergab, um möglichst hohe Einnahmen zu erzielen.
»Und? Was hat der Mann erzählt?«, fragte Klara, die sich wunderte, was ein Laborant aus Großbreitenbach ausgerechnet in einer Königseer Gastwirtschaft zu suchen hatte.
»Er wollte wissen, ob es in letzter Zeit Probleme auf unseren Strecken gegeben habe«, antwortete Tobias. »Er selbst hat im Frühjahr zwei Strecken verloren. Angeblich würden seine Arzneien nichts taugen. Dabei sind die Großbreitenbacher Laboranten gewiss nicht schlechter als wir.«
»Vielleicht waren die Heilpflanzen schlechter als in den Jahren zuvor, so dass die Arzneien an Wirksamkeit verloren haben«, überlegte Klara.
»Wir sollten uns davon nicht den Appetit verderben lassen«, warf ihr Schwiegervater ein. »Heute habe ich endlich mal wieder richtig Appetit. Das ist selten, seit meine Magdalena von uns gegangen ist.«
»Vater hat recht. Greift zu!«, forderte Tobias die beiden Frauen auf.
»Aber erst, nachdem er oder du das Tischgebet gesprochen habt. Wir wollen uns doch bei unserem Herrgott dafür bedanken, dass unser Tisch so reichlich gedeckt ist«, sagte Klara lächelnd und faltete die Hände.