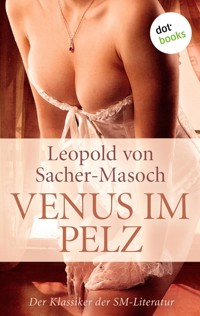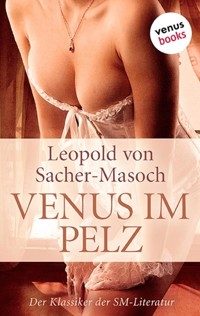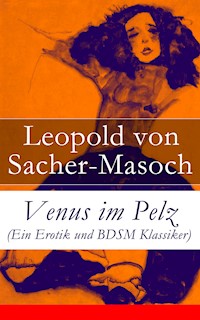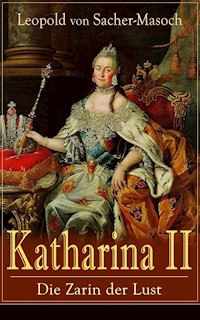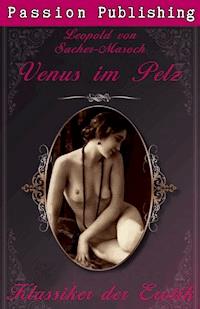9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Männerschwarm Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Geschlecht zu wechseln, um dem Geliebten zu gefallen, ist seit Shakespeare ein ergiebiger Gegenstand der Literatur. Sacher-Masoch unterlegt das Motiv mit seiner eigenen Typologie der Geschlechter, die auch der berühmten Erzählung Venus im Pelz zugrunde liegt: Die Frauen sind zu wahrer Liebe nicht fähig. In "Venus im Pelz" ersetzt der Held deshalb Liebe durch Unterwerfung, in "Die Liebe des Plato" entsagt der junge Graf Tarnow vollständig der Liebe der Frauen – und wird deshalb zum Gegenstand einer raffinierten Täuschung. Schließlich spielt er wider besseres Wissen sogar mit in diesem Spiel, da er seinen "Anatol" nicht verlieren will. Michael Gratzke hat mit viel Sorgfalt eine Neuausgabe dieser seit langem nicht mehr lieferbaren Erzählung besorgt und kenntnisreich kommentiert. Aufgrund seiner galizischen Wurzeln verkörpert Sacher-Masoch eine literarische Tradition, die im modernen Europa verschüttet ist. So ist vor allem eine zauberhafte Prosa wiederzuentdecken, die den Leser auf ihre eigene Weise in die Welt schneidiger Offiziere, rauschender Ballkleider und flackernder Kerzen entführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
LEOPOLD VON SACHER-MASOCH
DIE LIEBE DES PLATO
Herausgegeben und mit einemNachwort versehen vonMichael Gratzke
Männerschwarm VerlagHamburg 2012
«MAN MUSS DIE AN DER SEELE
HAFTENDE SCHÖNHEIT
FÜR KOSTBARER HALTEN
ALS DIE LEIBLICHE.»
PLATO, GASTMAHL
RAHMENHANDLUNG
Ich besuche so gern das Tarnowische Haus, weil in demselben eine eigenthümliche Gemüthlichkeit um die kleinsten Dinge webt, diese Gemüthlichkeit scheint dort in der Luft zu liegen, denn sie durchdringt Alles, die grauen Mauern des Edelhofes, die alten, verschossenen Möbel, die Menschen, die Thiere und man wird von ihr ergriffen und selbst friedlich und heiter, sobald man sie einige Zeit eingeathmet hat. Es ist dies auch eine Art Wärme und eine Art Licht, und dieses Licht und diese Wärme wird, wie ich glaube vor Allem von der alten Gräfin Karoline Tarnow* ausgestrahlt. Ich habe dort unter den großen Schränken mit dem altväterischen Holzmosaik, den Dienstleuten, welche alle wie Halbverstorbene aussehen, die schwarze Katze auf dem Schooße, die Gräfin mir gegenüber an dem flackernden Kamin, unter dem milden warmen Lichte ihrer Augen mehr als einmal meinen Kummer, meine Sorgen, mehr als einen quälenden Zweifel, mehr als einen tiefen Schmerz vergessen, ja überwunden.
Auch heute ist mir wohl bei ihr. Ich war lange von der Heimath fort und mein erster Gang war zu der Gräfin Tarnow, und nun sitzt sie mir wieder gegenüber und hält meine Hände und blickt mit ihren blauen Augen in meine Seele, denn was bliebe diesen Augen verborgen?
Es ist ein frostiger Winterabend, hell aber kalt, sehr kalt sogar, von draußen flimmern ein paar Sterne herein, das Feuer im Kamin wirft seine rothen Zungen über den Teppich und wir plaudern. Ich habe viel zu erzählen und sie hat mir manche Frage zu beantworten.
Die Gräfin ist die einzige Frau, die mir je außer meiner Mutter und meiner Frau Achtung eingeflößt hat; diese Frau aber, welche Jedem so sehr imponirt, ist in keiner Weise gebieterisch, sie ist nicht einmal groß, es ist eine ganz kleine, zarte Frau, mit einem kleinen Gesicht, das noch im Alter von grauem Haare ehrwürdig eingerahmt die größte Feinheit und Schönheit zeigt, aber diese Schönheit ist eine geistige und geistig ist auch die Macht, welche die Frau übt, und diese Macht liegt vor Allem in ihren großen blauen Augen, welche gleichsam aus einer andern Welt in die unsere herüber blicken. Dieses geistige Wesen hat sie auf ihren Sohn, den Grafen Henryk, übertragen und wie sie mich ansieht, ist es mir auch einen Augenblick, als ruhe das Auge meines Freundes auf mir.
«Was macht unser Plato?» frage ich rasch, «ich habe seit mehr als einem Jahre keine Nachrichten von ihm.»
«Seit einem Jahre,» sprach die Gräfin, «es ist Manches geschehen in diesem Jahre. Er hat sich von seiner Frau getrennt –»
«Von seiner Frau?» – rief ich und stand unwillkürlich auf – «Henryk hat eine Frau – Plato eine Frau – das ist ja gar nicht möglich.»
«Sie wissen also nicht einmal, daß er geheirathet hat?»
«Nichts weiß ich, nichts.»
«Aber setzen Sie sich doch,» sagte die Gräfin.
«Ja er hat vor einem Jahre geheirathet und hat sich vor wenigen Wochen von seiner Frau getrennt.»
Ich setzte mich. «Plato verheirathet, getrennt,» sprach ich, «ich kann es nicht fassen. Er – dieser Weiberfeind.»
«Das war er nie,» unterbrach mich die Gräfin.
«Also dieser Philosoph, dieser Idealist, der sich von nichts Irdischem nähren wollte, der immer wie der heilige Denis in Voltaire’s Pucelle* auf einem Regenbogen ritt und in dem Weibe nur den geistreichsten und schönsten Affen sah, verheirathet – es ist nicht zu glauben. Ich sehe ihn noch vor mir, als ich ihm vor drei Jahren zuletzt die Hand drückte. Damals hatte er noch kein Weib berührt, oder doch? Ich fragte ihn einmal: hast du noch nie ein Weib geliebt? und er erwiederte: doch – aber es war ein Mann.» Die Gräfin lächelte.
«Ich sehe ihn noch vor mir,» fuhr ich fort, «wie er dabei lächelte mit seinem schönen Gesichte und seinem kindlich malitiösen Lächeln, er kam mir immer wie ein verkleidetes Mädchen vor, so zart und anmuthig war seine Erscheinung, er ging immer auf den Fußspitzen, wurde leicht roth, schloß die Augen, wenn er sprach und hatte eine Bewegung mit den Händen, wie wenn er schwimmen würde. Er wich den Frauen gerne aus und behandelte die Männer mit einer Zartheit und Liebenswürdigkeit wie die Andern unsere Damen. Ein Freund war er wie kein zweiter, er konnte sich opfern für die, die seinem Herzen nahe standen –»
Ich erhielt keine Antwort, denn während ich dies sprach, war langsam würdevoll die schwarze Katze eingetreten, auf ihren sammtenen Pfoten unhörbar bis zu dem Kamin gekommen und mit einem Sprunge auf dem Schooße der Gräfin, wo sie mit zugedrückten Augen zu schnurren und den Schweif zu rollen begann. Diese Katze hieß Mimi und war die vollkommenste, die ich in meinem Leben gesehen, eine wahrhafte Katzenschönheit und dabei lag in ihren runden gelben Augen so viel Seele, eine Katzenseele natürlich, und so viel Geist und Güte, und sie hatte ihre Geschichte diese Katze und ihre Schicksale und ihren Weltschmerz, sie hatte das Unglück, eine Katze zu sein und sich in einen Menschen zu verlieben.
Nachdem sie der Gräfin ihren Gruß gebracht, sprang sie auf mein Knie herüber und wie ich sie streichelte, war ihr prächtiges Fell noch ganz kalt von dem Winterfrost draußen und strömte eine angenehme Frische aus.
«Seine Abneigung gegen die Frauen war also mehr Schüchternheit,» begann ich wieder.
«Nein, es sind Principien bei ihm,» entgegnete die Gräfin. Die Katze setzte sich in diesem Augenblicke auf den Sims des Kamins, wo sie sitzen blieb und mit großer Spannung an unserem Gespräche Teil zu nehmen schien.
«Principien?»
«Ja, es gibt überhaupt mehr ideale Naturen, mehr reine Herzen,» sprach die Gräfin, «als man glauben will. Nur schämt sich Mancher seiner Güte und verbirgt sie wie etwas, was ihn bloßstellen könnte, ja wie ein Verbrechen. Auch Sie – spielen Sie mir nur nicht den Pessimisten, den Libertiner* – ich kenne Sie. Nun gut. Um Ihnen aber zu erklären, wie dies Alles kam, müßte ich sehr weit ausholen, und wenn ich Ihnen auch Alles erzählen wollte, Sie würden die Geschichte seiner Ehe doch nicht verstehen. Was soll ich also thun?» Sie sann nach.
«Aber ich bin sehr neugierig.»
«Sie müßten ein früheres Erlebniß kennen,» begann die Gräfin wieder, «nur dann werden Sie meinen Sohn nicht ungerecht verurtheilen. Es ist also am Besten –» sie erhob sich, öffnete einen der großen Schränke und holte ein Heft hervor, in dem sie einen Augenblick blätterte.
Dann sprach sie: «Lesen Sie diese Briefe, aber vergessen Sie nie dabei, daß sie vor acht Jahren geschrieben sind und daß mein Henryk damals nicht mehr als zwanzig Jahre zählte, und lesen Sie dieselben genau in der Reihenfolge, in welcher sie hier zusammengeheftet sind. Henryk selbst hat, als er das letztemal da war, von mir eine Nadel verlangt und einen Faden blauer Seide und hat sie zusammengenäht und den Titel geschrieben.»
Es war spät, als ich nach Hause kam, aber meine Neugierde war zu groß; so verschlang ich denn das Heft sofort, ohne es nur für eine Sekunde aus der Hand zu legen.
BRIEFE AN MEINE MUTTER
Den 7. December.
Liebe Mutter!
Ich bin glücklich angekommen und befinde mich wohl, aber dabei ist es mir recht einsam und – ich schäme mich nicht, es zu gestehen – recht bange. Du weißt ja, daß ich den Soldatenrock angezogen habe, um in dem Lande, dessen Bürger ich bin, einen Beruf zu erfüllen, nicht aber, um den Helden zu spielen. Ich habe Heimweh und ein heftiges, tiefes Heimweh nach Dir, aber auch nach jedem alten Möbel, nach jedem halbdunklen Winkel, nach meiner schwarzen Katze, ja sogar nach dem Vater, der mir immer streng und fremd gegenüber gestanden ist. Ich bin eben das erstemal vom Hause fort. Meine Wohnung ist freundlich und bequem eingerichtet, ich habe auch bereits dem Obersten meine Aufwartung und meinen Kameraden Besuche gemacht; der Oberst war ziemlich kühl, die Officiere behandeln mich mit einer beleidigenden Artigkeit. Man läßt es mich fühlen, daß ich mit dem goldenen Porte-épée* in das Regiment kam.
So sitze ich denn Abends allein an dem warmen Ofen, mein Bursch kocht mir das Wasser zum Thee, und ich hänge meinen Gedanken nach und dies sind meine glücklichsten Stunden, denn dann bin ich bei Dir in unserem lieben Hause. Ich brauche nur die Augen zu schließen, und Alles steht lebhaft vor mir. Es ist fünf Uhr, die Stunde, wo wir in Deinem Zimmer den Kaffee nahmen. Anna deckt schon den großen runden Tisch mit dem gelben geblumten Tuch, und Marcin klappert mit den Tassen; ich höre Deine sanfte Stimme – ich höre Alfred und Roman, wie sie die gute Anna necken, sie die heilige Lichtscheere nennen und sie ganz zornig wird. Ich weiß nicht, aber ich kann in diesem Augenblicke weder über ihre vielen Heiligenbilder noch über ihren Myrthenkranz oder ihre Schwärmerei für den Pater Seraphikus* lachen, nicht einmal über den Jungfrauenverein. Marcin sogar in seiner komischen Leidenschaft für die Gouvernante erscheint mir als eine Naturnothwendigkeit, es würde dem alten Hause etwas fehlen, wenn er nicht während dem Serviren die Augen verdrehen und seufzen und während er den Boden wichst und auf seinen Bürsten tanzt, französisch lernen würde. Was macht der Adam, der herrliche Adam, den ich schon als Kind so liebte, der mich allein außer meiner Amme auf dem Arm haben durfte und den ich trotz seinem Stallgeruch, seinen ungewaschenen Händen und seinem von Branntwein rothlackierten Gesicht den schönen Ada nannte. Aber ich thue ihm Unrecht, er hat doch einmal seine Hände gewaschen und das war an dem Tage, wo er, zwei rothe Nelken im Knopfloch, um die Rosalie anhielt. Ob er sie am Hochzeitstage auch gewaschen, weiß ich nicht. Und Rosalie, was macht sie, die gute Seele hat manche Thräne in den letzten Äpfelstrudel hineingebacken, den sie mir gemacht hat. Aber ich spreche da von den Dienstleuten und vergesse –
Aber meine Brüder wissen ja wie ich sie liebe, sie meine besten Freunde, haben sie seitdem viele Schlachten geliefert, wer commandirt die französische Armee, seitdem ich fort bin. Sie werden vielleicht den Napoleon suchen und bei den Grenadieren werden ihnen vier Mann im Gliede fehlen und einer bei den Voltigeurs* der Garde und – ich kann es ihnen ja so nicht verheimlichen, auch bei den Uhlanen* einer – sie werden böse sein – aber sage ihnen, daß es mir schwer war, mich von meinen papiernen Soldaten zu trennen und daß ich diese wenigen mitgenommen habe und daß sie jetzt auf meinem Tische stehen zwischen meinen Büchern und den Büsten von Puschkin und Lermontow.
Und nach dem Kaffee sehe ich Dich an dem kleinen Nähtisch sitzen, auf dem eine Stadt abgebildet ist, unter der mit großen Buchstaben Petersburg steht, weil sie sonst Niemand erkennen würde. Erinnerst Du Dich noch, wie ich als Kind, wenn der Herr von Festenburg zum Vater kam und ich Dir nicht zu sagen wußte, wer bei ihm ist, da ich mir den Namen nie merken konnte, jedesmal zu Deinem Nähtisch lief und dann erfreut ausrief: der Herr von Petersburg, Mama, der Herr von Petersburg!
Ich sehe Dich an dem Nähtisch sitzen in Deinem weißen Häubchen und die Stadt Petersburg ist mit Hemden und Strümpfen bedeckt und Dir gegenüber hängt das Bild meiner kleinen verstorbenen Schwester, und über Deinem Bette hängt das Kreuz mit dem Heiland und die Mutter mit dem Jesuskinde und wie es dunkel wird, sitzen die Dienstleute in dem großen Zimmer, das keine Fenster hat und in dem eine ewige Dämmerung ist und, die Anna liest ihnen zum dreißigstenmale den Rinaldo Rinaldini oder die Geschichte von dem Czaren Iwan dem Schrecklichen und seinem Leibwächter und Du holst Deine Tücher und Fetzelchen und deckst die Vögel zu, die den Kopf unter dem Flügel auf den Sprossen sitzen und schlafen wollen, den Staar, die Turteltauben, die Kreuzschnäbel und die 21 Kanarienvögel, ich glaube, es sind wirklich 21 oder noch mehr, denn wir haben die Jungen niemals weggegeben, obwohl wir es uns jedesmal feierlich vornahmen. Leben die Katzen noch und Mimi, meine schwarze Freundin, wer läßt sie apportiren, und der alte Dschox, hat er nicht wieder dem Adam ein Kaninchen todt gebissen, ich höre ihn knurren und sehe ihn unter giftigem Gewinsel die Brodkügelchen essen, welche ihm Roman auf den Tisch legt.
Der Saal ist wohl schon ganz dunkel wie damals, wo der Vater mich in demselben auf den Vorposten stellte und die weißen Vorhänge lebendig wurden und ich weinend davonlief, der schöne Saal, der bei Sonnenlicht so freundlich ist, mit seinen blauseidenen Möbeln, seinen rothblühenden Kaktusen und seinen vielen Gemälden, dem Mädchen mit der Katze, der Maske, dem Moses, der den Israeliten in der Wüste die Schlange zeigt, den Landschaften, auf denen ich jeden Baum, jeden Zweig kenne.
Der Vater sitzt in seinem Zimmer an dem Marmortisch und liest, auf dem Tisch stehen Virgil, Goethe in seinem langen Kaputrock, die Hände auf dem Rücken und Friedrich der Große. Wie of unterhielt ich mich damit, seinen kleinen Degen aus der Scheide zu ziehen und wieder hineinzustecken. Auch Napoleon ist da, rittlings auf dem Sessel sitzend wie in der Schlacht bei Leipzig, und der kleine Klavierspieler aus Porzellan mit dem großen Zopf. Zwischen den beiden Fenstern steht drohend der geharnischte Mann, über seinem Helme kreuzen sich schartige Säbel, auf denen alte Blutflecken rosten und an der Wand hängt eine türkische Fahne, das Panzerhemd eines Tartarenchans, den ein Tarnow unter Sobieski* bei Zolkiev erschlagen, und auch die Mongolenpfeile hängen da, welche ich nie anrühren durfte, weil sie vergiftet sind.
Aber ich unterhalte Dich da mit Dingen, die Du alle kennst, die Dich umgeben, die mir indeß alle so unendlich kostbar und merkwürdig erscheinen, seitdem ich ferne von ihnen bin.
Du willst Nachrichten von mir und ich weiß Dir heute nichts zu erzählen, aber in meinem nächsten Briefe hoffe ich Dir Manches mittheilen zu können, denn wie ich Dir zu Hause stets Alles gesagt habe, so sollst Du auch jetzt von mir wissen und jeden geheimsten Gedanken und jedes Gefühl, das sich vor sich selbst schämt, Alles werde ich Dir schreiben, sollte es Dir auch zu viel werden, Alles was ich erlebe, die Gedanken, die mir kommen, die Empfindungen, die ich habe, und meine Handlungen, und Du wirst mir immer wie zu Hause sagen, ob ich unvernünftig oder ob ich recht gehandelt habe. Denn Du hast mich immer gut geleitet mit Deiner lieben, sanften Hand und wenn Dein Auge freundlich auf mir ruhte, so wußte ich, daß ich mit mir zufrieden sein durfte. Leb’ wohl, liebe Mutter, grüße mir Alle, Alle von ganzem Herzen,
Dein dankbarer Sohn
Henryk.
Nachschrift.
Wie ich den Brief schließen will, fällt mir noch etwas ein, was ich Dir mittheilen muß, eine auffallende Begegnung. Wie ich aus der Kaserne nach meiner Wohnung ging, schoß ein phantastischer Schlitten an mir vorbei und in dem Schlitten saß eine junge Frau in prachtvoller Toilette. Ich sah sie nur einen Augenblick, aber ich weiß, daß sie blonde Haare hat und schöne Augen und die Haltung einer Fürstin, einer Herrscherin. Ich blieb stehen und sah ihr nach und wenn ihre vier kleinen Ukrainer Pferde nicht Flügel gehabt hätten, ich wäre ihr nachgegangen. Ja ich bin imstande, die Promenade, das Theater zu besuchen, ja sogar die Kirchen, um sie wieder zu entdecken, und wenn ich einmal ihre Wohnung weiß, Stunden unter ihren Fenstern zu stehen, nur um ihren Schatten an den Vorhängen vorüber schweben zu sehen.
Erkläre mir dieß? Eine schöne Frau ist das Entzückendste, was es für mich gibt, ich kann mich Tag und Nacht mit ihr beschäftigen, ich erzähle mir selbst Romane, deren Held ich, deren Heldin sie ist, sie taucht in meinen Träumen auf, aber ich denke nie daran, sie zu besitzen, ja ich habe die Erfahrung gemacht, daß ich nur zehn Worte mit ihr zu wechseln brauche, um –
Eine schöne Frau ist mir wie ein Kunstwerk, z. B. ein Gemälde, das man nie berühren, ja dem man nicht einmal nahe kommen darf, wenn man den Zauber nicht schwinden sehen will.
Ich werde meine Fürstin wiedersehen, aber gewiß nie sprechen. Ich werde, wie Du es bei Deinen Rosen thust, ihren köstlichen Duft athmen, ihre Gestalt bewundern, aber sie nie pflücken. – Lache über mich, daß ich blöder Junge überhaupt nur davon sprechen kann, eine so stolze Rose zu brechen.
Dießmal hast Du einen sehr langen Brief, dafür schreibe ich Dir nächstens sehr wenig. Hab’ Nachsicht mit Deinem kindischen Helden, aber es ist mein einziges, mein seligstes Vergnügen, Dir zu schreiben.
Gute Nacht, liebe Mutter.
Den 11. December.
Liebe, gute Mutter!
Ich küße Dir die Hände für Deinen guten Brief. Wie glücklich bin ich, daß Alle wohl sind, sogar die 21 Kanarienvögel; ich habe also wirklich richtig gezählt. Sei unbesorgt, ich trage immer die warmen Strümpfe so wie Du es mir befohlen hast und werde mich gewiß nicht erkälten. Bei der Baronin war ich noch nicht – werde aber nächstens hingehen.
Du schreibst mir, ich soll mein Leben genießen, Du, die Du vom Leben nur Bitterkeit empfangen, Du gibst mir den Rath, meiner Fee im Schlitten oder sonst einer sterblichen hübschen Frau den Hof zu machen, Du, die Du in der Liebe nur Enttäuschung, Schmerzen und Kränkung gefunden, und endlich ihren eingebildeten Freuden vollkommen entsagt hast.
Weil ich ein junger Mensch bin!
Ich bin nicht so jung, oder ja, ich zähle erst zwanzig Jahre, aber mein Geist ist reif und mein Herz ist alt. Nein alt ist nicht das Wort, aber todt.
Ich weiß, daß Du mit dem Vater nicht glücklich warst, daß Du still mit Deinen Kindern gelebt hast, während er – wenn Du nicht glücklich warst in der Liebe, im Leben, wer soll dann glücklich sein, wer darf dann noch annehmen, daß er ein Recht auf Glück hat?
Was ich an Dir erfahren, was ich so gesehen habe in unserem Hause mit den großen neugierigen stets offenen Augen eines Kindes, hat sich tief in meine Seele gesenkt. Ich habe eine Art Furcht vor der Liebe, ich habe es Dir of genug gesagt, und nun willst Du mein Engel, Du reine heilige Frau, aus mir einen Lebemann machen. Ja Du bist nur so gerecht gegen die stürmischen Triebe der Jugend, so nachsichtig für die menschlichen Fehler und Leidenschaften, weil Du selbst so streng, so sittlich bist. Ich habe etwas von Deinem Wesen geerbt, – nicht daß ich besser sein will als die anderen Menschen – aber ein wenig zarter ist meine Empfindung doch, und dann habe ich von Dir diesen Ekel vor allem Unreinen. – Das Theater habe ich bereits wiederholt besucht; auch da sehe ich, wie die Menschen, die mit ihrer Bildung Staat machen, eigentlich halbe Wilde sind. Ich habe viel Putz bemerkt, aber wenig Sinn für die Kunst des Dichters und Schauspielers, sie kokettieren, während ich in das, was auf der Scene geschieht, wie verloren bin.
Warum aber die Dichter, und gerade die besten, uns immer die Handlungen und Menschen vergangener Zeiten vorführen, mir kommt es vor – vielleicht erscheine ich Dir sehr kühn, indem ich dieß ausspreche – mir ist es also, wie wenn dadurch etwas Halbes entstünde. Ich habe die lebhafte Empfindung, daß Egmont, Maria Stuart, Barbara Radzivil*, Iwan der Schreckliche nicht so gedacht, gefühlt und am wenigsten so gesprochen haben, wie der Dichter sie sprechen läßt, und wir verstehen nicht, wie die Menschen unserer Zeit Handlungen begehen können, die nur in vergangenen Jahrhunderten möglich waren, und würde der Dichter sie so auf die Bretter stellen, wie sie wirklich waren, würde er Allen die Farbe der Zeit geben – was gewiß keinem möglich ist – so würden wir sie noch weniger verstehen. Mir machen einen vollen Eindruck nur jene Stücke, welche die Gegenwart geben, so die guten französischen Komödien, der «Revisor» von Gogol, das «Unglück Vernunft zu besitzen» von Gribojedow*, und ich glaube auch, daß wir auf diesem Wege die besten historischen Stücke bekommen und schon zum Teil haben; so schilderten Shakespeare in seiner «Widerspenstigen», Molière im «Geizigen», im «Tartüffe», im «Misanthrop», in dem «eingebildeten Kranken», Moreto* in seiner «Donna Diana», Beaumarchais in der «Hochzeit des Figaro», Lessing in der «Minna von Barnhelm», Schiller in den «Räubern» und «Kabale und Liebe», Goethe in «Clavigo» und den «Geschwistern» Menschen ihrer Zeit, aber uns sind sie zu historischen Gemälden von unübertrefflicher Treue und Lebendigkeit geworden, und nur diese Stücke verdienen, wie ich glaube, klassische genannt zu werden. So ist es z. B. ein haarsträubender Unsinn, die «Räuber», welche gerade in allen ihren Auswüchsen und Geschraubtheiten die deutsche Sturm- und Drangperiode so meisterhaft wiedergeben, in dem Kostüm des Dreißigjährigen Krieges zu spielen; warum nicht gleich lieber einen Karl Moor im Frack und die Widerspenstige mit dem Chignon*? Noch eines muß ich Dir sagen. Die deutschen Schauspieler tragen viel dazu bei, die Unnatur ihrer Tragödien zu erhöhen, sie sprechen in einer Art Takt und in einem Pathos, daß mir of komisch wird und scheinen ein Studium daraus zu machen, so zu gehen und sich so zu bewegen, wie es kein Mensch mit gesunden Gliedern tut.
Die Uhr habe ich gekauft, um 80 fl., wie Du schriebst, und dann eine Pomade um 1 fl. 50 kr. und Seife zu 1 fl.*, ist dieß teuer? Sage es mir nur, ich nehme dann ein anderesmal billigere.
Zanke mich nur aus, wenn ich was schlecht mache.
Heute habe ich einen Äpfelstrudel gegessen, aber der Rosalie ihrer war doch besser.
Ich küße Euch Alle.
Dein Sohn
Henryk.
Den 14. December.
Liebe Mutter!
Gestern war ich bei der Baronin. Du hast recht, sie Deine Freundin zu nennen, denn sie liebt Dich nicht bloß, sie versteht Dich, und das ist weit mehr. Ich habe eine tiefe Verehrung für diese Frau, die Dein Vertrauen besitzt, denn ich weiß, was es heißt, Dir genügen, Deine Achtung erringen und festhalten. Sie lud mich sofort für den Abend und ich war auch Abends dort, habe, wie Du es gewünscht hast, eine förmliche Soirée mitgemacht und bin also in die Welt lancirt. Es waren natürlich viele Damen da, sehr hübsche und auch geistreiche Damen. Getanzt wurde nicht, die älteren Herren und Frauen spielten Whist*, die Jugend conversirte. Ich habe auch Bekanntschaften gemacht, eine abgelegene Generalin, welche einmal die Löwin der Hauptstadt gewesen sein soll, sie trägt noch immer Locken und ist stark geschminkt und stark decolletirt im vierten Grade; einer meiner Kameraden behauptet nämlich, daß sich die Frauen von zehn zu zehn Jahren immer mehr decolletiren. Die Generalin protegiert jetzt junge Lieutenants und da ich der jüngste Lieutenant war, wurde ich sehr gnädig behandelt und durfte ihr sogar die Mantille umgeben. Auch eine jüngere Frau hat sich meiner sehr angenommen, sie lebt von ihrem Manne geschieden, und ihr Anbeter wurde so eben im Duell erschossen. Es hat viel Skandal gemacht. Sie ist sehr blond, sehr weiß und sehr schwer – das weiß ich, weil ich das Vergnügen hatte, sie in den Wagen zu heben – kurz eine jener Nymphen von zwei Centnern, wie sie Rubens so gerne gemalt hat.
Bist Du mit mir zufrieden?
Ein reizendes, junges Mädchen war da, die Comtesse Adele Potocka; ich hätte mich beinahe in sie verliebt, solange ich nur auf zehn Schritte Distanz ihr Madonnengesicht, ihr nachtschwarzes Haar, ihre Augen und ihre Zähne anstaunte; ach, Zähne hat sie, man möchte sich beinahe von ihr beißen lassen. Ich wurde ihr jedoch leider viel zu bald vorgestellt, und nun ist es vorbei, obwohl sie verständig spricht, viel gelesen hat und überhaupt keine Schöne aus dem Modejournal ist.
Aber ich habe heute die Wache und kann Dich nur noch in aller Eile grüßen.
Dein Dich aufrichtig liebender Sohn
Henryk.
Den 17. December.
Meine Mutter!
Du frägst, warum ich die Liebe fürchte?
Ich fürchte sie, weil ich das Weib fürchte.
Ich sehe in dem Weibe etwas Feindseliges, es steht mir in seinem rein sinnlichen Wesen fremdartig gegenüber, wie die unbeseelte Natur. Beide sind mir gleich anziehend und gleich unheimlich.
Du weißt, wie sehr ich es liebte, an ruhigen Sommerabenden an dem Rande unseres Waldes zu sitzen, wenn von Zeit zu Zeit durch seine Wipfel hoch über mir ein leises Rauschen ging und unten durch die Gräser das tiefe Summen der Bienen und Hummeln und der goldigen Fliegen, und auf irgend einem Ästchen saß ein kleiner Fink und sang, und aus dem dichten, schwarzen Holze tönte der Pfiff der Amsel zu mir herüber; dann war es mir, als müßte ich zu dem grünen Walde sprechen, aber ich bekam keine Antwort, oder in einer Sprache, die ich nicht verstehe, und ich sah, daß der Epheu, der die Eiche liebend und malerisch zu umschlingen scheint, ihr langsam das Mark entzieht, sie wird in ein paar Jahren morsch und faul sein, und der schwache Hauch über mir wird zu einem Sturme werden und sie stürzen, wenn sie nicht vorher schon der Blitz zerschmettert; ich sah die Mücken in der Abendsonne tanzen und sah den Finken plötzlich unter sie schießen, und über ihm schreit der Rabe, der auf ihn Jagd macht, und höher noch kreist der Adler, dem heute oder morgen der große Rabe mit seinen scharfen Klauen und seinen starken Fittichen zum Raube wird.
Ich ging of durch die Felder und freute mich der Kornblumen, die freundlich zwischen den gelben Ähren stehen, und der kleinen Ameisen, die hier ihre Pyramide gebaut haben, und des braunen Rebhuhns, das auf seinen gefleckten Eiern brütet, aber die blauen Blumen und die rothen und gelben nicht minder, welche in dem Getreide stehen, sind ein Unkraut, das ihm das Leben streitig macht; ich fand einmal eine Schnecke, auf der die Ameisen wie die Liliputaner auf dem schlafenden Gulliver krabbelten, und sie zuckte unter ihren Stacheln und suchte sich vergebens zu retten, und das Rebhuhn wird der Fuchs auf seinen Eiern töten.
Auch der See mit seinen friedlichen, gleichmäßigen Wellen, seinen gelben Rosen und dem grünweißen Netz von Algen und Wasserlilien, der mich zu rufen scheint, würde sich kalt und stumm über mir schließen, wenn ich seiner trügerischen Lockung folgen würde, und meinen entseelten Leib dann verächtlich auf den Sand werfen; er murmelt so liebevoll, so einschläfernd, wie wenn er ein Wiegenlied singen würde, aber es ist nur die Todtenklage der Natur, die Stimme der Verwesung, die ich höre; seine Wellen spülen die Erde weg und die Steine und höhlen den Felsen aus, auf dem das Kreuz steht, und wenn einmal der Damm bricht, ersäufen sie das Land, Thiere und Menschen.
Und das Weib, was will es, wenn es mich an seine Brust zieht, als gleich der Natur meine Seele, mein Leben, um daraus neue Geschöpfe zu bilden und mir selbst den Tod zu geben? Seine Lippen sind wie die Wellen des See’s, sie locken, sie kosen – und bethören – und das Ende ist die Vernichtung.
Spotte nur über meinen Idealismus, er ist doch das Beste, was man noch hat in diesem Leben, dessen Zweck Niemand kennt, Niemand ergründet, das nur um seiner selbst willen da zu sein scheint und dem die Liebe beigegeben wurde, um es immer wieder fortzusetzen in neuen Wesen, die sich der Sonne freuen und des Mondes und der Sterne, wie wir, und doch auch wieder dem Tode zum Raube gegeben sind, wie wir.
Dein
H.
Den 21. December.
Liebste Mutter!
Ja, wie soll ich eigentlich anfangen, Dir das zu sagen, was ich Dir heute zu sagen habe.
Die einfache Wahrheit ist zwar immer das Beste, und ich konnte nie unwahr gegen Dich sein.
Also ich habe ein Duell gehabt und habe meinen Gegner verwundet, aber nicht erheblich, und so ist Alles gut ausgegangen.
Du wirst mir glauben, daß ich mich nicht aus Übermuth oder Prahlsucht geschlagen habe, ich konnte aber nicht anders. Die Kameraden konnten es mir nicht vergeben, daß ich als Officier in ihr Regiment trat, sie benahmen sich erst abstoßend, endlich beleidigend, besonders Graf Komarnizki. Ich mußte einen fordern, es ist einmal so Sitte, und so suchte ich mir denn den Unartigsten und Gefährlichsten heraus.
Wie ich mich geschlagen habe? Die dabei waren, sagen gut. Ich weiß indeß wahrhaftig nicht, wie es zugegangen ist, daß ich Komarnizki verwundet habe, ich will keinen Helden aus mir machen. Ich war sehr aufgeregt, aber ich habe Ehrgefühl und dachte an Dich und zeigte mich kalt, sogar heiter. Der alte Wenglinski, welcher auch bei der Cavallerie gedient und viele Duelle gehabt hat, er ist auch zerhackt genug, sagte einmal zu dem Vater: «Die Hauptsache ist, den Gegner nie zu erwarten, sondern immer zuerst auf ihn einzudringen.» Ich war ein Kind, als ich dies hörte, aber jetzt fiel es mir ein, und so drang ich denn auf meinen Gegner los, die Funken stoben Dir. Komarnizki ist sehr stark und ich bin schwächlich und nervös, aber ehe ich noch wußte, was geschah, schrie man Halt! Halt! und ihm rann das Blut vom Kopfe.
Wir reichten uns die Hände und jetzt bin ich der gute Kamerad und muß mit ihnen trinken, spielen und ihre rohen Scherze anhören. Das Officiersleben widert mich jetzt schon recht an. Ein einziger ist darunter, der mir gefällt, es ist ein Deutscher, aber stoße Dich nicht an seinem Namen, er heißt Schuster und ist offenbar kein Aristokrat.
Eben holen sie mich zu einer Champagnade.
Dein Sohn Henryk.
Den 24. December.
Meine gute Mutter!
Eine große Neuigkeit; Du wirst mit mir gewiß unzufrieden sein, aber ich bin mit mir zufrieden. Es betrifft nämlich die Partie, die Ihr für mich ausgeheckt habt. Denke meine Überraschung, wie ich Deinen Brief erhalte und die halb scherzhafte Mittheilung, daß Graf Potocki an meinen Vater geschrieben, er und die Seinen seien enchantirt von mir und mein Vater habe, ohne mich zu fragen, erwiedert, ich sei ebenso enchantirt von Comtesse Adele, und hierauf sei es zwischen den Familien abgemacht worden, uns zu verheirathen.
Zuerst erschrak ich, dann lachte ich, nachdem ich aber sah, daß es Dein Wunsch ist, Dein inniger Wunsch, dachte ich darüber nach und ergab mich.
Nie werde ich ein Weib lieben, aber das hindert mich am Ende nicht, ein Weib zu nehmen, meine Pflichten gegen Euch, gegen meine Familie zu erfüllen, nur werde ich die Frau, der ich meine Hand reiche, niemals mit meinem Wissen täuschen. Ich beschloß also, offen gegen Adele zu sein.
Den nächsten Abend fand ich sie in der Soirée bei der Baronin, welche durch ihre Briefe gewiß viel beigetragen hat, Dich so sehr für die Comtesse einzunehmen; sie machte nicht viel Umstände, sondern wünschte mir gleich mit leuchtenden Augen Glück – die Frauen sind ja so selig, wenn sie ein Paar verheirathen können. Sie sprach viel von den Vorzügen der Comtesse und dann auch Einiges von meinen Vorzügen und hatte sich schließlich selbst so gerührt, daß sie mit ihrem Spitzentuch – echte Brüsseler Kante – effektvoll ihre Augen trocknen konnte. Dann führte sie mich in ein Zimmer, das ganz mit Blumen gefüllt war und in welchem Adele unter blühenden Kamelienbäumen stand und mir den Rücken kehrte.
Die Baronin winkte mir triumphirend zu und ließ uns dann allein.
Ich näherte mich der Comtesse, welche mich plötzlich mit ihren schwarzen Augen ansah, während ihre Hand mit einer Blüthe spielte.
«Man will uns verheirathen,» begann sie, «ich muß Ihnen zuerst sagen, daß ich Sie so gut wie gar nicht kenne; Alles, was ich von Ihnen gehört habe, flößt mir zwar Achtung, ja Sympathie für Sie ein. Aber ich lasse mich nicht verheirathen.» Und das sagte sie so entschlossen, so barsch, daß ich ihr gerne um den Hals gefallen wäre.
«Nicht?» rief ich.
«Sie sind doch nicht beleidigt!» sprach sie hierauf sanfter.
«Entzückt bin ich!» schrie ich auf, «auch ich will mich nicht verheirathen lassen, aber Sie sind ein prächtiges Mädchen, Comtesse Adele, ein Charakter, Sie haben mich begeistert» – und ich faßte ihre Hände, und sie rief: «Jetzt erst habe ich Sie lieb und wir wollen gute Freunde werden.»
«Ja, das wollen wir, liebe, gute Adele,» und wir tanzten wie Kinder im Zimmer herum und lachten und – nun zanke mich nur aus – vom Heirathen ist natürlich keine Rede mehr zwischen uns, Graf Potocki macht ein ellenlanges Gesicht und die Baronin ein Gesicht von anderthalb Ellen und noch mehr. Der Vater wird an dem Tage, wo er die Geschichte erfährt, ein Loth Rapée* mehr schnupfen, und an dem Allen sind zwei unartige Kinder schuld, die kleine Adele mit den großen Nachtaugen und
Dein Sohn
Henryk.
Den 29. December.
Liebe Mutter!
Wie glücklich bin ich, daß es Euch Allen so gut geht; der Husten bei Roman hat gewiß nichts zu bedeuten, nicht wahr? Und daß Mimi auch einen Katarrh hat, ist gar zu komisch.
Man hat Dir geschrieben, daß ich allgemein schon als Sonderling gelte, und ich fühle aus Deinen Zeilen heraus, daß Du mit mir unzufrieden bist. Was ist am Ende ein Sonderling? Ein Mensch, der nicht ganz so ist, wie alle Anderen. Nun, das bin ich in der That nicht. Aber man schreit mich als eine Art Fabelwesen aus.
Was habe ich denn so Furchtbares verbrochen?
Ich kann nicht läugnen, daß ich nie zuerst mit einer Dame spreche. Bon, aber ich gebe ihnen doch Antwort, wenn sie mich anreden.
Man sagt, ich fürchte die Frauen, nun, das ist ja wahr.
Ebenso wahr ist es, daß ich roth geworden bin, als die Generalin mich neulich mit dem Fächer auf die Wange schlug, aber wer wird nicht roth werden, wenn er sich unvorbereitet einer im vierten Grade decolletirten antiken Büste gegenüber sieht?
Es ist gleichfalls wahr, daß ich nicht tanze, und, als mich die Nymphe beim Cotillon* wählte, sie bat, mir die Tour zu schenken, mit erhobenen Händen, wie man etwa um sein Leben bittet, aber die Geschichte wäre auch lebensgefährlich geworden, ich mit meinen schwachen Armen und zwei Centner Rubensscher Weiblichkeit! Ich habe mich endlich herzlich gefreut, daß ein braves Mädchen, das mich nicht liebt und das ich nicht liebe, mich ausgeschlagen hat, aber sonst habe ich wirklich nichts angestellt. Grüße mir den Vater und die Brüder Alle, Alle.
Dein sonderbarer Sohn
Henryk.
Den 31. December.
Liebe Mutter!
Die Frage, die Du an mich richtest, ist sehr wichtig und sehr ernst, ich habe viel darüber nachgedacht und will heute versuchen, sie Dir zu beantworten.
Was Liebe ist?
Ich kann Dir nur sagen, was ich unter Liebe verstehe.
Jener sinnliche Reiz, welcher meist die größten Gegensätze zusammenführt, Menschen, die sich zugleich hassen und küssen, kann es nicht sein, denn sie ist nichts Sinnliches.
Auch jene Neigung, welche der Zufall schürzt und die Gewohnheit freundlich befestigt, in welcher so viel Behagen, so viel Fröhlichkeit liegt, die aber ebenso mit jedem andern guten Menschen möglich wäre, kann es nicht sein, denn sie ist nichts Zufälliges. Am wenigsten aber kann es jene Leidenschaft sein, welche die Tragödien des Lebens macht, solange ihre Flammen lodern, und wenn sie erloschen sind, die spaßigsten Komödien, welche mit Dolch und Gift wie mit Fächer und Lorgnette spielt, denn sie ist nicht vergänglich. Die Liebe entsteht nie und hört nie auf, sie ist nur zwischen zwei bestimmten Menschen möglich, welche gleich denken, gleich fühlen, welche denselben Willen haben und wenn sie sich treffen, im ersten Augenblick wissen, daß sie zueinander gehören, Niemand sagt es ihnen, keine Erkenntnis leitet sie, kein Wohlgefallen besticht sie, keine Erfahrung belehrt sie, aber sie wissen es doch und jede Stunde, wo sie sich gehören, und jeder Tag und jedes Jahr bestätigt es ihnen, daß ihr Wissen ein wahrhaftes war. Und diese Liebe hört nur mit dem Leben auf und vielleicht auch da nicht, denn wenn etwas in uns weiterlebt, so ist es das Beste in uns, und mit diesem Besten lebt die Liebe fort. Ich weiß nicht, ob ich das, was mir selbst so klar vor der Seele steht, auch klar ausgedrückt habe.
Die Liebe ist mir vor Allem das geistige Hingeben an eine andere Persönlichkeit. Man gibt seine Seele hin für eine Seele. Jeder Mensch hat, glaube ich, diesen schönen Trieb, aber einen Jeden beinahe führt er zu dem andern Geschlechte, wo ihm, ich fürchte es, nie Genüge wird, weil tausend sinnliche Dinge die Wahl irre leiten. Sie glauben zu finden, zu lieben und sehen sich nur zu bald getäuscht, und suchen und finden wieder, nur um sich immer wieder zu täuschen und enden in Genußsucht, Müdigkeit und Ekel oder in finsterer, selbstsüchtiger Verschlossenheit.
Nur weil ich mich so sehr vor dem Verluste fürchte, fürchte ich die Liebe, und wenn ich einmal ein Weib liebe, will ich es nie besitzen, um es niemals zu verlieren.
Gibt es aber ein Weib, das einer geistigen Liebe fähig ist?
Der Versuch wäre interessant, aber ich werde ihn gewiß nicht wagen.
Als das edelste, das beste Gefühl, das uns am meisten Befriedigung bietet, erscheint mir die Freundschaft des Mannes mit dem Manne, weil sie allein auf Gleichheit beruht und vollkommen geistig ist.
Dein
H.
Den 3. Jänner.
Teure Mutter!
Ich habe das Gastmahl des Plato gelesen und immer wieder gelesen, so daß ich es beinahe ganz auswendig kann. Es ist doch nichts dem Vergnügen zu vergleichen, das man bei der ersten Durchsicht des bedeutenden Werkes eines großen Geistes hat, und erst eines Buches, wie dieses ist.
Wenn ich Dir Alles wiederholen wollte, was mich in demselben entzückt hat, so müßte ich Dir das Ganze abschreiben. Eine Stelle aber muß ich Dir doch hierher setzen, sie lautet: Man muß die an der Seele haftende Schönheit für kostbarer halten, als die leibliche.
In diesem Sinne wird von Sokrates so hübsch gesagt, daß er wie ein Faun war, in dem ein Götterbild verborgen ist.
Was mir aber am besten gefallen hat, das ist die Idee, daß Mann und Weib früher Ein Wesen waren und getheilt worden sind und jetzt jedes seine Hälfte sucht.
Auch ich bin so eine arme Hälfte –
H.
IMPRESSUM
Leopold von Sacher-MasochDie Liebe des PlatoHerausgegeben und mit einem Nachwortversehen von Michael Gratzke
Durchgesehene Taschenbuchausgabe 2012
© für diese Ausgabe:
Männerschwarm Verlag, Hamburg 2001
Umschlaggestaltung: Carsten Kudlik, Bremen1. Auflage 2012
ISBN der Buchausgabe: 978-3-86300-110-0
ISBN der Eboopk-Ausgabe: 978-3-86300-111-7
Männerschwarm Verlag
Lange Reihe 102 – 20099 Hamburg
http://www.maennerschwarm.de/verlag
ÜBER DEN AUTOR
Leopold Ritter von Sacher-Masoch (1836-1895) wurde in Lemberg (damals Österreich, heute Ukraine) geboren und hatte Vorfahren aus Slowenien, Spanien und Böhmen. Nach einem Studium der Rechtswissenschaften, Mathematik und Geschichte arbeitete er zunächst im Staatsarchiv in Wien, nach seiner Habilitation in Neuerer Geschichte unterrichtete er dann an der Universität Graz. 1870 gab er seine Lehrtätigkeit auf und widmete sich ausschließlich seinem literarischen Werk.
Innerhalb kürzester Zeit wurde er zu einem vielgelesenen und international renommieren Schriftsteller. Die Veröffentlichung des sexualwissenschaftlichen Standardwerks «Psychopathia Sexualis» im Jahr 1886 durch Richard von Krafft-Ebing beendete seinen Ruhm, da in diesem Werk eine vermeintlich krankhafte Erotisierung von Schmerz und Demütigung als «Masochismus» bezeichnet wird. Krafft-Ebing bezog sich mit dieser Namensgebung auf das berühmteste Werk Sacher-Masochs, «Die Venus im Pelz».
INHALT
RAHMENHANDLUNG
BRIEFE AN MEINE MUTTER
RAHMENHANDLUNG
FUSSNOTEN DES AUTORS ZU «DIE LIEBE DES PLATO»
GLOSSAR DES HERAUSGEBERS
NACHWORT ZUR NEUAUSGABE
EDITORISCHE NOTIZ
IMPRESSUM
ÜBER DEN AUTOR