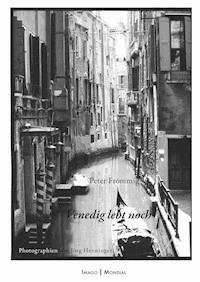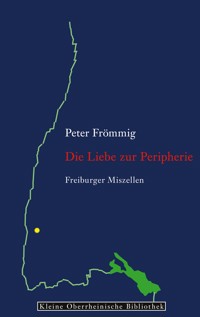
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In dieser Textsammlung, größtenteils zwischen 1981 und 1994 in Freiburg entstanden, fängt Peter Frömmig das urbane Leben in den Randbezirken der Städte ein. Beobachtungen und Gedanken treffen sich wie in einem Prisma. In der Wechselwirkung zwischen Lyrik und Prosa eröffnen sich vielfältige Blickwinkel zu Stadtrand und Vorstadt. Das vorwiegend regional Bezogene verweist auch auf größere Zusammenhänge. Innen- und Außenansichten, autobiographische Rückblicke und weitläufige Ausblicke fügen sich zu einem schillernden Ganzen. Die Texte sind in ihrem Reiz und ihrer Brisanz so aktuell wie eh und je. Abgerundet wird das Buch durch die neu entstandene Erzählung »Wie ich nach Freiburg kam«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Peter Frömmig, * 1946 in Eilenburg bei Leipzig, lebt seit 1995 in Marbach am Neckar. Davor hat er als Schriftsteller und Maler jeweils lange Jahre in Österreich, den USA und in Freiburg verbracht. Er veröffentlichte Erzählungen, Essays, Kurzprosa, Gedichte, Hörspiele und Theaterstücke. Zuletzt erschienen sind die Prosabände »Das Rumoren am Rande der Ereignisse« (2014) und »Auf langen Wegen in kleiner Stadt« (Überarbeitete Neuauflage, 2016) sowie »Das Haus, in dem die Wörter wohnen. Gedichte und Bilder für Kinder und Erwachsene« (2016).
Wie alle Dinge in einem unaufhaltsamen Prozeß der Vermischung und Verunreinigung um ihren Wesensausdruck kommen und sich Zweideutiges an die Stelle des Eigentlichen setzt, so auch die Stadt. Große Städte, deren unvergleichlich beruhigende und bestätigende Macht den Schaffenden in einen Burgfrieden schließt und mit dem Anblick des Horizonts auch das Bewußtsein der immer wachenden Elementarkräfte von ihm zu nehmen vermag, zeigen sich allerorten durchbrochen vom eindringlichen Land. Nicht von der Landschaft, sondern von dem, was die freie Natur Bitterstes hat, vom Ackerboden, von Chausseen, vom Nachthimmel, den keine rot vibrierende Schicht mehr verhüllt. Die Unsicherheit selbst der belebten Gegenden versetzt den Städter vollends in jene undurchsichtige und im höchsten Grade grauenvolle Situation, in der er unter den Unbilden des vereinsamten Flachlandes die Ausgeburten der städtischen Architektonik in sich aufnehmen muß.
Walter Benjamin, »Einbahnstraße«
Inhalt
Vom Stadtrand
Gedichte und Prosa
In der Früh
Überblick
Breisgau-Ballade
Bleiben. Ein Zwiegespräch
Das Flanieren
Kindheit 1
Kindheit 2
Frühjahrslicht
Es weht ein Wind
Wieder einmal
Ziellos
Begegnung
Freiburg im Breisgau. Ein Abend
Der Schönberg
Ohne Gewähr
Die Vögel des Tages
Kellertage
Als die Normaluhren stehenblieben
Phantasia Utopia
Irgendwo und überall
Garderobe in der Nacht
Nach Mitternacht
Traum und Querschläger
Keine Konstante
Schulterschluß
Wiederholte Strecken
Freiburg – Karlsruhe. Winter
IC-Suite oder Am Rand eines Gedichts
Mädchen und Stein
Der Samstag holt Atem
Menschen gesehn
Spätsommerabend
Alter Mann
Spiegelbild
Ein Augenblick, ein rasend Glück
Stadtrandherbst
Beruhigung und Hinterhalt
Umwandlung
Nachbarschaft
Aus grassierenden Tagen
Der unbeantwortete Anruf
Vorstadtabend
Schorf und Selbstvergessenheit
Lose verknüpft
Ankunft des Sturms
Der Tag, an dem Willy Brandt begraben wurde
Nach dem Regen
Aufruhr
Vom Schreibtisch aus
Lächeln
Der fliegende Holländer. Eine Stadtrandphantasie
Erotisches Intermezzo
Gülle und Abgas
Das Haus. Eine Innenansicht
Das letzte Blatt
Das große Glück, das Grau
Noch ein Vorstadtabend
Haltestelle im Herbst
Ausflüchte
Soll und Haben
Berlin ist weit
Am Stadtrand
Barrikaden und Durchbrüche
Freiburger Aufzeichnungen, 1981-1983
Verstreute Gedichte 1981-1989
Stadt der Freibeuter
Schwarzwaldstraße 1
Aus dem Raster
Im Dreiländereck
Durch den Wald nach Günterstal
Ausflucht auf die Glümershöhe
Für einen Besucher
Freiburg, aus der Mitte
Der Markt ums Münster
Ein Streifzug über das
Kopfsteinpflasterund durch die Zeit
In der Suite von Günter Grass
Wie ich auf Umwegen nach Freiburg kam
Vom Stadtrand
Gedichte und Prosa 1991-1994
In der Früh
Es ist ein Rumoren im Bauch der Stadt, ein Grollen zieht sich zurück in die Gedärme der Nacht. Folgen wir diesem Bild, ist die Stadt ein Körper, seine Haut die Peripherie. Ein Zucken geht über diese Haut, ein Erzittern.
Die Stadt erwacht, sie zögert nicht lange.
Im Osten – als wärs nicht der Lauf der Dinge, sondern geballter Wille tatkräftiger Menschen – steigt über Schwarzwaldgipfeln aufs neue ein Tag. Die Dunkelheit rinnt an Türmen, an Fassaden von Häusern, am Glas von Gebäuden herab und versickert, womit die Nachtschicht der Straßenlaternen beendet wäre. Durch Straßen strömt Tageslicht. Verkehr nimmt zu, das Hin und Her. Vom Stadtrand aber strebts eindeutig einwärts.
Auch hier ist kein Zaudern.
Wie Lider die Augen, so entblößen Rolläden und Jalousien die Fenster. Manche Gardine wird zurückgeschoben, um einen prüfenden Blick auf den Tag zu werfen, dort wird ein Fensterflügel geschwungen, Schritte über Schwellen, durch Türen; Tatkraft en masse. Schon klaffen Lücken auf Parkplätzen, frisch glänzend zeigen sich Ölflecken auf dem Pflaster. Auch Kinder huschen aus Häusern; sie gehen widerwillig, ranzenbeladen ihrer Wege, gekreuzt von verschlafenen Katzen.
Ein Feldhase hoppelt am Rande einer frischen Baugrube. Dunkler, feuchter Grund, eine Wunde im Feld. Darüber wimmelt es schwarz: Krähen, die von den Bergen herabfallen und sich als schwarze Klumpen in Fernsehantennen, im Gezweig kahler Bäume festsetzen. Ein rauhes Palavern hebt an.
Darunter, aus einem Parterrefenster, wird hörbar das Rascheln von Zeitungspapier. Brenzlig riecht es – ein Gemisch von Abgas und angebranntem Toast.
Höher wieder, in einem anderen Fenster, zeigt sich ein junges Paar: Umarmung und Abschied. Gleichzeitig ziehen zwei Vögel über alles hinweg, in die Ebene hinaus, ihre Flügelschläge stimmen perfekt überein. Der Mann packt den Diplomatenkoffer und eilt die Stufen im Treppenhaus hinab. Die Mutter nimmt das Kind zur Brust.
Gefaßte Gesichter sitzen in Bussen, auf man - chen noch der letzte Abglanz der Träume. Selbst die kleinsten Fäuste ballen sich jetzt.
Überblick
Reste und Ruinenstücke früherer Stadtmauern markieren heute allenfalls den Kern, die City. Bahndämme sind Zeichen einer anderen Epoche, weiterer Ausdehnung der Stadt. Jetzt sind es die Ringe, die Asphaltgürtel der Straßen, die eine Stadt einfassen oder umklammern, dem Auto Umfahrungen bieten. Ausfallstraßen sind für das Auto Breschen im Stadtrand, Einschnitte in Häuserfluchten, ins Land, Mündungen von Verkehrsflüssen zu Autobahnen, den großen Verkehrsströmen.
Stadtrand und Vorstadt bilden den Übergang zwischen Stadt und Land, zwischen ausgeprägt Urbanem und mehr oder minder Naturbelassenem. Landschaft ist Ausdruck der Urbarmachung, Landschaft ist Verschwisterung von Natur und Kultur. Wo Landschaft nicht oder nur geringfügig zivilisiert ist, wird sie bisweilen geschützt.
Zurück zum Stadtrand, mit einem Blick von außen, vom Umland zur Stadt: Straßen, Hochspannungsleitungen, Schienen, unsichtbare, aber festgelegte Flug linien streben ihr energiegeladen, von viel Willen gelenkt zu. Städte sind Zentren der Aufmerksamkeit, aber das Interesse konzentriert sich mehr auf das Zentrum und weniger auf den Rand der Stadt. Der Stadtrand liegt im Bannkreis der Innenstadt, um die sich alles dreht, ist, so gesehen, eine Randerscheinung, allenfalls ein Vorspiel der Stadt, Vorstadt. Stadtrand kann Verzierung sein mit schmucken Häusern und Gärten an Hügeln, Wohngebiet für Privilegierte, oder auch eine Grauzone des Unbestimmten und Gesichtslosen, wenn nicht gar ein Schattenbereich, wo Randexistenzen des Gesellschaftslebens abgedrängt hausen, Abfälle des großen Verbrauchs der Stadtmenschen sich sammeln und dem Land untergeschoben werden.
Am Stadtrand wird das Überschwappen deutlich, Folge eines Gärungsprozesses, Folge gewaltsamen Vordringens menschlichen Lebens in den Raum der Natur. Zum Stadtrand gehören Bagger und Bulldozer, Baugruben und Kräne, doch ebenso trotziges Brachland, Lückenhaftigkeit und Luftraum, Felder beharrlicher Bauern und Wege ins Freie. Unkraut und Linksliegengelassenes finden sich hier. Stadtrandvögel sind vorwiegend Rabenkrähen, Elstern und Amseln. Die Vögel bauen sich hier Nester, oder sie statten dem Stadtrand lediglich Besuche ab und nehmen in Regenpfützen auf Nebenwegen oder Flachdächern ein Bad. Wenn nicht durch Eiche, Buche oder Haselstrauch, so finden sie in Aas und Abfall ihr Fressen. Auch sie Stadtranderscheinungen, Stadtrandexistenzen. Für sie fällt immer etwas ab.
Der Stadtrand ist außerdem ein Grenzbereich, wo Kindheit gerne zu Hause ist oder war, wo das Niemandsland eine Nebenstraße zwischen Wohn- und Gewerbegebiet ist, wo Wetter früher sich ankündigen und heftiger sich auswirken, wo Winde, Stürme und Orkane ungehinderter blasen und zur vollen Entfaltung kommen, wo Mietshäuser und Wohnblockstafetten Wellenbrecher sind gegen ein Sturmtief von Westen, gegen die Fluten des Raums.
Dazu die Wallungen der Hochkonjunktur, das massierte Anrücken der Bautrupps mit ihren Maschinen, mit denen sie Brachland in Nutzflächen und Poesie in Parkplätze verwandeln. Dazu das Hin und Her des Berufs- und des Unsinnsverkehrs: stadt einwärts wird die Geschwindigkeit gedrosselt, stadtauswärts beschleunigt.
Voilá. Am Stadtrand stehen an Straßen die unvermeidlichen Tankstellen, oft an jeder Straßenseite eine.
Am Stadtrand befinden sich Altenheime, Erholungsstätten und Fitneßcenter.
Am Stadtrand heißt es: »Auf einen Sprung in die Stadt« oder »Ein Ausflug aufs Land«.
Einer sagt: »Im Rücken die Stadt und vor mir die Ebene.«
Breisgau-Ballade
Abendlicht mildert die Umstände,
die tagsüber scharfe Kontur angenommen.
Auf Straßen erschöpft sich die Flut,
das Hin und Her der Autos,
wie der Puls, verlangsamt sich jetzt,
Spaziergänger als sei nichts gewesen.
Im weiten Bogen die Züge zur Stadt,
hinaus schon zur Nachtfahrt.
Eine schwarze Katze streicht übers Gleis,
Glanz über Eisen und Fell.
Auf Höhenwegen ein Sichwiederfinden,
das Martinshorn ein Schnitt durchs Tal.
Berge im Rücken, die Ebene ein Anlauf
für Ausblick nach Westen,
ein Halt dem Aug das Gegengebirg.
Näher rauscht Fernverkehr, Nachhall
von Tagespauken, ein Licht wie Ankunft
und Heimat nach allzuviel Fremde.
Bleiben. Ein Zwiegespräch
Dem Flugzeug, wie es die Lüfte durchkreuzt,
nachschauen mit angemessener Sehnsucht,
doch ohne Bedauern oder Zerrissenheit.
Es fliegen und fahren lassen und bleiben,
fahren lassen, was nicht halten kann noch will,
was halt- und rastlos ist. Bleiben,
ohne sich zurückgeblieben zu fühlen, mit Lust
die Erde unter den Sohlen spüren.
Warum HIER bleiben, warum nicht DORT?
Ist’s Vertrautheit oder nur Gewohnheit? –
Immer die gleichen Wege, Gesichter,
Tag für Tag die Wiederholungen bis zur Öde,
all die Gefahren der Gleichförmigkeit.
Und dabei eine ganze Welt, die offen
steht, Möglichkeiten über Möglichkeiten,
Wind, sich treiben zu lassen, treiben –
Dennoch bleiben, auch wenn’s stürmt,
wenn’s lockend ruft durch alle Ritzen
der Behausung, wenn Angebote winken
und Versprechungen schmeicheln.
Bleiben, ohne Schwindelgefühl, wenn
sich auch die Welt dreht wie besessen,
Kreise sich weiten und alle sich stürzen
mit Wahn in unermeßlichen Raum.
Schön, du schaust zum Baum. Siehst du
denn nicht, wie auch er im Sturm
sich Flügel wünscht und auf die Wurzeln
pfeifen würde? Heimaterde, pah!
Sie ist zu schwer, zu dumpf, sie zieht hinab
und pfercht dich ein in ihren Grenzen.
Bewegung ist das Leben! Abzuschütteln
ist alles, was den Schritt erschwert. Voran!
Der Schritt, der Schritt. Wo führt er hin,
wenn er den Ausgangspunkt vergißt?
Ein Standpunkt ist das Bleiben. Bewegung
geschieht so in überschaubaren Kreisen,
wo greifbar ist die Welt, wo Ort und Ding
auf ihren Namen hören und Nachbarschaft
nicht unverbindlich, wo Weniges mehr ist,
ersetzend einen Ozean an Vielzuviel.
Es kann kein Ziel sein, auf dem zu beharren,
was man erreicht und hat. Wenn das Bleiben
heißt »Ich bin angekommen«, bleibt dann
nicht auch das Weiterkommen auf der Strecke?
Was mit den Reisen ins Unbekannte, Neue,
Begegnungen mit dem Unerwarteten? Und
ist es nicht gerade das Fremde, durch das wir
erst erfahren, wer wir eigentlich sind?
Das alles ist auch hier erfahrbar, der Virus
Unruh ist auch hier im Umlauf. Was soll das
Fahren, Fahren, wenn die Erfahrung ohne
Flüchtigkeit und Unruh uns viel weiter führt.
Zu bleiben heißt nicht, stehenzubleiben,
auch nicht, zu entkommen den Fragen,
zu bleiben heißt nicht, zu entgehen.
Zu bleiben heißt meist, zu wohnen im Zweifel.
Das Flanieren
Immer ein Ankommen ist das Flanieren.
Der Zeit entbunden, führt es hinaus
ins Freie, durch alle Zeiten hin zu Ewigkeiten.
Dorthin, wo Wegweiser, getragen von Kindern,
sich drehende Windmühlen sind.
Dorthin, wo Narren alles Wissen weitergeben
in handlichen, verschnürten Paketen
und ohne Zögern weitergehen in Richtungen,
die alle Heimat bedeuten und Ankunft.
Kindheit I
An einem Stadtrand das Licht der Welt erblickt. Eilenburg, eine Kleinstadt in der Leipziger Tieflandbucht. An Wohnblöcken brach sich die Flut des Raums, Wohnblöcke waren ein Bollwerk gegen die Stürme, die von der Ostsee und von russischen Steppen über Weide- und Heidelandschaften preschten, Felder plattwalzten und Wälder aufstörten. Trüb oder fröhlich stimmten die Winde und Wetter von kleinauf, doch am Stadtrand sah man sie früher kommen und konnte lernen, sich darauf einzustellen. Im Sommer grenzten die Häuserreihen an Korn felder: gelbes Meer der Kindheit, das Untertauchen darin.
Ein hoher Maschendrahtzaun umgab eine Möbelfabrik – immer zu überrunden, nie zu überwinden, und dabei so anziehend, was sich dahinter abspielte. Nie gaben die gigantischen Möbelwagen mit ihren großen einprägsamen Lettern preis, was sie transportierten, schon verpackt wurden die massigen Stücke verladen. Das Wort Möbel blieb ein Reizwort und Futter für eine nie zu sättigende Phantasie. Die Lastwagen fuhren ein und aus, und schnell wurden die Tore hinter ihnen geschlossen. Was ging wirklich vor hinter Maschendrahtzaun und Mauern? Waren es tatsächlich Möbel, die verladen und abtransportiert wurden? Und, was immer es war: Wohin überhaupt und wozu?
Anders die ausgebombte Munitionsfabrik: Ihr war alles Ausgrenzende genommen, sie hatte vor nur wenigen Jahren der Krieg in eine Trümmerlandschaft verwandelt. In sich zusammengestürztes Gemäuer, aufgebrochene Unterkellerungen und dort hinabgestürzte Mauerstücke ergaben Höhlen und Gänge, wurden zu einem Spielplatz-Labyrinth für die Kinder. Je dunkler, desto faszinierender. Der Stein war durch Feuer und Rauch geschwärzt.
Unterschlupf und Geborgenheit außerhalb des Elternhauses bedeutete die kleine Schmiede, die sich als alleinstehende Hütte an den Stadtrand verirrt zu haben schien. Der Schmied war groß und breit, wortkarg und gutmütig, seine Worte waren knapp und einprägsam wie schwarze, schmiedeeiserne Lettern. Der Schmied tat seine Arbeit, manchmal beschlug er ein Pferd mit neuen Hufeisen.
Im Innern der Schmiede herrschte das lebendi - ge Zusammenspiel von rotem Feuer und schwarzem Eisen, und der Schmied paßte dazu – mit seinem zugleich geröteten und verrußten Gesicht, der speckigen geschwärzten Schürze und den wiederum rotschwarzen Händen, die den schweren Hammer oder eine Zange hielten. Rot-glühend war das Eisen, das der Schmied aus dem Feuer nahm, zum Amboß führte und mit Hammerschlägen formte, so daß die Funken sprühten und es in den Ohren klang. Schwarz wurde das Eisen, wenn es zischend in einer Wanne mit Wasser abgeschreckt wurde.
Und wieder hinaus auf Straßen, die meist ungepflastert waren, immer ins Freie führten – über den Stadt rand hinaus, über die von den Eltern festgesetzten Tabuzonen hinweg. Die Straßen waren rote Pisten plattgewalzten Sandes, Tennisplätzen gleich, wo Kreisel sich drehten und drehten wie nirgendwo sonst. Die Straßen wurden zu gefährlichen Strecken, wenn ihr Belag aus der zerkleinerten schwarzglasigen Schlacke der Hochöfen bestand. Wehe, man stürzte darauf!
Mir nichts dir nichts waren Ellbogen und Knie zerrissen, war Haut abgeschürft. Auf diesen Straßen wurden die kleinen Schritte rasch größer, wur den die Beine leicht und leichter, wollten Beine nicht aufhören zu rennen. Nichts aufregender als das Auf- und-Davon. Doch da war dieser Bannkreis, den das Kind, wenn es auch wollte, nicht durchbrechen konnte, eine innere Stimme hielt das Kind zurück vor dem fremden unfaßbaren Draußen, wo sich eine Welt befand, dem das Kind noch nicht gewachsen war.
Flucht hatte bisher immer geheißen: Für eine befristete Zeit allein sein im Kornfeldversteck, im ausgehöhlten Fuchsbau einer Böschung, selbstverloren im anziehenden Chaos einer Müllgrube oder am Ufer des Flusses. Und getrost sich wieder zurückflüchten in die Arme des Vaters, den Schoß der Mutter, wieder in verläßlicher Gemeinschaft unter Geschwistern sein.
Flucht bekam nun eine andere Bedeutung.
Der Morgen nach dem 17. Juni 1953: Schützenpanzer umzingelten die Arbeitersiedlung und die nahen Chemiewerke. Wir wurden vom Dröhnen der Motoren, vom Rasseln der Panzerketten geweckt. Fensterscheiben klirrten im Rahmen, Mauern erbebten. Bedrohlich war das Geschütz eines Panzers, Zeigefinger an einer Riesenfaust, direkt auf uns, die wir im Fenster standen, gerichtet. Zufällig oder auch nicht. Wir standen gebannt und verstört, und wir schwiegen. Der Vater wurde bleich vor Zorn.
Es war das Ende eines Kapitels im Leben der Eltern und der Familie. Es war der Anfang vom Ende der Kindheit. Was folgte, war die Flucht in den Westen.
Kindheit II
Wie viele andere waren wir durchgesickert und abgedampft aus dem Drucktopf, den die eine Seite des Landes darstellte. Und wie der Zufall, das Schicksal oder Behörden es wollten, waren wir auf der andern Seite des Landes wieder an einem Stadtrand gelandet. Eine andere Kleinstadt: Speyer, Ort des romanischen Kaiserdoms, am westlichen Ufer des Oberrheins gelegen.
Der Flüchtlingsstrom der Fünfzigerjahre zwang auch diese Stadt, sich auszudehnen, überstürzter Billig-Wohnungsbau durchbrach den bestehenden Stadtrand. An Bruch- und Nahtstellen fanden viele Flüchtlingsfamilien, mehr oder minder gelitten, eine neue Heimat oder neue Not. Flüchtling wurde zum Schimpfwort. Es stand eines Morgens, mit Kot hingeschmiert, auf dem frischen Verputz des Neubaus. Davor lag eine junge Birke, mutwillig aus der Erde gerissen.