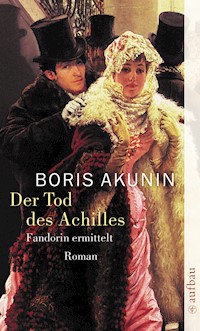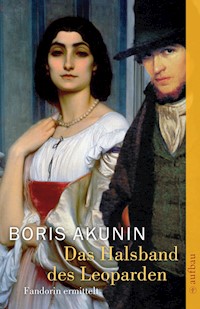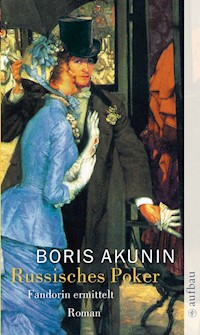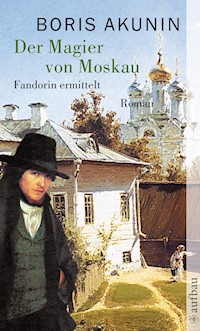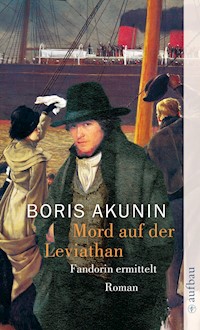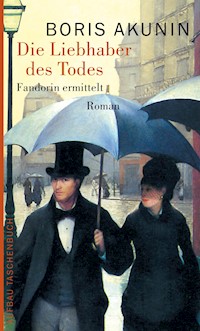
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Fandorin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Fandorin gegen die Herrscher der Moskauer Unterwelt.
Moskau 1900: Senka schlägt sich als kleiner Dieb durch. Eines Tages findet er einen Schatz. Nun kann er sich viele seiner Träume erfüllen. Und auch die schönste Frau Moskaus, die Geliebte des Herrschers der Unterwelt, scheint sich ihm zuzuwenden. Doch sämtliche Gauner Moskaus sind hinter dem Schatz und Senkas schöner Angebeteten her ...
Boris Akunin genießt in Rußland geradezu legendäre Popularität. Auch in Deutschland hat er Kultstatus. 2001 wurde er in Rußland zum Schriftsteller des Jahres gekürt, seine Bücher wurden bereits in 17 Sprachen übersetzt, weltweit wurden etwa 6 Millionen davon verkauft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Boris Akunin
Die Liebhaber des Todes
Fandorin ermittelt
Roman
Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt
Impressum
Die Originalausgabe unter dem Titel
Ljubownik smerti
erschien 2002 bei Sacharow-AST, Moskau.
ISBN 978-3-841-20163-8
Aufbau Digital, veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, März 2012
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 bei Aufbau Taschenbuch,einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
© B. Akunin 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Dagmar und Torsten Lemme,
unter Verwendung des Gemäldes »Der Student« von Nikolai Alexandrowitsch Jaroschenko und eines Gemäldes von Gustave Caillebotte
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Wie Senka Tod zum erstenmal begegnete
Wie Senka nach Chitrowka ging
Wie Senka sich am neuen Ort einlebte
Wie Senka Tod kennenlernte
Wie Senka das Schicksal beim Schopf packte
Wie Senka sich hervortat
Wie Senka bei einem richtigen Ding mitmachte
Wie Senka im Notdurftkabuff saß
Wie Senka lief und sich versteckte und dann einen Schluckauf bekam
Wie Senka nach dem Schatz suchte
Wie Senka erwischt wurde
Wie Senka reich wurde
Wie Senka im Reichtum lebte
Wie Senka Todes Geliebter wurde
Wie sich Senkas Zunge löste
Wie Senka bei einer Hundehochzeit zuschaute
Wie Senka von den Menschen enttäuscht wurde
Wie Senka die Drossel überdrehte
Wie Senka weinte
Wie Senka deduzierte
Wie Senka fremde Briefe las
Wie Senka schadenfroh war
Wie Senka ein kleiner Jude wurde
Wie Senka ein Mamsellchen wurde
Wie Senka eine Klatschbase wurde
Wie Senka eine Prüfung ablegte
Wie Senka den Kopf hin und her drehte
Wie Senka den Kopf drehte (Fortsetzung)
Wie Senka Zeitung las
Wie Senka Tod zum erstenmal begegnete
Erst hieß sie natürlich nicht so, sondern ganz normal, wie es sein muß. Malanja oder vielleicht Agrippina. Und einen Familiennamen hatte sie auch. Den hat schließlich jeder. Der Hofhund draußen, der hat keinen, aber ein Mensch muß einen haben, dafür ist er schließlich ein Mensch.
Aber als Senka Skorik sie zum erstenmal sah, da hieß sie schon so wie jetzt. Niemand nannte sie anders, keiner erinnerte sich an ihren Vor- und Nachnamen.
Als er sie zum erstenmal sah, das war so.
Er saß mit den anderen Jungen auf einer Bank vor Derjugins Krämerladen. Sie rauchten Tabak und quatschten.
Da hielt plötzlich eine Kutsche: dicke Gummireifen, die Speichen golden angestrichen, das Verdeck aus gelbem Leder. Und ein Mädchen stieg aus, wie Senka noch keines gesehen hatte, nicht mal auf der Kusnezki-Brücke, nicht mal auf dem Roten Platz an einem heiligen Feiertag. Nein, kein Mädchen, ein Fräulein, genauer gesagt, eine Jungfrau. Die schwarzen Zöpfe zu einem Kranz um den Kopf gewunden, auf den Schultern ein buntes Seidentuch, auch das Kleid aus schillernder Seide, aber das Tuch und das Kleid waren gar nicht die Hauptsache. Ihr Gesicht war so – man konnte gar nicht sagen, wie. Man sah es an und war hingerissen. Nun, Senka war also hingerissen.
»Was isn das fürn Weibsbild?« fragte er, und um möglichst ungerührt zu erscheinen, spuckte er durch die zusammengebissenen Zähne zur Seite. (Das konnte er weiter als alle anderen, einen ganzen Sashen1 weit, er hatte nämlich eine Zahnlücke, das war sehr praktisch.)
Procha erwiderte darauf nur: Man merkt gleich, daß du noch nicht lange hier bist, Skorik. (Senka lebte sich damals tatsächlich gerade erst ein in Chitrowka2, es war noch keine zwei Wochen her, daß er aus Sucharewka3 abgehauen war.) Selber Weibsbild, sagte er. Das ist doch Tod!
Senka begriff nicht gleich, wieso Tod. Er dachte, das sei so ein Spruch von Procha, von wegen: schön wie der Tod.
Und wirklich – schön war sie, man konnte den Blick gar nicht abwenden. Eine hohe, reine Stirn. Die Brauen geschwungen wie ein Joch, schneeweiße Haut, rote Lippen, und die Augen – ach, die Augen! Solche Augen hatte Senka schon gesehen, auf dem Konnaja-Platz, bei turkestanischen Pferden: groß, feucht und dabei wie von einem Feuer erleuchtet. Aber die Augen von dem Fräulein-Jungfrau, die aus der Kutsche stieg, waren noch schöner als die der Pferde.
Senka schaute die wunderschöne Person an und zwinkerte aufgeregt, und Michejka Eule wischte sich die Tabakkrumen vom Mund und stieß ihm den Ellbogen in die Seite: He, Skorik, starr sie nicht zu lange an. Sonst schneidet Fürst dir die Ohren ab und läßt sie dich auffressen, wie damals den Pferdehändler aus Wolokolamsk. Dem hat Tod auch gefallen, dem Pferdehändler. Und das war die Strafe, weil er sie so lange angestarrt hat.
Wieder kapierte Senka nicht, wieso Tod, aber die aufgefressenen Ohren interessierten ihn.
»Und, hat er sie gefressen, der Pferdehändler?« fragte er erstaunt. »Das hätt ich nie und nimmer.«
Procha nahm einen Schluck Bier aus der Flasche. Hättest du wohl, widersprach er. Wenn Fürst dich im Guten drum gebeten hätte, ganz höflich, hättest dus brav getan, dich obendrein noch bedankt – danke schön, hat gut geschmeckt. Der Pferdehändler hat ewig auf einem Ohr rumgekaut und kriegte es nicht runter, da hat Fürst ihm schon das zweite abgeschnitten und in den Mund gestopft. Und ihn dabei mit nem Messer in den Bauch gepiekt, damit er nicht so trödelte. Hinterher ist dem Wolokolamsker der ganze Schädel aufgequollen und hat geeitert. Ein paar Tage hat er geheult wie ein Wolf und ist dann krepiert, hats nicht mehr geschafft zurück in sein Wolokolamsk. Tja, so gehts zu bei uns in Chitrowka. Merk dir das, Skorik.
Von Fürst hatte Senka natürlich schon gehört, obwohl er noch nicht lange in Chitrowka war. Wer hatte nicht von Fürst gehört? Er war der verwegenste Räuber in ganz Moskau. Über ihn wurde auf den Märkten geredet und in den Zeitungen geschrieben. Die Polypen waren hinter ihm her, aber ihre Krallen waren nicht lang genug. Chitrowka verriet seine Leute nicht – jeder wußte, was mit Verrätern passierte.
Aber mein Ohr würd ich trotzdem nicht fressen, dachte Senka. Dann lieber kämpfen, Messer gegen Messer.
»Wieso, ist sie dem Fürst sein Schätzchen oder was?« erkundigte er sich nach der erstaunlichen Jungfrau – nur so, aus Neugier. Und beschloß, sie nicht mehr anzustarren, das hatte er gar nicht nötig. Außerdem war sie schon weg, in den Laden gegangen.
»Sätßen«, äffte Procha ihn nach (wegen des ausgeschlagenen Zahns sprach Senka nicht alle Wörter richtig aus). Selber Schätzchen, sagte er.
Wer in Sucharewka einen Jungen Schätzchen nannte, bezog dafür eine anständige Tracht Prügel, und Senka wollte Procha schon eins in die knochige Fratze geben, besann sich aber. Erstens, weil hier in Chitrowka womöglich andere Sitten herrschten und das vielleicht gar nicht beleidigend gemeint war; zweitens – Procha war ein kräftiger Kerl, es war noch sehr die Frage, wer wen vermöbeln würde. Und drittens wollte er gern mehr über dieses Fräulein hören.
Procha zierte sich noch ein bißchen, dann erzählte er.
Sie lebte, wie es sich gehört, bei Vater und Mutter, in Dobraja Sloboda oder in Rasguljaj, irgendwo in der Vorstadt jedenfalls. Sie wuchs zu einem stattlichen, hübschen Mädchen heran, die Brautwerber standen Schlange. Schließlich, als sie alt genug war, wurde sie einem Bräutigam versprochen. Sie fuhren zur Trauung in die Kirche, sie und der Bräutigam. Plötzlich rannten zwei riesige schwarze Hunde direkt vor dem Schlitten über den Weg. Hätten sie geahnt, was passiert, und ein Gebet gesprochen – wer weiß, vielleicht wäre dann alles anders gelaufen. Oder wenn sie sich wenigstens bekreuzigt hätten. Aber das taten sie nicht, vielleicht kamen sie auch nicht mehr dazu. Die Pferde scheuten vor den schwarzen Hunden, gingen durch und stürzten in die Jausa. Der Bräutigam wurde zu Tode gequetscht, der Kutscher ertrank, doch das Mädchen erlitt nicht den geringsten Kratzer.
Na schön, so etwas kommt vor. Später fuhren sie ihn beerdigen, den jungen Burschen. Sie, die Braut, lief neben dem Sarg. Sie klagte laut – es heißt, sie hat ihn sehr geliebt. Und als sie über die Brücke fuhren, gegenüber von der Stelle, wo es passiert war, schrie sie plötzlich: Lebt wohl, ihr Christenmenschen, und sprang über das Geländer, kopfüber von der Brücke. Am Tag zuvor hatte es gefroren, auf dem Fluß war meterdick Eis, sie hätte sich also den Schädel in tausend Stücke sprengen oder den Hals brechen müssen. Aber nichts dergleichen! Sie war geradewegs in ein Eisloch gesprungen, das nur mit einer dünnen Eisschicht überzogen und mit Schnee bedeckt war. Sie tauchte unter, und weg war sie.
Alle dachten natürlich, sie wäre ertrunken. Rannten herum, schrien und winkten. Und sie, die Ertrunkene, trieb unterm Eis fünfzig Sashen weiter und tauchte in einem Eisloch, in dem ein paar Weiber Wäsche spülten, wieder auf.
Sie packten sie mit einem Hakenstock oder was und zogen sie raus. Sie sah aus wie tot, ganz weiß, aber nach einer Weile taute sie wieder auf und war putzmunter und lebendig.
Wegen dieser katzenhaften Zähigkeit wurde sie nun die Lebendige gerufen, manche nannten sie auch die Unsterbliche, aber das war noch nicht ihr endgültiger Spitzname. Der änderte sich später.
Ein Jahr verging oder anderthalb, da wollten die Eltern sie erneut verheiraten. Das Mädchen war noch schöner erblüht als zuvor. Ein Kaufmann warb um sie, nicht mehr jung, aber sehr reich. Der Lebendigen wars einerlei – warum nicht ein Kaufmann? Wer sie damals kannte, der erzählte, daß sie sich sehr um ihren Bräutigam grämte – um den ersten, der umgekommen war.
Und was geschah? Der neue Bräutigam fängt einen Tag vor der Hochzeit früh in der Kirche plötzlich an zu röcheln, rudert mit den Armen und kippt zur Seite. Strampelt noch mit den Beinen, schmatzt mit den Lippen und haucht seine Seele aus. Ein Schlaganfall hat ihn dahingerafft.
Nach diesem Ereignis wars vorbei mit den Heiratsplänen. Bald darauf lief sie weg von zu Hause, mit einem feinen Herrn, einem Offizier, und lebte mit ihm am Arbat. Sie wurde eine ganz vornehme Mamsell: Sie kleidete sich städtisch; wenn sie Vater und Mutter besuchte, saß sie in einer Lackkutsche, in der Hand einen spitzenbesetzten Schirm. Der Offizier konnte sie zwar nicht heiraten, dafür gab ihm sein Vater nicht den Segen, aber er war ihr von Herzen zugetan, er liebte sie abgöttisch.
Doch auch diesem Dritten brachte sie den Tod. Er war ein kräftiger Kerl, dieser Offizier, wie Milch und Blut, doch kaum hatte er eine Weile mit ihr gelebt, fing er an zu kränkeln. Er wurde blaß und schwach, die Beine trugen ihn kaum noch. Die Ärzte mühten sich um ihn, schickten ihn zu Kuren ins Ausland, aber alles vergeblich. Es hieß, ein Krebs habe sich in ihm eingenistet und zerreiße ihm mit seinen Scheren die Eingeweide.
Als sie ihren Offizier begraben hatte, da wußte jeder, auch der dümmste Trottel: Mit dem Mädchen stimmt was nicht. Und da bekam sie ihren neuen Spitznamen.
Zurück in die Vorstadt konnte und wollte sie auch gar nicht. Ihr Leben veränderte sich von Grund auf. Normale Menschen mieden sie. Wenn sie vorbeiging, bekreuzigten sie sich und spuckten sich über die Schulter. Die einzigen, die sich mit ihr einließen, waren Banditen, verwegene Kerle, die den Tod nicht fürchteten. Denn nachdem sie ihrem Offizier alles Blut ausgesaugt hatte, ist sie noch schöner geworden, hast es ja gesehen. Sozusagen die erste Schönheit von ganz Moskau.
Na, und so gings immer weiter. Kolscha Stift (ein berühmter Taschendieb vom Meschtschane-Markt) war zwei Monate mit ihr zusammen – dann haben ihn die eigenen Leute erstochen, weil er die Sore nicht teilen wollte.
Danach kam Jaschka Kostromskoi, der Pferdedieb. Der stahl reinrassige Rennpferde direkt aus dem Stall und verscherbelte sie für viel Geld an die Zigeuner. Manchmal hatte er mehrere tausend Rubel in der Tasche. Für sie war ihm nichts zu teuer, er hat sie geradezu in Gold gebadet. Die Greifer haben Jaschka erschossen, vor einem halben Jahr.
Und nun ist sie mit Fürst zusammen. Schon drei Monate. Deshalb tut er so wichtig, plustert sich Wunder wie auf. Früher war er nur ein Dieb wie jeder andere, heute zerquetscht er einen Menschen wie eine Fliege. Bloß, weil er sich mit Tod zusammengetan hat und weiß: Er wird nicht mehr lange auf der Erde rumlaufen. Wie heißt es doch? Wer den Tod zu Gast lädt, weidet bald auf dem Gottesacker. Einen Spitznamen bekommt man schließlich nicht von ungefähr, schon gar nicht so einen.
»Was denn für einen Spitznamen?« fragte Senka, der mit offenem Mund zugehört hatte. »Das hast du mir immer noch nicht gesagt, Procha.«
Procha starrte ihn an und schlug sich mit der Faust gegen die Stirn. »Mann, bist du schwer von Begriff! Wieso nennt man dich bloß Skorik?4 Das erzähl ich dir doch schon eine geschlagene Stunde. Tod – das ist ihr Spitzname. Jeder nennt sie so. Und sie nimmts nicht krumm, hat sich dran gewöhnt.«
Wie Senka nach Chitrowka ging
Skorik war ein gewitzter Bursche, ließ seine Äuglein in alle Richtungen flitzen, hatte eine flinke Zunge und blieb keinem eine Antwort schuldig – daher sein Spitzname, dachte Procha. In Wahrheit aber kam Senkas Spitzname von seinem Familiennamen. So hatte sein Vater geheißen: Skorikow Trifon Stepanowitsch. Wie er jetzt hieß, wußte Gott allein. Vielleicht war er nun nicht mehr Trifon Stepanowitsch, sondern der Engel Trifaniil. Obwohl – Papa war wohl kaum zu den Engeln gelangt – er war zwar ein herzensguter Mann gewesen, hatte aber furchtbar gesoffen. Mama dagegen, die wohnte ganz bestimmt irgendwo ganz nah bei Gottes Thron.
Senka dachte oft darüber nach, wer von seinen Verwandten jetzt wo weilen mochte. Was seinen Vater anlangte, so war er im Zweifel, was jedoch seine Mutter und die Brüderchen und Schwesterchen betraf, die zusammen mit den Eltern an der Cholera gestorben waren, da war er sich ganz sicher und betete nicht einmal für sie um das Himmelreich – er wußte, sie waren ohnehin dort.
Die Cholera hatte ihre Vorstadt vor drei Jahren heimgesucht und viele dahingerafft. Von allen Skorikows waren nur Senka und sein Bruder Wanja noch am Leben. Ob das zum Guten war oder zum Bösen – das mußte sich noch erweisen.
Für Senka war es wohl eher zum Bösen, denn sein Leben hatte sich seitdem vollkommen gewandelt. Papa war Kommis in einem großen Tabakgeschäft gewesen, hatte einen guten Lohn gehabt und immer Tabak umsonst. Als kleines Kind hatte Senka keine Not gelitten. Wie es so schön heißt – der Bauch war satt und die Visage rein und glatt. Als es an der Zeit war, lernte er lesen und rechnen, besuchte sogar ein halbes Jahr die Handelsschule, doch als er verwaiste, wars aus mit dem Lernen. Na schön, halb so schlimm, das war kein großer Verlust, nicht das grämte Senka.
Sein Bruder Wanja hatte Glück, den nahm der Friedensrichter Kuwschinnikow zu sich, der bei Papa immer englischen Tabak gekauft hatte. Der Richter hatte eine Frau, aber keine Kinder, deshalb nahm er Wanja zu sich, denn der war klein und mollig. Senka dagegen war schon groß und knochig, so einer interessierte den Richter nicht. Also kam Senka zu seinem Onkel Sot Larionytsch nach Sucharewka. Ja, und da wurde Skorik aufsässig.
Wie sollte er auch nicht aufsässig werden?
Der Onkel, der dickbäuchige Halunke, ließ ihn hungern. Senka durfte nicht mit der Familie am Tisch sitzen, obwohl er doch ein Blutsverwandter war. Sonnabends schlug ihn der Onkel – manchmal aus gutem Grund, aber meist einfach so, aus purer Lust und Laune. Einen Lohn zahlte er ihm nicht, obwohl Senka im Laden nicht weniger schuftete als die anderen Laufburschen, die acht Rubel bekamen. Am schlimmsten aber war, daß Senka morgens seinem Cousin Grischka den Ranzen ins Gymnasium tragen mußte. Grischka lief stolz voran, ein Lutschbonbon im Mund, und Senka trottete mit dem zentnerschweren Ranzen (manchmal packte Grischka aus Bosheit extra einen Ziegelstein hinein) hinterher, wie ein Leibeigener in alten Zeiten. Am liebsten hätte Senka ihn zerquetscht wie einen Pickel, diesen Grischka, damit er die Nase nicht so hoch trug und seine Bonbons mit ihm teilte. Oder ihm den Ziegelstein auf den Kopf gehauen – aber nein, er mußte es ertragen.
Und Senka ertrug alles, solange er konnte. Ganze drei Jahre.
Natürlich rächte er sich, wenn er konnte. Schließlich muß man seinem Herzen auch mal Luft machen können.
Einmal steckte er Grischka eine Maus ins Kopfkissen. In der Nacht nagte sie sich ins Freie und wühlte sich dem Cousin in die Haare. Das war ein Geschrei mitten in der Nacht! Und niemand kam auf Senka.
Oder letzte Butterwoche, als im Haus gesotten, gebraten und gebacken wurde und die arme Waise nur zwei dünne Plinsen mit einem Tropfen Öl bekam, da kippte Skorik vor Wut in den Topf mit der fetten Kohlsuppe Haferschleim, den man gegen Verstopfung bekommt. Immer rennt aufs Örtchen, ihr Fettwänste, zerreißen solls euch! Auch das ging ihm durch – sie schoben es auf den Schmand, der vielleicht nicht mehr frisch gewesen war.
Gelegentlich stahl er Kleinigkeiten aus dem Laden: Garn, eine Schere oder Knöpfe. Was sich losschlagen ließ, verkaufte er auf dem Trödelmarkt von Sucharewka, Unbrauchbares warf er weg. Dafür bezog er bisweilen auch Prügel, aber nur auf Verdacht – direkt erwischt wurde er nie.
Doch als er eines Tages aufflog, da geschah es mit Pauken und Trompeten. Und daran war nur sein weiches Herz schuld, nur seinetwegen ließ Senka es an der sonstigen Vorsicht fehlen.
Er bekam eine Nachricht von seinem Bruder Wanja, von dem er drei Jahre lang nichts gehört hatte. Oft hatte er sich in seinem Elend damit getröstet, daß es seinem Bruder Wanja, dem Glückspilz, beim Richter Kuwschinnikow richtig gut ging, ganz anders als ihm selbst. Und nun kam also ein Brief von ihm.
Daß er den Weg zu Senka gefunden hatte, war ein Wunder. Auf dem Kuvert stand: »Nach Moskau nach Sucharewka an meinen Bruder Senja der bei Onkel Sot wont.« Gut, daß Sot Larionowitsch auf der Post in Sucharewka einen Postboten kannte, der hatte erraten, für wen der Brief war, und ihn Senka gebracht – Gott schenke ihm Gesundheit.
»Lieber Bruder Senka wie get es dir. Mit get es ser schlecht. Ich mus buchstaben schreiben lernen und werde oft ausgeschimft und gekrenkt dabei hab ich doch bald geburtstag. Und ich wünsch mir so ser ein Ferdchen aber sie denken gar nich dran. Komm her und hol mich weg von disen bösen Leuten. Dein Bruder Wanjuscha.«
Als Senka das las, fingen seine Hände an zu zittern, und Tränen schossen ihm in die Augen. Von wegen Glückspilz! Dieser Richter! Quälte ein kleines Kind und war zu geizig, ihm ein Spielzeug zu kaufen. Warum hatte er dann überhaupt eine Waise aufgenommen?
Kurz, er war gekränkt für Wanja und entschied, er wäre der letzte Lump, wenn er seinen Bruder in diesem Elend allein ließ.
Auf dem Kuvert stand kein Absender, aber der Postbote sagte, der Stempel komme aus Tjoplyje Stany, das sei kurz hinter Moskau, etwa zehn Werst vom Kalugaer Tor entfernt. Wo genau der Richter wohne, könne man an Ort und Stelle erfragen.
Senka überlegte nicht lange. Am nächsten Tag war Johanni, Wanjas Namenstag.
Er rüstete sich für den Weg, um seinen Bruder zu retten. Wenn es ihm ganz schlecht ginge, wollte er ihn mitnehmen. Zusammen ließ sich der Kummer leichter ertragen.
Im Spielzeugladen in der Sretenka fand er eine weiße Stute, mit einem Schweif aus Bast und weißer Mähne. Sie war märchenhaft schön, aber furchtbar teuer – sieben und einen halben Rubel. Am Mittag, als nur noch der taube Nikifor in Onkel Sots Laden war, brach Senka mit einem Nagel die Ladenkasse auf, nahm acht Rubel heraus und gab Fersengeld. An die Strafe dachte er nicht. Skorik hatte den Vorsatz gefaßt, nicht zum Onkel zurückzukehren, sondern mit seinem Bruder Wanja ein freies Leben zu führen. Vielleicht bei den Zigeunern oder irgendwo anders, das würden sie dann schon sehen.
Er lief schrecklich lange bis Tjoplye Stany, seine Füße wurden ganz wund, und auch das Holzpferdchen wurde mit jedem Schritt schwerer.
Dafür fand er das Haus des Richters mühelos, gleich der erste Ortskundige zeigte es ihm. Es war ein schönes Haus, mit einem eisernen Vordach auf Säulen und einem Garten davor.
Senka ging nicht zum Vordereingang – er genierte sich. Womöglich hätte man ihn nicht eingelassen, denn nach dem weiten Weg war er voller Staub, und sein Gesicht war zerschrammt und blutete. Hinterm Kalugaer Tor hatte ein Kutscher, als Senka sich hinten an den Wagen klammern wollte, ihm eins mit der Peitsche übergezogen, der Hund – ein Glück, daß er ihm wenigstens kein Auge ausgeschlagen hatte.
Senka hockte sich vor das Haus und überlegte, wie nun weiter. Aus dem offenen Fenster klangen süße Töne – irgendwer spielte langsam und unsicher ein Lied, das Senka nicht kannte. Ab und zu ertönte eine helle Stimme – das mußte Wanja sein.
Schließlich faßte Senka sich ein Herz, stieg auf einen Mauervorsprung und schaute ins Fenster.
Er sah ein großes, schönes Zimmer. Vor einem riesigen polierten Kasten (ein »Klavier«, so eins hatte in der Handelsschule auch gestanden) saß ein lockenköpfiger kleiner Junge im Matrosenanzug und patschte mit seinen rosigen Fingerchen auf die Tasten. Es war Wanja, und er war es auch nicht. Glatt und frisch sah er aus, direkt zum Anbeißen. Neben ihm saß eine Dame mit Augengläsern, blätterte mit einer Hand das Heft auf dem Notenständer um und streichelte mit der anderen dem Jungen das goldene Haar. Und in der Ecke lag Spielzeug über Spielzeug, auch Pferdchen, viel prächtiger als Senkas, gleich drei Stück.
Noch ehe Senka begriffen hatte, was das zu bedeuten hatte, kam eine Kutsche um die Ecke, ein Zweispänner. Er konnte gerade noch runterspringen und sich an den Zaun pressen.
In der Kutsche saß Richter Ippolit Iwanowitsch Kuwschinnikow. Senka erkannte ihn sofort.
Wanja beugte sich aus dem Fenster und rief: »Hast du es mitgebracht? Ja?«
Der Richter lachte und stieg ab. Hab ich, sagte er. Siehst du es denn nicht? Wie wollen wir es nennen?
Erst jetzt entdeckte Senka, daß hinten an der Kutsche ein Fohlen festgebunden war, braun, mit runden Flanken. Nein, kein Fohlen, es war ein erwachsenes Pferd, aber ganz klein, kaum größer als eine Ziege.
Wanja schrie: »Ein Pony! Jetzt hab ich ein richtiges Pony!«
Senka aber machte kehrt und lief zurück zum Kalugaer Tor. Das braune Pferdchen ließ er am Wegesrand im Gras liegen, mochte es dort weiden. Wanja brauchte es nicht – vielleicht hatte ein anderes Kind Freude daran.
Während er so lief, träumte er, daß sich sein Leben eines Tages zum Guten wenden würde, dann wollte er wiederkommen, in einer funkelnden Kutsche. Ein Lakai würde eine Visitenkarte mit Goldbuchstaben ins Haus bringen, auf der alles über Senka stand, und die Dame mit den Augengläsern würde zu Wanja sagen: Sieh nur, Iwan Trifonowitsch, Ihr Bruder kommt uns besuchen. Senka würde einen Anzug aus reinem Cheviot tragen, geknöpfte Gamaschen und einen Spazierstock mit elfenbeinernem Knauf.
Erst im Dunkeln langte er zu Hause an. Besser, er wäre gar nicht erst zurückgekehrt, sondern gleich weggelaufen.
Onkel Sot versetzte ihm gleich auf der Schwelle einen solchen Schlag, daß Senka Sterne sah und ihm der Vorderzahn ausfiel, weshalb er nun so gut durch die Lücke spucken konnte. Als Senka dann am Boden lag, trat der Onkel noch auf seine Rippen ein und verkündete: Warte nur, das ist noch nicht alles! Ich hab dich bei der Polizei angezeigt, schrie er, beim Herrn Reviervorsteher. Für den Diebstahl kommst du ins Gefängnis, du Hurensohn, dort wird man dich zur Räson bringen. So drohte und blaffte er eine ganze Weile.
Als der Onkel, erschöpft vom Schlagen und Treten, das Tragjoch von der Wand nahm, mit dem die Frauen Wassereimer schleppten, rannte Senka zur Diele hinaus, wobei er Blut spuckte und sich die Tränen übers Gesicht wischte.
Die Nacht verbrachte er bibbernd vor Kälte auf dem Sucharewka-Markt, unter einer Fuhre Heu. Er tat sich selber schrecklich leid, die Rippen und das zerschlagene Gesicht schmerzten, und er hatte furchtbaren Kohldampf. Den halben Rubel, der von dem Pferdchen noch übrig war, hatte er schon gestern verzehrt, nun pfiff durch seine Taschen der Wind.
Im Morgengrauen ging er fort aus Sucharewka. Da der Onkel ihn beim Revier angezeigt hatte, konnte der erstbeste Schutzmann Senka schnappen und ins Kittchen sperren, und dort kam man nicht so leicht wieder raus. Er mußte irgendwohin, wo ihn niemand kannte.
Er ging auf einen anderen Markt, hinter dem Alten Neuen Platz, an der Mauer von Kitaigorod. Dort trieb er sich bei den Garständen herum, sog den Duft von Gebackenem ein und blickte sich mit flinken Augen um – vielleicht paßte eine Marktfrau mal nicht auf? Doch einfach zuzugreifen wagte er nicht – schließlich hatte er noch nie so offen gestohlen. Wenn er nun erwischt wurde? Sie würden ihn schlagen und treten, dagegen würde ihm der Onkel erscheinen wie seine liebe Mama.
Er schlenderte über den Markt, hielt sich aber von der Soljanka-Straße fern. Er wußte, dahinter begann Chitrowka, der schlimmste Ort in ganz Moskau. Natürlich gab es auch in Sucharewka genügend Taschendiebe und Hehler, aber die waren nichts gegen die in Chitrowka. Da sei es wirklich gruselig, erzählte man. Ließ sich dort ein Fremder blicken, wurde er sofort splitternackt ausgezogen und konnte noch froh sein, wenn er lebendig davonkam. Dort sollte es schreckliche Nachtasyle mit Kellern und unterirdischen Gräbern geben. Und entlaufene Sträflinge, Mörder und überhaupt allerlei Abschaum. Außerdem erzählte man sich, wenn sich Halbwüchsige dorthin verirrten, verschwanden sie auf Nimmerwiedersehen. Dafür gab es angeblich spezielle Leute, sogenannte Häscher. Die Häscher fingen diese Jungen, die ohne Begleitung waren, und verkauften sie an Juden und Tataren für geheime Lasterhöhlen.
Das stellte sich später als Blödsinn heraus. Das heißt, das mit den Nachtasylen und dem Abschaum stimmte, aber Häscher gab es in Chitrowka nicht. Als Senka seinen neuen Freunden gegenüber die Häscher erwähnte, lachten sie ihn aus. Procha sagte, wenn ein Junge leichtes Geld verdienen wollte – bitte sehr, aber jemanden mit Gewalt verderben, nein, das gab es nicht, das würde die Gemeinschaft nicht zulassen. Des Nachts jemanden ermorden – das ja. Im Suff oder wenn sich irgendein reicher Trottel aus Versehen hierher verirrte. Vor kurzem war in der Podkopajewski-Gasse einer gefunden worden: der Schädel zertrümmert, die Finger mit den Ringen abgehackt und die Augen ausgestochen. Selber schuld. Hat ihn schließlich keiner eingeladen. Dafür ist der Kater schließlich da, daß die Mäuse nicht zu fett werden.
»Aber warum die Augen ausgestochen?« fragte Senka erschrocken.
Eule lachte nur. Frag den, ders getan hat.
Aber das war schon später, als Senka schon zur Chitrowka gehörte.
Das ging ganz schnell und leicht – sozusagen, ehe er einmal niesen konnte.
Senka sah sich bei den Sbiten5-Stände um, ob er nicht irgendwo was abstauben konnte, sammelte Mut, da gab es plötzlich einen gewaltigen Lärm, Geschrei und Gekeife. Eine Frau kreischte: Hilfe, man hat mich bestohlen, sie haben mir das Portemonnaie aus der Tasche gezogen, haltet die Diebe! Zwei Jungen in Senkas Alter türmten geradewegs über die Marktstände, die Schüsseln und Becher flogen unter ihren Stiefeln nach allen Seiten. Die Marktfrau packte den kleineren mit ihren riesigen Händen am Gürtel und warf ihn zu Boden. Hab ich dich, du kleiner Wolf! Na warte! Der zweite kleine Dieb, ein spitznasiger Junge, sprang vom Ladentisch und versetzte der Frau mit voller Wucht einen Hieb aufs Ohr. Sie erstarrte und kippte zur Seite. (Procha hatte immer einen Bleiwürfel dabei, das erfuhr Senka hinterher.) Der Spitznasige zerrte den anderen am Arm, wollte mit ihm fortrennen, doch da waren sie schon von allen Seiten umstellt. Aus Rache für die Marktfrau hätte man die beiden bestimmt zu Tode geprügelt, wenn Senka nicht gewesen wäre.
Senka schrie: »He, ihr Rechtgläubigen! Wer hat einen Silberrubel verloren?«
Da kamen sie alle angelaufen: Ich, ich! Er aber schlüpfte an den ausgestreckten Händen vorbei und rief den beiden Dieben zu: »Was glotzt ihr so! Lauft!«
Sie rannten ihm nach, und als Senka vor einem Torweg zögerte, überholten sie ihn und winkten ihm – los, komm mit.
An einem stillen Ort verschnauften sie und begrüßten einander. Eule (der kleinere, pausbäckige) fragte: Wer bist du, woher kommst du?
Senka darauf: »Aus Sucharewka.«
Der zweite, der Procha hieß, grinste, als hätte Senka was Komisches gesagt. Und wieso, wollte er wissen, bist du nicht in Sucharewka geblieben?
Senka spuckte schweigend durch die Zahnlücke – noch nicht so weit wie jetzt, aber doch mindestens drei Arschin6. Und sagte knapp: »Da kann ich nicht bleiben. Sonst komme ich ins Kittchen.«
Die Jungen sahen Senka respektvoll an. Procha klopfte ihm auf die Schulter. Na dann, bleib bei uns. Keine Bange, Chitrowka liefert keinen aus.
Wie Senka sich am neuen Ort einlebte
Mit den Jungen lebte er so:
Tags gingen sie »ausfegen«, nachts »bedienen«.
Zum Ausfegen gingen sie meist auf den Alten Platz, wo der Markt war, manchmal in die Marossejka-Straße mit den Krämerläden oder in die Warwarka-Straße mit den vielen Passanten, höchstens noch in die Iljinka-Straße, wo reiche Kaufleute rumliefen und Börsenmakler, aber nie weiter. Procha, der Älteste, nannte das »bis eine Flatter hinter Chitrowka« – das hieß, im Fall der Fälle konnte man noch bis zu den Höfen und Winkeln von Chitrowka türmen, wo ein Dieb nicht mehr zu fangen war.
Ausfegen lernte Senka schnell. Das war leicht und lustig.
Eule wählte einen Kaulbarsch aus – jemanden, der nicht gut aufpaßte – und überprüfte, ob er Geld bei sich hatte. Er ging ganz dicht an ihn ran, beschnupperte ihn und signalisierte den anderen mit einem Nicken: Ja, er hat eine Marie bei sich. Er selbst langte nie zu – dafür waren seine Finger nicht begabt.
Nun war Senka an der Reihe. Er mußte dafür sorgen, daß der Kaulbarsch das Maul aufsperrte und seine Taschen vergaß. Dafür gab es mehrere Methoden. Er konnte zum Beispiel eine Prügelei mit Eule anzetteln, bei so was bleiben die Leute gern stehen und gaffen. Oder er lief plötzlich mitten auf der Straße auf den Händen und zappelte dabei komisch mit den Beinen – das konnte er von klein auf. Das einfachste war, wenn er sich vor dem Kaulbarsch zu Boden warf, als wäre er fallsüchtig, und schrie: »Mir ist schlecht, Onkel (oder Tante, je nachdem). Ich sterbe!« Ein mitleidiger Mensch blieb auf jeden Fall stehen und sah nach dem Jungen, der sich am Boden krümmte, aber selbst wenn man an einen Hartherzigen geriet, der weiterging – auch der drehte sich um und schaute, aus schierer Neugier. Darauf wartete Procha nur. Schwupps, und die Sache war erledigt. Was dein Geld war, ist nun unser.
Das »Bedienen« mochte Senka weniger. Eigentlich überhaupt nicht. Dafür suchten sie sich abends, wieder nicht weit weg von Chitrowka, einen einsamen Biber (dasselbe wie ein Kaulbarsch, bloß betrunken). Dabei war wieder Procha der Anführer. Er sprang ihn von hinten an und schlug ihm mit voller Wucht die Faust gegen die Schläfe, und in der Faust hatte er seinen Bleiwürfel. Wenn der Biber zu Boden fiel, stürzten sich Senka und Eule links und rechts auf ihn, nahmen ihm sein Geld ab, seine Uhr und was er sonst noch bei sich trug, zogen ihm auch Jackett und Stiefeletten aus, wenn es sich lohnte. Fiel der Biber von dem Schlag mit dem Bleiwürfel jedoch nicht um, legten sie sich mit einem solchen Kraftprotz nicht an. Procha rannte gleich weg, und Senka und Eule blieben im Torbogen stehen.
Das Bedienen war eigentlich auch nicht weiter schwer, aber unangenehm. Senka fürchtete sich anfangs sehr – wenn Procha nun jemanden zu Tode schlug? Doch dann gewöhnte er sich daran. Erstens schlug er ja nur mit einem Bleiwürfel zu, nicht mit einem Schlagring oder einem Totschläger. Zweitens hatten Betrunkene bekanntlich Glück, Gott stand ihnen bei. Außerdem besaßen sie einen harten Schädel.
Die Beute verkauften sie an die Hehler im Buninschen Nachtasyl. Manchmal machte der Erlös nicht mehr als einen Rubel, an guten Tagen dagegen bis zu fünf Goldrubel. Wenn es nur ein Rubel war, aßen sie »Hundefreude«7 mit Schwarzbrot. Hatten sie aber gut abgesahnt, setzten sie sich ins »Katorga« oder ins »Sibir«8 und tranken Wein. Anschließend gingen sie zu den Schlampen (den Mamsellchen, wie sie in Chitrowka hießen), poussieren.
Procha und Eule hatten ihre eigenen Mamsellchen, bei denen sie Stammgäste waren. Natürlich keine festen Liebchen wie die großen Banditen – soviel Geld hatten sie nicht –, aber immerhin. Bei den Mädchen konnten sie sich durchfuttern und sie auch mal anpumpen.
Auch Senka hatte bald eine Freundin, die Taschka.
An jenem Morgen erwachte Senka spät. Weil er betrunken gewesen war, hatte er keine Erinnerung an den Vortag. Er schaute sich um – ein kleines Zimmerchen, ein Fenster mit Vorhang, auf dem Fensterbrett Töpfe mit gelben, roten und blauen Blumen. In einer Ecke, direkt auf dem Fußboden, lag eine sieche, klapperdürre Frau, hustete sich die Seele aus dem Leib und spuckte Blut in ein Tuch – anscheinend eine Schwindsüchtige. Senka lag auf einem Eisenbett, splitternackt, und am anderen Ende saß im Türkensitz ein Mädchen, nicht älter als dreizehn, schaute in ein Buch und ordnete Blumen. Dabei murmelte sie vor sich hin.
»Was machst du da?« fragte Senka heiser.
Sie lächelte ihn an. Kuck mal, sagte sie, das ist eine weiße Akazie – das bedeutet reine Liebe. Rotes Springkraut bedeutet Ungeduld, Berberitze Ablehnung.
Er dachte, sie wäre nicht ganz richtig im Kopf. Damals wußte er noch nicht, daß Taschka die Blumensprache lernte. Sie hatte irgendwo ein Buch aufgetan – »Wie man sich mit Hilfe von Blumen verständigt«, und das gefiel ihr sehr – sich nicht mit Worten auszudrücken, sondern mit Blumen. Auch die drei Rubel, die Senka ihr für die Nacht gegeben hatte, waren fast vollständig für Blumen draufgegangen. Sie war früh auf den Markt gelaufen, hatte einen ganzen Armvoll Grünzeug gekauft und es vor sich ausgebreitet. So war sie, die Taschka.
Senka hatte damals fast den ganzen Tag bei ihr verbracht. Erst kurierte er seinen Kater mit Gurkenlake, dann trank er Tee und aß Brot dazu. Danach saßen sie einfach so beisammen und unterhielten sich.
Taschka war ein gutes Mädchen, wenn auch nicht ohne Macken – da waren zum Beispiel die Blumen oder ihre Mutter, die schwindsüchtige Trinkerin, die zu nichts nütze war. Wozu gab sie sich mit ihr ab, verschwendete Geld für sie? Sie mußte so oder so sterben.
Am Abend, bevor Taschka paradieren ging, sagte sie plötzlich zu Senka: »Hör mal, Senka, laß uns Kameraden sein.«
Und er darauf: »Abgemacht.«
Sie verhakten ihre kleinen Finger ineinander und küßten sich auf den Mund. Taschka sagte, das gehöre sich so zwischen Kameraden. Doch als Senka sie nach dem Kuß begrapschen wollte, da war sie dagegen. Was soll das, meinte sie, wir sind doch Kameraden. Mit einem Kameraden schäkern ist das Letzte. Und überhaupt läßt du lieber die Finger von mir, ich hab die Franzosenkrankheit, die hab ich mir bei einem Ladendiener geholt. Wenn du mich bimst, fällt dir eines Tages deine Rotznase ab.
Senka war erschrocken. »Die Franzosenkrankheit? Wieso hast du mir das gestern nicht gesagt?«
Gestern, erwiderte sie, warst du für mich ein Niemand, bloß ein Freier, nun aber sind wir Kameraden. Ach, hab keine Angst, Senka, nicht jeder steckt sich gleich an, schon gar nicht von einem einzigen Mal.
Er beruhigte sich ein wenig, aber sie tat ihm leid.
»Und du?«
Was ist schon dabei, meinte sie. Das haben viele von uns. Halb so schlimm. Manche Mamsellchen werden mit der Franzosenkrankheit dreißig oder sogar noch älter. Wenn du mich fragst – dreißig ist schon zuviel. Mama zum Beispiel ist achtundzwanzig und schon eine alte Frau: keinen Zahn mehr im Mund und voller Runzeln.
Den anderen Burschen gegenüber nannte Senka Taschka weiter sein Mamsellchen. Er schämte sich, die Wahrheit zu sagen – die anderen würden ihn auslachen. Aber egal. Schäkern konnte man mit jeder, Hauptsache, man hatte drei Rubel in der Tasche, aber wo fand er einen zweiten solchen Kameraden?
Kurz, es ließ sich leben in Chitrowka, und zwar besser als anderswo. Auch hier gab es, wie überall, eigene Regeln und Sitten, die nötig waren, damit die Menschen besser miteinander auskamen und wußten, was erlaubt war und was nicht.
Es gab viele Gesetze. Um alle zu kennen, mußte man lange in Chitrowka leben. Die meisten Regeln waren simpel und leicht zu verstehen, da kam man auch selber drauf: Bei Fremden schlag ruhig zu, doch die Kumpels laß in Ruh; mach du deins und laß dem Nachbarn seins. Andere dagegen kapierte man kaum, egal, wie sehr man drüber grübelte.
Wer zum Beispiel vor drei Uhr früh krähte wie ein Hahn – ob betrunken, aus Übermut oder bloß so, aus Dummheit –, der wurde zu Tode geprügelt. Warum und weshalb, das konnte Senka keiner erklären. Bestimmt hatte das mal einen Sinn gehabt, inzwischen aber wußten selbst die ältesten Opas nicht mehr, was für einen. Jedenfalls durfte man nachts nicht krähen.
Oder dies: Wenn ein Mamsellchen sich die Zähne mit Zahnpulver putzte und ein Kunde erwischte sie dabei, dann durfte er ihr mit vollem Recht sämtliche Zähne ausschlagen, und ihr Spitz mußte den Verlust hinnehmen. Putz dir die Zähne mit zerstoßner Kreide, wenn du schön sein willst, aber wehe, du nimmst Zahnpulver – das haben die Deutschen erfunden.
Die Gesetze von Chitrowka waren von zweierlei Art: Die aus früheren Zeiten, wie es seit alters her üblich war, und die neuen – die kamen von der Gemeinschaft, aus Notwendigkeit. Zum Beispiel, als die erste Pferdebahn auf dem Boulevard fuhr. Wer sollte da arbeiten – die Ausfeger, die die Taschen mit den Fingern ausfegten, oder die Abfetzer, die sie mit einer geschliffenen Münze aufschlitzten? Die Gemeinschaft beriet sich und entschied: Die Abfetzer nicht, denn mit der Pferdebahn fahren immer dieselben Leute, wo sollen die ständig neue Taschen hernehmen?
Die Gemeinschaft bestand aus »Alten«, von allen respektierten Banditen und Anführern, die von der Zwangsarbeit zurück oder aus Gebrechlichkeit ausgestiegen waren. Die Alten lösten jede noch so knifflige Frage, und wenn einer sich etwas gegen die Gemeinschaft hatte zuschulden kommen lassen, sprachen sie das Urteil über ihn.
Wer die anderen nicht in Ruhe leben ließ, wurde aus Chitrowka verjagt. Wer es gar zu arg trieb, konnte sogar zum Tode verurteilt werden. Manchmal wurde einer zur Strafe den Greifern ausgeliefert, aber nicht mit dem, womit er gegen die Regeln der Gemeinschaft verstoßen hatte – er mußte fremde Taten auf sich nehmen, von einem der respektierten Banditen. Das fanden alle gerecht. Wer Chitrowka besudelte, mußte dafür büßen. Auf diese Weise konnte er sich selbst reinwaschen und zugleich einem anderen helfen, und dafür wurde im Kittchen und in Sibirien ein gutes Wort für ihn eingelegt.
Wenn einer an die Polizei ausgeliefert wurde, dann nicht an irgendwen, sondern nur an Budotschnik, den ältesten Schutzmann von Chitrowka.
Dieser Budotschnik tat seit mehr als zwanzig Jahren Dienst in der Gegend, ohne ihn war Chitrowka nicht Chitrowka, das ganze Viertel ruhte auf ihm wie der Erdball auf dem Walfisch, denn Budotschnik, das war die Macht, und ganz ohne Macht kann das Volk nicht sein, sonst vergißt es sich, das Volk. Aber es braucht nicht viel Macht, nur ein bißchen, und es muß nach der Gerechtigkeit zugehen, nicht nach Regeln auf dem Papier, die sich wer weiß wer irgendwann mal ausgedacht hat – damit jedermann kapiert, warum man ihm die Fresse poliert.
Von Budotschnik sagte jeder: Er ist streng, aber gerecht; er kränkt niemanden unnütz. Jeder nannte ihn respektvoll Iwan Fedotowitsch, und mit Familiennamen hieß er Budnikow. Aber Senka wußte nicht recht, ob er seinen Spitznamen daher hatte oder deshalb, weil in früheren Zeiten alle Moskauer Schutzleute Budotschniki genannt wurden. Oder vielleicht daher, weil er in einer staatseigenen Bude am Rand des Chitrowka-Marktes wohnte. Wenn er nicht gerade seinen Rundgang machte, saß er zu jeder Zeit bei sich zu Hause, vorm offenen Fenster, schaute auf den Platz hinaus, las Bücher und Zeitungen und trank Tee aus seinem berühmten silbernen Samowar mit den Medaillen, der tausend Rubel gekostet hatte. Riegel gab es in der Hütte nicht, so war das. Wozu auch? Erstens, was nützte ein Riegel, wenn es rundherum nur so wimmelte von erfahrenen Einbrechern? Für die war jedes Schloß ein Klacks. Und zweitens – wer würde schon beim Budotschnik einsteigen, wer war so lebensmüde?
Der Schutzmann sah und hörte von seinem Fenster aus alles, und was er nicht sah und hörte, das flüsterten ihm treue Gesellen. Das war nicht schlimm, dafür strafte die Gemeinschaft keinen, denn Budotschnik gehörte zu Chitrowka. Hätte er sich an die geschriebenen Gesetze gehalten statt an die Regeln von Chitrowka, wäre er längst ermordet worden. Aber so – wenn er jemanden mitnahm aufs Revier, dann wußte jeder: Es ging nicht anders, er mußte seiner Obrigkeit ja auch was vorweisen. Aber Budotschnik brachte selten jemanden ins Kittchen – außer, wenns gar nicht zu umgehen war –, er versemmelte den Übeltäter lieber eigenhändig, und das nahm keiner krumm, im Gegenteil, man sagte noch freundlich danke schön. In all den Jahren gingen nur einmal zwei Spitzbuben mit einem Messer auf ihn los, und die waren nicht aus Chitrowka, sondern entlaufene Sträflinge. Er prügelte die beiden mit seinen gewaltigen Fäusten tot, wofür er vom Amtsvorsteher eine Medaille bekam, allseitigen Respekt und obendrein noch von der Gemeinschaft eine goldene Uhr für die Unannehmlichkeiten.
Als Senka sich ein wenig eingelebt hatte, begriff er: So schlimm war Chitrowka gar nicht. Außerdem lebte es sich hier lustiger und freier, und satter sowieso. Im Winter, wenn es kalt wurde, würde es ihm zwar bestimmt elend gehen, aber der Winter war noch weit weg.
Wie Senka Tod kennenlernte
Das geschah zehn Tage, nachdem Senka Tod zum erstenmal gesehen hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!