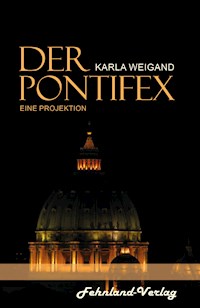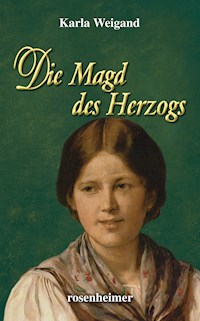
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Waise Anna wächst bei ihrem Oheim, dem Benediktinermönch Adalbert, auf der Burg Kelheim auf. Ihr Spielgefährte ist Ludwig, der drei Jahre jüngere Sohn des Herzogs. Zwischen den beiden Kindern entwickelt sich eine innige Freundschaft. Ludwig wird nach dem Tod seines Vaters 1183 Herzog. Unter seiner Herrschaft blüht Bayern auf. Die Standesunterschiede zwischen ihm und Anna werden unüberbrückbar. Doch um sich nicht von Ludwig trennen zu müssen, würde Anna alles tun …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
LESEPROBE zu
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2016
© 2016 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelbild: Franz von Defregger
Lektorat: Christine Weber, Dresden
Worum geht es im Buch?
Karla Weigand
Die Magd des Herzogs
Die Waise Anna wächst bei ihrem Oheim, dem Benediktinermönch Adalbert, auf der Burg Kelheim auf. Ihr Spielgefährte ist Ludwig, der drei Jahre jüngere Sohn des Herzogs. Zwischen den beiden Kindern entwickelt sich eine innige Freundschaft. Ludwig wird nach dem Tod seines Vaters 1183 Herzog. Unter seiner Herrschaft blüht Bayern auf. Die Standesunterschiede zwischen ihm und Anna werden unüberbrückbar. Doch um sich nicht von Ludwig trennen zu müssen, würde Anna alles tun …
Karla Weigand erzählt in diesem packenden Roman vom Aufstieg der Wittelsbacher unter Ludwig dem Kelheimer und berichtet aus der Zeit, in der die Raute den Weg in das Wappen von Bayern fand.
Inhalt
Prolog
Anno 1231
I
Achtundvierzig Jahre zuvor, auf der Burg zu Kelheim
II
Das jähe Ende unbeschwerter Kindertage
Ein neuer Freund
Ein ganz besonderer Fund
Der Ernst des Lebens
Anna kommt mit einem blauen Auge davon
Der Unfall
Alles halb so schlimm
III
Ende einer Kindheit
Ein Wiedersehen nach langer Zeit
Zurück in Kelheim
Ernste Konflikte
Zwist mit dem Grafen von Bogen
Eine neue Welt tut sich auf
Lebensweisheiten
Anna erweitert ihren Horizont
Unruhen im Lande
Machtkampf im Reich
Zukunftssorgen
Nachhilfe für das Glück
Ereignisreiche Zeiten
Jacob Graubart in Not
Fügungen des Lebens
IV
Pater Adalberts Tod
Bürgerkrieg in Bayern
Eine hinterhältige Entführung
Anna und Rachel erfahren Genugtuung
Glück im Unglück
Eine brisante Entdeckung
Anna und Georg
Pogrom in Kelheim
Der Ruf nach Landshut
Alles kommt ganz anders
V
Ein Attentat und seine Folgen
Enttäuschung über Ludwig
Wie ein Fähnlein im Wind
Spätes Glück
Ludwig wechselt wiederholt die Seiten
Ein neues Gesicht für Bayern
Anna in Gefahr
Man begegnet sich immer zweimal
Das Leben geht weiter
Die Trausnitz – ein Hort der Kultur
Ein wahrhaft kaiserliches Geschenk
Schock für Anna
Ein Wittelsbacher geht auf Kreuzzug
Ludwigs Scheitern
VI
Ein Ziehsohn für Ludwig
Sorge um Kajetan
Erneut wechselt der Herzog die Seiten
Verheerender Krieg in Bayern
Traurige Bilanz für Kelheim
Das große Wundenlecken
Gegenseitige Nähe und Annas Vorahnung
VII
15. September anno 1231
Annas Entscheidung
Epilog
Nachwort
Prolog
Anno 1231
Was für ein ansehnlicher Mann mein gnädiger Herr doch ist, dachte Anna Winterhalter und lächelte dem Sechsundfünfzigjährigen zu, als sich an diesem herrlichen Morgen des 15. September ihre Wege kreuzten.
Gemeinsam mit einer Schar Begleiter schickte sich Herzog Ludwig von Bayern an, die kurze Strecke durch das Donautor in Richtung Marktplatz per pedes zu bewältigen. In aller Regel bevorzugte er es zwar, zu reiten, doch heute war einer dieser Tage, da er dem Volk nahe sein und wieder einmal ein Bad in der Menge nehmen konnte.
Die Bürger der Stadt verehrten den klugen Wittelsbacher, der sich allerdings viel zu selten bei ihnen sehen ließ, seit er seine Residenz nach Landshut verlegt hatte. Der hohe Herr genoss es noch immer sehr, die Huldigungen all jener, denen er von Kindesbeinen an vertraut war, entgegenzunehmen – und zwar von Angesicht zu Angesicht.
Selbst nach fünf Jahrzehnten, die Anna den Bayernherrscher bereits kannte, ging der Ehefrau des herzoglichen Chronisten Kajetan Winterhalter das Herz auf beim Anblick des prächtig gekleideten Fürsten. Er war von mittelgroßer Statur, sein Bart inzwischen ergraut, das einst üppige Haupthaar ausgedünnter als noch vor Jahren. Stirn und Wangen waren von tiefen Furchen durchzogen. Doch in ihren Augen würde Ludwig I., der ganze drei Lenze weniger zählte als sie, immer derselbe hübsche, neugierige, etwas schüchterne Knabe bleiben, den sie einst kennen- und lieben gelernt hatte. Obschon der Standesunterschied gewaltiger nicht hätte sein können und sie beide aufgrund verschiedene Lebensläufe zurückblickten, hatten sie einander nie aus den Augen verloren.
Wie die vielen anderen Kelheimer Bürger sah Anna Winterhalter dem Herzog wohlwollend dabei zu, wie dieser erhobenen Hauptes die Donaubrücke betrat. Gleich würde er durchs Stadttor schreiten.
Wär ich eine Grafentochter gewesen, wer weiß, was aus uns beiden womöglich hätte werden können, überlegte die hoch gewachsene, auch im Alter von neunundfünfzig Jahren noch ansehnliche schlanke Frau, deren blaugrüne Augen so lebhaft wie eh und je funkelten – nur dass diese jetzt in einem Geflecht aus feinen Fältchen ruhten und die dicken Zöpfe unter der kleinen Haube nicht mehr weizenblond, sondern silbergrau hervorlugten.
Sie fasste den Entschluss, sich durch die gaffende Menge zu drängen, die sich im Nu vor dem Tor versammelt hatte, um dem Herzog zuzujubeln. Es war an der Zeit, ihn persönlich zu begrüßen, denn sie hatten sich eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Da die Kelheimer sie kannten und um ihre Sonderstellung bei Herzog Ludwig wussten, machte man Frau Anna, der Gattin des herzoglichen Schreibers, bereitwillig Platz.
Kurz bevor sie Ludwig erreicht hatte, schob sich mit einem Mal ein fremdartig gekleideter Hüne dem Herzog in den Weg: ein Mann um die dreißig mit nahezu olivfarbenem Hautton, der mit seinem weiten grünen, an den Knöcheln gerafften Beinkleid und dem weiß-goldenen Wams die Blicke aller auf sich zog. Um den Kopf hatte er ein gelbes Tuch geschlungen, auffällig waren seine flachen Schuhe aus feinem rotem Leder, mit aufgebogenen Spitzen.
Später danach befragt, vermochte Anna nicht zu sagen, woher der Mann so unvermittelt gekommen war … Vermutlich hatte er in einer Nische im Donautor gewartet. In ehrfurchtsvoller Haltung nach vorn geneigt, blieb er vor Ludwig stehen, hielt ihm ein gefaltetes Papier entgegen und schien dabei das Wort an den Herzog zu richten. Doch der Lärm der begeisterten Menge verhinderte, dass Anna irgendetwas von dem Gesprochenen verstehen konnte.
Sicher ein Bettelbrief, oder vielleicht eine kaiserliche Botschaft?
Friedrich II., der kaum jemals einen Fuß auf deutschen Boden setzte, sondern meist in sizilianischen Gefilden weilte und mittlerweile befremdliche Freundschaften mit heidnischen Sarazenen pflegte, war es durchaus zuzutrauen, einen so fremdartig anmutenden Boten nach Bayern zu schicken.
Anna wusste, dass es zuletzt große Spannungen zwischen dem Kaiser und dem Herzog gegeben hatte, die inzwischen allerdings beigelegt worden waren. Womöglich handelte es sich gar um ein Versöhnungsschreiben … Unwillkürlich musste sie schmunzeln, denn sie wusste, wie sehr Ludwig auf ein solches Zeichen gewartet hatte.
Dasselbe schienen im Übrigen auch die Leibwachen – allesamt mit Waffen ausstaffiert – zu vermuten, denn offenbar fühlte sich keiner vom ihnen bemüßigt, den Unbekannten gewaltsam zu vertreiben oder auf andere Weise von dem Adeligen fernzuhalten.
Anna beobachtete, wie Ludwig freudig überrascht den Brief entgegennahm, ihn lächelnd entfaltete und sich anschickte, ihn auf der Stelle zu lesen …
I
Achtundvierzig Jahre zuvor, auf der Burg zu Kelheim
Man schrieb den 10. Juli 1183. Frau Agnes, die junge Herzogin von Bayern, versammelte wie jeden Abend in der Kelheimer Schlosskapelle ihre Kinderschar um sich, um für die gesunde Rückkehr ihres Gemahls, Herzog Ottos I., zu beten.
Auch Anna, deren Oheim Pater Adalbert war, der Beichtvater des Herzogs und dessen Gemahlin, nahm ganz selbstverständlich an der Betstunde teil – wie überhaupt an so gut wie allen Unternehmungen der hochadeligen Familie.
Als die von Geburt an verwaiste Anna vor vier Jahren kurz nach ihrem achten Geburtstag auch noch die Großeltern verlor, die sich bisher um sie gekümmert hatten, hatte der Benediktinermönch aus dem nahen Kloster Weltenburg sie mit an den herzoglichen Hof genommen, um sich um das kleine elternlose Mädchen zu kümmern.
Im Jahre 1169 hatte Herzogin Agnes als damals Neunzehnjährige den Bayernherzog Otto geehelicht, der mit bereits fünfzig Jahren gut und gern ihr Vater hätte sein können. Ein stämmiger, mittelgroßer Mann mit hitzigem Gemüt war er, leicht aufbrausend und im Jähzorn häufig unberechenbar.
Er konnte aber sich auch sanft und nachgiebig geben; seine hübsche und kluge Gemahlin schätzte und verehrte er über alles. Das Verhältnis zu seinen Kindern war stets gut; und was die kleine Anna anbelangte, machte Herzog Otto niemals einen Unterschied zwischen ihr und den eigenen Töchtern.
Leider sah er seine Familie in der letzten Zeit viel zu selten. Da er seine Aufgaben als bayerischer Landesvater sehr ernst nahm, weilte er nicht mehr oft daheim in Kelheim. In den knapp drei Jahren, seit Kaiser Friedrich Barbarossa ihn zum Dank für geleistete Dienste mit dem Herzogtum Bayern belehnt hatte, war er ständig in seinem Reich unterwegs, um für Frieden zu sorgen und um Recht zu sprechen.
Herzog Otto unterstützte Barbarossa, wo er nur konnte. Einesteils aus dankbarer Ergebenheit – andererseits stand ihm das warnende Beispiel Heinrichs des Löwen vor Augen, dem der Kaiser die Herrschaft über Bayern kurzerhand entzog, nachdem der ihn schnöde im Stich gelassen und ihm die Gefolgschaft verweigert hatte.
Agnes, seine Gemahlin, ahnte längst, dass Otto sich in seinem Alter zu viel zumutete, und ihre Besorgnis um seine Gesundheit wuchs. Er hatte mit dem Kaiser das heilige Pfingstfest in Regensburg gefeiert und anschließend den »Rotbart« zum Friedensschluss mit den Städten der Lombardei nach Konstanz am Bodensee begleitet.
Es war Hochsommer und brütend heiß.
Der Herzog, der jetzt schon fünfundsechzig Jahre zählte, vertrug die Hitze nicht mehr gut; sein für gewöhnlich schon gerötetes Antlitz verfärbte sich bei hohen Temperaturen dunkelrot. Seine Umgebung befürchtete dann nicht ganz zu Unrecht einen Schlaganfall; worauf sein Leibknecht üblicherweise einen Medicus holen ließ, damit dieser den hohen Herrn zur Ader ließe, um Schlimmeres zu verhüten.
Agnes war unruhig. Immer wieder schweiften ihre Gedanken ab, was ihrem Sohn Ludwig nicht verborgen blieb.
»Woran denkt Ihr bloß, Frau Mutter?«, fragte der aufgeweckte Achtjährige, dessen um fünf Jahre älterer Bruder vor zwei Jahren an einer unbekannten Krankheit verstorben war und stattdessen ihn zum Erben und Nachfolger seines Vaters hatte werden lassen. »Macht Ihr Euch so große Sorgen um den Herzog? Ihr wisst doch, dass Vater diese Nacht noch in der Burg Pfullendorf verbringen will, um gleich morgen in aller Herrgottsfrühe aufzubrechen. Wenn alles gut geht, könnte er schon morgen Abend wieder bei uns sein!«
Ja, wenn alles gut ging!
Die Herzogin strich ihrem Sohn über den immer etwas wirren Blondschopf und seufzte. Sie sollte sich vor den arglos-unschuldigen Kindern nicht so gehen lassen. Mit aller Macht kämpfte sie gegen das dumpfe, bedrohliche Gefühl an, welches ein heraufziehendes Unheil anzukündigen schien.
Liebevoll ließ sie den Blick über die Kinderschar gleiten, die sie ihrem Gemahl bisher geschenkt hatte. Neunmal bereits hatte sie ihre »schwere Stunde« über sich ergehen lassen müssen und neun Kindern das Leben geschenkt. Einige hatte Gott der Herr allerdings schon wieder zu sich genommen: Otto, der älteste Sohn, starb als Elfjähriger. Auch zwei Mädchen hatte sie begraben müssen. Geblieben waren: Sophie, Agnes, Richardis, Ludwig, Heilika, Elisabeth und Mechthilde.
Lieber Herrgott, lass mir die restlichen wenigstens am Leben und schick mir meinen Gemahl heil nach Hause, betete die junge Herzogin im Stillen.
»Du hast recht, mein Sohn«, sagte sie sodann laut und entschlossen und schickte sich an, mit den Kindern die Kapelle zu verlassen. »Morgen kehrt euer Vater wieder heim!«
In ihrem innersten Herzen jedoch ahnte sie, dass sie den Gemahl nie mehr lebend sehen würde.
Am nächsten Tag ritt ein Bote in gestrecktem Galopp zur Burg Kelheim und überbrachte gegen Abend Frau Agnes die Trauerbotschaft, als diese sich gerade mit den älteren Kindern zur Tafel begeben wollte: »Euer Gemahl, edle Frau, Herzog Otto I. von Wittelsbach, ist in den frühen Morgenstunden des 11. Julius, im Jahre des Herrn 1183, in Pfullendorf einem Schlagfluss erlegen.«
Obwohl sie insgeheim damit gerechnet hatte, traf die Todesnachricht die Herzogin wie ein Blitzschlag. Stundenlang zog sie sich in ihr Gemach zurück; nur dem Beichtvater gewährte sie Zutritt. Ihre verstört draußen wartenden Kinder vernahmen nur das verzweifelte Weinen der Mutter, was auch sie in lautes Klagen ausbrechen ließ.
Endlich öffnete sich die Kammertür; Agnes erschien mit rot umränderten Augen, jedoch einigermaßen gefasst. Mit klaren Worten schilderte sie Ludwig, seinen älteren Geschwistern sowie auch Anna, wie der Herzog gestorben war, wobei sie ausdrücklich betonte, er habe vor seinem Ende noch die Tröstungen der heiligen Mutter Kirche empfangen. Gleichzeitig ermahnte sie die Weinenden, sich zu beruhigen und für die Seele des lieben Verblichenen zu beten.
»Folgt mir in die Kapelle, Kinder«, sagte sie leise.
Agnes von Loon, deren schlimmste Befürchtungen sich bewahrheitet hatten, war eine noch junge Witwe, die nun ihre vornehmste Aufgabe darin sah, zu verhindern, dass den Wittelsbachern nach dem Tod ihres Gemahls das Herzogtum Bayern gleich wieder verloren ging.
Bei Pater Adalbert, ihrem verständnisvollen Beichtvater, suchte und fand sie Rückendeckung und Unterstützung: »Neider und Missgünstige, die sich selbst Chancen auf die fette Beute ausrechneten, nachdem seinerzeit Heinrich der Löwe beim Kaiser in Missgunst geraten war, gab und gibt es immer noch viele, Frau Herzogin. Unternehmt alles, um die Herrschaft für Euren Sohn Ludwig zu retten!«
Glücklicherweise war Agnes nicht nur eine ansehnliche, sondern auch energische, politisch klug agierende und hochgebildete Frau. Ludwig zuliebe überwand sie den Schmerz und reiste sofort nach Ottos Bestattung in der Familiengruft zu Scheyern von Burg zu Burg zu den mächtigen bayerischen Geschlechtern, wo sie für ihren Zweitgeborenen mit guten Argumenten warb.
Eine Aufgabe, die nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern auch den Mut zu allerhand Zusagen und Versprechungen – und nicht unerhebliche finanzielle Zuwendungen! – verlangte. Uneigennützig gaben weder die Grafen von Andechs noch die von Bogen, gleich etlichen anderen, ihr Einverständnis dazu, die begehrte Herzogswürde bei den Wittelsbachern verbleiben zu lassen.
Frau Agnes hoffte, der Einsatz möge sich lohnen. Zusammen mit den weiteren Vormündern ihres Sohnes: Pfalzgraf Otto, Oheim Friedrich – ein Mönch – sowie Ludwigs Oheim Konrad – seit diesem Jahr Erzbischof von Mainz – würde sie die Munt und die Regentschaft bis zu Ludwigs Mündigkeit übernehmen.
»Mein größter Wunsch ist es, dir, meinem geliebten Sohn, einst ein geeintes Bayernland zu übergeben, dessen weltliche und geistliche Herren treu an deiner Seite stehen«, verkündete sie ihm im Kreise der gesamten Familie, unmittelbar nach ihrer Rückkehr von der strapaziösen Rundreise durchs Land.
Agnes’ Ältester machte Anstalten, ihr die Hand zu küssen, doch seine Mutter winkte ab.
»Ich erwarte mir jetzt keinen Dank von dir, Ludwig, sondern nur deinen aufrichtigen Willen, alles zu tun, wozu ausgesucht gute Männer dich künftig anleiten werden, auf dass du einst fähig sein mögest, deines Vaters würdiger Nachfolger zu sein!«
Anna, die atemlos gelauscht hatte, vergaß die feierlichen Worte der Herzogin Agnes niemals.
II
Das jähe Ende unbeschwerter Kindertage
Vorerst war der Knabe Ludwig aber noch ein Kind, lebhaft, von rascher Auffassungsgabe, neugierig, unternehmungslustig, tatendurstig – und freiheitsliebend. Was sich unter anderem auch darin zeigte, dass er seinen Lehrern und Aufsichtspersonen immer wieder liebend gern entwischte, um in umliegenden Wäldern herumzustreunen, auf Hügeln oder in Höhlen und Steinbrüchen, etwa in Jachenhausen bei Riedenburg, herumzuklettern.
Sein Vater hatte insgeheim großes Verständnis für Ludwigs Freiheitsdrang aufgebracht und es stets geschafft, den oft umtriebigen Sohn vor allzu strenger Bestrafung durch Lehrer, Erzieher und selbst dessen eigener Mutter zu bewahren.
Der kleine Knabe litt ungeheuer unter dem Verlust des bewunderten Vorbilds. Immer wenn der Schmerz ihn zu übermannen drohte, hielt ihn nichts mehr daheim. Sobald er fühlte, dass er es kaum noch verhindern konnte, scheinbar grundlos Tränen zu vergießen, musste er einfach der Enge entfliehen und all den Menschen, die die Burg Kelheim bevölkerten, aus dem Weg gehen.
Was ihm am allermeisten Freude bereitete, das Aufsuchen von Höhlen und Steinbrüchen nämlich, in denen man auch weißen Kalkstein zum Errichten von Häusern abbaute, war den Herzogskindern – und damit auch ihm – strengstens untersagt.
Ludwigs ältere Schwestern Sophie, Agnes und Richardis hielten sich selbstverständlich daran; »dergleichen« kam ihnen überhaupt nicht in den Sinn; die jüngeren Heilika, Elisabeth sowie die erst drei Jahre zählende Mechthilde kamen für derartige Abenteuer sowieso nicht in Frage. Was sollte der Unsinn, in nacktem Fels herumzuklettern? Man war doch keine Ziege!
Von seinen männlichen Spielgefährten, allesamt Edelknaben aus befreundeten Familien, die man zur Erziehung an den Herzogshof geschickt hatte, verspürte auch kein einziger das Verlangen, sich mit ihm auf die nicht immer leichten, weil abschüssigen und steilen Bergpfade zu begeben.
Das zu tun sei allein Aufgabe der Hörigen, denen es oblag, den wertvollen Kalkstein in mühevoller Arbeit zu brechen – oder der leibeigenen Jäger und deren Gehilfen, die das Wildbret für die herzogliche Tafel beschafften, behaupteten die Adelssprösslinge und rümpften die Nasen. Und gar die unheimlichen Höhlen aufzusuchen, in denen früher hässliche heidnische Urmenschen und riesige gefährliche Bären gehaust haben sollten, weigerten sie sich strikt.
»Alles Hosenscheißer«, maulte der zukünftige kleine Herzog. »Die Feiglinge haben keine Ahnung, was ihnen entgeht!« Von den meisten seiner edlen Spielkameraden hielt er sowieso nicht allzu viel, diese waren ihm zu hochnäsig, träge und fantasielos. »Wenn sie sich nicht trauen, ziehe ich eben allein los!«
Mutter Agnes, Pater Adalbert, die Lehrer oder einer der Kämpen, die Ludwig seit seinem siebten Lebensjahr im ritterlichen Kampfe ausbildeten, durften das allerdings nicht hören. Vor allem die Herzogin wäre vor Angst gestorben, wenn sie fürchtete, nach dem ältesten Sohn und dem Gemahl nun auch noch ihren zweiten Sohn zu verlieren.
Doch trotz gegenteiliger Beteuerung so ganz mutterseelenallein durch die wilde Gegend zu streifen, das wollte Ludwig eigentlich auch nicht. Er wünschte sich sehnlichst, jemanden bei sich zu haben, mit dem er die Abenteuer gemeinsam erleben, den angenehmen Kitzel bei aufregenden Entdeckungen teilen konnte.
Wie so oft vermisste er schmerzlich seinen älteren Bruder Otto, der ihm, was Entdeckergeist und Wagemut anbelangte, sehr ähnlich gewesen war.
Ein neuer Freund
In diesen Tagen sollte sich die Anwesenheit eines weiteren Kindes am Hofe als überraschend hilfreich erweisen. Bisher hatte der kleine Abenteurer das Geschöpf allerdings nicht als besonders beachtenswert empfunden, weilte es doch fast so lange in der Burg, wie seine Erinnerung zurückreichte, gehörte also gewissermaßen zum Inventar, hielt sich dauernd bei seinen Schwestern auf und wies zu allem Überfluss noch von Geburt an einen gewaltigen Makel auf: Es handelte sich um ein Mädchen!
Anna, das Waisenkind, lebte zusammen mit einem Vormund zurückgezogen auf der Burg, während ihr Onkel die geachtete Stellung des herzoglichen Seelsorgers und geistlichen Beraters einnahm. Der Abt des Weltenburger Klosters hatte Pater Adalbert seinerzeit von dessen mönchischen Aufgaben und Pflichten entbunden, da Herzog Otto und Herzogin Agnes den vertrauten Beichtvater fortwährend in unmittelbarer Nähe wissen wollten.
Nicht lange nach dem Ableben seines Vaters fragte Ludwig eines Tages Anna, ob sie vielleicht Lust hätte, mit ihm »etwas Verbotenes« zu wagen. Weil er insgeheim zwar mit einer Ablehnung rechnete, sich vor einer Zurückweisung jedoch scheute, verpackte der Achtjährige seine Anfrage in eine provokante Behauptung, nachdem es ihm gelungen war, sie allein auf einem der Flure in der Burg anzutreffen:
»Ich wette mit dir, Anna«, behauptete Ludwig im Brustton der Überzeugung, »du würdest dich niemals getrauen, mich bei einem Abenteuer zu begleiten, das gefährlich ausgehen könnte!«
»Warum würdest du darauf wetten?«, wollte die um drei Jahre Ältere wissen. Insgeheim brannte sie längst darauf, die Freundschaft des künftigen Herzogs zu gewinnen. Das ewige Ringelreihen und Spielen mit Püppchen, womit sie sich gemeinsam mit Ludwigs Schwestern täglich die Zeit vertrieb, langweilte sie mittlerweile unsäglich – ebenso wie die Pflichten, ermüdende Handarbeiten auszuführen oder Bibelsprüche auswendig zu lernen.
Ihr Oheim pflegte des Öfteren zu sagen, der Herrgott müsse sich bei ihr geirrt haben, dass er sie als Mädchen auf die Welt habe kommen lassen. In Wahrheit ähnele sie im Wesen eher einem Knaben.
»Du hast offenbar keine Ahnung, wie sehr ich Abenteuer mag und wie mutig ich bin! Je gefährlicher etwas ist, desto geheimnisvoller klingt es für mich. Was schwebt dir denn so vor, Ludwig?«, fragte Anna den herzoglichen Sprössling; die hellen, blaugrünen Augen blitzten aufgeregt vor Unternehmungslust.
Der um einen Kopf kleinere Bub starrte zu dem mageren, hoch aufgeschossenen Mägdlein hinauf, das aber dennoch so kräftig wie ein Junge wirkte. Ein wenig zögerlich rückte er mit seinem Vorhaben heraus, wobei Anna ihm aufmerksam zuhörte. Am Ende besiegelten beide mit einem feierlichen Handschlag den Willen zu einer »geheimen und gefährlichen Unternehmung«, die bereits am kommenden Tag stattfinden sollte. Ludwig musste sich nur noch etwas einfallen lassen, um Pater Adalbert abzuwimmeln, der ihn jeden Vormittag unter anderem mit lateinischen Vokabeln drangsalierte.
»Ich werde so tun, als wär ich krank«, kündigte er an. »Halsweh erscheint mir eine famose Idee! Da hat dein Oheim gewiss Angst, sich anzustecken, und lässt mich mit Cäsar und seinem faden De bello Gallico zufrieden.«
»Aber Frau Elisabeth wird nach dir schauen, und dann fliegt deine Schummelei auf«, gab Anna vorausschauend zu bedenken. Die herzogliche Kinderfrau versorgte in der Regel die nicht allzu schwer Erkrankten in der Burg – auch die ihrer erlauchten Herrschaft. Nur wenn etwas Ernstes zu befürchten stand, bemühte man den Medicus. Doch Ludwig winkte lässig ab.
»Keine Gefahr«, behauptete er. »Meine kleine Schwester Mechthilde jammert seit Tagen wegen Bauchschmerzen; da hat Frau Elisabeth anderes zu tun, als sich um meinen kratzenden Hals zu sorgen.«
Der Trick gelang, und von da an kam es ziemlich häufig vor, dass Ludwig und Anna sich davonstahlen, um in den Altwassern von Donau und Altmühl mit ihren Angelruten nach Weißfischen und Karpfen zu angeln, herumzustreifen in den umliegenden Hügeln und hin und wieder interessante Entdeckungen zu machen. Meist hatten die Kinder auch Pfeil und Bogen dabei und schossen auf Wildtauben und Kaninchen, fingen mit Keschern bunte Schmetterlinge oder sperrten Grashüpfer und Marienkäfer in Medizingläschen, die Ludwig zuvor dem herzoglichen Medicus stibitzt hatte.
So gingen etwa drei Jahre ins Land.
Anlässlich eines Ausflugs altmühlaufwärts, in Richtung der Ansiedlung Prunn, gelangten die Kinder eines Tages auf einem Höhenweg zu einem großen Loch in einer ziemlich steilen Wand. Der Zugang erfolgte über ein schmales Felsenband; aber da beide schwindelfrei waren, war das für sie nichts Besonderes, obwohl es auf einer Seite senkrecht in die Tiefe ging – und das über gut fünfzehn Mannslängen.
»Von unten, vom Tal aus, kann man diese Höhle gar nicht erkennen«, staunte Anna, als sie endlich vor dem fünf Ellen hohen, halb überwucherten Eingang standen. »Den unteren Weg haben wir doch schon ein paar Mal genommen, ohne dass uns die Öffnung im Berg aufgefallen wäre!«
»Den Einheimischen ist sie sicher bekannt«, vermutete Ludwig. »Ich denke, die abergläubischen Fischer und Bauern werden sich wahre Schauermärchen darüber erzählen!«
»Von wilden Bären und riesengroßen Wölfen, die bloß darauf warten, Kinder zu fangen und aufzufressen«, kicherte das Mädchen, dessen Zöpfe sich wie üblich beim Schlüpfen durch Gebüsch und Geäst gelöst hatten, sodass ihr die blonden Strähnen wirr ins Gesicht hingen. Wie oft hatten sich Annas Haare nicht schon in den Zweigen verheddert, genau wie der lange Rock!
»Setz doch eine Mütze auf«, empfahl ihr kleiner Begleiter – und das nicht zum ersten Mal. »Dann läufst du nicht Gefahr, irgendwann wie Absalom, der Königssohn aus der Bibel, mit deiner Mähne an einem Ast hängen zu bleiben!«
Aber die Kleine hatte auch ihre Prinzipien. Und eines davon lautete: Keine Kopfbedeckung tragen – außer in der Kirche. Mit vierzehn Jahren gehörte es sich leider so, bei Andacht und Messe eine Haube zu tragen. »Ich mag keine Mütze«, knurrte sie bockig.
Ludwig musste lachen und zog an einem der geflochtenen Zöpfe. Spielerisch wollte sie nach ihm schlagen, aber das gerade mal zwei Kinderellen breite Felsenband vor der Höhle bot zu wenig Platz und war für eine kindische Balgerei höchst ungeeignet. Um der Verfolgerin zu entkommen, schlüpfte er in die Höhle – und Anna drängte ihm hinterher.
Nach einigen Metern blieben die Kinder wie gebannt stehen. Sie brachten kein Wort heraus, standen nur starr und staunten andächtig.
»Das ist ja hier wie in einer großen Kirche«, wisperte Anna nach einer Weile. »Fast wie im Dom zu Regensburg!« Vor Aufregung zwirbelte sie einen Schürzenzipfel und kaute vor Aufregung darauf herum.
Ludwig hatte längst einen Daumen im Mund und wusste zunächst gar nicht, was er sagen sollte. »Eigentlich ist es sehr schön hier«, murmelte er schließlich ehrfürchtig und deutete zu der kuppelartigen Felsendecke hinauf, die tatsächlich ein wenig an das Gewölbe eines Gotteshauses erinnerte. Nur die herrliche Bemalung fehlte …
»Und wirklich finster ist es auch nicht«, stellte Anna fest. »Irgendwo oben muss ein Loch sein, durch das die Sonne scheinen kann.«
Vorsichtig wagten sich beide ein paar Schritte weiter in die Höhle hinein. Der Felsboden unmittelbar hinter dem Höhleneingang war ziemlich glatt und stieg ein wenig an.
»Schau«, Ludwig zupfte an Annas Gewandärmel. »Da vorn ist ein großer kohlrabenschwarzer Fleck am Boden!« Neugierig traten sie näher. »Das schaut grad aus wie Brandspuren«, rief er. »Ob da vielleicht einst Menschen gewohnt haben, die ein Feuer angefacht haben?«
»Kann schon sein.« Anna nickte. »Oben drüber ist eine Öffnung im Felsen, so ähnlich wie ein Kamin, durch den der Rauch hat abziehen können, damit sie hier drin nicht erstickt sind.«
»Wenn die Leute ein Feuer angezündet haben, konnten sie das Fleisch der erlegten Tiere braten oder kochen«, mutmaßte ihr kleiner Freund.
»Und warm hatten sie es im Winter in der Höhle auch. Gar nicht schlecht«, überlegte das Mädchen.
»Lass uns weitersuchen, Annele. Vielleicht finden wir wieder einen alten Tierschädel!«, regte Ludwig an, doch die Begleiterin hatte keine Lust dazu.
Schon häufiger hatten sie von ihren Exkursionen verschiedene Knochen mitgebracht, und das Mädchen fand die in einer Nische im Pferdestall der Burg aufgehäuften Schädel und Geweihe, all die Gebeine von Rindern, Hirschen und Ziegen allmählich gruselig. Zum Glück drückte Thomas, der Aufseher der Knechte, bisher ein Auge zu.
Pater Adalbert hatte sie allerdings eindringlich davor gewarnt, jemals einen menschlichen Schädel anzufassen – falls sie denn unglücklicherweise auf einen solchen stoßen sollten. Demnach schien der erfahrene Benediktinermönch um den Ungehorsam des künftigen Bayernherrschers sehr wohl zu wissen …
Der Felsenkamin oberhalb der alten Feuerstelle war nicht der einzige Lichtschacht; die Kinder entdeckten noch zwei weitere. Jetzt wussten sie, warum es in der riesigen Wohnhöhle nicht so dunkel war, wie man eigentlich erwarten musste.
Ungefähr in der Mitte der Höhle stand ein viereckiger, behauener Klotz aus Kalkstein, der ihnen bis zur Brust reichte. Sie hatten keine Ahnung, wozu der einst gedient haben mochte – vielleicht als eine Art Tisch.
Aus Jux fingen Ludwig und Anna an, rundherum Fangen zu spielen. Durch die ausgelöste Erschütterung vom Rennen und den Lärm, den sie mit ihrem Gekreische und Stampfen verursachten, schreckten sie allerdings eine Heerschar von Fledermäusen auf.
Die Tiere waren ihnen bisher noch gar nicht aufgefallen. Sie hingen im hinteren, finsteren Teil der Höhle kopfüber von der Felsendecke herab – ähnlich wie nasse Scheuerlappen, die eine nachlässige Magd zum Trocknen aufgehängt hat. Mit lautem protestierendem Fiepen und gewaltigem Rauschen ihrer lederartigen Hautflügel schwirrten die für gewöhnlich tagsüber schlafenden Tiere durch die Kuppel der Höhle.
Es mussten viele Hunderte, womöglich Tausende sein! Die Kinder erschreckten sich furchtbar. Laut schreiend rannten Ludwig und Anna in Richtung Ausgang, aber leider suchten die aufgeschreckten Fledermäuse denselben Weg ins Freie; nahezu blind vor Panik stolperten die Kinder in der riesigen Grotte umher.
Anna hatte schreckliche Angst, dass die dicht über ihren Köpfen flatternden und kreischenden Tiere sich in ihren langen Haaren verfangen könnten, und schlug wie wild um sich. Dabei stolperte sie über mehrere Kalksteinbrocken und -platten, die verstreut auf dem Boden herumlagen. Prompt fiel sie der Länge nach hin und konnte erst einmal nicht aufstehen. Gleich darauf plumpste nämlich Ludwig auf sie drauf und blieb in regelrechter Schockstarre auf ihr liegen.
Nach einer Weile fand zum Glück der Fledermausspuk allmählich ein Ende. Die Tiere beruhigten sich wieder und nahmen erneut, mit dem Kopf nach unten hängend, ihre Schlafplätze an der Felsendecke ein. Nach einigen Minuten waren auch jene, welche in Panik nach draußen ins Tageslicht geflüchtet waren, wieder da. Das Geschrei und Gefiepe hörte auf, und es kehrte abermals Ruhe ein.
»He, Ludwig«, protestierte Anna leise, »du liegst immer noch auf mir!« Worauf sich der Knabe, verlegen eine Entschuldigung murmelnd, zurückzog. Hatte er sich doch aus lauter Angst seiner kleinen Freundin an den Hals geworfen …
Die Kinder hatten nur noch den einen Wunsch: nichts wie raus aus dieser Grotte, die alles andere als unbewohnt war! Fledermäuse fanden beide hässlich und in einer solch unvorstellbaren Menge wie hier ausgesprochen ekelhaft. Erst jetzt fiel ihnen auch der widerliche Geruch von deren seit Jahren und womöglich Jahrzehnten aufgehäuften Hinterlassenschaften auf.
»Warum haben wir bloß nicht gleich den Haufen Dreck der Viecher gesehen?« Mit angeekelter Miene rappelte sich Ludwig auf. Fledermauskot sah allerdings ganz anders aus als der allseits bekannte Schafs- und Ziegenmist oder die Exkremente von Vögeln. »Komm, lass uns schnell verschwinden, Annele!«
Ein ganz besonderer Fund
Ludwig machte ein paar Schritte in Richtung Höhlenausgang, ehe er bemerkte, dass seine Begleiterin ihm gar nicht folgte. Er drehte sich nach Anna um. »Was ist denn?«, fragte er ängstlich.
Die Freundin stand da und deutete auf etwas, was sie beide vorher noch gar nicht wahrgenommen hatten: Auf dem felsigen Untergrund lagen mehrere Gesteinsbrocken, die sich bei ihrem Herumgehopse von der Wand oder von weit oben an der Decke gelöst haben mussten. Daher auch der infernalische Krach vorhin, der wiederum die Fledermäuse unsanft aufgeweckt haben musste.
»Was ist denn so wichtig an den Steinbrocken?« Beinah musste Ludwig lachen, als er Anna so perplex dastehen sah, immer noch mit dem Finger auf einen der Kalkbrocken deutend.
»So schau doch, Ludwig!«, forderte das Mädchen ihn auf.
Ihre Stimme klang drängend, also tat er ihr den Gefallen. Dass »Weiber« manchmal komisch sein konnten, war ihm natürlich als einziger Junge unter einer Schar von Schwestern nichts Neues. Seine Anna bildete da anscheinend keine Ausnahme …
Gehorsam beugte er sich zu dem Gebilde nieder, das sich da offenbar durch den Sturz aus etwa zehn Schrittlängen Höhe aus dem Kalkstein gelöst hatte – und schrie unwillkürlich auf. Gleich darauf schlug er sich die Hände vor den Mund: Alles, bloß nicht erneut die widerlichen Viecher an der Decke aufscheuchen! »Herrje! Was ist das denn?«, fragte er dann mit mühsam unterdrückter Lautstärke.
Die Kinder kauerten sich hin, um den Überraschungsfund genauer zu inspizieren. Eine der heruntergefallenen Kalksteinplatten war auseinandergeplatzt und lag in zwei mehr oder weniger beschädigten Hälften am Boden. Dabei war der darin verborgene Inhalt freigelegt worden – Knochen eines höchst merkwürdigen Wesens, in eine der Kalkplatten eingebettet …
»Was mag das denn für ein grässliches Vieh gewesen sein?«
Mit Mühe hob Anna die etwa eine halbe Handspanne dicke und eine halbe Elle im Quadrat messende Platte mit abgeschlagenen Ecken an. Auf dieser waren gebleichte Knochen festgebacken, anscheinend noch in derselben Anordnung, wie die Natur sie einst vorgegeben hatte.
»Schau nur, in der anderen Hälfte kann man die Abdrücke des Skeletts sehen, wie in einem Model für Lebkuchen!«
Sogar in der dämmrigen Höhle konnten die beiden einen Kopf mit riesigen Augenhöhlen und einem großen Schnabel erkennen, und zwei kräftige Beine mit langen Krallen. Zweifellos ein interessanter Fund – aber dennoch mehr als gruselig.
»Lass uns das Ding mit den Gebeinen nach draußen tragen, dann können wir es uns genauer anschauen«, schlug Ludwig leise vor.
Als Größere und Stärkere übernahm Anna das; hatte sie doch das sonderbare Teil auch entdeckt. »Schau her«, rief sie und lachte, als sie gemeinsam die Grotte samt ihren lärmempfindlichen Bewohnern verlassen hatten. Jetzt, im hellen Sonnenschein, machte ihnen das versteinerte Gebein überhaupt keine Angst mehr.
»Ach, das ist ja bloß ein Vogel gewesen!«, rief der Herzogssohn aus. »Nichts Besonderes! Lass ihn liegen, Annele!« Seiner Stimme war die Enttäuschung anzuhören, da der Fund ihm nun doch zu unspektakulär zu sein schien.
Doch das Mädchen – als stolze Entdeckerin – gab nicht so leicht auf. »Von wegen ›liegen lassen‹! Die Kalkplatte nehme ich mit und zeig sie meinem Oheim. Vielleicht war das ja einst ein ganz besonderer Vogel, und der Fund ist wertvoll?«
»Oh, ja, ganz bestimmt … Damit wirst du reicher werden als der Kaiser, haha. Aber wenn du dich mit dem sperrigen Ding abschleppen willst – bitte sehr, nur zu!«
Auf dem ziemlich weiten Heimweg nach Kelheim machte er sich erneut lustig über die Freundin, die jedoch stur und tapfer den scheinbar immer schwerer werdenden Kalkbrocken weiterwuchtete, obwohl die Kraft in ihren Armen allmählich erlahmte.
Weil er Anna aber wirklich mochte, half Ludwig ihr bald, indem er ihr die Platte abnahm. Bald verging ihm allerdings das Lachen; das Ding hatte ein ordentliches Gewicht. Zum Glück hatten sie die Deckplatte mit den Abdrücken in der Höhle liegen lassen.
Als sie schon glaubten, nicht mehr weiterzukönnen, kam zum Glück ein Fuhrwerk des Weges. Der Bauer zeigte Mitleid mit den Kindern und ließ sie bis Kelheim aufsitzen.
Als sie freudestrahlend Pater Adalbert aufsuchten, der gerade zu einer Strafpredigt ansetzte, weil der Herzogssohn erneut den Unterricht geschwänzt hatte, verkniff sich der Knabe sofort das Grinsen.
Der Benediktiner verhielt sich nämlich sehr befremdlich, kaum dass er einen Blick auf »das Ding« geworfen hatte. Lange schwieg er. Weder Anna noch Ludwig wagten es, auch nur einen Ton zu äußern.
»Woher stammt dieses Teufelszeug?«, erkundigte sich schließlich der herzogliche Beichtvater mit heiserer Stimme, wischte sich den Schweiß von der Stirn und bekreuzigte sich hastig – und das gleich mehrere Male.
»Aus einer riesengroßen Felsenhöhle mit ganz vielen ekelhaften Fledermäusen, zwischen hier und der Ansiedlung Prunn gelegen«, gab Anna zur Antwort. »Aber was habt Ihr bloß, Oheim? Warum seid Ihr so blass geworden und regt Euch so schrecklich auf?«, wagte das Mädchen zu fragen.
Der Mönch ermannte sich und holte tief Atem. »Wisst ihr überhaupt, was ihr da angeschleppt habt, ihr zwei Unglücksraben?« Der Pater stellte die Frage mit todernster Miene, erntete bei den Kindern jedoch nur ratloses Kopfschütteln.
»Irgendeinen alten Vogel?«, mutmaßte Anna schließlich.
»Ha! Einen Vogel! Herr Jesus Christus, erbarme dich unser!« Vor Entsetzen schüttelte es den Mönch regelrecht. Wieder schlug er das Kreuzzeichen.
»Seht her, aber berührt das Ding auf keinen Fall! Kann dieses Wesen ein Vogel gewesen sein, mit diesem langen knöchernen Schwanz? Der erinnert doch eher an eine Schlange oder an das Krokodil, das Arbeiter neulich aus dem Uferschlamm der Donau ausgegraben haben. Betrachtet nur einmal den Kopf des Untiers! Kennt ihr vielleicht einen Vogel, der so viele spitze Zähne hat? Und was ist das da oben auf der Stirn? Wonach sieht das aus für euch?«
Anna sah überhaupt nichts, aber Ludwig meinte nach einer Weile stummen Starrens vorsichtig: »Sind das womöglich Hörner, Pater?«
Ehe seine kleine Begleiterin kichernd protestieren konnte, bestätigte der Oheim die in ihren Ohren absurd klingende Vermutung. Sie hatte das Gebilde nämlich für zwei kleine verrutschte Knochenstückchen von einem anderen Teil des Vogelskeletts gehalten …
»Jawohl, meine lieben Kinder, das hier sind Hörner! Was ihr mir hier angeschleppt habt, ist nichts anderes als ein Abbild des Teufels!«
Oh! Das war in der Tat grauenhaft. Anna fühlte sich schuldig; auf einmal plagte sie ein fürchterlich schlechtes Gewissen. »Ludwig trifft keine Schuld!«, war das Einzige, was ihr dazu einfiel. »Er wollte, dass ich das Ding in der Höhle liegen lasse. Aber ich fand es so aufregend und –«
»Ja, meine Tochter, ›aufregend‹ ist das richtige Wort! Da hast du etwas ans Tageslicht gezerrt, das besser im Stein begraben geblieben wäre. Vor langer Zeit muss ein Priester den höllischen Unhold, den du wieder an die Sonne befördert hast, in den Kalkbrocken gebannt haben.«
»Daran war ich genauso beteiligt, Pater«, stellte Ludwig tapfer klar. »Wenn wir beide nicht in der Höhle herumgesprungen wären, dann hätte sich die Platte gar nicht von der Decke gelöst!«
»Das ist jetzt einerlei, Kinder. Das Stück zurückzubringen, nützt jedenfalls nichts. Der Teufel muss für immer unschädlich gemacht werden! Da werde ich nachdenken müssen, um eine Lösung zu finden. Um ganz sicherzugehen, dass ich mich nicht irre, werde ich es aber vorher meinem Abt im Kloster Weltenburg zeigen und ihn fragen, was er davon hält. Euch aber befehle ich aufs Allerstrengste, keiner Menschenseele jemals davon zu erzählen! Bei Ungehorsam würde Gott, der Herr, euch aufs Härteste bestrafen. Habt ihr mich verstanden? So schwört es mir bei eurem jungen Leben!«
Eingeschüchtert von Adalberts ernstem Tonfall, taten die beiden ohne jede Widerrede, wie ihnen geheißen. Auch noch am folgenden Tag waren sie völlig niedergeschmettert, als sie sich ausmalten, was der Satan, den sie dummerweise aus der Höhle befreit hatten, alles an Bösartigkeiten vollführen konnte.
»Womöglich lässt es der Teufel im Sommer schneien«, stellte Ludwig eine Vermutung an.
»Ha«, machte Anna. »Das wär ja noch gar nichts! Der Teufel hat große Macht und kann alle Menschen im Land krank machen und sterben lassen!«
»Oh, guter Gott! Auch meine Mutter und meine Schwestern, und dich auch, Annele?« Das erschien dem Knaben am schlimmsten. Dann fiel ihm noch etwas ganz anderes ein. »Und wenn der Teufel alle Leute im Land Bayern tötet, habe ich niemanden mehr, über den ich später mal regieren kann! Hältst du das für möglich?«
»Keine Ahnung, Ludwig, aber ich befürchte es schon«, gab Anna kleinlaut zur Antwort.
Wie froh war der Junge, dass Herzogin Agnes sich derzeit auf Reisen befand, um wieder einmal bei den Großen im Land für ihn, den künftigen Herzog, »gut Wetter zu machen«. So war seine Frau Mama zumindest aus der direkten Schusslinie, falls der Teufel Anstalten machen sollte, die Bevölkerung Bayerns auszurotten.
»Meine Mutter würde auch gleich merken, dass ich fürchterliche Angst habe«, gab Ludwig ehrlich zu. »Sie würde ganz bestimmt wissen wollen, warum. Und ich müsste ihr alles beichten. Das macht sie immer. Wenn ich ausweichende Antworten gebe, bohrt sie so lange weiter, bis ich es nicht mehr für mich behalten kann. So war es bisher jedenfalls immer!«
»Um Gottes willen«, jammerte Anna. »Du hast meinem Oheim geschworen, niemandem etwas zu verraten, Ludwig! Willst du etwa eidbrüchig werden?«
»Natürlich nicht, Annele. Drum bin ich ja so erleichtert, dass im Augenblick keiner da ist, der mich bedrängt.«
»Wenn wir nur schon etwas aus dem Kloster erfahren würden!« Ganz hatte die Ungeduldige die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Oheim sich womöglich doch im Irrtum befand und der Fund sich als ganz harmlos erwies. Sie bat ihren kleinen Freund, nur ja ganz fest die Daumen zu drücken.
Diese Hoffnung zerschlug sich leider nach wenigen Tagen. Pater Adalbert ließ Ludwig und Anna zu sich in sein Studierzimmer auf der Burg rufen. Sobald die Kinder seine todernste, ja, verzweifelte Miene sahen, wussten sie schon Bescheid.
»Die Versteinerung in der Kalksteinplatte hat bei meinem Abt und den wenigen gelehrten Klosterbrüdern, die er einweihte, helles Entsetzen ausgelöst«, berichtete Adalbert mit bedeutungsschwerer Miene. »›Das muss der Teufel sein!‹, hat Abt Eustachius ausgerufen, worauf meine Mitbrüder entsetzt aus seiner Zelle geflohen sind. Der Abt hat mich verpflichtet, das grausige Ding sicher und vor allem dauerhaft zu verwahren, damit es keinen Schaden anzurichten vermag.« Mit angeekelter Miene deutete der Pater auf das eingewickelte Paket, das er auf seiner Truhe abgelegt hatte. »Sobald ich es an einen sicheren Ort gebracht habe, werde ich mich, diesen Raum – und euch beide dazu – mit vielen Gebeten und noch mehr Weihwasser reinigen müssen, um uns alle vor teuflischem Schaden zu bewahren!«
In den folgenden Nächten träumten die Kinder von dem satanischen Wesen, das sie in Gestalt eines scheinbar harmlosen, etwa rabengroßen Vogels zwar zu täuschen vermocht hatte, aber dank der Wachsamkeit Pater Adalberts nun unschädlich gemacht werden würde – mit Unmengen an geweihtem Wasser.
Einen Tag nach dem »kleinen Exorzismus«, den der Benediktiner an ihnen hatte vornehmen müssen, flüsterte Anna ihrem Spielgefährten beim Angeln an der Altmühl zu: »Ich weiß, wo mein Oheim den Teufel in der Nacht versteckt hat, Ludwig! Er hat gar nicht gemerkt, dass ich ihm heimlich gefolgt bin. Aber ich war neugierig und wollte es unbedingt wissen! Wenn du mir deine Angel leihst, die um vieles besser ist als meine, verrate ich dir den Ort, wo das Satansding verborgen ruht.«
»Um Himmels willen, nein!«, schrie der elfjährige Knabe entsetzt. »Lass mich bloß damit zufrieden, Anna! Ich will gar nicht wissen, wo der Pater den Teufel hingebracht hat. Hoffentlich hat er ihn auf den Mond geschossen – oder meinetwegen sonstwohin, Hauptsache weit genug weg und wohl verwahrt, damit das Ding uns und auch keinem anderen Schaden zufügen kann!« Um die Worte zu unterstreichen, bekreuzigte sich der zukünftige Landesherr. »Meine Angel kannst du auch so haben. Und nicht bloß geliehen – ich schenk sie dir! Hier, bitte schön! Und noch was: Sei so gut und versprich mir, Annele, nie mehr den Teufel aus dieser abscheulichen Fledermaushöhle zu erwähnen!«
Anna beschwor es feierlich.
Die beiden schlüpften auch nie mehr in irgendwelche obskuren Kalklöcher hinein. In Zukunft wollten sie nur noch mit Pfeilen auf Tauben schießen, mit bloßen Händen Krebse in den Uferhöhlungen der Altmühl fangen, nach Weißfischen und Karpfen angeln und schillernde Eidechsen beobachten. Auf Annas Bitten hin ließen sie sogar die Jagd auf Schmetterlinge bleiben.
»Viel zu viele der schönen bunten Gaukler haben wir schon mit Nadeln auf Brettchen aufgespießt! Und wozu? Auf den Wiesen tanzend sind sie tausendmal schöner!«
Das leuchtete auch Ludwig ein.
Der Ernst des Lebens
Als Frau Agnes zurück in Kelheim war, versammelte sie noch am gleichen Abend Familie und Gesinde in der Halle um sich. Die Herzoginwitwe hatte Wichtiges zu verkünden. »Du kannst Gott danken, mein Sohn, dass es mir dieses Mal gelungen ist, unsere sämtlichen Gegner im Land endgültig ruhigzustellen. Wie es aussieht, wirst du nach deiner Großjährigkeit ohne Schwierigkeiten die Regierung Bayerns übernehmen können. Freilich hat es mich einiges gekostet – und beileibe nicht nur gute Worte!«
Anna beobachtete gerührt, wie Ludwig vor seiner Mutter auf die Knie ging – genauso, wie es ihn seine Magister gelehrt hatten: wie ein Ritter vor seiner angebeteten Dame. Inzwischen war einiges an »höfischer Lebensart« von Frankreich auch bis nach Bayern vorgedrungen …
»Gottes Segen für Euch, Madame!«
Frau Agnes gab ihrem Sohn ein Zeichen, sich zu erheben, und wartete mit weiteren Neuerungen auf. »Es ist mein Wille, dass mein Sohn Ludwig, der designierte Herzog von Bayern, ab sofort nicht mehr geduzt wird! Seine Ausbilder und Lehrer, selbst die geistlichen, sowie sämtliche Angehörige der Dienerschaft – auch die Altgedienten – haben sich der respektvollen Anrede ›Ihr‹ und ›Euer Gnaden‹ oder ›Euer Durchlaucht‹ zu bedienen. Das soll selbst für mich, seine Mutter, gelten, sowie selbstverständlich auch für seine Geschwister und Freunde!«
Ein paar der Grafensöhne, die sich derzeit auf der Burg aufhielten, grinsten dümmlich, und einige von Ludwigs Schwestern verzogen die kindlichen Gesichter zu einem spöttischen Grinsen. Als sie jedoch der gestrenge Blick der Herzogin traf, änderten sie auf der Stelle den amüsierten Ausdruck. Vor allem Sophie und Agnes gelang es meisterhaft, vollkommen ungerührt vor sich hinzustarren.
Anna erschrak. Bedeutete das jetzt das Ende ihrer Freundschaft, überlegte sie betroffen. Diese Aussicht stimmte sie überaus traurig, hatte sie in Ludwig doch einen treuen Kameraden gefunden. Als sie bemerkte, wie ihr kleiner Freund, der bis dahin ehrfürchtig vor seiner Mutter gestanden hatte, ihr verschwörerisch zublinzelte, atmete sie erleichtert auf.
Seine Gnaden würde zwar weniger Zeit für sie haben, und es würde schwieriger werden, sich davonzustehlen, wenn sämtliche Burgbewohner ihn mit Argusaugen bewachten; aber die Hauptsache war doch, dass der Freund ihr gewogen blieb.
»Kniet erneut nieder, geliebter Sohn, und empfangt meinen mütterlichen Segen, Euer Durchlaucht!«, hörte das Mädchen die schöne Herzogin sagen, die auch heute wieder – jedenfalls nach Annas Dafürhalten – wie ein Engel aussah, trotz des schwarzen Trauerkleides und des unvorteilhaften Witwenschleiers über ihrem wunderbar dichten und leuchtenden Blondhaar.
Hoffentlich blieb Oheim Adalbert dabei und erzählte Frau Agnes niemals von dem »Teufel im Stein«, den sie beide in der Höhle gefunden und dummerweise in die Burg geschleppt hatten. Eigentlich hielt sie den Mann ja für zu klug, um sich zu verplappern. Ob das jedoch auch für den Weltenburger Abt und die Klosterbrüder galt? Für diese konnte Anna ihre Hand nicht ins Feuer legen, denn hin und wieder suchte die fromme Frau Agnes das berühmte Kloster an der Donau auf, um sich Exerzitien zu unterziehen.
Andererseits: Pater Adalbert hatte ziemlich glaubhaft versichert, Abt Eustachius und seine Brüder wären so furchtbar über den in Stein konservierten Dämon erschrocken gewesen, dass deren Münder vermutlich bis in alle Ewigkeit versiegelt bleiben würden, was diese Sache betraf.
Beinahe überhörte Anna in ihren Träumereien, wie man aus der Halle hinüber zur Kapelle aufbrach, in der ihr Oheim nun eine Dankesmesse für die erfolgreiche Reise der Herzogin Agnes abhalten wollte. Schnell schloss das Mädchen sich den Übrigen an, die zum ersten Mal von »Seiner Gnaden«, dem beinahe zwölfjährigen Ludwig von Wittelsbach, ihrem künftigen Herzog, angeführt wurden.
Da dessen Mutter darauf drang, dass die Lehrer ihres Sohnes ihr jeden Tag Bericht erstatteten, wie der künftige Bayernherrscher sich benommen und was er gewusst – beziehungsweise nicht gewusst – hatte, war es Ludwig nahezu unmöglich, den Unterricht zu schwänzen und Anna zu treffen, außer bei den Mahlzeiten.
Aber auch da zu seinem Leidwesen nur von fern, denn neuerdings musste er oben an der Tafel bei der Herzogin, dem Burggeistlichen und dem einen oder anderen der drei Vormünder sitzen. Meist handelte es sich um Oheim Friedrich, einen Mönch mit strengem Blick und verkniffenem Mund, den er nicht besonders gut leiden konnte, weil dieser es sich bei keinem seiner Besuche nehmen ließ, ihn in Latein zu examinieren.
Die beiden anderen Herren, die die Munt über ihn zusammen mit Frau Agnes ausübten – einer ein Erzbischof, der andere ein Pfalzgraf – ließen sich nur selten in Kelheim blicken, was Ludwig sehr an ihnen schätzte. Anna jedoch saß am unteren Ende der Tafel beim Gesinde, nicht mehr bei Ludwigs Schwestern. So hatte Frau Agnes es verfügt.
Um den unhaltbaren Zustand zu ändern, seine Freundin kaum noch sprechen zu können, ließ Ludwig sich etwas einfallen: Kategorisch verlangte er, dass sie ab sofort an seinen Unterrichtsstunden teilnehmen sollte.
»Anna ist sehr gescheit und hat bei ihrem Oheim schon eine Menge gelernt! Sie ist älter als die meisten von uns«, die Adelssöhne drückten mit Ludwig gemeinsam die Schulbank, »und sie kann uns helfen, wenn wir etwas nicht gleich verstehen«, argumentierte er nicht unvernünftig.
Insgeheim waren die Herren Magister nicht gerade unglücklich über den Vorschlag. Eine Schülerin konnte für die Knaben ein Ansporn sein. Es sprach nichts gegen Annas Teilnahme – außer dass sie ein Mädchen war und nicht so viel zu wissen brauchte. Sie erschien sowieso wie ein halber Bub und sollte sich nach landläufiger Meinung besser in Häkeln und Sticken üben.
Doch der Magister für die Fächer Geografie und Mathematik erklärte sich einverstanden, weil auch Pater Adalbert keinen Protest anmeldete. Er unterrichtete Religionslehre, Latein und Geschichte, und ihn störte es offenbar keineswegs, eine gebildete Nichte zu haben.
Anfangs schauten Ludwigs Kameraden konsterniert, als das Mädchen im Unterrichtszimmer der Burg auftauchte und ganz selbstverständlich in der Bank neben Ludwig Platz nahm. Sie war schlau – das entdeckten die übrigen bald – und bescheiden; was daraus zu ersehen war, dass sie sich nicht anmerken ließ, das meiste vom Unterrichtsstoff längst zu kennen.
Einer der adeligen Faulpelze fragte sie kurz nach ihrer Ankunft, ob sie ihn abschreiben ließe, er hätte Besseres zu tun, als über Hausaufgaben zu brüten.
»Von mir aus, gern«, gab sie zur Antwort, was ihr nicht nur bei dem einen Knaben eine Menge Sympathiepunkte einbrachte.
Lange hatte es gedauert, ehe sich das Leben nach dem Tode Herzog Ottos wieder normalisiert hatte. So richtig war man erst zur Ruhe gekommen, nachdem gesichert war, dass die Wittelsbacher weiterhin die Regierungsgeschäfte in Bayern innehaben würden. Frau Agnes schien eine zentnerschwere Last von den schmalen Schultern gefallen zu sein. Ludwig und seine Freunde strengten sich bei den Lehrern an, weil sie gegen Anna nicht andauernd wie Dummköpfe dastehen wollten. So hatten die Herren Magistri bei der Herzogin nur wenig zu beanstanden.
Das wiederum brachte es mit sich, dass die anfänglich strenge Überwachung des künftigen Landesherrn mit der Zeit lascher gehandhabt wurde. Ludwig hatte wieder mehr freie Zeit, um mit Anna die geliebten und so schmerzlich vermissten Streifzüge zu unternehmen.
Ihm war es auch einerlei, dass die anderen Kinder, seine älteren Schwestern eingeschlossen, Anna mittlerweile als seine »Magd« titulierten. Eine etwas doppeldeutige Bezeichnung, konnte das doch legitimerweise sowohl »Dienerin« bedeuten, aber leider auch für »Bettmagd« stehen – eine Beleidigung für jedes anständige junge Mädchen!
Der künftige Herzog verstand noch nichts vom heiklen Beigeschmack des Begriffs, und Anna kümmerte es ebenfalls nicht. So genau wusste auch sie über diese Sachen nicht Bescheid. Ihr fehlte die Mutter, die sie hätte aufklären können; Pater Adalbert kam gar nicht auf die Idee, solches mit ihr zu erörtern.
Selbst als sie das erste Mal ihre Tage bekam und glaubte, sterben zu müssen, war sie auf die beruhigenden Worte Frau Elisabeths angewiesen, die ihr zumindest diese Angst nahm.
Allerdings erschöpfte sich die »Aufklärung« darin, das junge Ding zu warnen, sich »ja nicht mit Männern einzulassen« … Was immer das heißen mochte. Um Genaueres zu erfahren, würde sich Anna wohl oder übel mit einer der Küchenmägde unterhalten müssen.
Ludwig war inzwischen ein stämmiger Zwölfjähriger geworden, und die Freundin mit ihren fünfzehn Jahren wirkte wie ein magerer, aufgeschossener, älterer Bruder, vor allem, wenn sie ihre flüchtig aufgesteckten langen Haare unter eine Haube stopfte, den hinteren Rocksaum zwischen den dünnen Schenkeln hindurch nach vorn bis zur Taille hochschlug und in den Rockbund stopfte.
»Du schaust aus wie ein Storch, der Pumphosen trägt«, kicherte Ludwig, als er sie das erste Mal in diesem Aufzug durch einen knietiefen Bach staksen sah.
»Der Rock soll nicht nass werden, und ich will mir keine Blasenentzündung holen, wenn der dicke Stoff ewig nicht trocken wird«, meinte Anna in aller Unschuld. Dieses Mal waren sie zu dritt.
»Schlaues Kind«, sagte Georg von Felsing und grinste sie anerkennend an. Er war einer der adeligen Knaben, Sohn eines Edelmanns aus der Gegend um Abensberg, und er durfte die beiden heute ausnahmsweise begleiten. Der fast Zwölfjährige war unsterblich in Anna verliebt, aber lieber hätte er sich die Zunge herausreißen lassen, als das zuzugeben. Außerdem nahm er an, Ludwig besäße »ältere Besitzrechte« an Anna; dass der kleine Wittelsbacher Erbe unwahrscheinlich eifersüchtig sein konnte, hatten alle Kinder schon mehrmals erlebt. Sobald der sich nämlich darüber ärgerte, dass einer der anderen Knaben sich allzu sehr mit »seinem« Annele beschäftigte, verteilte er schon mal Rippenstöße oder Kopfnüsse.
Dass das aber noch gar nichts mit Verliebtheit und körperlicher Anziehungskraft zu tun hatte, ahnte Georg nicht. In dieser Beziehung war Ludwig noch ein richtiges Kind: Er hatte nur etwas dagegen, wenn jemand anderes (das konnte auch eine seiner Schwestern sein) seine Freundin zu sehr in Beschlag nahm.
Anna kommt mit einem blauen Auge davon
Auf Ferdinand von Hohentann, auch einer aus der Knabenschar auf der Burg, traf diese naiv-kindliche Art nicht mehr zu. Er war vierzehneinhalb Jahre alt und nach Ansicht der Zeit bedingt heiratsfähig. Dass seine Eltern ihm schon eine Braut ausgesucht hatten, wusste er: die vermögende Witwe eines alten Grafen, die zehn Jahre älter war als er. In einem halben Jahr sollte er mit ihr den Bund der Ehe schließen.
Eigentlich ganz schön, fand Ferdinand. Dann würde er als erwachsen gelten und brauchte sich endlich von seinem Vater nichts mehr befehlen zu lassen! Seine Verlobte war angeblich ziemlich hübsch – selbst gesehen hatte er sie noch nicht. Und sie sollte »unheimlich scharf auf ein richtiges Mannsbild« sein – so behaupteten es wenigstens die Knechte.
Er müsse sich besonders in der Hochzeitsnacht anstrengen, um sie ja zufriedenzustellen, warnten sie ihn vor, wobei sie vielsagend grinsten. Er hätte schließlich »seinen Mann zu stehen«, und einen »Schlappschwanz würde die edle Dame im Bett kaum schätzen«!
Leider besaß Ferdinand im Unterschied zu den meisten seiner Altersgenossen noch keinerlei direkte Erfahrung mit dem anderen Geschlecht. Die Kelheimer Hofhaltung bot in dieser Beziehung kaum Anschauungsmöglichkeiten, und für praktische Übungen mangelte es ebenfalls an Partnerinnen. Hier herrschten Zucht und Ordnung. Frau Agnes und ihre Damen sowie der Burggeistliche Adalbert hielten auf strenge Zurückhaltung und überwachten die Keuschheit sämtlicher Burgbewohner mit Argusaugen.
Bisher hatte Ferdinand nur beobachtet, wie sich rossige Stuten mit Hengsten und läufige Hündinnen mit Rüden paarten. Bei Menschen sollte es angeblich genauso sein, behaupteten die feixenden Stallknechte. Das vermochte sich der jugendliche Bräutigam allerdings nicht vorzustellen: Welche Frau mit Verstand wäre bereit, sich auf alle Viere niederzulassen, damit er von hinten aufreiten und ihr sein bestes Stück hineinstecken konnte? So ein Blödsinn, dachte er verärgert. Die unverschämten Kerle wollten ihn gewiss bloß veräppeln!
Aber wen sollte er fragen? Seine Unkenntnis »in Sachen Liebe« wollte er auf keinen Fall publik machen. So verfiel er auf einen höchst unseligen Gedanken.
Die Anna müsste eigentlich Bescheid wissen, überlegte der Knabe. Sie steckte doch andauernd mit dem künftigen Herzog zusammen, und alle hießen sie bloß seine »Bettmagd«. Ludwig würde sich von ihr schon hin und wieder »als Mann« verwöhnen lassen. Das könnte sie doch auch mit ihm, dem Ferdinand, machen – ein einziges Mal wenigstens, damit er in seiner Hochzeitsnacht nicht gar so blöd dastünde!
Er schlich den dreien nach, und als er vom Ufer des Baches aus, verborgen hinter einer Pappel, Anna dabei beobachtete, wie sie den Rock schürzte und die Beine bis zu den Oberschenkeln den Blicken Ludwigs und Georgs preisgab (die allerdings beide gar nicht darauf zu achten schienen), verlor Ferdinand fast den Verstand: Die hatte ja wohl überhaupt kein Schamgefühl und war damit für sein Vorhaben geradezu perfekt, er musste sie unbedingt haben!
Vorsichtig verfolgte er das Trio durch den kleinen Flusslauf, weiter durch dichtes Weidengebüsch bis zu einer Stelle, wo der Bach sich zu einem kleinen Teich verbreiterte. Mitten drin befand sich eine Kiesbank, welche die drei ansteuerten, um sich anscheinend für länger dort niederzulassen. Das war allerdings schlecht für ihn! Aus dem Anschleichen wurde nichts, man hätte ihn sofort entdeckt. Um ungesehen zu bleiben, blieb ihm nur, sich hinter den Weidenbüschen am Ufer verborgen zu halten.
Ferdinand wartete und wartete, während er Anna, den kleinen Herzog und ihren Freund Georg scharf beäugte, soweit die Entfernung es zuließ. Sie schleuderten Kieselsteine ins Wasser, und wer am weitesten warf, hatte gewonnen – was auch immer, denn was sie redeten, konnte er nicht verstehen.
Jedenfalls schienen die Kameraden eine Menge Spaß zu haben, was Ferdinands Wut entfachte. Nach einer Weile gingen sie dazu über, flache Steine über die Wasseroberfläche hüpfen zu lassen. Sieger war der, dessen flacher Kiesel im Fluge am häufigsten auf dem Wasser aufkam. Soweit der heimliche Beobachter es mitbekam, stellte sich Anna am geschicktesten an. Ihre Steine hüpften im Schnitt fünfmal auf, ehe sie versanken. Eine ganze Weile ging das so – und zum Schluss war Ludwig der Sieger.
Die Anna hatte ihn absichtlich gewinnen lassen, war sich Ferdinand ganz sicher. Wie schlau von ihr! Jeder wusste doch, dass Ludwig nicht verlieren konnte; auf diese Weise erhielt sie sich sein Wohlwollen.
Auf einmal kam ihm die Idee, das Mädchen zu irgendetwas – noch dazu gegen ihren Willen – zu veranlassen, gar nicht mehr so gut vor. Ihr Freund und Beschützer Ludwig würde ihm den Kopf abreißen, wenn sie sich bei ihm über ihn beschwerte.
Ferdinand war nahe daran, sich unauffällig zurückzuziehen und den Heimweg anzutreten, da kam ihm der Zufall zu Hilfe. Während die Knaben begannen, mit spitzen Stöcken Gräben in den Kies zu fräsen, machte Anna sich erneut eine »Pumphose«, stieg ins Wasser und stakste direkt auf ihn zu! Bald würde sie das Ufer und damit sein Versteck erreicht haben. Das war die Gelegenheit und erschien dem Tölpel wie ein Wink des Schicksals.
Sofort vergaß er die Skrupel, die ihn vorhin befallen hatten, und fieberte Anna regelrecht entgegen. Dumm, dass er sich nicht rechtzeitig überlegt hatte, wie er es anstellen sollte, sie sich gefügig zu machen …
Wenn es so weit ist, wird mir schon was einfallen, tröstete er sich und verhielt sich mucksmäuschenstill, um sie nicht vorzeitig zu verschrecken. Ihre weißen Schenkel brachten ihn vollkommen durcheinander. Das aufregende Gefühl in dem harten, aufrecht stehenden Ding zwischen seinen Beinen verstärkte sich. Automatisch griff er vorn in den Bund seiner Hose, um es mit der Hand zu umfassen.
Das fühlte sich wundervoll an, und erneut schob sich die Erinnerung an jenen Vorgang vor seine Augen, den er bei seinem letzten Besuch zu Hause beobachtet hatte: Einer der großen Jagdhundrüden seines Vaters hatte eine kleine Hündin besprungen. Ihr Besitzer wollte offenbar den Deckakt verhindern und hatte versucht, den Rüden mit einem Stock zu vertreiben. Aber er hatte nur erreicht, dass die beiden Tiere sich so erschreckten, dass das Weibchen einen Krampf bekam und das Männchen sein geschwollenes Ding nicht mehr herausziehen konnte. Es war ein richtiges Theater gewesen! Erst als ein Knecht mit einem Kübel kalten Wassers die Hunde übergossen hatte, waren sie voneinander losgekommen.
Die Erinnerung an das Ende dieser »Hundehochzeit« ernüchterte Ferdinand schlagartig; er bemerkte, wie sein eigener hart gewordener Schwengel wieder weich wurde und an Größe verlor. Das schlappe Ding konnte er Anna nicht gut präsentieren, sie würde ihn vermutlich bloß auslachen … Entmutigt zog er die Hand aus der Hose und ging dem Mädchen entgegen.
»He! Was machst du denn da, Ferdl?«, empfing ihn Anna, den langen Rock züchtig über die Beine herabfallen lassend.
»Ich wollte grade zu der Kiesbank da vorn, ein bisschen spielen«, murmelte er verlegen, wobei er gar nicht wagte, das Mädchen anzuschauen.
»Das trifft sich gut, Ludwig und Georg sind auch da. Dann sind wir zu viert und können zwei Mannschaften bilden. Geh nur zu ihnen!«
»Aber, was machst du, Anna? Wo gehst du denn hin?«, fragte er dümmlich. Das Mädchen lachte ein bisschen verlegen.
»Ich verschwinde mal kurz hinter die Büsche – auf der Kiesbank gibt’s nämlich keine, wenn du verstehst! Geh ruhig schon voraus, Ferdl; ich komme gleich nach.«
Er hörte bloß »hinter die Büsche«, und im Nu überkam ihn erneut die Versuchung, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Dass er sich bei Anna und den Knaben sämtliche Sympathien zu verscherzen, den kleinen Herzog dauerhaft zu erzürnen und sich insgesamt nur größten Ärger einzuhandeln drohte, weil man ihn mit Schimpf und Schande vom Kelheimer Hof verjagen würde, spielte keine Rolle mehr. Auch nicht, dass seine Mutter vor Gram sterben, der Vater einen seiner berühmten Tobsuchtsanfälle kriegen und die zukünftige Braut nichts mehr von ihm würde wissen wollen: Das alles galt nichts mehr.
Das Abenteuer war es ihm wert. Seine Neugier auf das Liebesleben von Erwachsenen musste unbedingt befriedigt werden.
»Ist gut, Anna. Aber beeil dich! Ich weiß ein tolles Spiel«, murmelte er, um sie zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen. Kaum hatte das Mädchen sich umgedreht, packte er Anna von hinten und versuchte, ihr ein Bein zu stellen, damit sie auf den Boden plumpsen würde.
»He! Spinnst du?«, schrie Anna empört und begann sich energisch zu wehren. »Lass das gefälligst, Ferdinand!«
Der Junge versuchte, ihr den Mund zuzuhalten, wenn er sie schon nicht gleich zu Fall bringen konnte. Das Mädel war um vieles kräftiger als von ihm vermutet. Außerdem schrie sie andauernd um Hilfe, sodass er es mit der Angst bekam. Sein ursprüngliches Ziel, sich ihr aufzudrängen, hatte er inzwischen längst vergessen; es ging nur noch darum, sie endlich ruhigzustellen.
Schließlich bekam er sie am Hals zu fassen, und Anna wurde es himmelangst, als sie seinen Würgegriff spürte. Dass es sich keineswegs um Spaß handelte, war ihr bewusst, und sie wehrte sich mit dem Mut der Verzweiflung. Zu ihrem Entsetzen spürte sie aber bald, dass ihre Kräfte allmählich nachließen. Dank einer gewaltigen Anstrengung gelang es ihr jedoch, sich endlich loszureißen, und sie brüllte, dass es dem Angreifer in den Ohren gellte: »Ludwig, Hilfe! Hilfe!«
Endlich vernahm der kleine Herzog ihre verzweifelten Schreie. »Was ist da denn los?«, fragte er Georg Felsing, doch beide konnten aus der Entfernung nichts Genaues erkennen – nur dass Anna in irgendwelchen Schwierigkeiten stecken musste. Die Freunde schauten, dass sie so schnell wie möglich von der Sandbank aus durchs seichte Wasser ans Ufer wateten, um der Spielkameradin zu Hilfe zu eilen.
Ferdinand versuchte noch zu fliehen, aber Ludwig und Georg holten ihn ein, nachdem ihnen Anna vollkommen aufgelöst von seinem Versuch berichtet hatte, ihr die Luft abzudrücken.
»Auf den Boden hat er mich schmeißen wollen«, schluchzte sie.
Für Ferdinand endete das Ganze mit einer fürchterlichen Abreibung, welche ihm Ludwig und Georg verpassten, und der Ankündigung, ihn jeden Tag aufs Neue zu verdreschen, falls er sich noch länger in Kelheim blicken ließe.
Bereits am nächsten Tag reiste er ab in seinen Heimatort – wobei er noch Glück hatte, dass die Erwachsenen nicht weiter nachbohrten, weshalb er sich denn so unmöglich gegen das Mädchen aufgeführt hatte.
Auch Anna dachte sich »Schwamm drüber« und weigerte sich, noch einen einzigen Gedanken an den verrückten Kerl zu verschwenden. Ihr war gar nicht klar, dass sie mit einem blauen Auge davongekommen und nur um Haaresbreite einer Vergewaltigung entgangen war.
In den nächsten Monaten änderte sich nicht allzu viel. Zumindest erschien es Ludwig nicht so, die Dinge wandelten sich nur ganz langsam. Woche um Woche, Monat für Monat war es so, dass seine Lehrer und Ausbilder »die Daumenschrauben ein wenig fester anzogen«, um eine übliche Floskel zu gebrauchen, die er mittlerweile regelrecht hasste. Zum Glück hatte das mit Folter aber nichts zu tun, lediglich seine Aufgaben wurden umfangreicher, die Pflichten vielfältiger – und die Freizeit karger.
Letzteres bereitete dem aufgeweckten und an allem interessierten Burschen nur Verdruss, sobald es bedeutete, längere Zeit von Anna getrennt zu sein. Mochten die Schwestern ruhig die Nase rümpfen, sein Vormund, Erzbischof Konrad von Mainz, verwundert den Kopf schütteln und die adeligen Spielkameraden die Augen verdrehen: Ihn, den zukünftigen Herzog, focht das nicht an. Sein Annele war sein Ein und Alles.