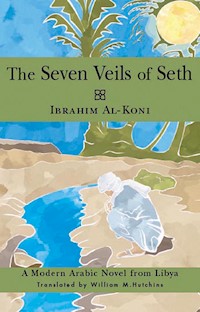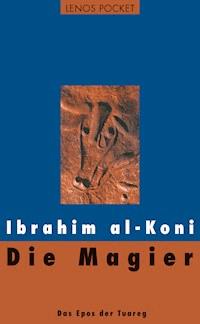
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Arabische Welten
- Sprache: Deutsch
»Die Magier« ist das Hauptwerk des libyschen Autors Ibrahim al-Koni. Ein gewaltiges Epos, das Geschichte und Mythos, Weisheit und Tradition, Denken und Handeln einer der grossen, in ihrer Existenz bedrohten Nomadenkulturen der Welt festhält. Ein Werk mit der Kraft antiker Epen, verbunden mit neuzeitlicher Romantradition. Ein Nomadenstamm lagert in der Wüste im Südosten Libyens bei einem Brunnen - schon zu lange, länger als die nach dem Gesetz der Wüstenbewohner erlaubten vierzig Tage. Eines Tages treffen Flüchtlinge aus dem Süden ein und bitten, in der Nähe des Lagers siedeln zu dürfen. Der Stammesführer gewährt es, und der uralte Konflikt zwischen Nomaden und Sesshaften bricht erneut aus. Die Fremden missbrauchen das Gastrecht und beginnen mit dem Bau einer Stadt nach dem Muster des legendären Timbuktu, aus dem sie geflohen sind, um ihrem Schicksal zu entgehen. Mehr noch: Sie handeln mit Gold, dem unheilvollen Metall, und bringen die neue Stadt, genannt Waw, das verlorene Paradies, zu ungeahnter Blüte. Gleichzeitig berauben sie den Stamm seiner Lebensader, indem sie den Brunnen in die Stadt integrieren. Die einstigen Nomaden erliegen fast ausnahmslos den Verlockungen des komfortablen städtischen Lebens. Doch schliesslich werden sie zusammen mit den Bewohnern der Stadt vernichtet. Das Innehalten bei der Wanderung des Lebens bleibt nicht ungesühnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1050
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Der Autor
Ibrahim al-Koni, geboren 1948, wuchs in einem Tuaregstamm in der Libyschen Wüste auf. Nach dem Studium der Literatur am Gorki-Institut in Moskau arbeitete er als Journalist in Warschau und in Moskau. Ab 1993 lebte Ibrahim al-Koni viele Jahre in der Schweiz. Er hat zahlreiche Romane und Erzählungssammlungen veröffentlicht. Für seinen Roman Blutender Stein wurde er mit dem Literaturpreis der Stadt Bern ausgezeichnet, für das Epos Die Magier mit einem Buchpreis des Kantons Bern. Für sein Gesamtwerk erhielt er 1996 den Libyschen Staatspreis für Kunst und Literatur, 2005 den Grossen Literaturpreis des Kantons Bern, 2008 wurden ihm der Preis der französisch-arabischen Freundschaft und der renommierte Scheich-Sâjed-Buchpreis verliehen.
Der Übersetzer
Hartmut Fähndrich, geboren 1944 in Tübingen. Studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Islamwissenschaft in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Seit 1972 in der Schweiz, seit 1978 Lehrbeauftragter für Arabisch und Islamwissenschaft an der ETH Zürich. Für Presse und Rundfunk tätig. – Der Übersetzer dankt der Präsidialdirektion der Stadt Bern und der Erziehungsdirektion des Kantons Bern für die grosszügige Unterstützung seiner Arbeit an diesem Buch.
Die Übersetzung aus dem Arabischen wurde unterstützt durch die Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.
Titel der arabischen Originalausgabe:
al-Mağûs
Copyright © 1990/91 by Ibrahim al-Koni
E-Book-Ausgabe 2015
Copyright © der deutschen Übersetzung
2001 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Anne Hoffmann Graphic Design, Zürich
Coverfoto: Alain Sèbe
www.lenos.ch
ISBN 978 3 85787 919 7 (EPUB)
ISBN 978 3 85787 920 3 (Mobipocket)
Für Mûssa al-Koni,den Derwisch dieser Zeit
Inhalt
Erster Teil
I. Der Südwind
II. Der Ordensscheich
III. Der Gesandte
IV. Der Irrende Gefährte
V. Der Paradiesvogel
VI. Die Renegaten
VII. Wâw
VIII. Die Schakale
IX. Das Fest
X. Die Vision
XI. Der Derwisch
Zweiter Teil
I. Die Brust der Erde
II. Der goldene Armreif
III. Wâw der Erde und Wâw des Himmels
Dritter Teil
I. Der Stammesführer
II. Der Balg
III. Gesetze der Erde und Gesetze des Himmels
IV. Die Schlange
V. Das Geheimnis des Durstes
VI. Die Wette
VII. Der Behälter
VIII. Der Gesichtsschleier
IX. Amghâr, der weise Alte
X. Die Klagelieder
XI. Das Schicksal
Vierter Teil
I. Die Arglist
II. Die Diaspora
III. Das Leichentuch
Anhang
Nachwort
In diesem Sinne muss jede Nation, wenn sie für irgend etwas gelten will, eine Epopöe besitzen, wozu nicht gerade die Form des epischen Gedichts nötig ist.
Johann Wolfgang von Goethe, Dichtung und Wahrheit
Erster Teil
I. Der Südwind
Der Wind geht gen Mittag, und kommt herum zur Mitternacht, und wieder herum an den Ort, da er anfing.
Das Alte Testament. Der Prediger Salomo 1,6
1
Nie wird den Geschmack des Lebens kosten, wer nicht die Luft der Berge geatmet hat.
Hier, auf den nackten Gipfeln, nähert er sich den Göttern, befreit sich vom Körper und vermag seine Hand auszustrecken, um den vollen Mond zu pflücken oder die Sterne abzulesen.
Von dieser Stelle aus beobachtet er gern die Menschen tief unten, wie sie ameiseneifrig umherwuseln, so dass man glauben könnte, sie würden Wunder vollbringen. Und wenn er hinabsteigt auf ihre Erde, stellt er fest, dass sie wirklich armselige Geschöpfe sind, ernsthaft suchend, jedoch nichts anderes erntend als Vergeblichkeit. Wie lächerlich und hässlich doch ihr Streben von weit oben erscheint!
Von der stolzen Akakûs-Kette haben sich zwei legendäre Berge getrennt und sind durch die Wüste geirrt. Einer von ihnen lagerte sich im Süden, unweit der Mutterkette, und scheint, trotz zweier gigantischer Formationen, niedriger als sein irrender Bruder, mit dem er den Ehrgeiz teilt, den Himmel zu erreichen. Der nördliche Berg, der am anderen Ende der Ebene ruht, spaltet mit seinen traurig-rätselhaften Gipfeln, die wie vier Türme aufragen, majestätisch den Raum.
Die Abenddämmerung überflutete die weglose Westwüste mit purpurnem Licht. Nutzlose Wolkenfetzen trieben am Horizont. Auf der Ebene, hingebreitet zwischen den beiden Bergen, erschien eine Karawane. Einige Personen gingen ihr zu Fuss voran, ein von Dienern umgebenes Kamel führend, auf dem eine prächtige Sänfte schwankte. Diesem folgten andere Kamele, beladen mit dem Gepäck. Doch von hoch oben auf dem Gipfel wirkte die Pracht des Zuges lächerlich. Er bemerkte, dass der Berg alles, was auf der Erde wichtig und majestätisch erscheint, in Spielzeug verwandelt. Stolze Mehri-Kamelhengste werden zu Mäusen. Ehrfurchtgebietende verhüllte Männer, aufgeblasen wie Pfauen, werden zu Figürchen, die entweder Heiterkeit oder Mitleid erregen. Sogar der edle, blaugewandete Stammesführer, der in den Seelen Ehrfurcht weckt, erschien ihm von seinem hohen Standort wie ein amüsantes, hilfloses Püppchen. Auch bemerkte er, dass das Spiel des Gipfels mit den Dimensionen der Menschen und ihres Tuns desto unerbittlicher wurde, je ernsthafter und erhabener sie sich gebärdeten. Und oft, wenn er wichtigtuerischen Notabeln die Hand schüttelte, dachte er: Wartet nur, bis ich auf den Berg gestiegen bin. Von dort sehe ich, ob ihr wirklich Götter seid oder doch nur Mäuschen! Das Geheimnis bewegte und erregte ihn immer wieder aufs neue. Welchen Grund hatte der himmlische Gipfel, die Grossen und Stolzen zu verspotten und sie zu elenden Geschöpfen zu machen? Doch eine Eingebung versicherte ihm, der Gipfel sei unfehlbar, und wenn er die Stolzen als Püppchen erscheinen lasse, so sei dies die Wahrheit. Die Ebene sei es, die die Menschen verfälsche und sie zu einer Illusion mache. Jene geschäftigsten von allen Kreaturen erscheinen komisch, weil sie sich in der Wirklichkeit auf Erden mehr als alle anderen dem Wahn hingeben und ihre Seelen dem Satan überantwortet haben.
Die Ernsthaften sind ein leichterer Happen für den Teufel.
Und wie der Berg die Gebetsnische der Götter ist, so ist die Ebene das Reich der Teufel.
2
Am Fusse des Berges liess sie anhalten. Die Kamele zerstreuten sich, getrieben von ein paar Negern, in den Wadis Richtung Osten. Andere Männer begannen mit der Errichtung des Lagers. Tênere ging hinaus in die weite Wüste, um sich die Beine zu vertreten. Das lange Eingesperrtsein in der Sänfte hatte sie das Gehen verlernen lassen und ihre Beweglichkeit gelähmt. So stolperte sie, den engen, steilen Taleinschnitten folgend, die von den Höhen des Berges herabführten, und diese Schwierigkeit mit ihren Füssen überraschte sie; sie lachte heiter auf.
»Zum erstenmal höre ich eine Frau über sich selbst lachen.« Seine Stimme kam aus dem Unbekannten; sie blickte sich verwirrt um, sah aber nichts. Flüsterte einige Zauberformeln und fragte laut: »Bist du der Teufel?«
»Nein, ich bin der Engel.«
Ein kräftiges Lachen. Dann trat er aus seinem Versteck hinter dem Felsen hervor und entschuldigte sich galant.
Sie stand lange da und betrachtete ihn, ohne seinen Gruss zu erwidern oder auf die Entschuldigung für sein kindliches Spielchen zu reagieren. Ein feines Lächeln zeichnete sich auf ihren Lippen ab. Sie beeilte sich nicht, ihr schönes Gesicht zu bedecken. Ein seltsamer Ausdruck lag darauf. Der unverfrorene Ausdruck von Menschen, die ein Geheimnis haben. Ihr Lächeln offenbarte zwei gleichmässige Reihen Zähne. »Auf dem Berg erscheinen nur Gespenster oder der vermaledeite Teufel«, meinte sie boshaft.
»Der Teufel wohnt auf der Ebene, und die Gespenster bewohnen die Berge des Nordens, dort oben.«
Er wies mit dem Finger zum Îdenan. Zog das Ende seines Turbantuches um den Mund fest und liess seiner Geste ein Lachen folgen. Eine widerspenstige schwarze Strähne kam aus ihrem Versteck unter dem Tuch hervor. Sie rutschte herab und fiel über ihre Brust. Sie beeilte sich nicht, sie zurückzuschieben. Beobachtete ihn neugierig. Dann stieg sie weiter den steilen Hang hinauf. Überwand ihre anfänglichen Schwierigkeiten und schritt aufrecht und stolz weiter. Udâd ging neben einer Frau aus der Welt der Märchen, einer Paradiesjungfrau oder einer Dschinnenfrau. Er wusste es, und das Gefühl der Majestät und der Scheu liessen ihn erschauern.
»Ich hatte nicht erwartet, in dieser weiten Wüste einem menschlichen Wesen zu begegnen«, sagte sie, ohne ihn anzuschauen.
»Menschen gibt es überall, sogar unter den Steinen und auf den höchsten Bergen.«
»Ab heute zweifle ich nicht mehr daran. Wohnst du auf dem Gipfel oder in einer Höhle?«
»Wenn ich mich einmal anzusiedeln gedenke, werde ich keinen angemesseneren Ort finden als den Gipfel. Die Höhlen sind zum Ersticken.«
Sie unterdrückte ein Lachen. »Wie der Mufflon«, sagte sie.
Er wickelte das grüne Stück Tuch um sein Gesicht. Begann, seine Scheu zu überwinden. »Wie der Mufflon.« Seine Bestätigung klang kindlich heiter.
Der Hang führte jetzt gerade hinauf. Sie wurde langsamer, dann setzte sie sich auf einen Felsen. »Bist du völlig allein hier?« fragte sie ihn.
Er wies nach Westen, wo die Sonne als grosse, runde Scheibe niederging. »Das Lager des Stammes ist dort.« Er schwieg einen Augenblick, dann fügte er plötzlich hinzu: »Wenn Ihr auf alles verzichtetet und mein Gast auf dem Berge würdet, bliebe ich am liebsten auf immer dort.«
Sie starrte ihn an, wortlos. Ihr Gesichtsausdruck wurde noch geheimnisvoller und zauberhafter. »Du bist wie ein Kind«, bemerkte sie schliesslich. »Ich bin noch nie einem Kind wie dir begegnet.«
»Ein Kind zu sein ist besser als ein aufgeblasener Mann, der auf der Ebene wohnt. Die Leute da unten sind zwar Männer, aber sie sind Sklaven. Und was ist besser, Sklave oder Kind?«
Sie lachte auf und band das Tuch vor ihrem Gesicht fest. »Alle Männer sind Kinder. Alle Menschen sind Sklaven.«
Die Dunkelheit am Horizont wurde dichter, vom Süden schoben sich schwarze Wolken heran.
»Die Luft kündigt Regen an«, sagte Udâd. »Eure Ankunft ist ein gutes Omen.«
»Das glaube ich nicht«, erwiderte sie kühl. Dann lächelte sie traurig.
Nach einigem Schweigen sagte er: »Entschuldigt, dass ich erst jetzt frage: Kommt Ihr aus Aïr?«
»Kannst du auch das Verborgene lesen?«
Die Antwort verwirrte ihn, doch sie kam ihm mit einem Scherz zu Hilfe. »Ich komme tatsächlich aus Aïr. Ich suche ein Obdach, das mich vor dem Wind schützt. Kennst du eine Höhle, die mich gegen den Südwind schützt?«
Er schlug sich mit der Hand aufs Herz und konterte den Scherz mit einem Scherz: »Hier kann ich Euch ein Obdach bieten, das sicherer ist als alle Höhlen. Dieser Käfig ist der einzige Ort, in den der Wind nicht eindringt.«
Sie schenkte dem Scherz keine Beachtung, betrachtete den trüben Horizont.
3
Nachdem er das letzte Glas Tee leergetrunken und eine lange Ausführung über Noblesse und Krieg abgeschlossen hatte, bekräftigte der Stammesführer die Notwendigkeit, den Brunnen zu befestigen.
Er übertrug Ocha die Aufgabe.
Ocha gehörte zu den Notabeln. Er war mit dem Stammesführer verwandt, war gross, schlank, begabt, schrieb Gedichte und verfasste Lieder. Er war ein Mehri-Reiter und hatte schon an drei Expeditionen zum Koko-Fluss1 teilgenommen. Die Scheichs lobten und priesen seine Heldentaten. Alle jungen Mädchen liebten ihn und warteten darauf, dass er seinem Stolz entsagte und sie ihn zum Ehemann gewännen.
Er durchquerte das Wadi und erklomm die Anhöhe, umringt von einer Schar pfauengleich aufgeplusterter Begleiter. Auf den Hügeln im Süden, rechts vom Lager, verteilten sich die Sklaven und die Gefolgsleute und riefen laut durcheinander. Sie trugen Beile und Hacken und scharten sich zusammen. Einige von ihnen ordneten sich in langer Reihe hintereinander, wie die Gazellenherden bei ihren Wanderungen.
Die Wüste verrunzelte sich, der Horizont legte die Stirn in Falten für den folgenden Tag. Am Himmel verdichtete sich fahle Dunkelheit. Die Türme des Îdenan verschwanden hinter einem Wolkenturban.
Doch Kenner versicherten, dass in der in Dunkelheit und Trauer gehüllten Wüste die regenschwersten Wolken ihre Entschlossenheit rasch aufgeben und den Rest dem Südwind überlassen. Denn die beiden ewigen Widersacher teilten vor Urzeiten die Wüste unter sich auf, so berichten die Alten. Die Südliche Wüste fiel an den Südwind, der Regen dagegen erhielt die Hammâda im Norden, und nur selten brachen die beiden Seiten den Pakt. So selten, dass die Menschen in der weiten Wüste diese Fälle in ihre Herzen einschrieben und damit ihr Leben in der Wüste datierten. Auch soll der Klang der Trommeln, die das Unbekannte in den Sandkörnern schlägt, nichts anderes sein als der Ruf der Sandwüste nach Regen, ihre brennende Sehnsucht nach Wasser, nach Leben. Zuzeiten ist diese traurige Melodie mehrere Nächte hintereinander zu hören, und oft schon hat sie sich im Morgengrauen in ein Klagen und Stöhnen verwandelt. Dann beten die Frommen und bitten Gott, dem Sand Geduld zu schenken, sein elendes Los zu ertragen. Manche schlachten gar Opfertiere, um die Wüste des Südens von dem tyrannischen Pakt zu befreien, der ihnen die lebensspendenden Regenwolken vorenthält.
Doch das Herz der Götter in den Himmeln ist unerbittlich, und der Fluch des Durstes ist ewiglich. Selbst bei den wenigen, schon weit zurückliegenden Malen himmlischer Regenspenden, nach denen die Menschen ihr Leben datieren, geschah dies durch einen Fehler, den das Schicksal beging, oder aufgrund eines vorübergehenden Streits zwischen den beiden Wüsten, der Sandwüste und der Bergwüste, nur selten entsprang es einer intriganten oder mörderischen Aggression einer der beiden Seiten. Bei dergleichen Konfrontationen wurde die Sandwüste so mit Wasser gesättigt, dass es durch die Wadis strömte und von den staubbedeckten Höhen floss. Doch wenn sich der Kampf zugunsten des Südwinds entscheidet, erwarten die Wüste unerbittliche Jahre. Dann gerät der Südwind ausser Rand und Band und tyrannisiert sie für Wochen und Monate, vielleicht länger. Er überfällt die Höhen der Hammâda mit ränkesüchtigen Angriffen, die auch den Dschebel Nefûssa nicht verschonen, ja über ihn hinausreichen bis in die Dschafâra-Ebene, die Küsten der Meere im Norden treffen und die gezackten Wolken auf Jahre hin auflösen.
Am Brunnen wartete eine Überraschung auf Ocha. Eine Karawane umlagerte dicht das Becken und drängte sich nach dem Wasser. Ein Stamm von hageren schwarzen Männern mit erschöpften Gesichtern umstand die Tiere. Einige waren damit beschäftigt, das Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen, andere sorgten sich um die Kamele und verteilten das Wasser. Ochas Gefolgsleute und Neger kamen und bildeten einen schweigenden Gürtel von Männern auf dem Hügel, von dem aus man auf den Brunnen hinuntersehen konnte.
Aus der Karawane der Fremden trat ein würdiger alter Mann hervor, auch er hochgewachsen und offensichtlich erschöpft. Allein ging er auf Ocha zu, richtete sein Gesichtstuch und schwieg lange. Schliesslich tat er den Mund auf. Er sei der Gesandte der Prinzessin und wolle mit dem Führer sprechen.
4
»Ich wusste gar nicht mehr, was ich tun soll«, erklärte Tamghart der Seherin. »Die Ebene sei das Nest der Satane, hat er gesagt, aber die Satane sind in seinem Kopf. Die Losungen des seligen Fakîh will er verloren haben, ich aber bin überzeugt, dass er sie vorsätzlich vernichtet hat. Ich habe auf den Rat der weisen Frauen gehört und wollte ihn mit dem einzigen Strick binden, der einen Mann an das Land fesseln kann: die Frau. Ich habe ihn mit der Tochter des Âmma verheiratet, einem wohlgeratenen Mädchen, dem nichts fehlt ausser eben der Erfahrung. Sie hat ihn gehen lassen, noch bevor die sieben Tage vollendet waren. Er hat sich mit den Kamelen zur Pilgerfahrt aufgemacht und ist zwei Monate im Tâdrart geblieben. Hast du in der Wüste je von einem Mann gehört, der nach nicht einmal einer Woche das Lager seiner jungen Frau verlässt und in die Berge flieht?« Sie band sich das schwarze Tuch um den Kopf und schob den Korb aus Palmblättern, den sie mitgebracht hatte, näher zur Seherin. »Ich habe der Törin gesagt«, fuhr sie fort, »dass die Frau ihren Mann nicht durch Schönheit hält und auch nicht durch Koketterie, sondern allein durch diese beiden …« Sie schlug sich mit den Händen auf ihre dürren Schenkel. Das mürrische Gesicht der Seherin verzog sich zu einem säuerlichen Lächeln. »Und jetzt will ich«, fuhr Tamghart fort, während sie den Korb der alten Negerin vor die Füsse leerte, »dass du einen Talisman schreibst, der ihn von seinen Türmen auf den Bergen runterholt und ihn wieder auf die Erde und zur Vernunft bringt.«
Die Seherin setzte zum Widerspruch an, doch Tamghart liess ihr keine Gelegenheit dazu: »Keinen geschriebenen Talisman. Er wird ihn genauso vernichten wie den Schutz des seligen Fakîh. Etwas anderes, etwas, das ich ihm mit Wasser, Tee oder Milch zu trinken geben kann.«
Die Seherin beobachtete ihre Besucherin, die ihre Geschenke auf einem Stück Stoff ausbreitete. »Ich bin schon vor einiger Zeit davon abgekommen, mich mit dergleichen zu befassen. Du weisst das.«
Aber die Besucherin war taub für den Widerstand. »Das Mädchen ist ins Haus ihrer Eltern zurückgekehrt, und er hat sie seither nicht wiedergesehen. Ich habe ihn aufgefordert, zu ihren Leuten zu gehen, sich zu entschuldigen und sie zurückzuholen; aber er ist eigensinnig, ist dickköpfiger als ein Schafbock oder ein Mufflon. Er behauptet, die Frau fessle die stärksten Männer mit einer Kette von siebzig Ellen Länge, mein Gott!«
»Mein Gedächtnis ist altersschwach geworden, mein Blick trüb. Es ist lange her. Ich habe das Metier vergessen.«
»Wenn er so weitermacht und der Berg von ihm Besitz ergreift, werde ich ihn auf immer verlieren.« Sie schob den Korb zur Seite und zeigte ihre Geschenke: ein Fläschchen mit Parfüm, ein Spiegel, Räucherwerk und vier Hühnereier. Tamghart war die erste, die den Mut hatte, in der Wüste Hühner zu züchten. Sie erfuhr deswegen lange Zeit die Verachtung des Stammes. Und wenn man sich bereit machte weiterzuziehen, gewann sie die Jungen mit Eiern und allerhand Versprechungen, damit sie ihr hülfen, am Tag vor dem Aufbruch die Hennen einzufangen, die sie dann in Körbe aus Palmzweigen sperrte und mit ihrem Gepäck auf dem Rücken der Kamele transportierte.
Die schlaue Tamghart wusste, dass die Seherin Eier mehr als irgend etwas sonst in der Wüste liebte, und so versuchte sie, sie mit den vier Eiern dazu zu bewegen, das Amulett zu bewerkstelligen. »Der Fakîh ist tot«, sagte sie ermutigend, »und ich bin nicht geschwätzig.«
Die Seherin starrte auf die leuchtendweissen Eier. Dann streckte sie die Hand aus und zog das Tuch zu sich heran. »Gott sei dem Toten gnädig«, sagte sie, »aber ich habe ihn nie gefürchtet.«
Plötzlich flatterten und schlugen die Zeltenden.
Feiner Staub wirbelte umher. Aus der Zeltecke tauchte der Derwisch auf.
II. Der Ordensscheich
Sehet euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reissende Wölfe.
Das Neue Testament. Das Evangelium des Matthäus 7,15
1
Um die Samen der Wahrheit auszustreuen, wandte sich der Fakîh zunächst gegen die Sterndeuter, die Priester und die Praktiken der Magier. Auf dem Weg zurück in sein Land, nach Twât, kam er mit einer Karawane aus Mursuk. Er gehöre dem Kadirîja-Orden an, erklärte er, und sein Ziel sei es, die Menschen auf den rechten Pfad der Freiheit zu führen. Und wie er sich so einführte, vergass er auch nicht hervorzuheben, was ihn von den Fakîhs der Sunna unterschied. »Auf diesen Unterschied weise ich nicht hin, um mich bei euch einzuschmeicheln und mich als integer hinzustellen«, erklärte er dem Stammesführer Âdda, der ihn bei sich aufnahm, »weil ich weiss, in welchem Ausmass die Stämme der Wüste durch sie im Namen der Religion schon ausgeplündert wurden, sondern weil hier ein Unterschied in der Methode vorliegt. Sie haben die Religion der Sprache der Andeutung beraubt und die Lehren in die Buchstäblichkeit und die Gesetzlichkeit übertragen. Sie haben den Satan aus seiner Festung in der Seele geholt und die einfachen Menschen aufgefordert, ihn in der Welt zu verfolgen, in der Absicht, ihn zu töten; doch er hat sich ihrer bemächtigt, und so verloren sie das wertvollste Juwel, das Gott jedem Geschöpf mitgegeben und das Er zum Wesen jeder Religion gemacht hat – die Freiheit.« Dieser Fehler sei es gewesen, glaubte der Scheich, der das Zeichen verkehrt habe, und so habe der Satan die Oberhand über sie gewonnen und ihre Bemühungen auf dieses Leben gelenkt, wodurch sie verdorben wurden und sich alle in Nimrods verwandelten, und die Religion wurde wieder etwas Fremdes, wie sie es einst gewesen war.
Der Stammesführer war hocherfreut und schlachtete seinem Gast zu Ehren ein paar Tiere. Drei Tage lang sassen die Scheiche und die Notabeln mit ihm zusammen, und die Mädchen des Stammes unterhielten ihn mit Gesang und einfacher Musik. Am vierten Tag beriet sich der Stammesführer mit den Oberhäuptern der Familien und bat danach den Ordensscheich in ihrem Namen zu bleiben, um ihnen all das darzulegen, was ihnen von den Geheimnissen der Religion verborgen war, und ihre Kinder den Koran zu lehren. Der Scheich erbat sich Bedenkzeit. Danach ersuchte er um Erlaubnis, in sein Land, nach Twât, zu ziehen, um seine weltlichen Angelegenheiten zu regeln; in zwei Monaten wolle er zurückkehren und dann auf immer bei ihnen bleiben. Die Notabeln geleiteten ihn und stellten ihm Kamele, beladen mit Vorräten und Wasser, ausserdem Diener zur Verfügung. Doch schon auf halbem Weg besann er sich anders. Er kam zurück und erklärte seinen Sinneswandel damit, die Angelegenheiten dieser Welt rechtfertigten nicht die Strapazen der Reise und wer andere auf einen neuen Pfad führen wolle, müsse damit beginnen, sich von sich selbst zu befreien.
Nun waren den Bewohnern der Wüste die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen islamischen Gruppierungen unbekannt, weshalb sie nicht verstanden, was er mit dem Unterschied zu den Lehren der Sunna meinte, und fortfuhren, ihn Fakîh zu nennen. Er beschloss, mit der Ausbildung von Anhängern zu beginnen, lehrte die Kinder den Koran und legte grossen Wert darauf, dass sie die Lehren rein übernahmen, ohne einen Mittler. Dann beschloss er, einen Schritt weiter zu gehen. Er formte aus den Jüngern der Wahrheit Gruppen, die ihm bei der Bekämpfung unislamischer Neuerungen und der Kulte der Magier behilflich sein sollten. Dafür hatte er einen Plan entworfen. Allen Jüngern hängte er ein Amulett um den Hals und forderte sie auf, die Seherin Têmet mit Steinen zu bewerfen. Oben auf dem Hügel, von dem aus man den Brunnen überblickte, errichtete er ein Zelt und machte daraus einen Ort für Dhikr-Sitzungen, Koranrezitation und die Versammlungen mit seinen Jüngern. Oft hörte man von dort Trommelklänge und die Stimmen von Sängern, die Sufigebete psalmodierten. In dieser göttlichen Klause entwarf der Fakîh die Methoden der Führung zum Pfad der Erlösung und der Freiheit. Nachdem er sich von der Konkurrenz der Seherin befreit und sie gezwungen hatte, sich von den Leuten fernzuhalten und von ihrem Metier zurückzuziehen und hinfort nicht mehr das Unsichtbare zu lesen und Teufelslosungen zu verfassen, schickte er seine Jünger ins Lager hinab, um den nächsten Schritt der Missionierung in die Tat umzusetzen. Zuvor führte er in Âddas, des Stammesführers, Zelt mit den Würdenträgern und Notabeln eine Versammlung durch und mahnte sie, wenn sie des Paradieses teilhaftig werden wollten, bei sich selbst zu beginnen. Ihnen war nicht wohl zumute, und sie warfen sich ratlose Blicke zu. Als der Scheich des Kadirîja-Ordens sagte: »Es ist an der Zeit, dass ihr von den Beutezügen in den Dschungel und zum Fluss ablasst«, wuchs die Überraschung noch.
»Und was sollen wir ohne Gefangene und ohne Sklaven tun?« fragte der Stammesführer.
»Jeder, der etwas sein Eigentum nennt, macht sich selbst zu dessen Eigentum. Und als solches kann niemand die Seligkeit der Freiheit erwarten.«
»Aber wir erjagen auf unseren Beutezügen nicht allein Gefangene und Sklaven. Wir bringen auch die frohe Botschaft des Islam.«
»Nicht kann die frohe Botschaft des Islam verbreiten, wer die Knechte Gottes wie Vieh jagt, um sie für sich selbst zu Sklaven zu machen.«
Schweigen herrschte. Dann ging der Scheich in seinem Angriff einen Schritt weiter. »Das ist aber noch nicht alles«, sagte er, und sie schauten ihn missbilligend an. »Ihr müsst auch jede gefangene Magd und jeden geraubten Sklaven freilassen«, fuhr er unbeirrt fort.
Nach langem Schweigen ergriff der Stammesführer ein weiteres Mal das Wort. »Vorbei ist vorbei. Was vergangen ist, hat Gott vergeben.«
»Im Gegenteil, alles ist auf wohlverwahrter Himmelstafel aufgeschrieben.«
»Aber die meisten dieser Edlen haben ihre Gefangenen zu Konkubinen gemacht, andere haben sie zu Frauen genommen, entsprechend dem Gesetz Gottes und seines Gesandten.«
»Die Gefangenen sind verboten, und die Frauen sind mit Gewalt genommen, mit dem Schwert in der Hand.«
Langes finsteres Schweigen. Dann versuchte es der Stammesführer ein weiteres Mal. »Wir sollen uns von ihnen scheiden?«
»Je rascher, desto besser.«
»Aber die Scheidung ist von allen erlaubten Dingen Gott am verhasstesten.«
»So ist es, aber nur, wenn die Verbindung in gegenseitigem Einverständnis erfolgt ist.«
»Und wenn die Sklaven deine Freiheit ablehnen und im Schutz des Herrn zu bleiben verlangen, was sollen wir dann tun? Sollen wir sie zwingen, uns zu verlassen?«
»Selbstverständlich! Sie müssen gezwungen werden. Jeder Mensch zieht es vor, sich in der Knechtschaft zu verstecken, um der Freiheit zu entfliehen. Die Befreiung ist eine grosse Last, und ihr müsst mit euren Sklaven anfangen, wenn ihr wirklich andere werden und das geheiligte Werk beginnen wollt.«
»Deine Lehren sind erbarmungslos.«
»Nicht kostet den Geschmack der Seligkeit, wer nicht zweimal geboren wird. Alle Lehren des Herrn sind erbarmungslos.«
Wie der Stammesführer vorausgesehen hatte, erwies sich die Befreiung der Sklaven als nicht einfach. Diese lehnten nämlich die Freiheit ab und scharten sich auf der Ebene zusammen. Ihnen schlossen sich die geschiedenen schwarzen Frauen an, die ihre zurückgewiesenen Kinder mitbrachten. Sie zogen zum Zelt der Dhikr-Sitzungen, wo sie schreiend und Steine werfend demonstrierten. Die Jünger stellten sich ihnen in den Weg, und man wurde mit Stecken, Stöcken und Fäusten handgemein.
Einige Verwundete und ein Toter waren das Resultat des Zusammenstosses. Die dem Kadirîja-Orden feindlich gesinnten Notabeln frohlockten, aber der Scheich beschloss, der Situation mit den beiden wertvollsten Mitteln zu begegnen, die sich zu jeder Zeit und an jedem Ort erfolgreich gezeigt hatten: Geduld und Tücke. Als sie sich am folgenden Tag vor dem Zelt versammelt hatten, trat er hinaus und sprach zu ihnen: »Ich weiss, dass es nichts Schwereres gibt, als sich selbst zu besiegen. Aber vergesst nicht, dass die Belohnung nur nach Massgabe des Gegebenen erfolgt. Hier haben wir die Gefährten des Propheten zum Vorbild. Sie haben den Tod verlangt, und die Wohltat des Lebens ward ihnen zuteil. Wenn ihr heute nicht geboren werdet, so werdet ihr auch morgen nicht geboren …«
Mehr als eine Stimme unterbrach ihn. »Wir wollen aber nicht morgen geboren werden. Lass uns in Ruhe und zieh ab!«
»Frei wurden wir geschaffen …«, fuhr er geduldig fort.
»Wir wollen keine Freiheit«, schallte es ihm aus vielen Mündern entgegen. »Zieh ab! Wir wollen unter unseren gütigen Herren leben.«
»Euer Herr ist Gott, und das Paradies liegt zu Füssen der Freiheit.«
»Wir wollen kein Paradies! Lass uns und zieh ab!«
»Das sagt ihr nur, weil ihr den Geschmack der Freiheit nicht kennt. Gebt mir eine Woche Zeit, und ihr werdet selbst sehen, wie ihr auferweckt werdet.«
Einige Augenblicke herrschte allgemeines Schweigen. Als er sich dann anschickte fortzufahren, hielt ihm eine hünenhafte Frau ihr weinendes Baby vor das Gesicht und rief: »Du hast unsere Kinder zu Waisen gemacht und sie der Fürsorge ihrer Väter beraubt.«
»Wir wollen zurück zu unseren Ehemännern«, fuhr eine andere fort.
Der Scheich schwieg. Er hörte das Schluchzen und das Fluchen, und er wusste nur zu gut um die Erbarmungslosigkeit seines Vorhabens, doch er beschloss, nicht auf halben Wege umzukehren. Unter den Frauen erblickte er die Seherin und hörte eine schmerzvolle Stimme: »Wir wollen zurück zu unseren Geliebten. Wir wollen nicht mit Ketten beladen in dein Paradies gehen.«
Mit beiden Händen wischte er sich den Schweiss vom Gesicht und murmelte verzweifelt: »Ich flehe zu Gott. Vertraut auf Gott. Es gibt keine Kraft und keine Macht ausser bei Gott.« Fast wäre er verzweifelt und hätte die Niederlage eingestanden, doch da eilten ihm die Frauen der Notabeln zu Hilfe.
2
Das Elend der Notabelnfrauen hatte eine lange Geschichte. Es ging auf einen Beutezug zurück, den der Stammesführer in den Urwald unternommen hatte. Für die Frauen begann die Katastrophe an jenem traurigen Tag, an dem sein Bote auf dem Rücken eines gazellenschlanken, gescheckten Mehri erschien, um ein Kamel mit Wasserschläuchen zu holen und es den Kämpfern zu bringen, die vom Lager noch etwa eine Tagesreise entfernt waren. Von früheren Fällen, wenn die Reiter von Beutezügen gegen andere Stämme zurückkehrten, wussten die Frauen, dass der Bote nur kam, um ihnen die Ankunft der Kämpfer anzukündigen und ihnen Gelegenheit zu geben, sich für den Empfang der siegreichen Männer angemessen herzurichten. Dann eilen sie, sich Hände und Füsse mit Henna zu färben, sich zu waschen und ihre Körper mit wilden Kräutern zu behandeln und sich mit dem kostbaren Têdit-Parfüm wohlriechend zu machen, diesem Parfüm, das sie sich ausborgen und dessen Fläschchen, speziell für derlei Gelegenheiten versteckt, bei allen verheirateten Frauen im Lager die Runde macht. Auch an jenem Tag geschah es so.
Sie legten ihre prächtigsten Gewänder an: die leuchtendweisse Rafeghat, darüber den blauen Târi, am Schluss den purpurnen Tabarekamt-Mantel. An hennagefärbten Fingern leuchteten silberne Ringe. An allen Ohren baumelten Gehänge. An schlanken Handgelenken klingelten Armreife. Und bunte Perlenketten hingen um jeden Hals. Goldschmuck vermieden sie mit Bedacht, wegen des Unheils, das dieses satanische Metall anzieht. Sie richteten die Trommeln und hielten ihre Zungen für die Jubeltriller und ihre Kehlen für die sehnsuchtsvoll traurigen Lieder bereit.
Alle gingen früh hinaus. Der prächtige Zug bewegte sich über die nackten Hügel und die akazienbestandenen Wadis nach Süden bis an jenen Punkt, wo sich die Gipfel des Akakûs-Gebirges trutzig gen Himmel erheben. Doch wie gross war ihr Erstaunen, als sie die Beute in ihrem ganzen Ausmass erblickten. Neben den Herden von Kamelen, Rindern, Schafen und Ziegen zog ein anderer Zug: eine lange Reihe schwarzer Männer und Frauen, wie das geraubte Vieh getrieben von hünenhaften Gefolgsleuten. Da erstarben auf ihren Lippen die sehnsuchtsvollen Lieder.
Das Monster der Eifersucht erwachte. Es ist ja nicht schwer für eine Frau, die schon im Schatten des Mannes eine Nebenfrau sieht, mit der sie um ihn buhlen muss, die Gefahr zu erkennen, die von den Abessinierinnen, grossen, mythischen Gestalten, für Männer ausgeht, deren schwache Seelen ihr aus Erfahrung bekannt waren. Kam ihnen doch schon eine hochgewachsene Akazie im Licht des Vollmonds wie eine gertenschlanke Paradiesjungfrau vor.
Sie teilten die Beute auf und stritten sich lange um die Gefangenen. Der Stammesführer schaltete sich ein und liess bei der Verteilung seine Weisheit walten. »Die Gerechtigkeit verlangt«, erklärte er, »dass die Entscheidung durch das Los erfolgt; dieses hat, soweit wir wissen, in der Wüste noch nie jemandem Unrecht getan.« Die pompösen Turbane bewegten sich zustimmend, und die Fäuste zitterten an den Schwertknäufen. »Jede Gefangene«, fuhr der Führer fort, »entspricht dem Wert dreier Sklaven. Gibt es dagegen einen Einwand? Also, mit Gottes Segen.«
Als die Verteilung beendet war, begann die Mühsal der Frauen.
Am dritten Tag nach der Rückkehr lud der Stammesführer einen wandernden Fakîh ein und verheiratete ihm eine hünenhafte abessinische Gefangene. Darin sahen die Männer ein Startzeichen, und einer rascher als der andere gingen sie bei den gefangenen Frauen ein, entsprechend dem Gesetz Gottes und seines Gesandten und in Hör- und Sichtweite ihrer Frauen und Kinder.
So bahnte sich das Elend seinen Weg in die Seelen der glücklichen edlen Frauen.
3
Kaum hatten die Frauen nun von der Aufforderung des Fakîh, des Scheichs des Kadirîja-Ordens, gehört, Seele und Sklaven zu befreien, da priesen sie Gott und flehten Ihn an, diesem Messias, den sie schon so lange erwartet hätten, den Sieg zu verleihen, damit er die Männer zur Vernunft und auf den rechten Weg zurückbringe und sie selbst von der Tyrannei der schwarzen Nebenfrauen befreie.
Einige Notabelnfrauen suchten das Zelt der Dhikr-Sitzungen auf, wo eine von ihnen das Wort ergriff. »Ich hatte in der Illusion gelebt, frei und edel zu sein, und niemals geglaubt, eines Tages könnte ich Sklavin einer schwarzen Gefangenen werden.«
Eine andere bestätigte ihre Worte. »Wir hatten angenommen, Herrinnen zu sein, doch dann sind wir niedrige Sklavinnen geworden.«
Da rief der Scheich erleichtert aus: »Ich suche Vergebung bei Gott! Wir sind doch alle nur Sklaven des Einen, des Einzigen.«
»Nur wir nicht«, klagte weinend eine junge Frau, die wohl erst kurz verheiratet war, »wir sind Sklavinnen des Sklaven.«
»Gott bewahre!«
Wieder ergriff die erste Frau das Wort: »Gefällt es dir etwa, dass die freie Frau Sklavin einer Sklavin wird?«
»Da sei Gott vor! Die Freiheit ist meine Religion. Aber höchst mühsam ist es, dass der Mensch sich selbst befreit.«
»Wir werden dir beistehen. Wir werden dir zur Verfügung stellen, was wir besitzen. Du befiehl, wir werden gehorchen. Wir sind erniedrigt, unsere Ehe ist entweiht worden von den Gefangenen aus dem Urwald. Unser edler Same ist in Gefahr, im Negerblut zu verschwinden, Herr!«
»Ich habe meine Meinung darüber schon in aller Öffentlichkeit gesagt.«
»Gott verleihe deiner Religion den Sieg, o Herr Fakîh!«
Und die ganze Gruppe wiederholte die herzzerreissende Litanei: »Gott verleihe deiner Religion den Sieg, o Herr Fakîh! Möge Gott uns und dich von jedem garstigen Feind befreien! Amen!«
Sie erhoben ihre Hände und sprachen die erste Sure des Korans, die Fâtiha.
So überliefern es die Geschichten, die über jenes geheime Treffen erzählt werden. Doch niemand weiss, ob da nicht noch andere, geheime, Klauseln in jenem Pakt enthalten waren oder ob das, was im Lager verbreitet wurde, nur eine der vielen Übertreibungen ist, die man in derlei Fällen kennt.
Sicher ist jedenfalls, dass sich am folgenden Tag die Gaben über das Zelt der Dhikr-Sitzungen nur so ergossen. Der Fakîh empfing Ringe, Reife und Silberschmuck. Gefolgsleute und Jünger brachten ihm Nahrungsmittel und Speisen. Ganze Bollwerke aus Säcken mit Weizen, Gerste, Zuckerrohr, Mais und Datteln. Junge Mädchen kamen mit Töpfen voller Kuskus auf dem Kopf. Und bis heute weiss niemand, welchen Zauber die edlen Herrinnen benutzten, um das Heer der Sklaven zu überreden, dem Fakîh gehorsam zu sein und die Befreiung zu akzeptieren. Aber alle fanden es, wegen der allgemein bekannten Feindschaft zwischen der Seherin und dem Fakîh, abwegig, Têmet könnte eine magische Rolle gespielt haben.
Der Scheich errichtete draussen in der Wüste hinter dem Brunnen ein Lager für seine neugewonnenen Anhänger. Einige Tage später war man im Stamm überrascht, als er die Fâtiha las und vierundzwanzig junge Männer, alle aus dem Kreis seiner Jünger, verheiratete und sie als Ehemänner den freigelassenen schwarzen Sklavinnen zuführte. Diese Verehelichungsaktion setzte er fort, bis die meisten Gefolgsleute hübsche Frauen erhalten hatten. Bald war nur noch eine geringe Anzahl der stolzen Abessinierinnen übrig, die freiwillig im Zelt der Dhikr-Sitzungen Dienst taten und den Scheich inständig baten, sie als Sklavinnen anzunehmen. Wie ein Lauffeuer gingen Gerüchte um, wonach sie nichts anderes seien als seine Konkubinen. Bösartige Gerüchte, die die Eifersucht der Notabeln, ihrer ehemaligen Ehemänner, weckten, die daraufhin vom Stammesführer verlangten, die Angelegenheit mit dem Schwert regeln zu dürfen. Doch der weise Mann beschämte sie, indem er ihnen in aller Ruhe sagte: »Wer zu Beginn akzeptiert, in einem Spiel Partei zu sein, muss am Ende auch die Ergebnisse ertragen.«
Der Überraschungen waren aber noch mehr. Denn kaum war der Stamm erwacht (besonders die Männer des Stammes), als die Notabeln auch schon einen Schlag erhielten, der für sie schlimmer war als alles Bisherige.
4
Von Anfang an begriffen sie, dass er es darauf angelegt hatte, ihren Stolz zu treffen. Er lud sie ins Zelt der Dhikr-Sitzungen, das inzwischen zum Zentrum des Lagers der Helfer geworden war, und liess sie am Eingang auf dem Boden Platz nehmen. Keiner wagte zu protestieren. Vielleicht spürten sie, dass schon ein Protest eine weitere Stufe auf der Treppe des Abstiegs bedeuten würde. Denn die Erniedrigung richtet sich nicht gegen dich, solange du sie nicht zur Kenntnis nimmst und die Aufmerksamkeit anderer darauf lenkst. So steht es im Sprachschatz der Nobilität. Sie übergingen schweigend die Schande, und selbst der Stammesführer ertrug es geduldig, auf dem nackten Boden neben dem Zeltpflock sitzen zu müssen. Aber ihnen entging nicht das Lächeln, das während der ganzen Sitzung nicht von seinen Lippen wich.
Der Scheich ging weit in der Quälerei. »Meint nicht, dass ich euch schlecht behandle, weil ich die Regeln der Gastfreundschaft nicht kenne«, erklärte er. »Nein, ich habe euch ganz bewusst auf der Erde am Eingang des Zeltes Platz nehmen lassen, damit ihr eine Erniedrigung kostet, die noch gestern das Geringste war, was eure Sklaven und Gefolgsleute von euch ertragen mussten.«
Der Hinweis auf die Erniedrigung bestätigte diese. Die Schande hing ihnen auf immer an. Der Stammesführer versuchte, die Situation durch seine Weisheit zu retten. »Bisher sehe ich keinen Grund, dass wir uns erniedrigt fühlen müssten. Unter unseren Gefolgsleuten und unseren Sklaven auf dem nackten Boden zu sitzen hat schon immer zu unseren Gepflogenheiten gehört. Wir, geschätzter Fakîh, sind bereit, jedweden Preis zu entrichten, der geeignet ist, unsere Seelen zu befreien und uns in die Grundlagen der Religion einzuführen.«
»Gut gesprochen! Gut gesprochen!« rief der Scheich. »Warum übernehmt ihr nicht die Weisheit eures weisen Stammesführers und folgt seinem Beispiel? Das erste, dessen sich entledigen muss, wer an die Religion der Wahrheit und der Erlösung glaubt, sind Hochmut und Stolz. Stolz steht allein Gott in den Himmeln zu, und Überheblichkeit über die Knechte Gottes ist ein Charakteristikum des vermaledeiten Satans. Nie wird jemandem die Erlösung zuteil, in dessen Herz auch nur ein Körnchen Hochmut oder Falsch ist.«
Er schwieg eine Zeitlang. Die Notabeln blickten sich an. Dann sprach er weiter: »Mit den pompösen Turbanen und den Pfauenkleidern werden wir uns in Bälde beschäftigen. Heute habe ich euch für etwas Wichtigeres hergebeten.«
Eine abessinische Sklavin brachte ihm einen Becher Dickmilch. Er trank zwei Schluck und wischte sich danach den Mund mit dem Ende seines schäbigen Gesichtstuchs ab.
»Nachdem ihr euer Haus vom Verbotenen gereinigt habt«, fuhr er fort, »müsst ihr nun euern Besitz reinigen und die Almosensteuer entrichten.«
Das Schweigen wurde gespannter. Eine Fulât-Sklavin kam und bot ihnen Tee an. Keiner brachte auch nur einen Schluck hinunter. Sie pflanzten die Becher vor sich in die Erde und starrten auf die Schaumbläschen.
Schliesslich nahm der Stammesführer seinen Mut zusammen und wandte ein: »Wir haben die Erfüllung dieser Pflicht nie versäumt. Wir haben zu jedem Fest die Almosensteuer entrichtet.«
Der Scheich schien diesen Einwand erwartet zu haben. »Die Almosensteuer zu Festen ist eine Sache«, erklärte er, »diejenige zur Reinigung des Besitzes eine andere. Das Geld hinzugeben ist das Geringste für jemanden, der seine Seele vor dem Satan retten möchte. Ich glaube nicht, dass unter euch ein einziger Reicher ist, der mit seinem Geld auf dem Wege Gottes knausrig sein will.« Er griff in seine Tasche und holte ein kleines Heft heraus, aus dem er die Einzelheiten des erstaunlichen Gesetzes vorlas, das die Errichtung eines Schatzhauses ebenso vorsah wie die geregelte Erhebung von Steuern aus Einkünften und Vieh, ausserdem weitere Abgaben, die Handelskarawanen zu entrichten hätten.
5
Die Notabeln befürchteten Schlimmes für die Zukunft des Stammes. Es bedrückte sie zu sehen, wie das tyrannische Gesetz seinen Weg zur Verwirklichung nahm und so die tatsächlichen Befugnisse an den gerissenen Scheich übergingen. Sie wiesen darauf hin, dass die Verwirklichung dieses Gesetzes einen Angriff auf die Herrschaft des Stammesführers und seine Machtbefugnisse bedeutete. Doch dieser sagte zu ihnen im Ratszelt: »Nur der Wahnsinnige stellt sich dem Strom entgegen.«
Der Stammesführer ertrug die Heimsuchung am gefasstesten von allen. Er sprach viel von der Notwendigkeit, um der Erlösung und der Erlangung des Paradieses willen mit allen Besitztümern Opfer zu bringen. Ihn erschreckte nicht, wie gebrochen sie waren, und auch nicht die Niederlage, die aus ihren Augen sprach. Einer von ihnen wurde unwillig. »Wir haben ihm unsere Kinder gegeben, damit er sie im Koran und in den Grundlagen der Religion unterweise, und er hat aus ihnen Gefolgsleute und Jünger für sich gemacht.«
»Er hat aus ihnen ein Heer von Helfern gemacht, die gegen uns kämpfen sollen«, pflichtete ihm ein anderer bei.
»Er hat die Sklaven gegen uns aufgehetzt«, rief ein dritter. »Und er hat uns gezwungen, uns von den Frauen zu trennen, die wir mit dem Schwert erobert haben. Die Religion sagt: ›Und was eure Rechte besitzt.‹ Wie kann da einer behaupten, für die Religion des Propheten zu werben, während er zur Scheidung aufruft, die Gott von allem Erlaubten am verhasstesten ist?«
Als der Stammesführer lächelte, klagte ein vierter. »Aber damit nicht genug, er ist noch weiter gegangen und hat uns unsere Ehefrauen gestohlen.«
»Welche Schande!«
Nun nahmen die Eiferer ihren Mut zusammen und riefen: »Angesichts dieses Schwindlers nützt nur das Schwert. Nur Blut tilgt diese Schande.«
Und einer der edlen Scheiche sagte provozierend: »Ihr habt noch entwürdigendere Taten übersehen. Habt ihr vergessen, dass er die Absicht hegt, euch nach all dem auch noch euren Besitz zu rauben?«
Langes Schweigen. Dann ereiferte sich ein junger Mann, dessen Haupt ein prächtiger Turban krönte. »Und schlimmer als all das, er will unsere Häupter ihrer Verhüllung berauben, und das unter dem Vorwand, den Hochmut und die Hochmütigen zu bekämpfen. Ich möchte lieber sterben, als im Lager entblössten Hauptes umherzugehen wie die Sklaven aus dem Urwald.«
»Jawohl«, fuhr ein würdiger Notabler fort, »uns ist kein Zeichen unserer Manneswürde geblieben.« Er wandte sich an den Stammesführer. »Wie kannst du, Hochverehrter, wollen, dass wir zu all dem schweigen? Wir sind jetzt Sklaven, ja, wir sind schlimmer dran als der jämmerlichste Sklave.«
Über ein Symbol gebeugt, das er mit dem Finger in den Staub zeichnete, antwortete Âdda ruhig: »Begehrt ihr denn das Paradies ohne einen Preis?«
»Wir wollen kein Paradies um den Preis der Erniedrigung. Da ist der Tod ehrenvoller«, schrie einer, und zornerstickte Stimmen riefen: »Die Ehre ist verloren. Da ist der Tod ehrenvoller.«
In diesem kritischen Augenblick erhob sich ein Mann, der während der ganzen Versammlung schweigend in einer Ecke gesessen hatte. Er trat vor und offenbarte ein Geheimnis. »Vor einigen Tagen begegnete ich auf den Weiden des Tassîli einem Fakîh. Und wisst ihr, was er über die Religion unseres Fakîh gesagt hat?« Er erfasste alle anwesenden Notabeln mit einem Blick und flüsterte dann: »Er sagte, er werbe für die Religion der Magier.«
»Die Religion der Magier?!« erkundigte sich der Stammesführer überrascht.
Die Notabeln aber waren unfähig, etwas dazu zu sagen.
6
Der Stammesführer fühlte sich einsam, von allen verlassen und vergessen. Darum bat er den Scheich des Ordens um Erlaubnis, in die Hammâda-Wüste zu gehen.
Der Scheich dagegen brachte die Wege der Karawanen unter seine Kontrolle und verdoppelte die von den Händlern verlangten Abgaben; ausserdem bekriegte er die anderen Stämme, machte Überfälle in den Dschungel und raubte Gefangene, Sklaven und Herden. Doch dabei unterlief ihm ein fataler Fehler: Er soll von den Händlern der Karawanen aus Timbuktu ein Geschenk angenommen haben, ein Kästchen voller Goldstaub.
Bis heute weiss niemand, wie dem weisen Scheich entgangen sein konnte, was es mit diesem unheilvollen teuflischen Metall auf sich hat. Einige elende Kreaturen boten eine Geschichte herum, wonach die Seherin ihm diese Falle gestellt hatte und jener Händler ihr nur als Instrument diente, um den magischen Talisman in die Hand ihres alten Widersachers gelangen zu lassen. Auch hätten die Leute das rätselhafte Kästchen nicht mit einer solchen Aura des Besonderen umgeben können, hätte der Scheich selbst das Geschenk nicht wie einen Talisman behandelt. Er trug es bei sich, wohin auch immer er ging. Ja, er schob es unter sein Kopfkissen, wenn er sich zur Ruhe legte, und oft beobachteten ihn seine Helfer und seine Jünger, wie er sich das Kästchen während der Dhikr-Sitzungen unters Gesäss schob. Das überraschte seine Gefolgsleute, die bei ihrem Scheich keine Liebe zu Schätzen und zu deren Anhäufung gekannt hatten. Im Gegenteil, oft hatte er materiellen Besitz ebenso verflucht wie diejenigen, die sich ihm unterwarfen, und verschiedene Aussprüche wurden von ihm überliefert, in denen das gelbe Metall als Wurzel allen Übels der beiden Welten beschrieben wurde. Seine Jünger waren verunsichert und sagten oft, dieses Kästchen berge noch ein anderes Geheimnis als den unheilvollen Goldstaub.
Schliesslich kam der Tag des Auszugs nach Timenôkalen. Es war der Tag, an dem die unbekannten Mächte einen Schlag gegen das Reich des Scheichs führten und es ein für allemal beseitigten. Alle, die diese seltsame Schlacht überlebten, wurden zu Derwischen und verloren den Verstand oder versanken in ewigem Schweigen und verloren ihr Gedächtnis.
Dem denkwürdigen Tag voraus gingen umfassende Vorbereitungen für einen Kriegszug, von dem der Scheich behauptete, er werde die Geschichte der Wüste verändern. Doch wie es seine Gewohnheit war, wenn er seine schicksalhaften Entscheidungen traf, gab er keine Einzelheiten preis.
Oft haben seine Feinde in dieser Politik der Geheimniskrämerei und der Verdunklung das Geheimnis seines Erfolges gesehen. Auch bei diesem Kriegszug, dem die geheimnisvollen Mächte nicht bestimmt hatten, dass er erfolgreich sei, glaubten die Kämpfer, er werde sich nach Süden richten, gegen den Dschungel, doch im letzten Augenblick überraschte sie der Scheich mit einem anderen Plan. Es kam der Befehl, kehrtzumachen und nach Nordwesten zu ziehen. Und beim Îdenan, dem Irrenden Gefährten, teilte sich das Heer und umschloss, vorbeimarschierend, den rätselhaften, einsamen Berg und umklammerte die himmlischen Türme auf den Gipfeln, ein endloser Zug von Menschen, beladen mit den mörderischsten Waffen der Wüste, der sich in die weite Wüste ergoss, einem unbekannten Feind entgegen.
Beim Brunnen von Timenôkalen hielt man an, und der Scheich befahl, die Wasservorräte aufzufüllen und den Tieren Gelegenheit zu geben, sich zu erholen und sich ebenfalls mit Wasser zu versorgen, in Vorbereitung der Fortsetzung der geheimnisvollen Reise.
In diesem Augenblick vernahmen sie ein Getöse, ein Sturm kam auf, und das Gemetzel begann. Unbekannte Feinde, deren Gesichter niemand sah und gegen die es keinen Widerstand gab, erhoben die Schwerter wider sie und schlachteten sie ab wie Schafe. Der Scheich war der erste, der fiel. Auch durch Flucht konnte sich keiner retten, und selbst die wenigen, die entkamen, waren so gut wie tot. Das Heer aus dem Reich des Unbekannten, nahm man an, habe die Körper auf der Suche nach noch lebenden Verwundeten durchkämmt, darauf bedacht, alle, in deren Brust noch ein Quentchen Leben war, vollends zu erledigen. Niemand wusste, wer jene Soldaten waren, auch nicht, was sie wollten, und niemand erfuhr, ob der Scheich das Heer zusammengestellt hatte, um sie zu bekämpfen, oder ob es andere Feinde waren. Was die in den Zelten zurückgebliebenen Scheiche, die Krankheit oder Alter gehindert hatte, sich dem Heer anzuschliessen, ratlos machte, war das Fehlen jeglicher Spur dieser Feinde. Sie waren verschwunden, wie sie gekommen waren. Aus dem Nichts aufgetaucht und ins Nichts zurückgekehrt. Und was alle besonders beschäftigte, war das Verschwinden des Kästchens.
Deshalb war es nicht abwegig, dass man die Katastrophe auf den verfluchten Staub zurückführte.
7
Âdda, der Stammesführer, kehrte aus seinem Exil in der Hammâda zurück. Er sammelte seine noch verbliebenen Anhänger und die Helfer und Scheiche, die ihm die Treue bewahrt hatten, um sich und sass mit ihnen einige Tage zusammen. Danach kehrten die Ausgewanderten und die Exilierten, die in der Wüste verstreut waren, in die Ebene zurück. Und der Stammesführer herrschte nach der Sitte der Wüste und der alten Tradition.
III. Der Gesandte
Und Kain erkannte sein Weib, die ward schwanger, und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch.
Das Alte Testament. Das Buch Genesis 4,17
1
Der durchsichtige Turban, mit dem sich der Irrende Îdenan das Haupt verhüllte, wurde finsterer und senkte sich von der obersten zur dritten Stufe in himmlischer Höhe. So beraubte ihn der Kibli aus dem Süden seiner Majestät, seiner Rätselhaftigkeit und seines Hochmuts und zwang ihn, sich mit Demut zu schmücken und es seinem niedrigeren südlichen Kollegen gleichzutun.
Über der Ebene schwebte finster brütend eine Wolke. Sie verweilte einige Tage. Dann brachte der Horizont Staubschwaden hervor. Am ersten Tag fegten sandlose Windstösse dahin, aus verschiedenen Richtungen. Die Sandkörner blieben irgendwo in der Luft und fielen erst am zweiten Tag von den unbekannten Himmeln herab. Gleich der erste Wind riss die Zelte im Lager nieder, liess Kleider und pompöse Turbane davonfliegen, füllte Münder, Ohren und Augen, warf Greise und Kinder zu Boden und zerstreute die Herden.
Am Morgen erinnerte er sich einer alten Arglist und begann, den Brunnen zu verschütten.
In der Senke versammelte sich um die Öffnung herum eine Anzahl Männer. Einige baumelten an einer Leiter aus Palmfaserstricken im Brunnen. Ein Korb, mit dem sie den feuchten Sand vom Grund des Brunnens hochholten, wanderte von Hand zu Hand. Andere waren ausserhalb des Brunnens damit beschäftigt, Befestigungen aufzuschütten und um die Brunnenöffnung einen Mauerring zu errichten, der aussah wie die Gräber der Ahnen. Von der Senke zum Berg im Süden zog sich eine lange Reihe aus Sklaven und Gefolgsleuten mit entblössten Armen, die Steine heranschafften, sie von Hand zu Hand bis in die Senke weiterreichend.
Auf dem Hügel stand, in blauem Gewand, Ocha. Die Hand am Schwertknauf, verfolgte er, wie ein Gespenst vom Besessenen Berg, die Arbeit der Männer. Der Wind blähte in provozierenden Attacken sein weites Gewand, trieb es nach unten, dann wieder nach hinten in die Höhe. Aber seine Rechte liess nicht den Schwertknauf los. Er schien drauf und dran, angesichts des Windes die Waffe zu zücken.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!