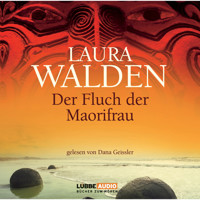9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Mutterseelenallein kommt die junge Deutsche Eva Schindler 1930 nach Neuseeland, wo sie bei entfernten Verwandten leben soll. Sie wird dort wenig freundlich aufgenommen. Doch bald verliert sie ihr Herz an den attraktiven Adrian und gewinnt das Vertrauen seiner Großmutter Lucie, die von den Maori abstammt. Nach Jahrzehnten des Schweigens vertraut Lucie der jungen Eva ihre Lebensgeschichte an - eine Geschichte über Mord, Entführung, Liebe und Verrat, die Eva immer mehr in ihren Bann zieht...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. TEIL
POVERTY BAY, DEZEMBER 1867
ZUG NACH NAPIER, DEZEMBER 1930
NAPIER, DEZEMBER 1930
NAPIER, DEZEMBER 1930
NAPIER, DEZEMBER 1930
NAPIER, DEZEMBER 1930
HAVELOCK NORTH, JANUAR 1868
MEEANEE, HAWKE’S BAY, APRIL 1868
MEEANEE/HAWKE’S BAY, APRIL 1868
NAPIER, DEZEMBER 1930
NAPIER, DEZEMBER 1930
NAPIER, NOVEMBER 1868
MEEANEE, NOVEMBER 1868
NAPIER, DEZEMBER 1930
MEEANEE, DEZEMBER 1868
NAPIER, DEZEMBER 1868
NAPIER, 25. DEZEMBER 1930
NAPIER, 25. DEZEMBER 1930
NAPIER, DEZEMBER 1868
NAPIER, ENDE JANUAR 1931
NAPIER, JULI 1875
NAPIER, JULI 1875
NAPIER, 3. FEBRUAR 1931
NAPIER, 3. FEBRUAR 1931
NAPIER, 3. FEBRUAR 1931
NAPIER, OKTOBER 1876
NAPIER, NOVEMBER 1885
NAPIER, 4. FEBRUAR 1931
NAPIER, FEBRUAR 1931
NAPIER, FEBRUAR 1931
2. TEIL
MEEANEE/NAPIER, FEBRUAR 1933
MEEANEE/NAPIER, APRIL 1933
MEEANEE, APRIL 1933
NAPIER, APRIL 1933
MEEANEE, MAI 1933
MEEANEE, MÄRZ 1888
MEEANEE, MAI 1933
NAPIER, MAI 1933
NAPIER, JANUAR 1905
NAPIER, DEZEMBER 1908
NAPIER, DEZEMBER 1908
NAPIER, JULI 1933
NAPIER, DEZEMBER 1908
NAPIER, DEZEMBER 1908
WELLINGTON, AUGUST 1933
WELLINGTON, AUGUST 1933
NAPIER, DEZEMBER 1908
NAPIER, 25. DEZEMBER 1908
WELLINGTON, AUGUST 1933
WELLINGTON, AUGUST 1933
NAPIER, JULI 1909
NAPIER, DEZEMBER 1909
POVERTY BAY/TOLAGA BAY, OKTOBER 1933
Über die Autorin
Laura Walden studierte Jura und verbrachte als Referendarin viele Monate in Neuseeland. Das Land fesselte sie so sehr, dass sie nach ihrer Rückkehr darüber Reportagen schrieb und den Wunsch verspürte, es zum Schauplatz eines Romans zu machen. In der Folge gab sie ihren Berufswunsch Rechtsanwältin auf und wurde Journalistin und Drehbuchautorin. Wenn sie nicht zu Recherchen in Neuseeland weilt, lebt Laura Walden mit ihrer Familie in Hamburg. www.laurawalden.de
Laura Walden
DIEMAORI-PRINZESSIN
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Antje Steinhäuser
Titelillustration: © mauritius images/age; © Masterfile/Frank Krahmer
Umschlaggestaltung: Christina Krutz Design
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-2445-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1. TEIL
POVERTY BAY, DEZEMBER 1867
Die große Zeremonie stand unmittelbar bevor. Häuptling Rane Kanahau saß auf seinem Thron aus Palmenblättern und betrachtete zufrieden das geschäftige Treiben, mit dem die Einweihung seiner älteren Tochter vorbereitet wurde. Er selbst hatte den Tohunga-ta-moko, den Tätowierern, das Oko überreicht, jenes verzierte Holzkästchen, das die Farbpigmente aus Awheto und Ngarehu enthielt, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, damit das Moko unverwechselbar sein würde.
Die Tätowierer waren zwei alte Männer, die bereits ihm die Zeichen seiner Herkunft ins Gesicht und auf die Oberschenkel geschabt hatten. Diese unverwechselbaren Muster waren sein ganzer Stolz. An diesem Moko konnte jeder erkennen, dass er nicht nur ein Häuptling, sondern ein großer Herrscher war.
Dieser Tag war ein ganz besonderer. Wie gern hätte Kanahau einen Sohn gehabt, dem er den Thron hätte vererben können, aber die Erfüllung dieses Wunsches hatte der Gott der Fruchtbarkeit ihm und seiner Frau verweigert. Zwei Mädchen hatte er ihnen geschenkt. Nun galt Kanahaus ganze Hoffnung diesem älteren Kind, das einem Jungen beim Fischen und Jagen in nichts nachstand. Würde sie nicht wie eine Tochter aussehen, Häuptling Kanahau hätte sich in der Illusion wiegen können, einen Sohn gezeugt zu haben. Sie war wild und ungestüm. Eine echte Kriegerin.
Wenn er da nur an den Überfall der Feinde vor vielen Jahren dachte. Ahorangi war damals erst elf gewesen und hatte wie ein Mann gekämpft. Er war stolz auf ihren Mut, aber nun wurde es höchste Zeit, dass sie sich auf ihre fraulichen Pflichten besann. Deshalb sollte die Zeremonie am heutigen Tag gleich mit ihrer Eheschließung verbunden werden.
Hehu, der Bräutigam, war Ahorangis Freund seit Kindertagen. Als Sohn eines Kanahau treu ergebenen Häuptlings hatte er stets viel Zeit mit ihr verbracht. Die Wettkämpfe der beiden Kinder waren legendär. Wie Brüder hatten sie sich gemessen, ja, sich sogar die traditionellen Kämpfe mit dem Stock – Mann gegen Mann – geliefert. Dass Hehu mehr für die Prinzessin empfand, war deren Vater allerdings nicht entgangen. Der junge Mann war außer sich vor Freude gewesen, als Kanahau ihm vorgeschlagen hatte, seine Tochter am Tag der Tätowierung zu heiraten. Ahorangi hingegen hatte mit einem heftigen Zornausbruch reagiert. Sie wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen, Ehefrau zu werden, doch ihr Vater hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass die Heirat beschlossene Sache war. Seitdem lief seine Tochter mit finsterer Miene durch das Dorf. Keiner durfte sie ansprechen, und ihren Jugendfreund Hehu würdigte sie keines Blickes mehr. Der junge Mann tat dem Häuptling leid. Immer wieder suchte er Ahorangis Nähe und holte sich eine Abfuhr nach der anderen.
Kanahau stieß einen tiefen Seufzer aus, als sein Blick am abweisenden und stolzen Gesicht seiner Ältesten hängen blieb. Er liebte sie von ganzem Herzen, viel mehr als die um ein Jahr jüngere Harakeke, aber ihre Eigenwilligkeit bereitete ihm auch Sorgen. Würde der feinsinnige Hehu Herr über ihr wildes Wesen werden?
Was ihn jedoch weit mehr beunruhigte als ihr Widerstand gegen die Ehe war ihre offen geäußerte Abscheu vor dem Moko. Sie hatte gebeten und gebettelt, dass man ihr Gesicht mit den Zeichen ihrer Ahnen verschonen möge. Sie hätte es in Kauf genommen, dass man ihre Beine tätowierte, aber dann hätte niemand auf den ersten Blick ihre vornehme Herkunft erkennen können. Und diesem Zweck diente das Zeichen. Das Moko musste ihr Kinn sichtbar zieren.
Ich werde wie ein Mann mit einem Bart aussehen, hatte sie ihrem Vater entgegengeschleudert. Du wolltest doch immer ein Junge sein, hatte er ihr erwidert, aber das hatte sie nicht gelten lassen. Und was sie dann gesagt hatte, das beschäftigte Kanahau noch in diesem erhabenen Augenblick, in dem Ahorangi nur noch wenige Augenblicke von ihrer Einweihung trennten. Sie hatte ihn provozierend gefragt, warum die Engländerinnen kein Moko im Gesicht trügen. Und keinen Zweifel daran gelassen, dass die Pakeha in diesem Punkt zivilisierter seien als die Maori. Ihre Worte hatten Kanahau bis ins Mark getroffen, denn er vermochte keinerlei Vorzüge der Weißen seinem Volk gegenüber zu erkennen.
Kanahau atmete tief durch und versuchte, sich entspannt auf seinem Thron zurückzulehnen. Wovor hatte er Angst? Es konnte gar nichts mehr geschehen!
Die jungen Männer von seinem und Hehus Stamm machten sich bereits fertig, um nach Ahorangis Einweihung einen Haka, den rituellen Tanz der Maori, vorzuführen, während die Tätowierer ihre Werkzeuge vor der Prinzessin ausbreiteten. Es waren Schaber aus den Knochen des Albatros. Kanahau erfüllte der Gedanke, dass die noch blütenzarte Gesichtshaut seine Tochter alsbald rau und voller Narben sein würde, mit Stolz. Er mochte die Pfirsichhaut der Pakeha-Frauen nicht, und er verstand nicht, wie man ein solches glattes, helles Gesicht mögen konnte. Wenn seine Tochter erst als Maoriprinzessin gezeichnet wäre, würde sie solche törichten Vergleiche in Zukunft sicherlich nicht mehr anstellen. Das jedenfalls redete sich Kanahau in diesem Augenblick ein.
Soeben stimmten die Frauen ein Lied an. Ihre Stimmen erfüllten den erhabenen Ort und schallten bis weit über das Meer. Kanahau wischte sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel. Wie sehr er seine Frau vermisste, die vor knapp einem Jahr gestorben war. Sie wäre voller Stolz, wenn sie hätte miterleben dürfen, wie ihre ungestüme Tochter sich nun doch noch zähmen ließ und die Rituale ihrer Ahnen zu respektieren lernte. Vielleicht würde Ahorangi sich unter dem Schutz ihrer Mutter auch immer noch weigern, sich tätowieren zu lassen und zu heiraten. Wenn es nach Kanahau gegangen wäre, hätte man diesen Tag nämlich bereits vor zwei Jahren gefeiert, aber seine Frau Ihapere hatte sich stets vor ihre Tochter gestellt und ihren Mann vertröstet. Nicht bevor sie sechzehn wird, hatte Ihapere gefordert. Inzwischen war Ahorangi siebzehn Jahre alt und in den Augen ihres Vaters so reif wie eine Süßkartoffel, die zu lange im Vorratshaus gelagert hatte.
Kanahau wollte noch einen letzten Blick auf ihr kindlich reines Gesicht werfen. Sie sah ihrer Mutter verblüffend ähnlich. Wenn er daran dachte, wie vehement sein Vater sich seinerzeit gegen die Hochzeit seines Sohnes mit der »Schmalgesichtigen« – so hatte er seine zukünftige Schwiegertochter zeitlebens genannt –, ausgesprochen hatte. Kanahau aber hatten genau diese – für eine Maorifrau außergewöhnlich zarten – Gesichtszüge magisch angezogen. Doch Ihapere hatte ein Moko am Kinn besessen, das sie voller Stolz getragen hatte. Und genau dort würden die Tohunga-ta-moko seiner Tochter das Moko in die Haut ritzen.
Plötzlich brach der Gesang der Frauen ab; Schreie wurden laut.
Kanahau wandte erschrocken den Blick von seiner Tochter ab. Eine Gruppe von Reitern bahnte sich den Weg durch die kreischenden Frauen. Woher diese Männer kamen, wussten nur die Götter. Und noch hatte der Häuptling die Tragweite dieser Störung nicht gänzlich begriffen. Erst als einer der Männer seine Tochter Harakeke packte und auf sein Pferd zog, ahnte er, dass dies ein feiger Überfall war. Er hatte davon gehört, dass liebeshungrige Siedler gelegentlich Maorifrauen raubten, aber wie konnten sie es wagen, es in seinem Dorf und an diesem Tag zu wagen?
Kanahau erhob sich und gab den jungen Männern, die zum Haka aufgestellt waren und auf ihren Tanz warteten, ein Zeichen, sich gegen die Eindringlinge zu wehren. Mit martialischem Gebrüll stürzten sich die Krieger auf die Pakeha und schlugen sie in die Flucht. Unter wilden Flüchen preschten sie im Galopp davon.
Auch Kanahau hatte sich in das Kampfgetümmel gestürzt und war gerade dabei, den letzten der Reiter zu vertreiben, als ein spitzer Schrei ihn herumfahren ließ.
Dem Häuptling stockte der Atem. Der Platz, auf dem soeben noch seine geliebte Tochter Ahorangi gesessen hatte, war von einer Staubwolke eingehüllt, die ein davongaloppierendes Pferd aufgewirbelt hatte. Als die Wolke sich verzog und der Häuptling wieder freie Sicht hatte, stieß er beim Anblick des leeren Palmenthrons einen markerschütternden Schrei aus.
ZUGNACH NAPIER, DEZEMBER 1930
Anfangs hatte Eva noch gebannt aus dem Fenster des Zuges gestarrt. Eine derart wilde Landschaft hatte sie noch nie zuvor gesehen. Bis zu jenem Tag, an dem sie alles hinter sich gelassen hatte, war sie selten aus Badenheim herausgekommen, dieser kleinen pfälzischen Welt mit ihren sanften Hügeln und Weinbergen so weit das Auge reichte. Sie hatte es sich immer gewünscht, eines Tages fortzugehen, aber wie schnell und auf welche Weise ihre geheimsten Träume wahr werden sollten, hätte sie niemals für möglich gehalten.
Das Ganze war jetzt bald ein Vierteljahr her. Niemals würde sie den Abend vergessen, an dem sie bei Kerzenlicht beisammensaßen und der Vater ihnen seinen Plan verkündete. Sie würde auch niemals die Erinnerung daran aus ihrem Gedächtnis streichen können, wie reglos die Mutter die Nachricht von der baldigen Auswanderung aufnahm. Dass sie manchmal stundenlang in ihrem Sessel saß und düster vor sich hinstarrte, daran hatte sich Eva mit den Jahren gewöhnt, aber dass sie nicht aufschrie, weil von ihr verlangt wurde, ihr geliebtes Heimatland von einem Tag auf den anderen zu verlassen, verwunderte Eva sehr.
Sie selbst hingegen hatte ihre Begeisterung kaum verbergen können. Amerika war mehr, als sie je zu hoffen wagte, doch dann bekam ihre Freude einen argen Dämpfer: Nur ihren Bruder Hans wollte der Vater mitnehmen. Seine gemütskranke Frau und seine temperamentvolle Tochter sollten indessen nach Neuseeland zu irgendeiner Cousine reisen.
»Die Fahrkarten, bitte!«, riss sie eine Stimme auf Englisch aus ihren Gedanken. Eva schreckte hoch und wühlte in ihrer Handtasche nach dem Ticket. Das hatte sie sich vom letzten Geld kaufen können, das ihre Mutter als Reisekasse mit aufs Schiff genommen hatte. Eigentlich hätte sie in Auckland abgeholt werden sollen, aber nachdem sie mutterseelenallein bis zum nächsten Tag am Kai gewartet und schließlich ein Telefon gesucht hatte, um ihre Tante anzurufen, war ihr mitgeteilt worden, sie solle den Zug nach Wellington nehmen, in Taumarunui in Richtung Napier umsteigen und sich dort vom Bahnhof zu ihrem Haus in Napier bringen lassen. Sehr freundlich hatte ihre Tante am Telefon nicht geklungen. Dabei hatte sie ihrem Vater einen netten Brief geschrieben, dass man seine Frau und seine Tochter gern für zwei Jahre aufnehme. Auf dem Weingut sei genug zu tun. Da könne man jede Hand gebrauchen.
Nun hatten sich die Umstände offenbar geändert, denn von einem Haus in der Stadt war nie zuvor die Rede gewesen.
»Träumen Sie?«, hörte sie den Schaffner fragen.
»Nein, hier ist das Ticket!«, erwiderte Eva hastig auf Englisch.
»Woher kommen Sie?«
Eva zuckte zusammen. Hörte man es etwa, dass sie aus Deutschland kam? Dabei hatte sie doch so fleißig gelernt. Die ganze Überfahrt hatte sie nichts anderes getan, als auf ihrem Etagenbett zu hocken und sich in die Bücher zu vertiefen. Sie wollte auf keinen Fall als sprachloses Dummchen am anderen Ende der Welt ankommen.
»Ich bin aus Deutschland«, erwiderte Eva zögernd.
Ein Strahlen huschte über das Gesicht des Schaffners.
»Ich hab’s gewusst. Und ich müsste lügen, wenn ich nicht gleich herausgehört hätte, dass Sie aus der Pfalz kommen.«
Evas Miene erhellte sich ebenfalls. Sie nickte eifrig. »Ja, aus Badenheim!«
Der Mann kratzte sich den Bart. »Kenn ich nicht, aber ich bin auch schon über vierzig Jahre hier. War noch ein Kind, als wir ausgewandert sind …« Er stockte und musterte sie prüfend. »Hat man Sie ganz allein um die Welt geschickt?«
»Nein, mit meiner Mutter; die ist allerdings unterwegs gestorben …«
Tränen traten ihr in die Augen; sie konnte nichts dagegen tun. Es lag wohl an diesem fremden Mann, der die ihr vertraute Sprache sprach. Hinzu kam die schmerzhafte Erinnerung an den Tag, an dem ihre Mutter nicht mehr aufgewacht war. Es stand ihr so lebendig vor Augen, als wäre sie wieder auf dem Schiff.
»Die wird nicht mehr!«, hatte sich eine alte Frau aus dem Stockbett nebenan mitleidlos eingemischt, nachdem Eva den leblosen Körper ihrer Mutter wie eine Irre geschüttelt hatte.
Spätestens in jenem Augenblick hatte sie gewusst, dass die Alte die Wahrheit sprach, aber sie wollte sich ihr nicht stellen. Sie stürzte aus dem Saal mit den Doppelstockbetten und schrie nach Doktor Franke. Der begleitete sie sofort zum Bett der Mutter, die er recht gut kannte, hatte sie sich doch während einer schlimmen Grippewelle, die unter den Passagieren wütete, freiwillig bei ihm als Helferin gemeldet. Eva und sie halfen unermüdlich, die Kranken zu betreuen. Immer in der Angst, sie könnten sich selber anstecken, aber sie bekamen nicht einmal einen Schnupfen. Inzwischen war die Epidemie an Bord überstanden und hatte nur wenige Opfer gefordert.
Der grauhaarige Arzt wurde weiß um die Nase, als er sich zu Martha Schindler hinunterbeugte.
»Ihre Mutter ist tot«, sagte er, nachdem er sie untersucht hatte.
»Gestern war sie noch völlig gesund! Sie hatte keine Anzeichen der schrecklichen Grippe. Und sie leidet nicht unter einem schwachen Herzen. Das kann doch gar nicht sein!«, widersprach Eva verzweifelt.
Doktor Franke machte ein Zeichen, dass sie ihm nach draußen folgen sollte, denn mittlerweile waren die neugierigen Blicke sämtlicher mitreisender Damen auf Eva und den Doktor gerichtet.
Eva ließ sich aus dem Schlafsaal hinausschieben. Sie hatte immer noch nicht begriffen, was geschehen war.
»Ich habe mich schon gewundert, wer uns das Veronal gestohlen hat, aber hier ist das leere Röhrchen.« Der Doktor hielt es hoch.
»Wo haben Sie es her?«
»Es lag unter der Bettdecke Ihrer Mutter. Ich habe es eben gefunden, als ich sie abgehorcht habe. Sie müssen jetzt tapfer sein: Ihre Mutter hat sich umgebracht.«
»Sie hat es schon einmal versucht«, hatte Eva kaum hörbar erwidert. Ihr Vater hatte ihr einmal erklärt, dass es mit Marthas Schwermut kurz nach ihrer Geburt losgegangen sei.
Der Schaffner hatte sich inzwischen neben Eva auf die Bank gesetzt und den Arm um sie gelegt. Als sie begriff, dass dieser fremde Mann sie zu trösten versuchte, schluchzte sie laut auf. Endlich konnte sie weinen. Die ganze Zeit seit dem furchtbaren Tag war sie wie versteinert gewesen.
»Nädd draurig sin, Maat«, hörte sie den Schaffner wie von ferne raunen, doch sie konnte nichts dagegen tun. Es musste sein. Endlich! Alle hatten sich gewundert, dass sie keine Träne vergossen hatte, während der Kapitän den Leichensack mit ihrer Mutter ins Meer gekippt hatte. Sie aber hatte nicht weinen können. Ihr Inneres war wie erstarrt gewesen.
Erst in diesem Augenblick, als sie an einen fremden bulligen Mann aus ihrer Heimat gelehnt war, trauerte sie darüber, dass sie ihre Mutter verloren hatte und allein in einem fremden Land war.
Ich werde Vater schreiben, damit er mir das Geld für eine Fahrkarte schickt, dann sehe ich die beiden bald wieder, redete sie sich gut zu. Und nicht erst in zwei Jahren, wie ihr Vater es sich vorgestellt hatte.
In zwei Jahren habe ich genug Geld zusammen, sodass wir unsere Hänge wieder bewirtschaften und vom Weinverkauf leben können, hatte er versprochen, aber bis dahin könnt ihr nicht auf diesem heruntergekommenen Stück Land hausen, das einmal ein ertragreiches Weinland gewesen war.
Nach dem Krieg war es mit dem Weingut ständig bergab gegangen. Zum einen war der Vater mit einer Kriegsverletzung heimgekehrt und zum anderen hatte er sich früh den Separatisten um Heinz Orbis angeschlossen. Sein Traum war eine freie Pfalz mit Anlehnung an Frankreich gewesen. Doch der Rückhalt in der Bevölkerung für diese Bewegung war nicht eben groß gewesen. Peter Schindler hatte sich zwar noch rechtzeitig von den Separatisten losgesagt, um nicht mit seinem Leben zu büßen, aber in den Augen der französischen Besatzer war er politisch unzuverlässig, und von den Hilfen der Bayrischen Landesregierung bekam er gar nichts. Der Bürgermeister überging den frankophilen Querkopf, wie Peter Schindler im Dorf genannt wurde. Mit dem Ergebnis, dass er Weinberge verkaufen musste und vom Rest seine Familie nicht mehr hatte ernähren können. Er hatte sich allerdings geweigert, das Anwesen zu verkaufen. Stattdessen hatte er für die Tickets nach Amerika und Neuseeland sämtliche Schmuckstücke versetzt, die ihm seine Mutter einst vererbt hatte. Und das waren nicht wenige gewesen, denn das Weingut Schindler hatte unter seinen Eltern weitaus bessere Zeiten gesehen.
Eva schreckte aus ihren Gedanken, als der Schaffner sich entschuldigend erhob. Er müsse weiter. Allerdings nicht, ohne sich nach ihrer Bleibe in Napier zu erkundigen. Als sie die Adresse in der Cameron Road nannte, pfiff er durch die Zähne und erklärte ihr, dass dies eine Straße wäre, in der es nur große, alte viktorianische Villen gebe. Dort habe man Geld, fügte er augenzwinkernd hinzu.
Eva dankte dem freundlichen Mann. Wenn er wüsste, wie gleichgültig ihr war, wohin sie kam. Sie würde eh nicht lange bleiben. Sie war nur von einem Gedanken besessen: ihrem Vater einen Brief zu schreiben, sobald er seinerseits die Adresse geschickt hatte, um ihn zu bitten, sie nachkommen zu lassen.
Wenn ich diese Reise überlebt habe, werde ich auch noch gesund von hier nach Amerika gelangen, dachte sie und setzte sich aufrecht hin. Draußen schien die Sonne, und im Zug wurde es langsam warm. Eva zog ihren dunklen Wollmantel aus, der sie seit Beginn der Reise begleitete. Ihr Vater hatte ihn ihr in Hamburg gekauft. Dort hatten sie einige Tage in einer schäbigen Unterkunft auf die Abfahrt ihrer Schiffe warten müssen. Auch das würde sie nie vergessen: Wie ihre Mutter und sie auf dem riesigen Dampfer gestanden und ihrem Vater und Bruder zugewunken hatten, bis diese eins mit der gesichtslosen Menge geworden waren, die am Kai Abschied von ihren Verwandten nahm.
In ihrer ersten Nacht auf dem riesigen Auswandererdampfer hatte Eva sich in den Schlaf geweint, um dann keine einzige Träne mehr zu vergießen – bis heute. Der Zug durchquerte soeben eine Landschaft aus Bergen und grünen Wiesen. Die Berge waren höher als zu Hause und die Wiesen grüner. Eva drückte sich die Nase an der Scheibe platt. Selbst die Sonnenstrahlen, die das Land in ein warmes Licht tauchten, kamen ihr kräftiger vor als in Badenheim. Sie wollte auf keinen Fall etwas verpassen. Doch schon kurz darauf ergriff die Müdigkeit mit aller Macht von ihr Besitz. Die Augen fielen ihr zu und ihr Kopf sackte nach vorn auf die Brust.
NAPIER, DEZEMBER 1930
Eva erwachte davon, dass jemand sie kräftig schüttelte. Es war der freundliche Schaffner.
»Schnell, steigen Sie aus. Sonst müssen Sie bis nach Hastings mitfahren!«, rief er aufgeregt, während er ihren Koffer aus dem Netz zerrte und zum Ausgang eilte. Eva sprang auf, griff sich ihren Mantel und die Handtasche und folgte ihm. Kaum war sie auf dem Bahnsteig, setzte sich der Zug auch schon in Bewegung.
»Viel Glück in Ihrer neuen Heimat!«, rief der Schaffner und winkte ihr zu.
Eva hatte nur den einen Koffer, der allerdings so schwer war, dass sie ihn kaum tragen konnte. Als sie auf dem Vorplatz ankam, lief ihr der Schweiß in Strömen aus allen Poren. Das hatte sie bereits bei der Ankunft in Auckland bemerkt. In diesem abgelegenen Teil der Erde herrschten im Dezember sommerliche Temperaturen. Sie hielt Ausschau nach einem Taxi, aber in der Mittagshitze entdeckte sie weit und breit keinen Wagen.
»Da können Sie lange warten«, bemerkte eine vorübereilende Frau. »Am Wochenende fahren kaum Wagen. Die Männer sind alle beim Fischen oder Wandern.«
»Und wie komme ich dann zur Cameron Road?«
»Ganz einfach. Sie gehen die Straße nach links und dann immer geradeaus. Da fragen Sie noch einmal. Es geht ein bisschen bergauf, aber Sie sind ja noch jung! Keine zwei Kilometer. Höchstens fünfzehn Minuten.«
Eva holte tief Luft und überlegte. Vielleicht sollte sie bei der Tante anrufen und sie bitten, dass man sie abholen möge. Doch sie hatte noch immer den unwirschen Ton im Ohr, der ihr aus dem Telefon entgegengeklungen war. Diese Stimme machte ihr keine allzu große Hoffnung auf einen freundlichen Empfang. Was würde die Tante wohl sagen, wenn sie ohne ihre Mutter in der Cameron Road ankam? Entschieden nahm Eva den Koffer und ging nach links, wie die Frau es ihr geraten hatte. Die Strecke schien sich ewig hinzuziehen. Ein kleiner Trost war der atemberaubende Anblick des Meeres, das rechter Hand auftauchte. Aber die Freude darüber konnte Eva schließlich auch nicht mehr von ihren schmerzenden Armen ablenken. Alle paar Minuten blieb sie stehen, um die Hand zu wechseln. Ihre Finger waren jedes Mal schneeweiß, weil das Gewicht des Koffers die Blutzufuhr abquetschte.
Nach einer Weile kam ihr eine alte, dunkelhäutige Frau mit krausem schwarzem Haar, das von grauen Strähnen durchzogen war, entgegen. Ob sie die ansprechen sollte? Sie war unschlüssig, starrte die Fremde aber so durchdringend an, dass diese stehenblieb und unverblümt fragte, warum sie sie so ansehe.
Eva fühlte sich ertappt und kam ins Stottern, als sie der Alten zu erklären versuchte, dass sie aus Deutschland käme und zu ihrer Tante in die Cameron Road wolle.
Ein Lächeln huschte über das Gesicht der Frau.
»Sie haben noch nie zuvor eine Maori gesehen, oder?«
Eva schüttelte den Kopf. »Ich habe in einem kleinen Ort gelebt, bis mein Vater unsere Auswanderung beschlossen hat.« Eva hatte Mühe, die richtigen englischen Wörter zu finden. In der Schule hatte sie kein Englisch gelernt und ihr Eifer auf dem Schiff zahlte sich zwar darin aus, dass sie beinahe alles verstand, aber zum flüssigen Sprechen reichte es noch nicht. Eva war das ein wenig unangenehm. Ebenso wie die Tatsache, dass sie gar nichts über dieses Land wusste. Es wäre ihr ein Gräuel, wenn man sie für ungebildet hielte. Denn ihre mangelnde Ausbildung war ihre Schwachstelle. Wie gern wäre sie nach Mainz oder Worms auf die höhere Schule gegangen wie Inge, ihre Freundin, die Tochter des Bürgermeisters. Doch es war kein Geld da, und sie wurde im Haushalt gebraucht. Einer musste schließlich kochen und sauber machen, wenn ihre Mutter wieder einmal wochenlang nur trübsinnig vor sich hingestarrt hatte.
»Und wo ist deine Mutter?«
Eva blickte die Maori erschrocken an. »Woher wissen Sie, dass ich in Begleitung meiner Mutter erwartet werde?«
Die Maori lachte.
»Weil ich die Schwester von Misses Bold bin.«
»Misses Bold? Ich werde aber von einer Misses Clarke erwartet.«
»Das ist Misses Bolds Tochter.«
»Oh, das hat mein Vater mir gar nicht gesagt, dass Misses Clarkes Mutter im Haus wohnt, aber ich wundere mich sowieso. Ich sollte eigentlich auf ein Weingut kommen und nicht in die Stadt.«
Die Miene der Maori verfinsterte sich. »Das kann ich mir lebhaft vorstellen, dass man Ihrem Vater die gute Lucie unterschlagen hat. Und Misses Clarke heißt auch nicht mehr Misses Clarke, denn sie hat neu geheiratet. Einen Doktor Thomas. Sie heißt also jetzt Misses Thomas.«
»Nein, ich meine … doch schon, ich weiß, dass der Onkel meines Vaters eine Frau hatte, sonst würde es ja Misses Clarke, ich meine, Vaters Cousine, also Misses Thomas nicht geben; wir dachten allerdings, sie sei schon lange …« Eva stockte mit hochrotem Kopf, gerade noch rechtzeitig, um es nicht auszusprechen.
»Sprechen Sie es ruhig aus! Mich können Sie damit nicht schockieren. Sie haben zudem in gewisser Weise recht. Sie ist zwar bei bester Gesundheit, aber sie wird gern auch einmal totgeschwiegen.« Die Maori griff nach Evas Koffer. »O je, das Monstrum sollen wir den ganzen Berg hochhieven? Warum holt Sie Joanne nicht ab. Oder Adrian?«
»Ich … ich habe nicht gefragt, weil sie sich am Telefon so abweisend angehört hat.«
Die Maori lachte wieder laut auf.
»Na, dann lernen Sie die Dame des Hauses erst einmal persönlich kennen.«
Das klingt nicht gerade ermutigend, schoss es Eva durch den Kopf, während sie mit am Griff des Koffers anpackte. Zu zweit trug er sich wesentlich leichter.
»Wer ist Adrian?«, fragte Eva, nachdem sie schon ein kleines Stück bergan gegangen waren.
»Lucies Enkel, Joannes, also Miss Thomas’, Sohn und der von Mister John Clarke. Sein Vater war ein feiner Kerl, aber zu schwach für diese Welt. Er ist mein Patenkind, also Adrian, nicht der Vater, der ist ja auch leider viel zu früh verstorben.«
»Und wie alt ist er. Ich meine, Adrian?«
»Zwanzig und ein echter Prachtbursche. Er wäre ein fantastischer Weinbauer geworden, wenn das nicht alles den Bach hinuntergegangen wäre, aber ihn interessieren ohnehin mehr die alten Häuser …«
Eva hörte der Maori gar nicht mehr zu. Sie hatte ihren staunenden Blick auf die Häuser geheftet, die nun vor ihnen auftauchten. Wenn sie auch wenig über Land und Leute hier wusste, den Baustil, der, je näher sie kamen, umso prächtiger wirkte, kannte sie bis in die Details. Ihre größte Freude war es gewesen, sich bei ihren seltenen Besuchen in Mainz Bücher über Architektur zu besorgen. Das Geld dazu hatte sie sich mit Kinderhüten verdient. Sie bedauerte in diesem Augenblick zutiefst, dass sie das Buch über viktorianische Häuser kurz vor der Abreise hatte hergeben müssen. Auf Wunsch ihres Vaters, der alle Kostbarkeiten im Haus zu Geld gemacht hatte, um die Reisekasse zu füllen.
»Wir sind da! Oder schlafen Sie mit offenen Augen?«
»Entschuldigen Sie, nein, ich bin beeindruckt von den Häusern. Ich liebe diesen Stil, wenngleich er sehr altmodisch ist. Aber es hat alles einen so verspielten Charme. Sehen Sie, allein die verzierten Giebel …«
»Da wird sich Adrian freuen. Der redet von nichts anderem als von alten Häusern. Aber Sie haben recht. Man kann gegen die Pakeha sagen, was man will, Sie haben schon in schönen Bauten gewohnt, als wir noch in fensterlosen Hütten gehaust haben.«
»Pakeha? Wer ist das?«
»Sie zum Beispiel. Sie sind eine Pakeha. Eine Weiße. Wir nannten die ersten weißen Siedler so, und mittlerweile ist das ein ganz gebräuchlicher Begriff geworden und …«
Die Maori wurde unterbrochen, als die Haustür aufging und ein junger Mann mit dunklen Locken freudig auf sie zueilte.
»Tante Ha, sie erwartet dich schon sehnsüchtig. Sie kann dem Trubel im Haus nichts abgewinnen. Und du weißt ja, den medizinischen Künsten des Arztes traut sie auch nicht. Sie lässt sich nur von dir behandeln …«
Der junge Mann stockte, als er Eva wahrnahm. Mit einem Blick auf ihren Koffer sagte er verschmitzt: »Sie sind hoffentlich die unbekannte Großcousine, für die ich mein Zimmer räumen musste. Dann täte es mir nämlich nicht mehr ganz so leid, dass ich das separate Reich am Ende des Flurs habe aufgeben müssen.« Er streckte ihr die Hand entgegen.
»Ich bin Adrian.«
Eva hatte Angst zu erröten. Dass junge Männer so charmant sein konnten, hatte sie nicht für möglich gehalten. In Badenheim hatten zwar mehrere Männer um sie geworben, kein einziger von den Dorfburschen hatte allerdings je ihr Interesse erregt. Und keiner hatte über solche Manieren verfügt und ein derart gewinnendes Lächeln besessen.
Sein Händedruck war angenehm kräftig.
»Ja, ich bin die Cousine aus Deutschland, aber ich bestehe nicht auf Ihrem Zimmer. Meinetwegen können wir tauschen.«
»Kommen Sie, geben Sie mir Ihren Koffer. Sie haben in dem Monstrum hoffentlich ein paar sommerliche Kleidungsstücke. Oder haben Sie darin Ihre Mutter versteckt? Wenn ich richtig informiert bin, erwarten wir Sie beide.«
Eva biss sich auf die Lippen. Nur nicht wieder weinen, redete sie sich gut zu.
»Meine Mutter ist unterwegs gestorben«, sagte sie mit belegter Stimme.
»Aber, warum haben Sie das nicht gleich gesagt, Kindchen?«, bemerkte Tante Ha ehrlich betroffen.
»Können Sie mir meinen dummen Witz verzeihen? Wie sollte ich ahnen, dass Ihrer Mutter etwas zugestoßen ist. Dabei stand es sogar in der Zeitung, dass auf Ihrem Schiff eine Grippeepidemie ausgebrochen war.«
Eva verkniff sich, ihnen mitzuteilen, dass Martha nicht einmal an einem Husten gelitten hatte, als sie sich das Veronal aus der Krankenkabine gestohlen hatte.
»Machen Sie sich keine Gedanken«, erwiderte sie stattdessen. »Meine Mutter war schon vor der Reise sehr krank.«
»Aber Sie müssen erst einmal etwas essen, etwas trinken und sich ausschlafen.« Adrians Stimme klang ernsthaft besorgt.
Dass ein Mann sich um ihr Wohl Gedanken machte, hatte sie noch nie erlebt. Zu Hause hatten stets die Bedürfnisse ihres Vaters und ihres Bruders im Vordergrund gestanden.
Eva folgte Adrian und Tante Ha ins Haus. Bewundernd blickte sie sich um. Nicht nur von außen war es ein stilechtes viktorianisches Gebäude, sondern auch die Möbel stammten aus der Zeit.
»Großmutter hat ein Faible für viktorianische Einrichtungsgegenstände«, bemerkte Adrian schmunzelnd.
»Ich werde schnell zu ihr gehen. Sonst wird sie unwirsch.« Tante Ha steuerte auf die Treppe zu und eilte ins erste Stockwerk hinauf.
»Heißt sie wirklich Ha?«, fragte Eva, als ihre Schritte verklungen waren.
Adrian lächelte. »Ihr richtiger Name ist Harakeke, aber ich darf ihn so respektlos abkürzen. Die Maori haben ein Faible für Zungenbrecher. Es gibt in der Nähe einen Berg. Ich habe mir einen Spaß gemacht und den Namen auswendig gelernt: Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu.«
»Und was heißt das?«
»Der Vorsprung des Berges, wo Tamatea, der Mann mit den großen Knien, der rutschte, kletterte und die Berge verschlang und der durch das Land reiste, für seine Liebste Flöte spielte.«
Adrian musterte Eva wohlwollend. »Wie schön, dass Sie wieder lachen können. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Am besten legen Sie sich hin und schlafen sich aus. Ich wecke Sie zum Abendessen.«
Eva folgte ihm, nicht ohne bewundernde Blicke auf die Tapeten und das Flurmobiliar zu werfen. Das Ganze war so herrlich altmodisch, als wäre es aus der Zeit gefallen. Eva war beeindruckt, und sie war sehr gespannt, die Frau kennenzulernen, die das alles so stilsicher zusammengetragen hatte. Doch warum hatte ihr kein Mensch etwas von diesem Haus und der Großmutter erzählt?
»Haben Sie vielleicht eine Erklärung dafür, weshalb mein Vater meiner Mutter und mir erzählt hat, wir kämen auf ein Weingut?«, fragte sie, als er schließlich vor einer Tür anhielt und den Koffer abstellte.
Adrians Miene wurde eisig. Das konnte Eva selbst bei dem gedämpften Licht auf dem Flur erkennen.
»Mutter hat das Anwesen nach Vaters Selbstmord fluchtartig verlassen«, entgegnete er mit schneidender Stimme. »Und das ist erst ein paar Monate her. Wahrscheinlich hatte sie keine Gelegenheit, Ihrem Vater zu schreiben, dass sie inzwischen einen neuen Gatten ihr Eigen nennt.«
Dass Adrian mit dieser Entscheidung seiner Mutter nicht einverstanden gewesen war, war unschwer an seinem Ton und seiner Ausdrucksweise zu erkennen.
Eva atmete ein paar Mal tief durch. »Meine Mutter hat sich mit Schlaftabletten umgebracht. Sie litt an Schwermut.«
»Mein Vater hat sich erschossen. Er war eigentlich ein fröhlicher Mensch, aber er hat es nicht verkraftet, dass sein Lebenswerk, das Weingut, dem Ruin geweiht war und dass seine Frau nichts Eiligeres zu tun hatte, als beim Auftauchen der ersten Schwierigkeiten …« Er unterbrach sich hastig, während er die Tür zu dem Zimmer öffnete.
»Das ist Ihr Reich. Ich hoffe, es gefällt Ihnen!«
Eva war verwirrt wegen des plötzlichen Themenwechsels, aber dann zog die Einrichtung ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich. Aus ihren Augen sprach Bewunderung.
»Ist das ein echtes Chesterfield-Sofa?«, fragte sie und näherte sich dem Möbelstück ehrfürchtig.
»Alles echt!«, erwiderte Adrian nicht ohne einen gewissen Stolz in der Stimme.
»Und hat das auch Ihre Großmutter eingerichtet?«
»Nein, das wäre ihr alles viel zu modern. Es sind meine Möbel. Ich habe nach dem Schulabschluss bei einem Architekten gearbeitet und gehe im Februar auf die Akademie nach Wellington. Dort unterrichtet ein Schüler von Frank Lloyd Wright und ich liebe diesen Stil, aber noch kann ich mir kein solches Haus bauen …«
»Es ist schon faszinierend«, fiel Eva in seine Schwärmerei ein. »wie man einen organischen Zusammenhang zwischen Architektur und den menschlichen Bedürfnissen herstellen kann.«
»Sie wissen, wer Frank Lloyd Wright ist?«, fragte Adrian ungläubig.
»Ja, sonst würde ich mich wohl kaum zu diesem Thema äußern«, entgegnete sie schärfer als beabsichtigt. Er redete darüber, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, dass man Architektur studierte. Wenn er wüsste, dass es genau das war, was sie tun würde, wenn sie nur einen Wunsch auf dieser Welt frei hätte. »Schauen Sie mich nicht so an, als würden Sie daran zweifeln. Ich habe all mein Geld in Architekturbücher gesteckt!«
Adrian musterte sie irritiert. »Was habe ich Ihnen getan? Sind Sie mir böse?«
»Ich bin sehr erschöpft«, erwiderte sie, während sie sich fragte, wie er es wohl fände, wenn er ahnen würde, was in ihrem Kopf vor sich ging. Sie verstand sich ja selbst nicht. Wie kleinlich, dachte sie. Ich neide ihm, dass er bei einem Schüler des großen Frank Lloyd Wrights lernen durfte. Ein Blick in den großen Flurspiegel bestätigte ihr, dass ihre Miene äußerst angespannt war. Sie kam sich vor wie ihre verkniffene alte Lehrerin.
»Und vielen Dank für alles. Sie haben mir das Ankommen sehr erleichtert«, fügte sie steif hinzu.
»Dein Englisch ist übrigens sehr gut«, bemerkte er auf Deutsch. »Wir müssen uns jetzt duzen. Schließlich bist du so etwas wie eine Cousine. Wie sind wir eigentlich genau verwandt?«
Eva stieß einen tiefen Seufzer aus. Ihr Vater hatte es ihr zwar erklärt, aber es war gar nicht so einfach, sich das Verwandtschaftsgefüge ins Gedächtnis zurückzurufen.
»Wenn ich es richtig verstanden habe, waren unsere Großväter Brüder. Deiner wanderte in jungen Jahren nach Neuseeland aus, weil meiner als der Ältere das Weingut in der Pfalz erben sollte. Mein Großvater hätte ihn damals am liebsten für verrückt erklärt, weil er sich in den Kopf gesetzt hatte, dort Wein anzubauen.«
»Ja, und mein Großvater war ein Kämpfer, und er hat es tatsächlich geschafft. Er hat das erste florierende Weingut in der Hawke’s Bay besessen. Sag mal, wie ist denn der Kontakt zu meiner Mutter überhaupt entstanden? So von einem Ende der Welt zum anderen?«
»Das weiß ich auch nicht so genau«, meinte Eva nachdenklich. »Ich glaube, deine Mutter hat meinem Vater einen Brief geschrieben, in dem sie ihn gebeten hat, dass er ihr die Hälfte des Schmuckes schicken solle, den seine Großmutter, die ja zugleich die Mutter ihres Vaters war, ihm vererbt hatte. Da gab es wohl ein Testament, in dem die alte Dame auch die Abkömmlinge ihres jüngeren Sohnes bedacht hatte. Ich habe keine Ahnung, warum er nicht persönlich schrieb, sondern seine Tochter.«
»Vielleicht war es erst nach Großvaters Tod«, sagte Adrian. »Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Ich war noch nicht geboren, als Großvater plötzlich starb.«
»Jedenfalls haben mein Vater und deine Mutter, die Cousin und Cousine sind, sich dann in unregelmäßigen Abständen über Wein ausgetauscht. Und als unser Weingut in Badenheim nicht mehr zu halten war, fasste mein Vater den Entschluss, mit meinem Bruder nach Kalifornien zu gehen, um dort Arbeit zu finden. Meine Mutter und ich hätten die beiden nur gestört. Deshalb sollten wir auf das Weingut deiner Mutter kommen …« Sie stockte. »Aber da es deiner Mutter finanziell auch nicht gut geht, werde ich euch natürlich nicht lange auf der Tasche liegen. Sobald Vater mir das Geld für eine Passage nach Amerika schickt, bin ich weg!«
»Ach, um Mutter mach dir mal keine Sorgen. Ihr neuer Gatte ist einigermaßen bei Kasse und sie spekuliert nur darauf, endlich Großmutter Lucies Haus und ihr Vermögen zu erben.«
Eva verkniff es sich, ihn zu fragen, warum er so hässlich über seine Mutter redete. Das war nun schon das zweite Mal in diesem Gespräch. Aber sie wollte nicht neugierig wirken. Außerdem musste sie erst einmal verarbeiten, was sie einander binnen so kurzer Zeit alles anvertraut hatten. In gewisser Weise teilten sie ja dasselbe Schicksal. Lag es daran, dass er ein entfernter Verwandter war, dass sie sich ihm so seltsam nahe fühlte?
»Dann schlaf gut und träume schön. Du weißt ja, der erste Traum, den du in einem neuen Zuhause hast, geht in Erfüllung.«
Nachdem Adrian die Tür hinter sich geschlossen hatte, betrachtete sie die Möbel eingehender. Er hatte wirklich Geschmack, das musste man ihm lassen. Schließlich öffnete sie das Fenster und blickte in einen Garten, in dem es so bunt blühte, wie sie es noch niemals zuvor gesehen hatte. Seltene Vogelstimmen drangen an ihr Ohr. Plötzlich hörte sie eine Frauenstimme, die Befehle erteilte.
»Bringen Sie mir bitte den Tee nach draußen und ein paar von den Keksen!«
Eine Frau in Kostüm und Hut trat auf die Veranda aus Holz, die genau unter Evas Zimmer lag. Eva hielt die Luft an. Noch nie hatte sie eine so schöne Frau gesehen. Sie besaß helles Haar, einen makellosen weißen Teint, ein schmales Gesicht, eine perfekte Nase und einen vollen sinnlichen Mund. Ihre Augen waren grün, soweit es Eva von hier oben erkennen konnte. Eva hielt sie auf den ersten Blick für Adrians Schwester, weil sie so jugendlich wirkte und es eine unübersehbare Ähnlichkeit zwischen ihnen gab. Erst auf den zweiten Blick sah man der feinen Dame ihr Alter an. Sie musste bereits auf die fünfzig zugehen.
Nun vernahm Eva eine zweite Stimme aus dem Haus.
»Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich diesen Trampel unterhalte. Meine Freunde mögen keine Deutschen. Ich kann sie beim besten Willen nicht überall mit hinschleppen. Und gerade jetzt vor Weihnachten häufen sich die Einladungen. Bitte mute es mir nicht zu, sie zu unterhalten.«
Eva trat einen Schritt ins Zimmer zurück aus Angst, man könne sie am Fenster entdecken, denn sie hegte keinen Zweifel, dass die Rede von ihr war. Doch dann siegte ihre Neugier. Sie wollte wissen, wie das Gesicht zu der quengeligen Stimme aussah.
Das Aussehen der jungen Frau, die offenbar die Tochter des Hauses war, reichte bei Weitem nicht an die Schönheit ihrer Mutter heran. Sie war blond, hatte im Gegensatz zu ihrer Mutter ein rundliches Gesicht mit einer Stupsnase und Sommersprossen. Niedlich würde man in Deutschland sagen, aber neben ihrer Mutter wirkte sie wie ein Ackergaul neben einem Rassepferd. Eva schämte sich ein wenig für diesen Vergleich, aber es fiel ihr nichts Besseres ein. Natürlich war er auch geprägt von ihrer Abneigung gegen die etwa gleichaltrige junge Frau. Wie kam sie dazu, sie als Trampel zu bezeichnen? Oder hatte sie das nur falsch übersetzt?
Eva verließ ihren Fensterplatz hastig, als sich Mutter und Tochter zum Tee auf der Veranda niederließen.
Sie holte ihr Wörterbuch hervor und bekam die Bestätigung, für das, was sie meinte herausgehört zu haben. Clod bedeutete tatsächlich so etwas wie »Trampel«.
Eva legte sich aufs Bett und ballte die Fäuste. Als sie aufwachte, hatten sich ihre Hände gelöst, und sie lächelte in sich hinein. Sie konnte sich sofort an ihren Traum erinnern: Sie war mit einem gut aussehenden jungen Mann durch eine viktorianische Villa geschlendert!
NAPIER, DEZEMBER 1930
Eva war schon lange wach, als es an ihrer Zimmertür klopfte. Sie hatte versucht, ein ansprechendes Sommerkleid in ihrem Koffer finden, aber sie besaß überhaupt nur ein einziges schönes Kleid.
Adrian steckte vorsichtig den Kopf zur Tür hinein.
»Bist du fertig?«
Eva nickte und folgte ihm zurück über den endlos langen Flur nach unten in das Esszimmer. Sie war ein wenig erschrocken, weil sie gleich von drei Augenpaaren eindringlich gemustert wurde, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Adrians Mutter und der grauhaarige füllige ältere Herr am Tisch zeigten keinerlei Regung außer Neugier, während die Tochter des Hauses verächtlich ihr Gesicht verzog.
»Das ist unsere Cousine aus Deutschland, Eva Schindler«, sagte Adrian mit fester Stimme.
Seine Mutter stand auf und streckte ihr die Hand entgegen. Sie ist schön, aber kalt, durchfuhr es Eva, während sie ihre Tante begrüßte. Das Dumme war nur, dass Eva deren Name entfallen war. Wie sollte sie sie nur anreden? Während sie noch fieberhaft in ihrem Gedächtnis kramte, hörte sie, wie die Tante sich nach ihrer Mutter erkundigte. Bevor sie antworten konnte, musste ihr deren verdammter Name einfallen. Die Maori hatte ihn doch vorhin erwähnt …
»Und wo ist deine Mutter?«, wiederholte ihre Tante ungeduldig die Frage, dann musterte sie Eva von Kopf bis Fuß. »Ach, sie spricht wahrscheinlich gar kein Englisch. Deshalb antwortet sie nicht«, fügte sie hinzu.
»Sie ist auf der Überfahrt gestorben«, mischte sich Adrian hastig ein. »Und es wäre sehr reizend, wenn auch du, liebe Berenice, deine Cousine herzlich willkommen heißen würdest. Sie wird jetzt eine Zeitlang bei uns leben.«
Glücklicherweise wird es gar nicht lange sein, dachte Eva, die intuitiv spürte, dass sie kein gern gesehener Gast in diesem Haus war. In diesem Haus, in das man sie gar nicht eingeladen hatte.
»Ich hoffe, dass ich mich ein wenig nützlich machen kann, nachdem du Vater schriebst, dass ihr auf dem Weingut jede helfende Hand braucht. Aber ich kann auch hier mithelfen. Ich musste zu Hause den ganzen Haushalt machen …« Sie unterbrach sich, als sie merkte, dass sich keiner wirklich für sie interessierte. Die Tante schien nur ein wenig überrascht, dass sie doch Englisch sprach.
»Dann kannst du ja gleich in meinem Zimmer anfangen. Das muss dringend sauber gemacht werden«, sagte Berenice schließlich in spöttischem Ton.
»Schwesterherz, halt dein freches Mundwerk. Eva ist unser Gast, damit du es weißt. Und sie wird auf keinen Fall unsere Zimmer putzen!«
»Adrian, nun setzt euch endlich, damit wir mit dem Essen beginnen können«, knurrte der ältere Herr am Tisch, während Berenice ihrem Bruder die Zunge herausstreckte, was keinen bei Tisch kümmerte. Das hätte es bei uns zu Hause bei Tisch nicht gegeben, durchfuhr es Eva verwundert über die Manieren der Tochter des Hauses.
Kaum dass sie auf ihrem Platz saß, wandte sich die Tante höflich an Eva. »Es ist nett, dass du deine Hilfe anbietest. Wir werden sehen, wie du dich hier im Haus nützlich machen kannst. Auf dem Weingut hättet ihr uns bei der Weinernte helfen können, aber das entfällt ja nun.«
»Ich wüsste etwas«, meldete sich Adrian zu Wort. »Ich soll doch, bevor ich nach Wellington gehe, die Bold Winery in Meeanee wieder fit machen, damit du das Anwesen verkaufen kannst, Mutter, nicht wahr?«
»Ja, das kann ich ja wohl erwarten, wenn mein Sohn unbedingt Architekt werden will.«
»Ich bräuchte allerdings jemanden, der mir hilft, der einen Blick für Häuser hat und einen guten Geschmack besitzt.«
Die einzige Reaktion war ein meckerndes Lachen von Berenice.
»Unsere deutsche Großcousine und Geschmack. Das ist wohl ein Scherz! Schau nur den groben Stoff des Kleides an. Wolle im Sommer? Wer trägt denn so was?«
»Berenice, bitte! In Deutschland ist jetzt Winter. Das konnte sie nicht wissen. Am besten gibst du ihr gleich deine abgetragenen Sommerkleider, die wir den Bedürftigen spenden wollten«, mischte sich die Tante nun geschäftig ein. »Wir werden schon etwas finden, womit du dich beschäftigen kannst. Kannst du kochen?«
Eva nickte.
»Das wäre vielleicht etwas. Unsere Küchenhilfe ist nämlich schwanger und wird bald ausfallen.«
Eva warf einen flüchtigen Blick zu Adrian, der ihr gegenübersaß. Er glühte vor Zorn und stand soeben im Begriff, seiner Mutter heftig zu widersprechen. Aber das wollte Eva nicht. Sie machte ihm ein Zeichen zu schweigen. Es lag ihr fern, die Spannung, die ohnehin in diesem Raum herrschte, noch unnötig zu verstärken. Und so nett es auch gemeint war, Adrians Engagement lohnte sich nicht. Ihr Entschluss stand fest: Sobald die erste Post von ihrem Vater kam, würde sie ihn anflehen, ihr das Geld für die Überfahrt zu schicken. Hier würde sie jedenfalls nicht einen Tag länger als erforderlich bleiben. Diese Berenice war ein unverschämtes Gör und ihre Mutter zwar bemüht, aber ebenfalls taktlos. Und sie hat es nicht einmal gemerkt, als sie über die Kleidung für die Bedürftigen sprach, dachte Eva, während sie sich an den heimatlichen Ofen zurücksehnte und die wenigen Momente, in denen ihre Mutter fröhlich gewesen war …
»Wo bleibt deine Mutter, Joanne?«, fragte der ältere Herr in die Stille hinein.
Joanne, natürlich, sie heißt Tante Joanne, ging es Eva durch den Kopf.
»Großmutter lässt sich entschuldigen«, antwortete Adrian. »Sie ist mit Tante Ha in die Stadt zum Dinner ins Masonic Hotel gefahren.«
»Na, die alte Dame lässt es sich allerdings sehr gut gehen. Sie isst ja öfter auswärts als in unserem Haus«, bemerkte der ältere Herr kritisch.
Eva vermutete, dass er der neue Ehemann von Tante Joanne war. Wahrscheinlich war dies sein Haus, in das die Familie nach der Pleite von »Bold Wineyard Estate« gezogen war.
Daran, wie Adrian die Stirn kräuselte, war unschwer zu erkennen, dass er gleich platzen würde. Da landete auch schon seine Faust mit einem lauten Knall neben seinem Teller.
»Lieber Doktor Thomas, es dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass dieses Haus noch meiner Großmutter gehört und dass sie es sich leisten kann, mit ihrer Schwester auszugehen. So oft und so viel sie will.«
»Adrian! Hör endlich auf, Bertram zu provozieren«, wies Tante Joanne ihren Sohn zurecht. »Natürlich hätten wir nach der Hochzeit auch in sein Haus ziehen können, aber dies ist einfach schöner und größer. Und es wird eines Tages ohnehin mir gehören!«
»Deine Mutter ist aber noch sehr, sehr rüstig!«, erwiderte Adrian mit vor Zorn bebender Stimme. »Offenbar rüstiger, als es dir lieb ist!«
»Junger Mann! Schluss jetzt«, brüllte Doktor Thomas.
Eva blickte verstohlen von einem zum anderen und fragte sich, in welches Schlangennest sie da wohl geraten sein mochte. Wobei – das konnte sie nicht verhehlen – ihre Sympathie eindeutig Adrian und seiner Großmutter gehörte und nicht Tante Joanne und ihrem Ehemann. Und schon gar nicht Berenice, die sich nun einmischte.
»Du solltest dich da ganz raushalten, mein lieber Bruder! Du hast dich ja schon vor Dads Tod bei Großmutter eingenistet und bist auf den maroden Weinberg nur noch zu Stippvisiten gekommen. Erwartest du allen Ernstes von Mom und mir, dass wir in Vaters kleines Haus ziehen? Außerdem ist die Praxis dort untergebracht. Dort ist viel zu wenig Platz.« Berenice hatte das Wort »Vater« provozierend gedehnt, und es war Adrian anzusehen, wie er es verabscheute, wenn sie von dem Doktor als »Vater«, sprach.
»Schluss jetzt!«, ging Tante Joanne mit strenger Stimme dazwischen. »Wir sind nicht allein bei Tisch. Eva muss ja glauben, unsere Familie würde sich nicht vertragen. Was soll denn mein lieber Cousin Peter denken, wenn Eva in ihrem nächsten Brief berichtet, wie es bei uns zugeht?« Sie schenkte Eva ein Lächeln, doch die konnte sich nicht helfen. Es kam nicht von Herzen, das spürte sie ganz genau. Dennoch erwiderte sie es.
»Ach, bevor ich es vergesse, es gibt ja schon Post für dich!« Mit diesen Worten sprang die Tante vom Tisch auf und eilte zur Anrichte.
Evas Herz machte einen Sprung, als sie ihr einen Brief in die Hand drückte. Das war unverkennbar die Schrift ihres Vaters. Sie presste das Schreiben an ihre Brust und stieß einen tiefen Seufzer aus. Das war die Rettung. Noch heute Abend würde sie ihm antworten und um das Geld bitten.
»Du isst ja gar nichts. Schmeckt es dir nicht?« Mit dieser Frage riss Tante Joanne Eva aus ihren Gedanken.
»Sie achtet bestimmt auf ihre Linie. So dünn kann man nicht sein, wenn man normal isst«, bemerkte Berenice gehässig.
»Doch, liebes Schwesterchen, Menschen, die normal essen, sind normal schlank wie Eva, aber Mädchen, die den ganzen Tag lang Süßigkeiten naschen, die können auch schon mal ein paar Röllchen bekommen …«
»Du, du …« Berenice war aufgesprungen und wollte sich auf ihren Bruder stürzen.
Ihre Mutter hielt sie im letzten Moment zurück.
»Das ist so gemein!«, zeterte die Tochter des Hauses.
»Nein, ist es nicht, denn mich stört das gar nicht«, säuselte Adrian. »Ich mag dich, so wie du bist, meine Liebe. Jedenfalls äußerlich, nur deine Art, andere zu beleidigen, die solltest du dringend ablegen. Die mag ich nicht. Und ich denke, ich spreche da für alle Männer Napiers im heiratswilligen Alter, allen voran Vaters Sohn!« Das Wort »Vater« hatte er in spöttischem Ton über die Lippen gebracht.
»Jetzt ist es aber gut. Lass bitte Daniel aus dem Spiel! Er mag deine Schwester!«, mischte sich Adrians Stiefvater ein.
»Als er letzte Weihnachten hier war, hat sich meine Schwester ja auch von ihrer liebreizenden Seite gezeigt! Das muss sehr anstrengend gewesen sein, vor Daniel zu verbergen, was für ein eigennütziges Biest sie sonst sein kann.«
»Hört endlich auf zu streiten!«, befahl Tante Joanne mit schneidend scharfer Stimme.
Eva tat nur Adrian leid. Aber auch der würde diesem schrecklichen Zuhause ja bald entkommen können, wenn er zum neuen Semester im Februar auf die Akademie nach Wellington ging.
Doch Adrian war nun so heftig von seinem Stuhl aufgesprungen, dass das Möbel mit Getöse nach hinten kippte.
»Ich weiß genau, warum Daniel so selten aus Wellington nach Hause kommt. Er fühlt sich nicht wohl in dieser neuen Familie. Genauso wenig wie ich!«, brüllte er und verließ türenknallend das Esszimmer.
Danach herrschte peinliches Schweigen bei Tisch. Eva kam es wie eine halbe Ewigkeit vor, bis die Tafel schließlich aufgehoben wurde und Tante Joanne ihr steif eine »Gute Nacht«, wünschte. Ihr Mann murmelte etwas Unverständliches in seinen Bart, während Berenice die Lippen fest zusammenpresste.
Erst als Eva bereits bei der Tür war, hörte sie die Tochter des Hauses laut und vernehmlich sagen: »Das macht er doch nur, um vor der da anzugeben! Ich verstehe überhaupt nicht, was die hier zu suchen hat! Als hätten wir nicht genug Sorgen. Da muss sich jetzt nicht noch eine Fremde bei uns durchfressen.«
Eva kämpfte mit sich, ob sie sich umdrehen und der unverschämten Person die Meinung sagen sollte, aber sie entschied sich dagegen. Sie wollte keinen überflüssigen Gedanken an ihre unmögliche Verwandtschaft verschwenden. Stattdessen verließ sie das Esszimmer, als wäre nichts geschehen, und formulierte auf dem langen Gang zu ihrem Zimmer, was sie ihrem Vater wohl schreiben würde. Und sie fragte sich, ob sie ihm ihren Eindruck schildern sollte, den sie von der Familie Bold/Clarke/Thomas binnen weniger Stunden gewonnen hatte.
Vor ihrer Zimmertür hielt sie kurz inne. In diesem Teil des Hauses herrschte eine friedliche Stille, und sie verstand nur allzu gut, dass Adrian den vorübergehenden Auszug aus seinem Reich bedauerte.
NAPIER, DEZEMBER 1930
Harakeke und Lucie saßen auf ihrem Stammplatz am Fenster. Von hier aus hatten sie einen Blick bis zur Wasserfront. Von dem aber nahmen sie kaum etwas wahr, weil sie, wie immer, wenn sie zusammen waren, in einem fort plauderten.
Die beiden alten Damen waren stadtbekannt, weil sie zu den wenigen wohlhabenden Maorifrauen vor Ort gehörten und weil beide mit einem angesehenen Bürger der Stadt Napier verheiratet gewesen waren. Deshalb nannte man sie auch stets respektvoll Misses Bold und Misses Dorson. Wenngleich Lucie stets noch das Befremden der Menschen heraushörte. Früher war es nur Harakeke gewesen, über die man sich in Napier das Maul zerrissen hatte. Doch längst klebte der Skandal, dessen Hauptakteurin Lucie gewesen war und der schon lange der Vergangenheit angehörte, an ihr wie das Harz am Kauri-Baum.
Was die Schwestern allerdings mehr als das Gerede hinter vorgehaltener Hand störte, war die Tatsache, dass sie in der Regel die einzigen Nicht-Pakeha waren, die hier speisten. Aber auch das vergaßen sie, wenn sie wie die Wasserfälle miteinander plauderten.
»Nun erzähl schon von dem Mädchen. Du bist ja richtig angetan von ihr.«
Harakeke zündete sich zunächst einmal genüsslich eine Zigarette an und blies den Rauch in Kringeln aus der Nase. Lucie wusste, dass ihre Schwester sie auf die Folter spannen wollte, aber sie lehnte sich betont ruhig zurück.
»Sie ist sehr natürlich und dabei äußerst hübsch – was sie nicht weiß. Und das ist das Gute. Sie ist eine echte Schönheit. Sie hat dichtes weizenblondes Haar, ein Gesicht wie die Madonnen in deiner Kirche und grüne Augen«, schwärmte Harakeke. »Nur ihr Englisch lässt, wie soll ich sagen, zu wünschen übrig.«
Lucie dachte nach.
»Dann ist sie leider nicht geeignet für mein Vorhaben.«
»Doch, doch du brauchst nur viel Geduld. Und du würdest ihr gleichzeitig helfen, ihre englischen Sprachkenntnisse zu perfektionieren. Ich glaube, sie ist nicht nur hübsch, sondern auch äußerst klug. Und sie hat ein Gefühl für unsere Sprache. Es bedürfte nur des richtigen Lehrers.«
»Ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich an jemanden gedacht, der die englische Sprache perfekt beherrscht. Und der seine Nase nicht in meine Angelegenheiten steckt, sondern es als reine Arbeit begreift. Schließlich offenbare ich damit etwas aus meinem Leben. Er muss mir versprechen, allen anderen gegenüber zu schweigen.«
»Dann gibt es ja nur einen Menschen, der dafür in Frage kommt.«
Lucie sah ihre Schwester verdutzt an.
Harakeke lachte: »Na ich. Schließlich kenne ich all deine dunklen Geheimnisse. Wer wäre geeigneter, deine Lebensgeschichte aufzuzeichnen, als ich?«
»Du? Ja, das … das wäre ideal. Natürlich, nur du hast doch … solche Schwierigkeiten … ich meine mit den Augen. Du … du kannst, du kannst ja nicht einmal mehr Zeitung lesen ohne Lupe«, stammelte Lucie.
»Schwesterlein, was ist los mir dir? Genau daran würde es scheitern, aber du scheinst auch nicht besonders interessiert zu sein an meiner Hilfe. Verheimlichst du mir etwas?« Harakeke drohte der Schwester scherzend mit dem Finger.
»Ach, was du immer denkst«, schnaubte Lucie und fuhr unwirsch fort: »Natürlich könnte ich es Adrian diktieren. Der würde es bestimmt machen, allerdings möchte ich gar nicht in der Nähe sein, wenn er alles erfährt.«
»Du willst ihm wirklich alles verraten?« Harakeke zündete sich eine neue Zigarette an.
»Alles! Er soll die fertige Geschichte bekommen, am liebsten erst, wenn ich tot bin.«
»Jetzt werde mal nicht pathetisch, meine Liebe«, lachte Harakeke. »Wenn du dir schon die Mühe machen willst, dann solltest du dem Jungen die Gelegenheit geben, nach Kenntnis der ganzen Geschichte ein Gespräch mit dir zu suchen …« Seufzend unterbrach sie sich. »Ich hätte es ihm ja längst erzählt.«
»Ich weiß, ich weiß«, knurrte Lucie. »Wie du ja immer alles besser wusstest. Wenn ich mein Leben lang auf dich gehört hätte, würde es mir heute bestimmt besser gehen!«
»Das brauchst du gar nicht so spöttisch zu sagen. Ich glaube, die Wahrheit zur rechten Zeit hätte der Charakterbildung der beiden Damen durchaus förderlich sein können. Und warum willst du es überhaupt Adrian erzählen, wo du dein Leben lang mit einem Haufen Lügen leben konntest?« Gekonnt blies Harakeke Kringel in die Luft.
»Weil er ein Recht hat, seine Wurzeln zu kennen.«
»Dann müsstest du Berenice ein ebensolches Geschenk machen.«
»Was würde sich ändern, wenn sie erführe, wie es sich damals wirklich alles verhalten hat? Das wird sie nur noch mehr gegen mich aufbringen.«
Harakeke nahm die Hand ihrer Schwester und drückte sie fest. »Was für dich eine gute Tat war, haben die Pakeha als Affront und Anmaßung verstanden. Und ich war damals auch nicht sonderlich davon begeistert, wie du weißt. Weder von dem einen noch von dem anderen. Aber dich trifft auch ein kleines bisschen Schuld: Du hast dieses Kind dermaßen verwöhnt …«
»Du weißt doch, warum«, seufzte Lucie.
»Ja, ich weiß es. Und dennoch hatte ich auch schon früher meine Zweifel, ob ihr dem Kind damit einen Gefallen tut. Sie musste ja zwangsläufig glauben, dass die Welt allein dazu da ist, ihr die Wünsche von den Augen abzulesen.«
»Ich weiß, du hast ja recht, aber es ist nicht mehr zu ändern. Ich komme nicht an Joanne heran. Was ich ihr sage, geht in das eine Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Ich glaube, sie wäre nicht einmal traurig, wenn ich bald stürbe und den Weg freimachte, damit sie das Haus nach ihren Wünschen gestalten könnte.«
»Den Gefallen wirst du ihr nicht tun! Vielleicht solltest du ohnehin zu mir ziehen. Das Haus ist zwar kleiner, und mein Haushalt entspricht nicht deinen Ansprüchen, aber du hättest endlich Ruhe vor Joanne, Berenice und diesem aufgeblasenen Doktor. Ich werde nie verstehen, warum sie sich auf diesen Kerl eingelassen hat!«
»Vergiss nicht, er kennt ihr Geheimnis! Und offenbar ist es auch von seiner Seite die ganz große Liebe. Jedenfalls war es das einmal! Heute wirkt er eher gelangweilt! Ich glaube, Joanne fühlt sich bei ihm auf merkwürdige Weise geborgen.«
Lucie machte eine wegwerfende Bewegung. »Ach, lass uns nicht mehr über die Vergangenheit sprechen. Ich will sie endlich loswerden. Deshalb werde ich sie schnellstens zu Papier bringen lassen, und dann will ich nie wieder etwas davon hören!«
»Ich glaube, dann wäre diese entzückende Deutsche wirklich die Richtige. Sie ist unbelastet, kennt keinen der Beteiligten näher, hegt keine eigenen Emotionen bei dieser Geschichte. Du solltest dir rasch ein eigenes Urteil bilden. Aber lesen darf ich sie schon, wenn sie fertig ist, nicht wahr?«
Lucie zuckte unmerklich zusammen; aber das merkte ihre Schwester nicht.
»Natürlich!«, log sie in der Hoffnung, Harakeke würde die Sache bald wieder vergessen haben. »Gut, gut, ich werde die junge Frau zu mir ins Zimmer bitten, um mir selbst einen Eindruck zu verschaffen. Wenn du sie mir so ans Herz legst, kann sie ja nicht ganz so verkehrt sein«, fügte Lucie hastig hinzu und musterte ihre Schwester prüfend, doch die hatte offenbar nicht bemerkt, welchen Schrecken sie Lucie mit ihrer Frage, ob sie die Geschichte auch lesen dürfe, eingejagt hatte. Sie konnte ihr schlecht sagen, dass das auf keinen Fall möglich wäre, weil sie auch ein Geheimnis offenlegen würde, von dem Harakeke niemals erfahren durfte … Verstohlen musterte sie ihre Schwester. Unterschiedlicher wie wir kann man gar nicht sein, dachte sie. Schon vom Aussehen her. Harakeke kam ganz nach dem Vater und wurde bereits von Weitem als Maori erkannt, während Lucie gelegentlich für eine sonnengegerbte Pakeha gehalten wurde. Sie kam ganz nach ihrer Mutter, in deren Stamm die Frauen alle feingliedriger waren als die meisten Maorifrauen. Auch vom Charakter her unterschieden sie sich grundlegend. Lucie war stets bemüht, nach außen wie eine Dame aufzutreten, während Harakeke sich gern burschikos gab. Sie lehnte feine Pakeha-Kleider ab, während ihre Schwester stets Wert auf Mode gelegt hatte.
Das mit meinem Pakeha-Namen wird sie mir niemals ganz verzeihen, ging es Lucie gerade durch den Kopf, als Harakeke sich noch einen Whiskey bestellte. Denn auch in diesem Punkt konnten sie verschiedener nicht sein: Harakeke war eine trinkfeste Person, während Lucie Alkohol regelrecht verabscheute.
NAPIER, DEZEMBER 1930
Misses Bolds Stimme klang rau und kräftig, als sie »Herein!«, rief. Zögernd betrat Eva das Zimmer, zu dem Adrian sie auf Wunsch der alten Dame gebracht hatte.
»Mach es gut. Sie beißt nicht!«, sagte er grinsend und verschwand.
Eva hatte gehofft, dass Adrian sie begleiten würde, aber nun war sie allein mit der vornehmen Lady, die kerzengerade an einem Tisch saß und sie zu sich heranwinkte.
»Komm näher!«, sagte sie und deutete auf den Sessel ihr gegenüber. Das Zimmer schien – genau wie die Fassade des Hauses – aus der Zeit gefallen. Jedes Möbel, das Evas flüchtiger Blick erhaschen konnte, war ein Stück aus der spätviktorianischen Epoche.
Als sie Misses Bold genauer ansah, fragte sie sich, worin ihre Ähnlichkeit mit Joanne bestehen mochte. Sie waren völlig unterschiedlich. Die Tochter war extrem hellhäutig, während ihre Mutter einen ebenmäßigen dunklen Teint besaß. Als ob sie gern in der Sonne saß. Und sie wirkte jünger, als Eva es vermutet hatte. Im Gegensatz zu den hellen Augen ihrer Tochter glänzten die der alten Dame wie Bernsteine. Und während aus den Augen der Tochter Gleichgültigkeit und Kälte sprachen, waren in denen der Mutter Mitgefühl, Wärme und ehrliches Interesse zu lesen.
»Mein Kind, erst einmal möchte ich dir sagen, dass es mir sehr leid um deine Mutter tut. Es ist sicherlich nicht einfach, plötzlich allein am anderen Ende der Welt anzukommen, nicht wahr?«
Eva nickte. Das Aussehen täuscht also nicht, sie hat ein völlig anderes Wesen als Tante Joanne, ging ihr durch den Kopf, während sie nach einer Tasse Tee griff, die Misses Bold ihr ungefragt gereicht hatte.