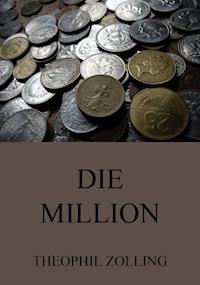
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der "Million" führt Zolling in das Getriebe des Geldmarktes, wie es sich tagtäglich an der Berliner Börse offenbarte, und zeichnet nebenbei auch ein feines Gemälde der Berliner Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Million
Theophil Zolling
Inhalt:
Theophil Zolling – Biografie und Bibliografie
Die Million
Erster Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Zweiter Teil.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
Die Million, T. Zolling
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849640354
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Theophil Zolling – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 30. Dez. 1849 in Scafati bei Neapel, gest. 23. März 1901 in Berlin, wurde in der deutschen Schweiz erzogen, studierte Philosophie und Geschichte in Wien, Heidelberg und Berlin, wo er 1875 promovierte, und siedelte dann als Feuilleton-Korrespondent der »Neuen Freien Presse« nach Paris über. Im Oktober 1881 übernahm er die Redaktion der von P. Lindau gegründeten Berliner Wochenschrift »Die Gegenwart«, die er bis zu seinem Tode fortführte. Von seinen Schriften erwähnen wir die Quellenstudie »Alexanders d. Gr. Feldzug in Zentralasien« (2. Aufl., Leipz. 1875), das satirische Epos »Die Jungfrau vom Stuhl« (anonym, das. 1876), das mit Alphonse Daudet verfaßte Drama »Neue Liebe« (das. 1877), die gesammelten Feuilletons »Reise um die Pariser Welt« (Stuttg. 1881, 2 Bde.), die Monographie »Heinrich v. Kleist in der Schweiz« (das. 1882, mit Briefen von Kleist, Wieland, Herder u. a.), endlich die Romane: »Der Klatsch« (Leipz. 1889) und »Frau Minne«, Künstlerroman (das. 1889), »Coulissengeister« (das. 1891), »Die Million« (Berl. 1892), »Bismarcks Nachfolger« (das. 1894, 5. Aufl. 1895). Für Kürschners »Deutsche Nationalliteratur« besorgte er eine seinerzeit verdienstliche, jetzt überholte Ausgabe von H. v. Kleists Werken (Stuttg. 1884, 4 Bde.).
Die Million
Erster Teil
I.
Ein heißer Tag an der Börse! Die drei großen Säle waren voll Lärm und Bewegung. Überall tauchten Makler und Agenten in fieberhafter Thätigkeit auf und verschwanden in dem hastenden, heftig erregten, tosenden Menschenstrom. Barhäuptig oder den Cylinderhut auf dem Hinterkopfe, wimmelten die meist schwarzgekleideten jungen und alten Herren durcheinander. Es gab kein Plaudern oder ruhiges Gespräch mehr, man schrie oder flüsterte, Kurse und Papiere wurden ausgerufen und Zahlen flogen durch die Luft, wie auf einer Versteigerung, und weil man sein eigenes Wort kaum vernahm, so schrie man einander in die Ohren. Die Wissenden und die Wichtigthuer raunten mit Diplomatenmiene geheimnisvolle Ziffern, lächelten schlau, zuckten die Achseln und schoben sich Kursberichte, Depeschen und Zeitungsblätter zu. Und diese Zurückhaltung und Leisetreterei schien die Anderen nur noch mehr aufzuregen. Immer lauter wurde die wilde Jagd der Makler und ihrer Angestellten. Da galt es, den Konkurrenten zu übertönen, die Kurse zu treiben, die Kauflustigen anzueifern und zu bereden, die erteilten Aufträge auszuführen und neue zu erhaschen, die Bewegung der Hausse zu befestigen, Fernsprecher und Telegraphen spielen zu lassen. Die großen Bankiers und ihre Disponenten saßen auf den mit ihren Firmatäfelchen versehenen Rohrbänken oder an den Schreibtischen unter den hohen Fenstern, durch welche mächtige Lichtwellen aus dem stillen Hof in das Getümmel fielen, und empfingen Berichte und Aufträge, erteilten Ratschläge und Ordres und klatschten wohl auch über gleichgültige Stadtneuigkeiten, um sich vom Geschäft zu erholen oder durch ihre Ruhe und gute Stimmung Vertrauen zu verbreiten.
Unter der Uhr, deren goldene Zeiger auf halb Zwei rückten, sah man eine stillere Gruppe von ergrauten Börsenmännern, die von Lehrjungen und Kommis zwar umschwärmt, aber kaum erregt wurden, – kaltblütige Spekulanten und schlaue »Konzertzeichner«, die sich nicht mehr verblüffen und überrumpeln ließen. Nur ein dicker, ältlicher Herr, dessen Haar von Pomade glänzte, sprach, an eine graue Granitsäule gelehnt, etwas heftiger, – ein Baissier aus Temperament und Beruf, den dieser Hexensabbath mit immer stärkerem Mißtrauen erfüllte.
»Alles fauler Zauber!« rief er mit lispelndem Deutsch, das den germanisch blonden Bart Lügen strafte und deutlich die morgenländische Abkunft verriet. »Alles fauler Zauber! Noch vor Börsenschluß haben wir den Krach! Und das sage ich!«
Nun wurde endlich den umstehenden Freunden die ewige Zweifelsucht und Schwarzseherei zu viel. Sie suchten den Pessimisten zu bekehren, und ein eben herbeigeeilter Makler mischte sich in die Unterhaltung.
»Aber Herr Moritz,« kreischte der schon heiser gewordene Schreier, indem er entrüstet die Bleifeder in sein Buch steckte und die Hände zusammenschlug, »heiß' ich einen ungläubigen Thomas! Liegt die Sache nicht so klar wie Tinte? Die Niederdeutsche Bank rückt mit der Emission der peruanischen Anleihe heraus ... Ist es nun so unnatürlich, daß der Herr Generalkonsul für seine Emission Stimmung macht, indem er eine Hausse auf allen Märkten in Szene setzt?«
»Das ist nicht natürlich, sondern ungesund!« versetzte Herr Moritz, der ein arger Prinzipienreiter war.
»Selbst ungesund!« rief der Andere, dessen Geduld zu Ende ging, und stürzte sich wieder in den Menschenstrom, denn jenseit der viereckigen Schranken hatte er eine hohe Gestalt mit grauem Cylinderhute bemerkt, die von einem Kreise von Bankiers, Disponenten und Agenten umgeben war. Rasch brach er sich mit Hilfe rücksichtlos eingesetzter Ellbogen Bahn und näherte sich dem allmächtigen Bankdirektor.
»Ein seltener Gast an unserer Börs'!« rief der Makler mit süßlichem Lächeln und erkundigte sich einschmeichelnd, ob der Finanzmann vielleicht einen Auftrag für ihn habe. Doch dieser schüttelte den leicht ergrauenden Kopf und strich gelassen mit der Hand über die glattrasierten Wangen. Dann warf er durch seine goldene Brille einen ungeduldigen Blick nach dem Haupteingang, als erwartete er jemand. Aber die Umstehenden überließen ihn nicht lange seinen Gedanken und bestürmten ihn von allen Seiten mit ihren Fragen, denn er galt als treffliches Börsenorakel, das Vieles wußte und immer geschickt zu kombinieren verstand. Heute war er indessen nicht gewillt, den forschenden Geistern Rede zu stehen. Meist antwortete er ihnen mit irgend einer gleichgültigen Bemerkung, die zu nichts verpflichtete, oder mit einer ausweichenden Gegenfrage. Es schien ihn wenig zu interessieren, daß London fest, Wien animiert, Paris kauflustig, daß der kranke Kaiser eine gute Nacht gehabt, daß Lombarden 65, Franzosen 109, Diskonto 219, daß Fürst Schnitz gestern Abend im Klub 100+000 Mark im Baccara mit einem Pariser Journalisten verloren. Als aber ein mittelgroßer alter Herr, den Zylinderhut in der Hand, neben dem Portier erschien, durchbrach er rasch den ihn umgebenden Kreis und eilte mit elastischen Schritten zum Eingang.
»Der Herr Kommerzienrat gehört zu mir!« rief er dem Thürhüter schon von weitem zu, der sich mit einer Verbeugung entschuldigte. Dem Fremden aber mochten die Schwierigkeiten, die der Cerberus gegen seinen Eintritt erhoben, peinlich gewesen sein, denn eine jähe Röte färbte sein Gesicht, so daß es jetzt in der Umrahmung des weißen Backenbartes weniger alt erschien. Der Bankdirektor ging ihm mit vorgehaltenen Händen entgegen, was der Alte sehr geschmeichelt aufnahm, denn er verneigte sich einmal übers andere, immer mit einem Anfluge von schüchterner Unbeholfenheit. Doch weltstädtisch gewandt half ihm der Börsianer darüber hinweg, ergriff seinen Arm, hakte ihn in den seinigen ein und führte ihn so schnell, als es das Gedränge und die Rücksicht auf den Greis zuließen, in die Fensternische der Niederdeutschen Bank, wobei er mit ungeduldigen Handbewegungen die sich herandrängenden Geschäftsleute verscheuchte.
»Gott sei Dank!« rief er aus, als sie diese Insel inmitten der Brandung erreicht hatten. »Die Rotte Korah sind wir los. Aber bedecken Sie sich doch, Herr Kommerzienrat.«
Er setzte dem nicht gern unhöflich scheinenden Greise den Hut mit sanfter Gewalt auf den noch dichten Graukopf, und sie nahmen mit dem Rücken gegen das Fenster an dem viereckigen grünen Tische Platz. Der freundliche, aber noch nicht warme Aprilsonnenschein fiel nach einem Augenblicke der Verdunkelung durch leichte Regenwolken wieder in den Saal und goß, lustig von Stäubchen durchtanzt, über die nächsten Männergruppen seinen flimmernden Glanz, und der blanke braune Stuckmarmor an den Wänden warf den Schimmer wie ein Spiegel zurück, so daß der ganze Raum und alles Treiben darin wie in Licht gebadet schien. Doch nur zu bald mußte eine Wolke über das Stückchen Himmel ziehen, denn plötzlich erlosch das Sonnengold und sein Widerschein, und man sah von neuem nichts mehr als dunkle Männergestalten in einer von Staub, Dunst und Lärm erfüllten Säulenhalle.
Der Bankdirektor wies dem Fremden mit deutendem Finger den dreifach gegliederten Saal und seinen kunstvollen Bau, die Marmorgruppen, die Kolonnaden und die Galerien mit ihrem verwunderten Zuschauerpublikum aus der Provinz, aber das Haus schien seinen Freund weniger zu fesseln, als das betäubende Getriebe ringsum.
»Ja, das ist Handel und Wandel!« rief er aus. »Wer sein Leben lang wie ich nur Hand- und Maschinenarbeit verrichtete und verrichten ließ, erstaunt über diese Zauberwelt der modernen Million. Man spielt mit bloßen Begriffen, und ein Vermögen zerfließt einem zwischen den Fingern. Aber im Grunde wird hier doch das bewegliche Kapital der produktiven Arbeit entzogen und nur der schnell gewinnenden Spekulation zugeführt. Der mühsam erworbene und beharrlich gesammelte Volksreichtum verfliegt in der Luft, ohne daß man nachweisen kann, in welchen Taschen der Niederschlag geblieben. Hab' ich Recht, Herr Generalkonsul?«
Der Finanzmann warf aus seinen kalten, wasserblauen Augen einen ironischen Blick auf den alten Fabrikherrn, aber lächelte ihn gleich darauf freundlich an, um ihn nicht zu verletzen.
»Die Börse ist ein ganz unentbehrlicher und segenreicher Regulator und Stützpunkt des wirtschaftlichen Lebens,« wandte er ein. »Sie schafft den öffentlichen Kredit, gibt den Staaten und der Industrie ihre Millionen und öffnet der Sparkraft des Volkes sichere Wege und Stätten, wodurch die nationale Basis des Wohlstandes und der Steuerkraft gebildet wird. Freilich ist hier ein heißer Boden, und man muß genau Bescheid wissen. Sehen Sie, ein bloßes Gerücht hat den Bienenkorb in Aufregung versetzt. Andere Gerüchte sind entstanden. Ob wahr oder falsch, gleichviel. Die Hausse ist da. Wohl dem, der sie zu nützen versteht, ehe es zu spät wird.«
Zwei Makler hatten die Herren erblickt und drängten sich mit ihren Kurszetteln und Depeschen heran. Als der Direktor sie abwies, wandten sie sich an seinen Begleiter, der sie mit einem hilfeflehenden Blick auf den Freund loszuwerden suchte, doch fand er keine Unterstützung.
»Stellen Sie Ihr Glück auf die Probe.« sagte der Konsul. »Die steigende Tendenz ist nach meiner Berechnung fest, und Sie riskieren nichts.«
Es bedurfte nur dieser Aufmunterung, um die Makler zu einem erneuten Ansturme zu veranlassen. Aus ihrem Munde kamen Börsenausdrücke, Zahlen, Namen, von denen der Fremde nichts verstand. Im Handumdrehen hatte er um dreißigtausend Mark erstanden, und auch nach diesem Geschäfte gelang es dem Direktor nur mit Mühe, ihn von seinen Drängern zu befreien. Mit gutmütigem Lächeln und der leisen Besorgnis, die Herren zu beleidigen, ließ er sich von dem Konsul entführen, wahrend die anderen ihm neugierig nachblickten.
»Wen hat sich Lenz da herangeholt?« fragte der pessimistische Herr Moritz, der in diesem Augenblicke zu den Agenten trat. »Kommerzienrat Heller, Hohenzollernstraße 12,« antwortete der Makler mit einem Blick in sein Notizbuch, das er jetzt mit dem scharf gespitzten Bleistifte verschloß. »Ich weiß aber mehr von ihm, denn ich arbeitete früher am Rhein als Baumwollener. Heller war durch dreißig oder vierzig Jahre Besitzer der jetzigen Union-Aktienspinnerei in Burtscheid bei Aachen. Hat sein Schäfchen im Trocknen. So Stücker zwei, drei Millionen nach niedriger Schätzung.«
»Was Lenz nur mit ihm vorhat?« brummte der unverbesserliche Moritz. »Der Alte mag sich in acht nehmen. Wo Lenz hinkommt, da wächst kein Gras mehr. Der ist noch mit jeder Million fertig geworden.«
Die Anderen hörten kaum auf die Unglücksunke, denn sie drängten sich schon wieder zu den Schranken der vereideten Makler, wo jetzt die neuen Papiere reißenden Absatz fanden.
»Peruaner achtzig!« rief es von allen Seiten. »3/8 Geld! 1/2 Brief! 81 Geld! 82 Geld! Nur Geld!«
Indessen kamen die beiden Kaufherren auf ihrem vielgehemmten Rundgange durch den gewaltigen Bau weiter. Der Direktor führte den Greis an den Schranken vorbei durch die Menge, wo mit offenem Buch und gespitztem Bleistifte die »Pfuschmakler« standen und schrien, und hinüber zur Montanbörse, wo die ersten Kurse auf hochragenden schwarzen Tafeln angekreidet waren. Er wurde nicht müde, seinem Begleiter die Organisation der Börse zu erklären, berechnete den Umsatz der täglichen Geschäfte, schätzte den jährlichen Ertrag der Provisionen und war objektiv genug, auch die Verluste im Börsenspiel ungefähr zu beziffern. Der Kommerzienrat, auf seinen Arm gestützt und das Ohr ihm zugeneigt, hörte mit größter Aufmerksamkeit und wachsendem Erstaunen zu. »Wirklich! ... unglaublich!« diese Ausrufe drängten sich immer wieder über seine Lippen.
Der Generalkonsul weidete sich an diesem Erstaunen. Nein, für so naiv hatte er den Alten doch nicht gehalten, als dieser mit der Empfehlung eines Kölner Bankiers in seinem Bureau in der Niederdeutschen Bank vorsprach und sich zugleich über einige zweifelhafte nordamerikanische Papiere – Alabama-Tennessee und Memphis City – erkundigte, sowie die letzten Ziehungslisten der Schwedischen Zehnthalerlose einzusehen wünschte. Während ein Kommis die alten Nummern des Frankfurter »Aktionär« heraussuchte, beeilte sich der Direktor, dem Kommerzienrate klar zu machen, daß er sein Vermögen in weniger altmodischen Werten anlegen sollte, und gab sich alle Mühe, sein Mißtrauen gegen den »Giftbaum Börse« zu bekämpfen. Darum hatte er ihn auch zu einem Besuche des Merkurtempels in seiner Gesellschaft eingeladen. Und nun war er wirklich gekommen, und es traf sich ganz vortrefflich, daß er gerade in eine Hausse geriet, die freilich Lenz selber vorbereitet hatte.
»Die Börse,« sagte er, indem sie die leeren Verwaltungszimmer und die Restauration mit den beiden belagerten Büffets durchschritten, »ist das Herz der modernen Gesellschaft. Sie sehen nur das wüste Hin und Her, das Drängen und Schreien der Jobber, die Finanzmänner, die aus jedem Bankbruche bereichert hervorgehen, die getäuschten Aktionäre, all diese feilschenden Krämer, die man mit der Peitsche aus dem Tempel treiben sollte. Aber aus dieser wilden Jagd nach der Million geht auch tausendfacher Segen hervor. Viele gemeinnützige Werke, die Seehäfen, Eisenbahnen, Docks, Kanäle, die durchbohrten Meerengen, die bekämpfte Hungersnot, das Brot für jeden ... das wäre alles nicht ohne die Börse.«
Nach einem Blick in den Telegraphenraum und Journalistensaal drängten sie sich durch das Gewimmel der Produktenbörse, die gleichfalls in hellem Aufruhr schien. Drüben an der Längswand hoch ob dem Gewühl und Lärm war ein großes rundes Zifferblatt angebracht, aber der Zeiger wies nicht wie die Uhr drüben in der Fondsbörse die bedächtig entfliehende Zeit unter den Schlägen einer lauten Glocke, sondern sprang leise und launenhaft vor und zurück, in kurzen und langen Sprüngen und Zwischenräumen.
»Das sind die Drehungen der Windfahne auf dem Dach,« erklärte Lenz seinem Begleiter, und dieser war der Ansicht, daß die Winduhr da oben, die den Getreidespekulanten das Wetter verkündete, so recht in diese Räume passe. Unerachtet des eben gehörten Lobliedes kam ihm der ganze stolze Bau wie ein windiges Schwindelnest vor, aber er verschwieg rücksichtvoll seine Gedanken.
Sie waren eben in den Mittelsaal zurückgekehrt, als ihnen unter der Arkadengalerie ein hochgewachsener junger Mann in tadellos sitzendem grauen Anzuge den Weg vertrat. Nein, dachte Heller, das ist kein Börsianer, sondern gewiß ein Offizier in Zivil, wie der lang gedrehte Schnurrbart verrät, der Hinterscheitel, das bis zur Stirne sonnenverbrannte Gesicht und das ins rechte Auge gedrückte Glas.
»Lothar,« rief ihm der Konsul entgegen, »Du hier?«
»Jawohl, Papa,« antwortete der Offizier lustig, und Heller faßte jetzt den brünetten jungen Mann schärfer ins Auge und wunderte sich nur, daß ihm dessen Familienähnlichkeit mit Lenz nicht gleich aufgefallen war. Das war dieselbe schmale, spitze Nase, der fein geschnittene Mund, doch der Ausdruck offener, frischer, weniger diplomatisch zurückhaltend.
»Leutnant Lothar von Lenz,« sagte der Generalkonsul, während der Alte seinen schlichten bürgerlichen Namen »Heller« rief und dem Offizier die Hand schüttelte. »Du wolltest ohne Zweifel Deine schöne Uniform nicht bei diesem Krämervolk enkanaillieren,« fügte der Direktor mit einem Blick auf seines Sohnes Zivilistenanzug hinzu.
»Nein, nicht darum,« war die Antwort, »denn bei Dir und Deinen Freunden gibt es keine Kanaille. Aber ich bin in Begleitung ... draußen im Wagen ... Miß Leona, Du weißt ja ...«
Der Konsul erhob drohend den Finger. »Junge, Junge!« rief er mit falscher Strenge. »Also noch immer gute Freunde?«
»Ach ja!« seufzte der Offizier, und die Erinnerung an die tyrannischen Launen der vielumschwärmten Schulreiterin ging ihm wie ein Blitz durch den Kopf. »Sie wollte Dich um Rat fragen wegen ihrer Ungarischen Papierrente, ob sie verkaufen soll, und überhaupt wegen der heutigen Hausse, die ihr Hirsch telefoniert hat. Auch Peruaner will sie haben. Nur zu Dir hat sie Vertrauen. Also was soll sie thun?«
»Eine unverbesserliche Spielratte!« rief der Konsul kopfschüttelnd. »Nur gut, daß sie sich von ihren wucherischen Wechselagenten befreien will. Sie hat bei ihren letzten Operationen eine Reihe größerer Verluste erlitten, so daß ihre weiteren Spekulationen zu einem Risiko für uns führen. Wir werden sie auffordern müssen, ihr Depot bei uns zu verstärken.«
»Vater,« rief Lothar stehend, »sei kein Unmensch. So'n reizender kleiner Käfer! ...«
»Hat Schulden wie ein Major,« warf Lenz ein.
»Aber auch Freunde, die für sie gut stehen und sie unter allen Umständen über Wasser halten.«
»Du etwa?« spöttelte der Konsul.
»Bessere als ich,« rief Lothar mit Überzeugung. »Fürst Saßnitz zum Beispiel ...«
»Der gestern im Baccara 100 000 Mark verspielt ...«
»Das weißt Du auch schon?!«
»Die Börse weiß alles,« antwortete der Konsul trocken und winkte einen kleinen schwarzen Herrn heran, der am Tische der Niederdeutschen Bank ein Depeschenformular füllte und unter frauenhaft langen Locken einen starken Höcker umsonst zu verbergen suchte. Während der Chef sich halblaut mit ihm unterhielt, wechselten Heller und Lothar einige Worte.
»Papa ist nicht immer rosiger Laune,« vertraute er dem alten Herrn an, »aber ich kenne ihn und weiß jedesmal genau, wie weit ich gehen darf. Natürlich wird diese neue Spekulation meiner Freundin auf mein Konto gebucht, dessen Saldo schließlich doch er begleichen muß. Aber dahin wird es ja nicht kommen, denn Leona wird sicher gewinnen. Sehen Sie, jetzt erkundigt er sich über die Bewegung der Kurse ... ein Blick auf die Frankfurter Depesche, ein gedankenvoller Strich über die Stoppeln ... Achtung, er kombiniert! ... Hat ihm schon, von Schiller. Jetzt gibt er die Ordre ... was hab' ich gesagt? Und nun, die Kopie für Miß Leona ...«
»Lothar!« rief der Konsul.
»O ich kenne ihn!« flüsterte der Lieutenant lächelnd. »Folgt noch eine Strafpredigt über jugendlichen Leichtsinn, aber es ist nicht böse gemeint.«
»Lothar!«
»Da bin ich schon, Papa.«
Heller beobachtete aus der Entfernung die leise Unterhaltung zwischen Vater und Sohn, die allerdings den programmäßigen Verlauf zu nehmen schien. Geheuchelte Zerknirschung hier, nicht minder gut gespielte Strenge dort, dann ein Lächeln hüben und drüben, und der Zettel für Miß Leona ging von Hand zu Hand.
»Tausend Dank, Papa!« rief Lothar und schlug mit dem Spazierstöckchen, als wäre es eine Reitgerte, an seine Waden – eine Gewohnheit vom Exerzier- und vom Rennplatz. Aber zuletzt gab es doch eine Überraschung, denn der Konsul hielt seinen halb schon zum Gehen bereiten Sohn fest und sagte in wirklich hartem Tone zu ihm:
»Übrigens erwarte ich, daß Du bei nächster Gelegenheit Dich von dieser Zirkusreiterin freimachen wirst. Sie zerstreut Dich und lenkt Dich von Deinem wahren Ziel ab. Du weißt, was ich meine. Du machst seit einiger Zeit Adelheid von Berlow lässiger den Hof. Ich brauche aber die Unterschrift ihres Vaters für eine hannoversche Operation. Also muß ich sie zur Schwiegertochter haben.«
»Sie ist mir zu kalt und vernünftig,« wandte Lothar ein und spielte verlegen mit seinem zimmtfarbigen Hut. »Aber ich werde Dir gehorchen, Papa.« Und darauf gab er ihm die Hand, machte mit zusammenschlagenden Hacken vor dem Kommerzienrat eine Verbeugung und verschwand eilig in dem Gewühl.
»Ich war wieder schwach,« sagte Lenz lächelnd zu Heller, »aber es ist mein Einziger. Er ist gutmütig und willig, und da er meine Kreise sonst niemals stört, so drück' ich gern ein Auge zu.« Er ergriff den Kommerzienrat wieder am Arm und führte ihn hinweg. »Wir wollen doch sehen, wie seine Schöne ihm dankt.«
Sie betraten eines der menschenleeren Kurszimmer und stellten sich ans Fenster, das auf die Straße ging. Dort hielt ein leichter, offener Daumont, dessen feurige Schimmeljucker von einer eleganten, doch in schreiende Farben gekleideten, sehr schlanken Dame gelenkt wurden. Ihre großen, regelmäßigen Züge, die hochblonden Haare, rückwärts in einen schimmernden Zopf verflochten, und die kecken schwarzen Augen erschienen bei dem starken Auftrag von Schminke, der ihre Wangen bedeckte, noch auffallender und sehr herausfordernd. Ungeduldig blickte sie von Zeit zu Zeit nach dem Börseneingang, und in ihrer Hand zitterte die Peitsche. Da nahte Lothar von Lenz mit frohlockendem Gesicht und schwang den Zettel in der Rechten. Schnell entriß sie ihm das Papier, warf einen flüchtigen Blick darauf, zuckte geringschätzig die Schultern und schob es ins Mieder. Dann streifte sie mit der Peitsche leicht den Rücken ihrer Pferde, und ehe der über den ungnädigen Empfang erstaunte Offizier noch recht Platz neben ihr gefunden, rollte der Wagen der Spreebrücke zu und verschwand, wie vom Winde getragen, hinter den Bäumen des Lustparkes.
»Armer Junge!« sagte Lenz lachend. »Die Prinzessin scheint nicht zufrieden, aber den Gewinn, und wenn er noch so klein, wird sie pünktlich höchstselber einkassieren, dafür steh' ich. Doch Lothar muß mit ihr brechen, denn es ist eine gefährliche Person. Diesmal entsprach ich ihm noch. Man soll im Kasino und im Klub seinen Vater nicht einen Knicker heißen. Das könnte seinem Avancement Schaden bringen.«
Er nahm den Arm des Kommerzienrates, und sie gingen in die Halle zurück.
»Wohl eine kostspielige Ehre, einen Sohn bei der Garde zu haben?« bemerkte Heller, denn die Szene zwischen Vater und Sohn und zumal die blendende Erscheinung im Daumont hatten allerlei Gedanken in ihm geweckt. »Aber freilich,« fügte er wie zur Entschuldigung seiner Verwegenheit hinzu, »der Herr Papa hat es ja dazu.«
Der zerstreute Generalkonsul schien ihn nur halb verstanden zu haben, nickte aber doch artig. Dann ließ er seinen Arm fahren und ging rasch in den vom Menschengetöse erfüllten Saal voran. Da trat der lockige Kommis auf ihn zu. Sie wechselten einige Worte, und der Buckel tauchte wieder in der Menschenflut unter. Fragend sah Heller, der näher getreten, den Konsul an.
»Die Hausse macht das Völklein nervös,« war die Antwort, wobei Lenz vor seine goldene Brille noch einen Kneifer auf die Nase setzte, um besser zu sehen. »Ihre dreißigtausend Mark dürften schon jetzt einen ansehnlichen Gewinn repräsentieren.«
»Wirklich?« rief Heller vergnügt.
Das Leben und Treiben schien in der That seinen Höhepunkt erst jetzt erreicht zu haben, trotzdem die Uhr bereits Zwei schlug. Doch fiel dem Kommerzienrat auf, daß die gute Geschäftslaune von früher verschwunden war und einer gewissen Gereiztheit Platz gemacht hatte. Die Gebärden waren ungestümer, die Ausdrücke heftiger, die lauten Stimmen heiser geworden und überschlugen sich im Geschrei, und schon gab es da und dort Vorwürfe, Wortwechsel, von der Hysterie des Spiels geballte Hände. Aber was war das? Da hielten sich ja zwei Börsianer drohend die Faust unter die Nase und überschütteten sich mit einer Flut von Schimpfreden. Kaum gelang es den Umstehenden, die Streiter zu beruhigen und auseinander zu bringen. Natürlich war Herr Moritz, der ewige Baissier und Krakehler, der Störenfried.
»Was geht vor?« erkundigte sich der Bankdirektor bei seinem buckligen Faktotum und setzte wieder den Zwicker vor seine Brille, doch Herr Moritz mit hochrotem Gesicht, in dem jede Ader geschwollen war, hatte ihn gesehen und seine Frage gehört.
»Was es gibt, lieber Herr?« rief er ihm höhnisch zu und deutete auf seine vier Augengläser. »Sechs Augen und sieht doch nicht! Baisse gibts! Die Peruaner futsch! Alles fauler Zauber, ich hab's immer gesagt, und nun haben Sie mich doch reingelegt, zum erstenmal, wo ich à la hausse war. Pfui Teufel!«
Die Umstehenden schlossen einen Kreis um den aufgeregten Mann, und obgleich er fortfuhr, weitere Verwünschungen auszustoßen und wild um sich zu schlagen, so gelang es dennoch, ihn ins Freie zu schaffen, wo er sich an der frischen Luft beruhigen konnte. Doch sein Zorn schien auch auf andere übergegangen, wenn er sich schon bei ihnen maßvoller äußerte. Lenz fing indessen noch genug drohende Blicke und leise Flüche auf und fand es geraten, den heißen Boden zu räumen. Er führte den Kommerzienrat seitwärts unter den Säulengang und erkundigte sich bei einem guten Bekannten nach der Ursache dieser Panik.
Nichts war einfacher. Die Rothschild-Gruppe, die der Niederdeutschen Bank feindlich gegenüberstand, hatte dem verhaßten Konkurrenten einen schweren Schlag versetzt. Sie hatte sich durch ihre Vertreter und Agenten in Peru genau über die Absichten und Aussichten der Regierung erkundigen lassen, und all die dunklen Gerüchte, die seit einiger Zeit über die neue Anleihe in den bestunterrichteten Börsenkreisen herumgingen, hatten jetzt plötzlich Gestalt genommen. Depeschen von Lima und London mit den schlechtesten Auskünften wurden herumgereicht und eifrig besprochen. Die Niederdeutsche hatte in ihrem Prospekt unkontrollierte Angaben über die Staatsschulden gemacht, gewisse Posten waren verschwiegen, die Zolleinnahmen gefälscht worden, die neuen Silber-, Salpeter- und Goldminen schienen wertlos zu sein, die Guanolager waren längst in Paris verpfändet. Und indem diese bösen Berichte von Mund zu Mund gingen und in ihrem Rundlaufe sich verschlimmerten, sank der Kurs in wenigen Minuten von achtzig auf sechzig Prozent. Schon wurde der Generalkonsul von den Vertretern der großen Bankhäuser umringt, die eifrig mit ihm die Sachlage erwogen. Gewiß, die Niederdeutsche mochte ja selbst von ihrem Agenten hinters Licht geführt worden sein, aber bei einem solchen überseeischen Geschäft, meinte Bankier Mehlmeyer, schickt man einen Vertreter an Ort und Stelle, das sei man seiner Kundschaft schuldig.
»Ist alles geschehen,« rief Lenz, ohne seine diplomatische Haltung einen Augenblick zu verlieren, so peinlich und aufregend auch der Auftritt für ihn sein mochte. »Ich bestreite die Richtigkeit all dieser leeren Gerüchte. Eine sachverständige Expedition und kostspielige Studien lauter fachmännisch geschulter Kräfte gingen voraus, denn der allgemeine Grundsatz, daß jeder ehrenhafte Kaufmann sich bemühen soll, seinen Abnehmern für gutes Geld auch gute Waare zu liefern, kann im Emissionsgeschäfte nicht ernst genug genommen werden. Nach diesem Grundsatz hab' ich auch hier gehandelt.«
»Bestreiten Sie etwa,« fragte Herr Mehlmeyer lächelnd, »daß Sie die Emission mit achtzig ausgaben, während Sie sie mit sechzig übernahmen?«
»Nein,« war die Antwort.
»Ein horrendes Agio!« ging es entrüstet im Kreise herum.
»Die Niederdeutsche Bank,« erwiderte der Direktor achselzuckend, »hat sich als Emissionshaus den Ruf erworben, daß ihre Gründungen Erfolg haben, sei es durch schnelle Kursentwickelung oder durch wirkliches Gedeihen der Betriebe. Darum bin ich beim Ansetzen des Verkaufspreises immer für den kühnen Griff, denn ich denke, die Käufer schätzen den Wert einer Aktie hoch, wenn der Verkäufer sie selbst hoch schätzt. Übrigens noch einmal, meine Herren, die peruanische Emission ist durchaus solide und wird trotz aller neidischen Konkurrenz und des augenblicklichen Erfolges der Kontremine Freunde finden.«
Die grünröckigen Boten des Wolff'schen Telegraphen-Bureaus drängten sich eben durch die erregte Menge und verteilten hastig ihre blauen Zettel, die schon im nächsten Augenblick in den geschwungenen Fäusten der Geld- und Briefschreier flatterten oder in Fetzen am Boden lagen. Auch der Bucklige stürmte mit fliegenden Locken einher. Er brachte sehr günstig lautende Depeschen von den Börsen in London, Paris, Frankfurt, Wien, und sein Herr zeigte sie triumphierend herum. Dann eilte er, seinen Gast vergessend, der ihm schüchtern folgte, zum Tische der Niederdeutschen Bank und sprach eifrig mit seinen Angestellten. Er setzte sich und diktierte halblaut seine Maßnahmen. Depeschen, Briefe, Meldungen flogen hin und her, Boten kamen, und die Lehrlinge stürmten zum Depeschensaal und in den Telephonkeller.
Und noch immer stieg die Unruhe und das Unbehagen im Saal. Die Bewegung von fast unheimlicher Natur nahm an Umfang zu und riß auch die anderen Märkte mit sich ins Verderben. Alle Kurse sanken plötzlich, niemand wußte warum. Auswärtige Börsen sandten große Verkaufsordres, und auch am Platz erfolgten von angesehenen Instituten bedeutende Abgaben. Tausend ungünstige Gerüchte schwirrten durch die Luft. Kaiser Friedrich sei gestorben, in Petersburg habe ein neues Attentat stattgefunden, London und Paris seien in Panik und ähnliche Enten. Aber wer hatte denn noch Zeit, all den Unsinn zu kontrollieren? Verkaufen, nur verkaufen! hieß jetzt die Losung. Blindlings wurde alles über Bord geworfen, was man kurz vorher eifrig erworben hatte.
Noch immer stand der Konsul unentweglich im Sturm und bot ihm die Stirn. Er hoffte vor Börsenschluß die letzten Kurse zu retten, aber die Zeit verrann ohne sichtbaren Erfolg. Wie ein Feldherr nach verlorener Schlacht seine Reserven zusammenrafft und zu einem letzten Vorstoße dem übermütig vordringenden Feind entgegenwirft, um, wenn auch nicht mehr den Sieg, doch einen geordneten, ehrenvollen Rückzug zu erstreiten und den Ansturm der Verfolger zu brechen, so hatte Lenz noch einmal einen Gegenstoß gewagt und große Beträge aus dem Markt genommen, um das rasende Fallen der Kurse aufzuhalten. Den goldenen Tintenstift in der Hand, die Augen hinter den doppelten Brillengläsern fest auf das Treiben im Saale gerichtet, jeden Schrei der Makler, jede Miene der Widersacher auffangend, saß er ruhig auf seinem Lehnstuhl und hielt dem stürmischen Angebote stand. Heller mit seinem schlichten Alltagsverstand erkannte etwas Großes, Unbegreifliches in ihm und bewunderte seine Ruhe und Energie, weil sie ihm selbst so gänzlich versagt waren. Mochte Lenz auch die heutige Schlacht verlieren, so gewann er doch jetzt einen treuen, überzeugten Freund und wertvollen Bundesgenossen.
Da tauchte das bucklige Faktotum wieder aus der lärmenden Menge auf und drückte seinem Chef eine Kursdepesche in die Hand. Dieser warf einen Blick hinein und gab sie zurück, worauf er sich lächelnd an Heller wandte, den er ganz vergessen zu haben schien.
»Der Kurszettel ist das Zifferblatt an dem Uhrwerke des politischen und wirtschaftlichen Lebens,« sagte er, »aber man muß die Ziffern zu lesen verstehen und nie vergessen, daß oft auch unberufene Hände in das Räderwerk eingreifen und Unordnung schaffen. Doch solche Ruhestörer vermögen die Wirkungen realer Ursachen und Anlässe nicht auf die Dauer zu unterdrücken.«
Diese beschwichtigenden Worte schienen fürs erste ihre Wirkung auf den Kommerzienrat zu verfehlen, der eine feine Andeutung, einen Wink vermutete.
»Soll ich verkaufen?« fragte er, von der inneren Unruhe getrieben.
»Wenn Sie kein Vertrauen haben, gewiß,« war die Antwort.
»Nun, ich gestehe offen, die Deroute ringsum hat mich nervös gemacht.«
»Gut, dann übernehme ich Ihre Effekten zu Ihrem Ankaufspreise.«
»Sie verlieren also aus Rücksicht auf mich?«
»Rücksichten soll ein Finanzmann nicht kennen. Übrigens wäre ich sie Ihnen schuldig, denn ich verleitete Sie zum Kauf.«
Der Kommerzienrat sah mit Bewunderung zu dem Spieler auf, der einige Worte auf ein Blockbuch schrieb, den Zettel herausriß und dem Alten reichte.
»Wenn Sie darauf bestehen,« versetzte Heller, indem er fast beschämt über sein Mißtrauen den Zettel zu sich nahm.
»Ich kaufe noch tausend Stück zu,« sagte Lenz dem herangewinkten Makler, der den Auftrag rasch notierte. Auch andern Maklern, die herangekommen waren, erteilte er ähnliche Kaufaufträge.
»Direktor Lenz kauft!« dieser Ruf pflanzte sich bald von Gruppe zu Gruppe fort. Man zollte dem Mute des Spekulanten alle Achtung, aber die Stimmung blieb doch gedrückt. Nur wenige Kurse erholten sich wieder um ein Weniges. Die Baisse behauptete das Feld.
Nach und nach legte sich auch der Sturm, schon weil die offizielle Börse geschlossen wurde. Die Uhr gellte mahnend von oben herab, und in ihr Geläute heulten jetzt die langstieligen Handglocken der Börsendiener ihre schrillen Klänge. Die abgehetzten Schreier verstummten zuletzt, das Gedräng hörte auf, die Reihen lichteten sich, und hüben und drüben klappten die Ausgangsthüren immer schneller auf und zu.
»Peruaner fünfzig!« schrie ein kühner Makler. Ein Hohngelächter antwortete ihm.
»Narren!« brummte Lenz und zog den Kommerzienrat dem Ausgange zu, doch gellte ihnen noch der Ruf eines Pfuschmaklers nach:
»Peruaner fünfundvierzig!«
Ärgerlich schlüpfte der Konsul durch die selbstthätig sich drehenden Thüren und bemerkte erst draußen, daß sein Begleiter, der vor den Tourniquets sich nicht zu helfen wußte, zurückgeblieben war. Er kehrte also nochmals um, hieß ihn den Griff fassen und schob ihn vor sich her durch die Thüre.
»Die Börse will mich nicht mehr los lassen,« sagte der Alte mit gutmütigem Lachen.
»Das ist ein Omen!«
»Nein, nein! Mir fehlt der Mut, Sie aber haben Nerven und Courage, alle Achtung!«
»Immer, wenn ich meinen Fetisch bei mir habe,« erwiderte Lenz und strich seinem Kommis, der ihnen gefolgt war, mit der Hand über den gekrümmten Rücken. »Nicht wahr, ein heißer Tag, Schwarzbach?«
»Hoffentlich bringt Ihnen mein Verdruß Glück, Herr Generalkonsul,« antwortete der Krüppel mit einer tiefen Verbeugung, wobei sein Höcker noch höher emporzuwachsen schien.
Lächelnd öffnete der Konsul den Schlag seines Koupees, das links vor dem Gebäude am Ufer harrte, und nötigte den Geschäftsfreund hinein, der bloß in einer Droschke zweiter Klasse hergefahren war. Einen Augenblick später rollten die Gummiräder über die Brücke dem Westen der Stadt zu.
Aber die beiden Kaufleute waren von dem erlebten Schauspiele zu mächtig erregt, um ihre Gedanken anderen Dingen zuzuwenden, und Lenz empfand das Bedürfnis, seinen Begleiter zu beruhigen und mehr noch sich selbst gewissermaßen zu rechtfertigen.
»Die besten Wirkungen entstehen oft aus den unsinnigsten Ursachen,« sagte er. »Die Abenteurer haben mehr neue Länder entdeckt, als die vorsichtigen Küstenfahrer. Ganz rücksichtlose Geschäftsmänner verliehen der Industrie einen Aufschwung, an dem noch unsere Kinder und Kindeskinder sich erfreuen werden, ohne nach all den Vermögen zu fragen, die dabei zu Grunde gegangen sind, wie wir uns auch nicht mehr um die untergegangenen Schiffe grämen. Ich kenne Faiseurs der Börse, die Millionen schuldig geblieben sind, und denen die dankbare Nachwelt ein herrliches Denkmal errichten sollte.«
Ein scheu fragender Blick flog aus den Augen des Alten auf den Sprecher, aber dieser redete wirklich mit dem Brusttone der Überzeugung und schob seine Rechte majestätisch in den Ausschnitt seiner Weste, als stände er schon auf dem marmornen Sockel, der schnöden Mitwelt zum Vorwurf und kommenden Geschlechtern zu dankbarer Verehrung.
II.
Einer freundlichen Einladung eingedenk, machte Generalkonsul von Lenz dem Kommerzienrat Heller schon nach wenigen Tagen einen Besuch. Zwar kam er zunächst um gewisser Papiere willen, die Heller bei der Niederdeutschen Bank deponieren wollte, aber als diese geschäftliche Angelegenheit, die sich ebenso gut brieflich hätte erledigen lassen, besprochen war, da ließ es sich der ehemalige Fabrikant nicht nehmen, den Bankier in seine Häuslichkeit einzuführen. Es wurde dem Weltstädter, der lange Jahre in London, Paris und New-York gelebt und jetzt in Berlin eine große gesellschaftliche Stellung einnahm, nicht allzu behaglich darin. Zwar die Wohnung in der Hohenzollernstraße bestand aus einer »hochherrschaftlichen Belle-Etage« mit einer Flucht von vier Salons nach der Straße zu und entsprechenden Räumen gegen die Hofseite, alles komfortabel und geräumig, aber der kleinbürgerliche Geist hatte sich doch zugleich mit den Bewohnern hier festgesetzt. Schon im Kontor, wie Heller gewohnheitsmäßig sein Sprechzimmer nannte, bildete die von einem Berliner Tapezierer gelieferte Einrichtung einen scharfen Gegensatz zu den von Burtscheid mitgebrachten Bureaumöbeln: dem soliden, aber geschmacklosen Schreibtisch aus gelblackiertem Tannenholz mit Unterlage, Blockkalender und Tintenfaß, sowie dem plumpen, kaum von der Stelle zu rückenden Sessel, der mit seiner niedrigen Lehne und dem grünen Sitzkissen ebenso unbequem, als seinem Besitzer unentbehrlich war. An den Wänden hingen verblichene Photographien und erblindete Daguerrotypieen in verschossenen Plüsch- und holzgeschnitzten Rahmen, und ein von schmaler Goldleiste umgebenes Diplom irgend einer Ausstellung, wo die Firma Johann Rudolf Heller ihre erste Auszeichnung errungen, prangte über einem altväterlichen Sopha, das Heller aus seiner Junggesellenzeit herübergerettet hatte. Das waren alles teure Andenken für ihn und Marksteine aus seinem aufsteigenden Lebenslaufe vom Ansetzerburschen zum Fabrikherrn und Millionär, und er wollte sich um keinen Preis von ihnen trennen, den Vorstellungen seiner sonst vielvermögenden Frau zum Trotz. Übrigens hätte diese in den anderen, ihrer ausschließlichen Herrschaft unterstehenden Gemächern bei etwas besserem Geschmack reichliche Gelegenheit zur Umgestaltung und Verschönerung gefunden, wie ihr das sogar ihr Berliner Tapezierer schon mehrmals angedeutet hatte. Ebenso vergeblich waren seine Versuche gewesen, der Dame klar zu machen, daß die lebensgroßen Familienporträts, die sie für unerreichbare Meisterwerke hielt, bloße Pfuschereien eines höheren Weißbinders waren. Da sah man in handbreiten Goldrahmen den vierzigjährigen Johann Rudolf Heller mit Frack, Vatermörder und hoher schwarzer Seidenbinde, wohlfrisiert, mit roten Bäckchen und klugen, glänzenden Äugelein, in der flüchtig gepinselten Hand eine dampfende Zigarre. Die um achtzehn Jahre jüngere Gattin aber thronte ihm gegenüber mit eingefrorenem Lächeln in ihrem besten schwarzen Seidenkleide mit Krinoline und indischem Shawl, dem jüngsterhaltenen Ohren- und Busenschmuck von schwerem Gold, das Gesicht wie frisch geschminkt, süßlich, fad, aber dafür waren die über die Handknöchel fallenden Spitzenmanschetten mit einem Fleiße gepinselt, worauf das Ehepaar den Beschauer niemals hinzuweisen versäumte. Zwei ebenso großartige Bildnisse prangten daneben. Da sah man in Samtbluse und Spitzenkragen den jungverstorbenen und noch immer beweinten einzigen Sohn des Hauses, den kleinen Alexander, und die annoch blühende Tochter des Hauses, Viktoria, nach der imposanten Mutter, aber zum Unterschiede von ihr gewöhnlich Wicky benannt, damals ein kugelrundes, rotwangiges Backfischchen mit der Stumpfnase und den schönen Augen der Mutter.
Unwillkürlich verglich der Generalkonsul, als ihn Heller mit vieler Förmlichkeit in seinen Salon führte, diese Porträts mit den ihm vorgestellten lebendigen Urbildern. Wie Papa Heller aus dem rüstigen Fabrikherrn an der Wand ein weißköpfiger Rentier, so war auch Frau Viktoria aus der jungen Mutter eine behäbige Matrone geworden. Nur ihren Augen hatten die Jahre nichts oder wenig genommen; sie glänzten noch mit denen ihrer Tochter um die Wette und sprachen von einer Lebenslust, die den ergrauten Scheitel Lügen strafte. Diese Augen schienen nebst der impertinenten Stumpfnase das einzige, was ihre Tochter, die den Besuch mit dem schönsten Tanzstundenknix empfing, aus ihren Kinderjahren bewahrt hatte. Es war ein hochgeschossenes, etwas blasses, aber recht hübsches Mädchen geworden, das mit der Siegesgewißheit einer reichen einzigen Tochter eine Schaar Verehrer und Bewerber zu erwarten schien.
War der Konsul im ersten Augenblicke von dem provinzialen Beigeschmack des Hauses unangenehm berührt, so überraschte ihn bald ein etwas freierer Zug, ein gewisser Drang nach größeren Verhältnissen, ja eine Sehnsucht nach weltstädtischem Schliff und moderner Lebensfreude. Schon das Kleid der Kommerzienrätin aus dunkler Seide kam offenbar nicht von Burtscheid, sondern aus einem Modewarengeschäft der Residenz. Wenn die Dame sich noch von der plebejischen goldenen Uhr und Kette und den protzenhaften Diamantohrringen trennen konnte, so durfte sie sich in jedem feinen Salon mit Anstand sehen lassen. Im Anzug und Behaben der Tochter hatte der Kundige fast nichts auszusetzen. Ihr einfaches Rosakleid war vielleicht samt den Hängezöpfen für ihre zwanzig Jahre zu jugendlich, aber beides paßte zu ihrem matten Teint und den braunen Augen. Entschieden, Papa Heller war der altmodischste und spießbürgerlichste in seinem Hause.
Kaum hatte der Generalkonsul und Direktor diese Bemerkung für sich gemacht, so war sie von der Kommerzienrätin schon laut ausgesprochen und von ihrer Tochter durch ihr lächelndes Schweigen bestätigt worden. »Mein Mann sieht es nicht ein!« ... diese Klage kehrte im Munde der stattlichen Frau immer wieder. Ach, und was sah der gute Alte nicht alles ein! Daß seine Frau ihr Leben in der traurigen Provinz eigentlich gar nicht genossen habe, und daß er es ihr und seiner heiratsfähigen Tochter und nicht zu vergessen seinem Stand und Vermögen schuldig sei, ein großes Haus in Berlin zu machen, glänzende Gesellschaften zu geben, sein »Kontor« neu zu möblieren, Wagen und Pferde zu halten, ein eigenes Haus zu bewohnen, auf eine Loge in der Oper und im Schauspielhaus zu abonnieren, die vornehmen Konzerte nicht zu vergessen u.s.w. u.s.w. Und indem Frau und Fräulein Viktoria vor dem Besucher die jedenfalls täglich wiederholte und verlängerte Liste der »wirklich notwendigen« Weltstädtereien aufzählten und mundfertig ergänzten, lachte Papa Heller in der ganzen Verstocktheit eines anspruchlosen Kleinbürgers in sich hinein.
»Schon recht, schon recht, Kinder!« rief er zuletzt, als er ganz in die Enge getrieben war und auch vom Generalkonsul keine Hilfe bekam, »ich gebe ja alles zu. Ich bin vom alten Schlag und verstehe mich nicht auf den modernen Ton. Als ich vor fünfundfünfzig Jahren mit zerrissenen Schuhen und dem Ränzel auf dem Rücken nach Burtscheid kam ...« Mutter und Tochter brachen in ein schallendes Gelächter aus, das offenbar die unliebsame Reminiszenz übertönen sollte, aber der Alte mißverstand diese Absicht, und da er sich verlacht sah und befürchtete, von dem Bankier nicht ernst genommen zu werden, so wiederholte er mit erhobener Stimme seine Behauptung und erzählte, vor Eifer glühend, ein Langes und Breites von seinen mühsamen Anfängen auf dem Wege zur Million: wie er, der Sproß einer kinderreichen Arbeiterfamilie, als kleiner Knabe, statt die Schule zu besuchen, die Spinnstühle fegen und die zerrissenen Baumwollfäden anknüpfen mußte, dann nach Jahren endlich einen Spinnstuhl bekam, Aufseher wurde und eines Tages eine kleine Wattenmühle einrichtete, aus der sich im Laufe der Jahrzehnte die größte Spinnerei der Rheinprovinz entwickelte. Lenz hörte mit aufrichtiger Teilnahme der Erzählung dieses schlichten Arbeiters zu, der sich durch Intelligenz und unermüdlichen Fleiß emporgeschwungen, aber seine Bewunderung wurde ihm erschwert durch die lachenden Zwischenrufe von Frau und Tochter, denen solche Erinnerungen unerwünscht und vor diesem Weltmanne peinlich und beschämend waren. Doch der Alte fuhr unbeirrt fort, ohne die gute Laune zu verlieren, und erzählte auch weitläufig, wie er die Bekanntschaft seiner späteren Frau gemacht, welche die Tochter eines Oberlehrers am Gymnasium gewesen sei.
»Alles, was ich bin, verdanke ich neben dem lieben Gott, der mir Gesundheit gab, nur mir selbst und meiner Hände Arbeit,« schloß er seine Bekenntnisse. »Dafür kenne ich aber auch den Wert des Geldes, denn ich weiß, wie schwer ich es verdient habe. Und wenn ich heute nochmals auf die Welt käme, so wollte ich doch wieder so ein altmodischer Mensch werden, der alles nur seinem Fleiße schuldet. Ich sehe wohl ein, daß man heute leichteren Verdienst findet, und Sie, Herr Generalkonsul, haben mir jüngst ein Beispiel davon auf der Börse gegeben. Aber das ist nichts für einen schlichten Arbeiter wie ich.«
Frau Viktoria zuckte die Achseln. »Deine Verdienste in Ehren, lieber Mann, und kein Mensch denkt auch daran, sie Dir zu nehmen. Du bist aus der alten Schule, und sie ist Dir wohlbekommen. Gut, aber deswegen sollst Du Dir doch Mühe geben, Dich in die neue Zeit zu fügen, in der Du nun einmal lebst und wir mit Dir. Unsere Übersiedelung nach Berlin haben wir Dir nach jahrelangem Zureden abgebettelt und abgetrotzt. Das war aber nur der erste Schritt. Jetzt heißt es hier standesgemäß leben. Das sind wir unserem einzigen Kinde schuldig. Habe ich nicht Recht, Herr Generalkonsul?«
»Reichtum verpflichtet,« war die Antwort. »Der Herr Kommerzienrat wird sich schon noch in seine neue Umgebung und seine neuen Pflichten finden.«
»Nie, nie!« rief der Alte. »Hier werde ich mich niemals heimisch fühlen! Ja, wenn ich meine Thätigkeit wieder hätte! Meine hohen, luftigen Spinnsäle, die sausenden Maschinen, die Arbeit, die Arbeit! Sie können nicht glauben, wie ich mich schon in Burtscheid nach meinem Austritt aus dem Geschäft unglücklich fühlte! Und dort hatte ich wenigstens meinen Garten, mein Stammcafé, meine Geschäftsfreunde ... Aber hier in der Weltstadt sterbe ich vor Langeweile.«
»Dagegen gibt es bewährte Mittel,« sagte Lenz, »und Ihre Frau Gemahlin hat sie bereits aufgezählt: die Gesellschaft aufsuchen, zu sich laden, sich in den Strudel stürzen« ...
»Nicht wahr?« rief Frau Viktoria mit strahlenden Augen, ganz glücklich, einen Helfer und Bundesgenossen gefunden zu haben, doch ihr Gatte blickte mit hartnäckigem Kopfschütteln vor sich hin.
»Ich bin kein Weltmann,« sagte er fast traurig.
»So werden Sie einer!« rief Lenz. »Es gibt keine zweite Stadt auf der Welt, wo es einem so leicht gemacht wird, wie in Berlin. Eine harte, schneidende Luft, gewiß, aber man fühlt sich warm und wohl darin, sobald man sich daran gewöhnt hat. Genußfreude und Lebenslust liegen hier wie das Geld auf der Straße. Eine maßlose Gastfreundschaft, gar nicht wählerisch, denn die Gesellschaft ist demokratisch angehaucht und leicht zugänglich. Und so billig!«
»Wirklich?« rief der Kommerzienrat, dem das letztere Argument gewaltig einleuchtete. Doch seine Frau schien beleidigt.
»Und wenn es was kosten würde, Rudolf?« sagte sie aufgebracht, »wir haben's ja!«
»Das mein' ich auch, gnädige Frau.«
»Du siehst, der Herr Generalkonsul sind ganz meiner Ansicht.«
»Gewiß, und ich glaube, daß es leicht sein würde, die Lieblingswünsche Ihrer Frau Gemahlin auszuführen, ohne Ihre eigenen Gewohnheiten allzu sehr zu stören. Sie führen ein großes Haus, Sie leben weltstädtisch, Sie empfangen und erwidern Besuche, Sie gehen in die Theater« ...
»Das wäre mein Tod!« unterbrach ihn Heller angstvoll. »Drei Stunden lang eingesperrt in einem menschenüberfüllten Haus, ohne Licht, ohne Luft, und dazu sich eine Geschichte vormachen lassen, die einen gar nichts angeht! Ein Komödiant, der nichts als Schulden hat, setzt sich eine Papierkrone auf und mutet uns zu, wir sollen ihn für einen König halten. Das sind Kindereien, denen ich keinen Geschmack abgewinne.«
Lenz lächelte, während die beiden Damen verzweifelnde Blicke wechselten.
»Mein Mann war von jeher ein Prosamensch!« seufzte die Kommerzienrätin.
»So lassen Sie ihm seine Prosa,« versetzte Lenz begütigend. »Er ist glücklich dabei, und sie hat ihm wahrlich Segen gebracht. Es wäre Unrecht, sie ihm verkümmern zu wollen. Nein, die Weltstadt läßt jeden nach seiner Fasson selig werden. Das ist gerade ihr größter Reiz. Mögen Frau und Tochter in die Welt gehen, dem Gatten bleibt es unbenommen, in seinem stillen Winkel ruhig für sich zu leben. Wenn der Gemahl seine Rolle bloß markiert, ist die Welt schon befriedigt. In der Gesellschaft regiert ja überhaupt die Frau, nur die Frau! Der Mann braucht einzig bei Antritts- und Anstandsbesuchen dabei zu sein. Als Wirt kann er fast ganz verschwinden, sofern die liebenswürdige Wirtin für die Gäste sorgt. Um die Damen in Konzert und Theater zu führen, findet sich wohl ein Freund des Hauses ... O es wird Ihnen nicht an Begleitung fehlen, meine Damen, glauben Sie mir!«
»Herrlich! herrlich!« jubelte Wicky und klatschte in ihre weißen, weichen Händchen.
» Mein verehrtes Fräulein, Sie werden sogar Mühe haben, sich all' Ihrer Verehrer zu erwehren.«
Das junge Mädchen schlug errötend ihre Augen nieder und war in diesem Augenblicke von einer berückenden Anmut. Nur Schade, daß sie es viel zu gut weiß, dachte Lenz.
»Ich habe also dabei wirklich nichts zu thun?« fragte der Kommerzienrat.
»Gar nichts.«
»Das paßt mir. Aber wie werde ich dann erst meine Langeweile los?«
»Ich denke die Verwaltung Ihres Vermögens sollte schon genügen, Ihre Muße interessant auszufüllen.«
»Das gibt mir wenig Arbeit. Den größten Teil habe ich in meiner ehemaligen Spinnerei sicher angelegt. Allwöchentlich erhalte ich die Arbeitausweise, die ich nachrechne, und einmal im Jahre die Bilanz.«
»So lange Sie dort selbst regierten, ging das an,« meinte der Bankier. »Aber bei der leidigen Aktienwirtschaft und der englischen Direktion zöge ich mich zurück. Freilich, an der Börse mögen Sie nicht spielen?«
»Da sei Gott vor!« rief Heller in panischem Schrecken, so daß der Konsul laut auflachen mußte. Indessen war diesem noch daran gelegen, seinen Freund zu einer milderen Anschauung von der Börse zu bekehren, denn er kam auf die Vorfälle an jenem heißen Tage zurück, deren Zeuge der Alte gewesen war. Es hatte sich alles nachträglich als Mißverständnis herausgestellt und in Wohlgefallen aufgelöst. Die feindliche Gruppe war von ihrem Nachrichtendienst schlecht informiert worden oder hatte ein bloßes Börsenmanöver zu Gunsten der Baissiers in Szene gesetzt. Natürlich war die Wahrheit noch am nämlichen Abend ans Licht gekommen, und sämtliche Kurse schnellten in die Höhe, so daß auch der Kommerzienrat, wenn er nicht den Mut verloren, jetzt einen namhaften Gewinn in der Tasche hätte.
»Ja, ich habe den Ring gesprengt,« schloß er stolz seine Ausführungen, »und dem neuen Reichsanleihen die Wege geebnet. Diese goldene Internationale kann ja vom rein geschäftlichen Standpunkte keine freundliche Haltung gegen ein Land einnehmen, welches sich mit seiner geordneten Finanzwirtschaft von den Geldmächten frei hält und ihnen keinerlei Einfluß einräumt, obendrein staatssozialistische Bestrebungen bethätigt und die andern Staaten zur Nachfolge drängt.«
Heller horchte auf. Er hielt als Mann der Selbsthilfe nicht eben viel vom sozialpolitischen Erbe des alten Kaisers, aber der patriotische Klang dieser Worte berührte ihn angenehm, und bewundernd blickte er zu dem großen Finanzmanne auf. Seine Frau jedoch, für welche die Börsenthätigkeit einen vornehmen Beigeschmack hatte, beklagte den spießbürgerlichen Standpunkt ihres Gatten und machte sich nicht wenig über seinen mangelnden Spekulationssinn lustig.
»Das ist Sache des Temperaments,« meinte Lenz, »Man müßte eine andere Beschäftigung für Sie finden, Herr Kommerzienrat.«
»Ach bitte ja, Herr Generalkonsul, suchen Sie!« baten die Damen.
Doch da fiel dem Bankier ein, daß er nebenbei auch gekommen war, das fachmännische Urteil Hellers in einer anderen geschäftlichen Angelegenheit zu erbitten, und als er von den Damen Abschied genommen, da ersuchte er noch um eine kurze Audienz im »Kontor«.
Es handelte sich um die Erlaubnis, den Alten an einem Abend nächster Woche zum Besuch einer verkrachten Charlottenburger Baumwollspinnerei abzuholen. Sie hatte dem jüngeren Lenz gehört, der vor einigen Monaten einem Schlaganfall erlegen war. Bei der Ordnung des brüderlichen Nachlasses ergaben sich so bedeutende Passiven, daß der Betrieb der Fabrik eingestellt werden mußte. Der Hauptgläubiger, die Niederdeutsche Bank, stand gegenwärtig mit den übrigen Kreditoren in Unterhandlung, doch war der Zwangsverkauf an den Meistbietenden kaum mehr zu umgehen. Während der Direktor noch hoffte, die Fabrik für den Sohn seines Bruders, den dreißigjährigen Hans Lenz, retten zu können, der unter seinem Vater dem Bureau vorgestanden hatte, war der Verwaltungsrat der Bank eher geneigt, dieses Privatunternehmen in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Der Vorbesitzer, als Fabrikant ein guter Techniker, aber schlechter Kaufmann, war lange ein unbequemer Schuldner der Niederdeutschen Bank gewesen, doch konnte man seine Fabrik mit genügenden Geldmitteln wohl noch emporbringen. Jedenfalls war es dem Konsul erwünscht, in dieser Angelegenheit das Gutachten eines Fachmannes wie Heller einzuholen, und mit tausend Freuden erklärte sich dieser zur Besichtigung der Spinnerei bereit, worauf Tag und Stunde sofort vereinbart wurden.
»Ein genialer Kaufmann!« rief der Alte begeistert, als er nach dem Abschiede des Konsuls wieder ins Wohnzimmer zu seinen Damen stürmte.
»Ein Ideal von einem Mann,« erwiderte Frau Viktoria, die sehr leicht schwärmte. »Hoffentlich sehen wir ihn recht oft bei uns. Er hat auch einen Sohn, den Gardelieutenant von Lenz ... aber freilich seine Zirkusreiterin ...«
Der Alte verstand die Anspielungen seiner Frau, die in jedem adeligen jungen Mann einen passenden Schwiegersohn vermutete, und er gebot ihr mit dem Finger auf dem Munde, in Wicky's Gegenwart von solchen Damen zu schweigen. »Das Kind, das Kind!« flüsterte er mit besorgtem Vaterblick. Unnötige Vorsicht! Das »Kind« war längst kein Kind mehr und hatte denselben Gedanken wie ihre liebe Mutter, und obwohl sie jetzt einen verschämten Blick zu Boden warf, zuckte doch um ihre Mundwinkel ein eigentümliches Lächeln, das sogar den tapferen Dragoneroffizier vielleicht entmutigt hätte.
III.
Es war ein schöner Nachmittag im Mai, als der Kommerzienrat schon eine Stunde vor der festgesetzten Zeit den Konsul zum Besuche der Spinnerei erwartete. Das blanke Koupee fuhr Schlag drei pünktlich vor, und da vergaß der Alte in seiner Aufregung, daß er seinen Damen versprochen hatte, ihnen den Freund noch auf einen Augenblick heraufzubringen. Er stieg also wider die Abrede nach kurzer Begrüßung sogleich ein, und der Wagen rollte ohne Aufenthalt von dannen, gefolgt von den enttäuschten Blicken der am Fenster harrenden Frau Viktoria und ihrer Tochter.
Der blaue Himmel, nur da und dort noch gesprenkelt von hellgrauen Wolken, und ein warmer, sanfter Hauch hatten Spaziergänger und spielende Kinder auf die Straßen und Plätze gelockt. Auf der Charlottenburger Chaussee, zu deren beiden Seiten die Bäume des Tiergartens im zarten Schmuck ihres jungen Laubes grünten, war ein Gedränge von Menschen und Fuhrwerken. Die hellgrauen Tische und Stühle der Schenkgärten standen nicht mehr einsam da, denn zahlreiche Gäste saßen unter den Kastanien bei Bier und Kaffee und ließen sich nach dem langen Winter endlich wieder einmal von der Sonne durchwärmen. Fröhliches Geplauder, wohl auch ein Lied vergnügter Zecher, Kinderlachen und Vogelgezwitscher überall. Und dichter wurde das Gewühl, je näher man dem Schlosse kam, von dessen Kuppel hoch über der Krankenstube des kaiserlichen Dulders die purpurne Standarte wehte.
Die Spinnerei lag am äußersten Westende der Vorstadt Moabit auf Charlottenburger Gebiet, und als der Wagen von der Chaussee rechts abbog und den Spreekanal entlang fuhr, erkannte Hellers scharfes Auge das Ziel schon von weitem. Es war ein langes, fünfstöckiges Gebäude mit kleinem Thürmchen, das die gelbe Vesperglocke sehen ließ, und obwohl nutzlos und verlassen, blickte es stolz auf die umliegenden Bau- und Zimmerplätze und die spärlichen Häuser. Auf den ersten Blick erkannte der Fachmann die stillstehende Fabrik an dem schadhaften Dach und den unbelebten Fenstern mit ihren blinden Scheiben, und es that ihm leid um die große tote Spinnerei mit ihrem eingestellten Betrieb.
Das Koupee fuhr über die plumpe Holzbrücke. Der Blick von hier war sehr verschiedenartig. Stromaufwärts ahnte man die große Stadt, deren Thürme und Giebel in Rauch und Nebel verschwammen. Hier ankerten mächtige Baggerschiffe und bliesen aus ihren Schloten dichte Rauchwolken, indessen der triefende Eisenkorb aus dem schwarzen Wasser tauchte, in der Luft kreiste und seine Last klaffend in den angekoppelten Schuttnachen ausgoß. Dampf- und Handkräne waren in voller Thätigkeit und entleerten die angekommenen Schiffe, Lastträger luden Backsteine und Balken auf, und eine hochgeschnabelte »Apfelzille« empfahl sich als Restaurant. Neben diesen unbeweglichen Schiffen sah man die stinken Schlepper, die den Kanal auf und ab fuhren und einen ganzen Schweif von schwerbeladenen Elbkähnen hinter sich durch das trübe Wasser zogen. Der Rauch wirbelte empor, an seinem aufrechten Rade stand der Steuermann neben dem rußigen Maschinisten, und rasselnd glitt die nasse Kette über die sanft gewölbte Länge des niedrigen Dampfers. Auch die Lastschiffe, die aus eigener Kraft stromauf strebten, kamen heute rascher von der Stelle. Frau oder Kind stand am ungefügen Steuer, indes die Männer mit ihren an die Schulter gelegten zweizinkigen Stacheln den Kahn weiterstießen, wobei sie tief gebückt das ganze Schiff abliefen, doch der Wind, der westwärts von Spandau her wehte, erleichterte ihre Mühe. Das große, graue Segel war ja halb gehißt und blähte sich mit lustigem Rauschen im Winde, und so glitt das Schiff schnell genug dahin, daß die Männer bald ihre harte Arbeit aufgaben und sich behaglich der Stadt entgegentreiben ließen.
Ein ganz anderer Ausblick war nach Westen. Da sah man kein Haus, keine Lagerplätze, keine Arbeiter. Der Kanal machte eine Biegung, und der königliche Schloßpark am linken Ufer umrahmte mit seinen hohen Linden und Buchen das idyllische Landschaftbild, so daß der Strom einer stillen Bucht ähnlich sah. Nur links hatte ein großer Apfelkahn geankert, und rechts bei der Fabrik lagen ein Lastschiff und ein kleines Boot an der Kette. Ein Flug weißer Möven flatterte kreischend über dem Wasser, während einige Krähen auf den Weiden und Pappeln krächzend ihre schwarzen Flügel schlugen. Hoch über den Bäumen des Parks schwamm ein Weih mit ausgebreiteten Schwingen fast reglos in der Luft.
Der Wagen hielt vor dem verschlossenen Thor, über dem in Goldbuchstaben die Firma: Johannes Lenz & Komp. stand, und lange dauerte es, bis auf das gellende Glockenzeichen ein leichter Schritt näher kam, so daß den Herren alle Zeit blieb, um auf eine Geige mit Klavierbegleitung zu hören, deren Klänge über die hohe Fabrikmauer drangen.
Ein fünf- oder sechszehnjähriges bleichsüchtiges Mädchen in dünnem Kattunkleid öffnete, und die großen dunkelbraunen Augen nahmen einen erschrockenen Ausdruck an, als sie den Generalkonsul erblickten.
»Um Entschuldigung,« stammelte die Kleine, »daß ich so lange warten lasse. Ich dachte, es wäre man bloß der Nachtwächter. Gleich ruf' ich Vatern.«
Ein Wink des Konsuls hielt die Enteilende zurück.
»Hier geht es ja wieder hoch her,« sagte er streng.
»Vater musiziert.«
»Natürlich mit meinem Neffen?«
Die Kleine nickte, und über ihr hübsches, aber fahles Gesichtchen flog ein roter Schimmer.
»Und ich hörte zu mit Muttern. Es war so schön, daß ich Ihr Klingeln gar nicht vernahm. Mutter schickte mich und ich schlich davon, um nicht zu stören. Es ist die neue Sonate. Die ganze letzte Nacht hat er daran gearbeitet.«
»Also eigene Komposition?«
»Ach!« Der Seufzer war ihr unbewußt entfahren, und mit offenem Munde schien sie die Tonwellen zu trinken, indeß ihre Augen weit geöffnet standen und doch nichts sahen. Ein nervöses Zucken lief durch ihren zarten Körper, als zitterte darin jeder Bogenstrich nach. Und jetzt ging die sanfte klagende Weise in eine brausende, schwungvolle Melodie über, worin sich alle Wehmut des Adagio ungestüm auflöste. Es klang wie Befreiung und Erlösung, wie von fallenden Ketten und seligem Jubel, in kräftigem Takt, als gelte es einen begeisterten Marsch in einem heiligen Kriege für alles Hohe und Schöne. Aber nur zu bald brachen die klagenden, grübelnden, bohrenden Akkorde wieder hervor und überwucherten den erhabenen Freiheitgesang. Was hatte die jubelnde Seele aus ihren Himmeln gestürzt? War sie erlegen im Kampf oder vor dem entscheidenden Schlag ermattet? War sie zu schwach und zu zaghaft? Trug sie den Feind in sich selbst, die nagende Schwermut, den tödtlichen Zweifel, die Milde oder die unendliche Liebe, die nur den Frieden will und wenn sie selbst zu Grunde gehen sollte? Und in sanften, trüben, langgezogenen Klagetönen verklang das Lied.
Die Kleine blieb noch immer aufhorchend stehen und sah wie verklärt aus, aber die beiden praktischen Geschäftsleute hatten weder für Musik, noch weibliche Anmut Verständnis und gingen voran. Jetzt schien das Mädchen aus seinem Traum zu erwachen, strich sich mit der kleinen gelben Hand über die Stirn und sprang den Herren nach, um vor ihnen die Thüre zu öffnen. Als sie die Schwelle betraten, zeigte die große Uhr darüber halb Vier. Nur sie hatte die Arbeit nicht eingestellt.
»Ich werde Vatern rufen,« wiederholte das Mädchen.
»Nein, wir finden uns ohne ihn zurecht,«
»Auch Herrn Hans – ich meine Herrn Lenz – nicht?«
»Kein Wort. Er mag weiterspielen, denn zu Geschäften scheint er nicht aufgelegt. Sie können gehen, Kleine.«
Sie zögerte Und blieb kopfschüttelnd mit einem entschlossenen, fast trotzigen Zug im Gesichte stehen. »Ich darf keinen Fremden allein in die Fabrik lassen.«
»Mich auch nicht?«
»Niemand.«
»Ein wohlbewachtes Haus!« sagte der Konsul lächelnd, »aber Sie folgen mit Recht Ihrer Instruktion. Also kommen Sie mit.«
Sie stieß zur Linken eine große, ungestrichene Thür auf, in der ein von schmutzigen Händen abgegriffenes Guckloch angebracht war, und sie traten in den ersten Arbeitsaal, der sein Licht von den Doppelreihen hoher Fenster erhielt, durch deren trübe Scheiben die Frühlingssonne mit irisierendem Glanze sah. Ein Geruch von Maschinen- und Brennöl lag in der muffigen Luft. Er fiel dem alten Spinner nicht lästig, aber Lenz öffnete schnell ein Fenster. Nun gingen sie langsam zwischen den feiernden Maschinen hindurch, die in Manneshöhe ragten und mit ihren Spulen, Haspeln und Rädern etwas Persönliches, Menschliches hatten. Wie die verzauberten Bewohner von Dornröschens Schloß waren sie mitten in ihrer Thätigkeit erstarrt, und nun schienen sie die Besucher anzustehen: Gebt uns das Leben wieder!
Heller musterte mit kundigem Blick und tastenden Händen die Maschinen, las die Firmentafeln, die sie an der Stirnseite trugen, klopfte auf die Blechröhren, zog an den Treibriemen. Da und dort hing noch eine Flocke Wolle. Er nahm sie sorgsam weg und prüfte sie aus alter Gewohnheit, indem er sie zwischen den beiden Daumen und Zeigefingern drei- oder viermal zerzupfte und übereinander legte, bis er die Fasern in ihrer ganzen Länge in der Hand hielt. »Guter Stapel!« murmelte er dann oder benannte die Wolle: »Low Middling!« oder »Fair Oomra!« oder »feine Ägyptische!« Am Ende des Saales warf er einen Blick zurück, als wollte er den ganzen Inhalt noch einmal übersichtlich ordnen und in einem Zahlenwert ausdrücken. Lenz sah ihn fragend an, aber der Alte schwieg und eilte ins erste Stockwerk voraus.
Dort stand der »Wolf« mit offenem Rachen, in dessen Innern der Gehalt ganzer Baumwollballen wie spielend auseinander gerissen und ausgespieen wurde. Jetzt schwieg das eiserne Ungeheuer, seine Verdauung stockte, und Heller gab ihm mit der Hand im Vorbeigehen einen Klaps. »Alter Junge!« sagte er mit einem Doppelsinn, der dem Konsul entging. »Du mußt Gesellschaft haben!« fügte er bei, um keinen Zweifel über die Notwendigkeit eines neuen Openers aufkommen zu lassen.
Nun in den zweiten Stock und über einen mit Eichenbohlen belegten Vorraum, wo die emporgezogenen Ballen durch das offene Fenster hereingerollt und geöffnet wurden. Noch lag im Winkel ein Haufen rostiger Eisenbänder und verstaubter Packleinwand. Heller schüttelte mißbilligend den Kopf. Sein Ordnungssinn war verletzt, weil man das gar nicht wertlose Gerümpel hier liegen ließ.
Dann über die steile Holztreppe einen Stock höher durch eine offene Fallthüre. Sie standen in der unteren Karderie. Dort sah man auf einem Podium die Maschinen des Schleifers, der die Kratznadeln zu reinigen und zu schleifen hatte, und zwei Reihen Krempelmaschinen. Noch klebte an einem Deckel eine dicke Kruste Watte. Heller, dessen Bäcklein sich gerötet, brummte etwas Unverständliches und ging ohne Aufenthalt schnell weiter. Er schien wie verjüngt.
Länger hielt er sich in den Spinnsälen auf. Er prüfte die Halbselfaktors mit wohlgefälligem Auge und las die englischen Firmenschilder.
»Eine Sünd' und Schande für so ein Geschäft!« rief er aus. »Die Maschinen sind alt, aber gut.«
»Mein Bruder hat sich daran verblutet.« »Ja, die Engländer sind nicht billig,« gab er trocken zurück. »Aber im Stillstand muß das alles freilich verrosten und verkommen.«





























