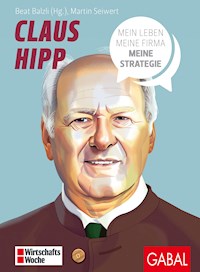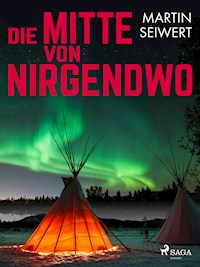
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Student Martin Seiwert begibt sich auf eine abenteuerliche Reise: er besucht in Kanada die Dene-Indianer, einen der letzten freien Ureinwohner-Stämme Nordamerikas. Auf seinem Weg quer durch das Land lernt Seiwert hautnah die Kultur, Bräuche und Legenden der Dene kennen und berichtet in diesem eindrucksvollen Mix aus Reportage und Reisebericht von seinen Erfahrungen auf diesem vielleicht spannendsten und lehrreichsten Trip seines Lebens. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Seiwert
Die Mitte von Nirgendwo
Die letzten freien Indianer Nordamerikas
Saga
Die Mitte von Nirgendwo
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1995, 2021 Martin Seiwert und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728025536
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Obwohl es draußen bereits hell ist, brennt in den Zugabteilen noch das Licht. Ein verspäteter Nachtfalter umkreist nervös die Deckenlampe, als die schrille Pfeife des Schaffners die Ruhe auf dem Bahnhof jäh unterbricht. Der Zug scheint kein Verständnis zu haben für meine Ungeduld. Mit würdevoller Langsamkeit setzt er sich in Bewegung, verläßt gemächlich meine Heimatstadt Konstanz, auf deren Dächern noch der morgendliche Dunst liegt. Darüber wartet schon ein wolkenloser Sommerhimmel.
Ich verpasse die schönsten Tage des Jahres, denke ich. Die Leute werden am Seeufer in der Sonne liegen, während ich auf dem Weg zum Polarkreis bin.
Wir haben die Stadt verlassen. Mein Blick schweift nach draußen, wo die Büsche, die den Bahndamm säumen, immer schneller vorbeihuschen, die Dörfer erwachen, die Straßen sich langsam mit dem Berufsverkehr füllen. Zwischen diese Bilder drängen sich immer wieder Ereignisse der vergangenen Wochen. Wie ein Unbeteiligter erlebe ich noch einmal die letzten Tage in der Schule und schaue mir beim Rucksackpacken zu. Ich höre wieder den grellen Alarm des Weckers, der mir heute morgen – wie die Schulglocke zum Beginn einer Prüfung – einen Stich in den Magen versetzte. Und ich erinnere mich an das plötzliche Bewußtsein, daß nun der Tag gekommen ist, um den seit Monaten so viele meiner Gedanken kreisten.
Angefangen hat alles damit, daß ich in der Schule recht lesefaul war. Niemand konnte mich motivieren, freiwillig einen längeren Text zu lesen – bis meine Mutter mir eines Tages ein Buch über Indianer brachte. Es war das erste Buch, das ich aus eigenem Antrieb las, und es sollte zu diesem Thema wahrhaftig nicht das letzte sein. Mir hatte sich eine neue, spannende Welt eröffnet, und ich war fest entschlossen, sie genau kennenzulernen. Zunächst vermutete ich diese neue Welt nur bei den Indianern, und so begannen sich die Bücher über Nordamerikas Ureinwohner in meinen Regalen zu stapeln.
Jahre später sollte mir diese Ansammlung zum Schicksal werden. Ich hatte beschlossen, daß ich zu alt sei für eine derartige Kinderlektüre und daß die Regale für Wichtigeres geräumt werden müßten. Etwas wehmütig blätterte ich die verstaubten Bände noch einmal durch und fand zufällig zwischen den Seiten einen zehn Jahre alten Artikel aus unserer Regionalzeitung. Sicherlich hatte ich als Kind den Bericht nicht verstanden, sondern ihn nur wegen des Wortes »Indianer« in der Überschrift ausgeschnitten. Auf dem vergilbten Papier las ich nun von den sogenannten Dene-Indianern im Nordwesten Kanadas und von einer Rede des Häuptlings Nerysoo:
»Wir sind das letzte freie Indianervolk Nordamerikas. Wir haben unsere eigene Kultur, unsere eigene Sprache, unser eigenes politisches System und, was das wichtigste ist, wir besitzen das Land. Stück für Stück hat der Weiße versucht, uns diese Dinge zu nehmen. Die Zeit ist reif. Wir müssen sagen: Bis hierher und nicht weiter. Wenn wir für das Überleben als freies Indianervolk kämpfen müssen, so werden wir dies tun.«
Diese Worte faszinierten mich ungemein. Ich las sie immer und immer wieder, kannte sie bald auswendig. Doch hätten sie wohl kaum größere Bedeutung für mich gewonnen, wäre da nicht gleichzeitig das Stipendium gewesen. Erst vor kurzem hatte ich es erhalten, und es sollte mir eine Studienreise mit selbstgewähltem Thema in ein Reiseland meiner Wahl ermöglichen. Gleichzeitig verpflichtet es aber den Stipendiaten, die Reise allein zu unternehmen, einen Bericht darüber anzufertigen und mit einem absoluten Minimum an Geld auszukommen.
Ein Plan, der mich nicht mehr loslassen wollte, begann Gestalt anzunehmen: Mit dem Stipendium würde ich mir den Kindheitstraum erfüllen, nach den Indianern aus meinen Büchern zu suchen, vielleicht bei ihnen zu leben. Längst hatte ich mich damit abgefunden, daß Indianergeschichten Stoff für Kinderträume seien und nicht mehr. Doch der Zeitungsartikel entzündete in mir den winzigen Funken Hoffnung, es könne Stämme geben, die zumindest einen Teil ihrer wertvollen Kultur vor der weißen Invasion in die Gegenwart hinüberretten konnten.
In den darauffolgenden Monaten versuchte ich, mehr über die Dene-Indianer herauszufinden. Zwar bekam ich wenig brauchbares Material zusammen – und es mag sein, daß ich insgeheim froh darüber war, denn ich fürchtete, in Wirklichkeit einem Wunschtraum nachzujagen. Doch was ich über die Dene erfuhr, genügte, um die Reise in meinen Augen zu rechtfertigen.
So hatte ich gelesen, die Dene lebten auch heute noch hauptsächlich von der Jagd und behandelten deshalb ihr Land mit tiefem Respekt. Sie betrachteten sich nicht als Eigentümer ihres Stammesgebiets, sondern lediglich als dessen Hüter. Es hieß, sie sähen ihre wichtigste Aufgabe darin, das Land den kommenden Generationen in einem guten Zustand zu überlassen. Deshalb widersetzten sie sich dem industriellen Fortschritt, von dem sie glauben, daß er ihr reiches Land arm und sie selbst zu Marionetten eines ausbeuterischen Systems macht.
Diese Äußerungen beeindruckten mich, doch war mir völlig unklar, wo ich sie in meine bisherigen Vorstellungen von den amerikanischen Ureinwohnern einordnen sollte. Da gab es einerseits das Bild der »edlen Wilden« Karl Mays oder Kevin Costners, andererseits dachte ich aber auch an die schockierenden Berichte über arbeitslose Reservatsindianer, die ihre Hoffnungslosigkeit im Alkohol ertränken.
Ein unfreundliches »Die Fahrausweise bitte!« reißt mich aus meinen Gedanken. Eben ist ein älterer Mann zugestiegen, der die Fahrkartenkontrolle zum Anlaß nimmt, mich nach meinem Reiseziel zu fragen.
»Ich fahre nach Kanada«, antworte ich knapp und versuche, ein höfliches Lächeln aufzusetzen, obwohl mir nicht gerade nach einer Unterhaltung zumute ist.
»Oh, haben Sie Freunde oder Verwandte dort?«
»Noch nicht«, würde ich am liebsten antworten, doch es gelingt mir, die Frage mit ernster Miene zu verneinen.
»So ganz allein zu den Indianern. Ist das nicht gefährlich?«
»Schließlich leben die ja nicht mehr im Wilden Westen!« antworte ich.
Andererseits, denke ich bei mir, trägt der verhängnisvolle Zeitungsartikel die Überschrift »Kanadas Indianer wehren sich an der Letzten Grenze«. Der Westen war in Nordamerikas Pionierzeitalter stets die äußerste Siedlungsgrenze, die sogenannte Last Frontier. Dieser Begriff ging später als Synonym für die großen Herausforderungen einer Epoche in die Geschichte der Vereinigten Staaten ein. Amerikas Westen ist inzwischen längst erobert, die Letzte Grenze liegt heute für viele Weiße im Norden des Kontinents – auch in der unberührten Wildnis der Nordwestterritorien, wo die Dene-Indianer seit Jahrtausenden auf die Jagd gehen, wo auf einer Fläche von der Größe Indiens weniger Menschen wohnen als in einer deutschen Kleinstadt und wo angeblich noch riesige Rohstoffvorkommen unter und über dem Boden ungenutzt lagern.
Als zu Beginn dieses Jahrhunderts im Stammesgebiet der Dene Öl, Gold und Uran gefunden wurden, verschob sich die Letzte Grenze schlagartig in Richtung Norden. Auf die wenigen, größtenteils friedlichen Pelzhändler, die seit rund hundert Jahren unter den Dene lebten, folgte eine Flut von weißen Kaufleuten und Spekulanten. Die Einwanderer lösten Epidemien aus, zerstörten traditionelle Sozialstrukturen und brachten viele Ureinwohner an den Rand des Hungertodes.
Bis in die späten sechziger Jahre beobachteten die friedliebenden, höflichen Dene, was um sie herum geschah. Doch dann begannen sie, von neuem auf die Ältesten zu hören, Selbstbestimmung über ihr eigenes Land und Leben zu fordern. Die Dene-Stämme schlossen sich in einer politischen Organisation zusammen und kämpfen seither für ihre Rechte und gegen zerstörerische Entwicklungsprojekte auf ihrem Land.
Die Hitzewelle, die mir beim Betreten des Flugzeugs entgegenschlägt, nimmt mir den Atem. So hält sich die Freude darüber, daß ich einen Fensterplatz bekommen habe, zunächst in Grenzen. Die Sonne brennt durch das schmutzige Guckloch herein, und schon bald klebt mir mein T-Shirt am Körper. Als ich den Sitz nach hinten kippen lasse, merke ich, wie die Anspannung der letzten Tage endlich aus meinen Gliedern weicht. Ein beruhigendes Gefühl, daß es nun kein Zurück mehr gibt, keine quälenden Fragen mehr nach dem Ob und Wann!
Mit mehr als einer Stunde Verspätung hebt die Maschine ab, wovon ich allerdings nicht viel mitbekomme. Erst als wir schon ein paar Kilometer Flughöhe erreicht haben, wache ich wieder auf und blicke zunächst ratlos aus dem Fenster, wo gewaltige Wolkenberge vorüberziehen.
Nach mehreren Stunden Flug bietet sich allen, die auf eine Durchsage des Kapitäns hin ihre Nasen an die Außenfenster drücken, ein grandioser Ausblick. Wir überfliegen einen Gebirgszug Grönlands, dessen höchste Berggipfel aus einem Wolkenmeer in die frostige Polarluft emporragen. Darüber spannt sich ein Himmel, der nach oben hin immer dunkler wird, und man möchte fast meinen, die Erdkrümmung sei wahrzunehmen. Später zieht das Meer, auf dem riesige Eisschollen treiben, unter uns vorbei. Von Deutschland aus sind wir nordwärts geflogen; jetzt geht es auf der anderen Seite des Globus wieder in Richtung Süden. Grünbraunes, scheinbar ödes Land taucht auf, das von unzähligen schwach blauen Flüssen und Seen durchzogen ist. Ich überlege mir, ob so das Stammesgebiet der Dene aussehen könnte.
Am späten Nachmittag setzt unsere Maschine zum Landeanflug an. Der Flughafen von Edmonton liegt, eingebettet in endlose Felder und Viehweiden, weit außerhalb der Stadt. Diese Tatsache erleichtert mir die Entscheidung, ohne Zwischenstop in der Hauptstadt Albertas gleich an den Großen Sklavensee weiterzureisen. Mein Ziel dort, über tausend Kilometer Luftlinie weiter im Norden gelegen, heißt Yellowknife, ein kleines Städtchen, Regierungssitz der Nordwestterritorien und damit auch Zentrum des Kampfes der Dene um Land und Rechte. Ich ergattere ein Stand-by-Ticket und komme gerade noch beim letzten Flug vor Schalterschluß an Bord.
Obwohl es bereits nach zehn Uhr abends ist, scheint in Yellowknife noch die Sonne, als ich etwas verloren auf der Landebahn stehe und mich umsehe. Überrascht, beinahe ein wenig enttäuscht, stelle ich fest, daß die Landschaft fast so aussieht, wie ich sie mir vorgestellt habe. Flach und karg, von Seen und zwergwüchsigen Nadelbäumen durchzogen.
Wo kann ich nur jetzt noch einen Schlafplatz finden? denke ich und betrachte dabei den langen Schatten, den ich im Schein der untergehenden Sonne auf das Rollfeld werfe. Da taucht ein zweiter Schatten neben meinem auf.
»Vorhin im Flugzeug, als du mit der Stewardeß gesprochen hast, habe ich gehört, weshalb du hier bist. Wenn du willst, kann ich dich nach Yellowknife mitnehmen. Das ist von hier aus noch ein ganzes Stück.«
Vor mir steht ein junger Mann; ich würde ihn auf mein Alter schätzen. Er könnte ein Dene sein – wenn ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie ich mir die Angehörigen dieses Indianerstammes vorstellen soll. Seine Haut ist nicht auffallend dunkel, doch auch nicht so hell wie die eines Weißen, seine schulterlangen Haare sind tiefschwarz. Die mandelförmigen, braunen Augen geben ihm ein asiatisches Aussehen. Seine Kleidung, aber auch sein Englisch, sind durchaus amerikanisch, wenn auch ein eigentümlicher Akzent in der Aussprache nicht zu überhören ist. Irgendwie klingen die Worte besonders weich, beinahe ein wenig stumpf. Später werde ich feststellen, daß fast alle Dene an dieser typischen Aussprache zu erkennen sind.
»Ich heiße Antoine Cleary«, meint der hilfsbereite Unbekannte, als wir zu seinem beinahe schrottreifen Geländewagen hinübergehen.
Während der Fahrt deutet er auf die »Skyline« von Yellowknife und meint lächelnd, als müsse er sich dafür entschuldigen, wir seien hier »in the middle of nowhere«, der Ort habe nur ganze fünfzehntausend Einwohner.
»Ein Drittel davon sind Dene, so wie ich«, fügt er hinzu.
»Sprechen die alle Englisch?« möchte ich wissen.
»Ja, schon. Nur die alten Leute sprechen lieber ihre Muttersprache. Unter uns Jugendlichen gibt es seit einiger Zeit wieder den Trend, sich in den Dene-Sprachen zu unterhalten. Unseren Eltern sollte das durch das weiße Schulsystem abgewöhnt werden.«
Yellowknife macht auf mich den Eindruck eines modernen amerikanischen Städtchens. Die jetzige Hauptstadt der Nordwestterritorien hatte vor einigen Jahrzehnten durch ihre Goldgruben Bedeutung erlangt und war daraufhin nach Art der Weißen aus dem Boden gestampft worden. Die Straßen sind breit, die Architektur ist kalt und langweilig. Über den vielen zweistöckigen Gebäuden erheben sich einige Hochhäuser – wohnungsbaupolitische Reaktion auf die hohen Mieten, wie mir Antoine erklärt.
Ich versuche, die Gesichtszüge der Menschen auf den Straßen zu erkennen, doch inzwischen breitet sich die Nacht über der Stadt aus. Mit der Dämmerung verlassen auch die berüchtigten subarktischen Moskitos ihre Verstecke. Kaum hat mich Antoine am gewünschten Ort – bislang meine einzige Kontaktadresse in Kanada – abgesetzt, hüllt mich eine dunkle Wolke dieser stechwütigen Biester ein. Ich stehe vor einem schlichten gelben Holzhaus, dem Wohnsitz eines katholischen Missionars namens Pater Lambert. Viele Personen hier im Norden hatte ich von zu Hause angeschrieben – er war der einzige, von dem ich eine positive Antwort erhielt.
»Wenn Sie vor Ort sind, dann schauen Sie doch einmal bei mir vorbei«, steht in dem Brief, den ich in der Hand trage, als ich auf die Eingangstür zugehe. Ich versuche, mir die Moskitos vom Leib zu halten, was sich als gar nicht so einfach herausstellt, wenn man mit einem zwanzig Kilogramm schweren Rucksack, Fototasche und Handgepäck behängt ist.
Gleich nachdem ich angeklopft habe, wird die Tür vorsichtig geöffnet, und vor mir steht ein ergrauter Mann, dem die Lesebrille gefährlich weit auf die Nase heruntergerutscht ist. Über die Gläser hinweg mustert er mich sichtlich erstaunt und müßte eigentlich bemerken, wie sehr mich die Moskitoschwärme plagen. Doch selbst nachdem ich mich vorgestellt habe, macht er keine Anstalten, die zweite Tür aus Moskitonetz zu öffnen und mich hereinzubitten. So unterhalten wir uns zunächst durch das Netz hindurch, und es stellt sich heraus, daß der Mann die Ferienvertretung von Pater Lambert ist.
»Aber kommen Sie doch erst einmal herein«, meint er dann. »Ich bin Brian Nickerson aus England.« Er streckt mir die Hand hin.
Vielleicht ist er doch nicht so zugeknöpft, wie es den Anschein hat, hoffe ich, nicht zuletzt mit dem Hintergedanken, irgendwo im Pfarrhaus meinen Schlafsack ausrollen zu dürfen. Doch dafür macht wohl mein nächtlicher Überfall einen allzu abenteuerlichen, unseriösen Eindruck auf Mr. Nickerson – was ich ihm nicht übelnehmen kann. Per Telefon organisiert er bei der »Konkurrenz«, in der Sozialunterkunft der Heilsarmee, ein Bett für mich. Als ich das Missionarshaus verlasse, offenbart mir der Engländer: »Ich hoffe, es macht Ihnen nicht allzuviel aus, daß dort vor allem Obdachlose und Prostituierte wohnen. Aber für eine Nacht... morgen müssen Sie sich halt nach etwas anderem umsehen.«
Das kann ja heiter werden, denke ich, mache aber gute Miene zum bösen Spiel und trotte nach einer Skizze des Priesters in Richtung Obdachlosenheim davon.
Schon um sechs Uhr in der Frühe müssen laut Hausordnung die Bewohner der Heilsarmee-Unterkunft ihr Quartier verlassen haben. Kurz nachdem dieses gnadenlose Ultimatum verstrichen ist, trete ich zusammen mit einer Handvoll verschlafener Gestalten an die kühle Morgenluft. Ein hohles Gefühl in der Magengegend treibt mich in die City, wo meine Suche nach einem Frühstück – vor allem nach einem heißen Kaffee – schon bald von Erfolg gekrönt ist. Das Miner’s Mess ist ein einfaches Restaurant aus den frühen Tagen der Hauptstadt. Wie mir die Wirtin erzählt, ist es aber auch der Treffpunkt des Städtchens schlechthin, Umschlagplatz für die neusten Gerüchte, Pausenstation für Minenarbeiter, Indianer, Presseleute und Regierungsbeamte. An den rußgeschwärzten Holzwänden zeugen verstaubte Schwarzweißfotografien von den Pioniertaten der ersten Siedler und den Anfängen der Stadt. Ich verschlinge mit Heißhunger das üppige Frühstück und werde dabei von den anderen Frühaufstehern an den Nachbartischen eingehend gemustert. Vielleicht sind Reisende mit großen Rucksäcken und ebenso großem Hunger eher selten in Yellowknife.
Nicht ganz die Hälfte der Leute im Miner’s Mess sind Indianer. Sie sitzen etwas abseits, und es sieht so aus, als wollten sie unter sich sein. Kaum einer trinkt seinen Kaffee mit einem Weißen zusammen.
In der Kleidung unterscheiden sich die jungen Dene fast nicht von den Weißen ihres Alters: Sportschuhe, Jeans und T-Shirt. Nur die betagten Indianer mit ihren kupferbraunen, tiefgefurchten Gesichtern scheinen sich heimlich auf dunkle Kleidung abgesprochen zu haben. An den Füßen tragen manche reichlich mit bunten Perlen bestickte Mokassins, deren Schaft mit Fell ausgekleidet ist. In Sachen Kopfbekleidung sind sich junge wie alte Männer offenbar einig. Praktisch jeder Indianer, der das Restaurant betritt, trägt eine Baseballmütze. Mögen sie auch in Form und Farbe variieren – allen gemeinsam scheint ihre große Wichtigkeit zu sein. Wie die Kopftücher der älteren Indianerinnen werden sie nicht einmal zum Essen abgenommen.
Obwohl die Dene bestimmt bemerken, wie ich sie beobachte, werde ich umgekehrt von ihnen scheinbar gar nicht wahrgenommen. Ihr gesamtes Auftreten, ihre Bewegungen, ihre Gespräche sind ruhig und gelassen. Jede Reaktion, jede Mimik bringt Zurückhaltung und Souveränität zum Ausdruck. Ich frage mich, ob das als Vorsicht, Stolz oder einfach als Teilnahmslosigkeit zu verstehen ist. Ganz anders verhält sich die geschwätzige Wirtin. Sie fragt mich richtiggehend aus, welche Absichten und Pläne mich an den Sklavensee führen, und verspricht mir dann: »Falls Sie öfter mal auf einen Kaffee hier hereinschauen, werde ich Sie mit einigen Leuten bekanntmachen, die Ihnen sicher weiterhelfen können. Sie glauben gar nicht, wer hier tagtäglich so vorbeikommt.«
Ihr Blick richtet sich auf eine weiße Frau, die mit einem kleinen Jungen ganz in meiner Nähe sitzt. Noch während die beleibte Wirtin zwischen zwei Sätzen eilig Luft holt, wird mir klar, daß diese Frau als Bestätigung für das eben Gesagte herhalten muß. In der Tat ist sie die Sekretärin eines indianischen Parlamentsabgeordneten. Spontan versucht sie, mir ein Interview mit ihm zu ermöglichen. Leider ist der Politiker gerade in einer Sitzung, als wir im Parlamentsgebäude eintreffen, das sich gleich um die Ecke befindet. Trotzdem kehre ich mit einer ganzen Liste neuer Kontaktadressen – darunter weitere Politiker, Organisationen und Journalisten – ins Miner’s Mess zurück.
Unter den neuen Anschriften ist auch diejenige von City Hope, einer Anlaufstelle für Indianer, die aus einsamen, kleinen Siedlungen stammen und mit dem städtischen Leben in der Hauptstadt Yellowknife nicht zurechtkommen. Da ich nicht zum ständigen Bewohner der Heilsarmee-Unterkunft werden möchte, erkundige ich mich bei City Hope nach einer Bleibe. Die Blicke der Angestellten dort, einer Indianerin, sind kühl und mißtrauisch.
»Sie sind also hier, um unsere Kultur zu untersuchen, ja?«
Es folgt ein peinlich langes Schweigen, dann fährt die junge Frau fort: »Nun, für gewöhnlich wohnen solche Leute im Yellowknife Inn.«
Das Yellowknife Inn ist das teuerste Hotel der Stadt! Mir wird klar, daß die Indianerin ein ziemlich falsches Bild von mir haben muß. Wie mache ich ihr nur klar, daß ich keiner der vielen Wissenschaftler bin, die beruflich hierher kommen?
»Ich bin kein Ethnologe; ich möchte die Dene-Kultur nicht in diesem Sinne untersuchen«, sage ich zögernd. »Ich will sie vor allen Dingen erleben. Ich dachte mir, ich könnte irgendwo, vielleicht bei einer Familie, so leben, wie es die Dene auch tun.«
Zum ersten Mal blickt mich die Frau direkt an, und ich glaube, ein gut verstecktes Erstaunen in ihrem Gesicht zu erkennen. Ich erkläre ihr, daß mir ein kleines Fleckchen für meinen Schlafsack durchaus genügen würde.
»Dafür könnte ich ja im Haushalt aushelfen.«
Die Indianerin scheint ernsthaft nachzudenken. Dann huscht ein verschmitztes Lächeln über ihr Gesicht.
»Können Sie spülen?«
»Ja, spülen kann ich schon.«
»Und babysitten?« – »Na ja, ich...«
»Also, wenn Sie wollen, können Sie für zwei, drei Tage bei mir wohnen. Und übers Wochenende suche ich dann etwas Besseres. Meine Wohnung ist recht klein, und dazu habe ich zwei sehr anstrengende Söhne. Aber es wird schon irgendwie klappen.«
Jetzt bin ich es, der überrascht ist. So ganz scheint die Frau selbst noch nicht von ihrem Angebot überzeugt zu sein, und mir ist das plötzliche Entgegenkommen auf einmal peinlich.
»Das ist ja wirklich nett, aber sind Sie sich auch sicher, daß...?«
»Ja, das geht schon in Ordnung«, unterbricht sie mich kurzerhand und gibt mir einen Zettel mit ihrer Adresse und einen Schlüssel.
»Ich muß hier noch bis sechs Uhr arbeiten. Sie können sich ja schon ein bißchen einrichten.«
Ich versuche, die Adresse auf dem Zettel zu entziffern, da meint die Indianerin noch: »Ach, das habe ich völlig vergessen. Mein Name ist Doreen. Und wie heißt du?«
Das Appartement von Doreen befindet sich im Untergeschoß eines vierstöckigen Hauses, nicht weit vom Ufer des Großen Sklavensees entfernt. Obwohl der Fernseher läuft, als ich die Wohnung betrete, scheint niemand zu Hause zu sein. Der Anblick, der sich mir bietet, ist chaotisch. Überall auf dem Fußboden liegen Spielzeug und Kinderkleider verstreut, auf den Schränken türmen sich benutztes Geschirr, Bücher und Kosmetikartikel. Von den Kindern keine Spur. Ich suche mir ein halbwegs freigeräumtes Plätzchen und beschließe abzuwarten.
Als Doreen am Abend nach Hause kommt, nimmt sie sich als erstes eine Flasche Rotwein und setzt sich mit einem Glas vor den Fernseher.
»Trinkst du Alkohol?« fragt sie mich, nachdem ich neben ihr Platz genommen habe.